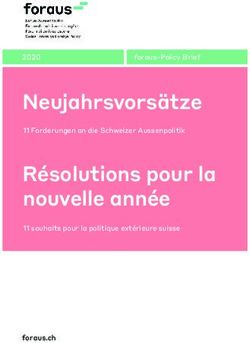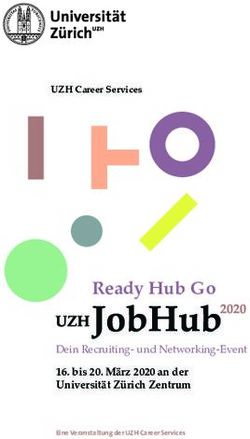Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik - Année politique ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik
Dossier Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens (Swisslex)
(93.100)
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIKImpressum Herausgeber Année Politique Suisse Institut für Politikwissenschaft Universität Bern Fabrikstrasse 8 CH-3012 Bern www.anneepolitique.swiss Beiträge von Benteli, Marianne Bevorzugte Zitierweise Benteli, Marianne 2020. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens (Swisslex) (93.100), 1991 - 1998. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 28.03.2020. ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK I
Inhaltsverzeichnis Drei Kreise Modell 1 Geringfügige Änderung des Arbeitsgesetzes (Swisslex, 93.113) 5 Armierung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (Swisslex, BRG 93.103) 6 Familienzulagen in der Landwirtschaft (Swisslex, BRG 93.104) 6 ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK II
Abkürzungsverzeichnis
UNO Organisation der Vereinten Nationen
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
EU Europäische Union
EVD Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
EG Europäische Gemeinschaft
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005)
heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
EKR Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
ONU Organisation des Nations unies
AELE Association européenne de libre-échange
UE Union européenne
DFE Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
EEE l'Espace économique européen
CE Communauté européenne
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005)
aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail
CFR Commission fédérale contre le racisme
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 1Drei Kreise Modell
Asylpolitik
BERICHT Im Mai stellte der Bundesrat einen neuen Bericht zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik
DATUM: 16.05.1991
MARIANNE BENTELI
vor. Anders als der Strategiebericht zwei Jahre zuvor entstand dieser nicht mehr unter
Federführung des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF), sondern unter jener des Biga. Im
Vordergrund stehen denn auch mehr arbeitsmarktorientierte Fragestellungen.
Hauptpunkt der mittelfristigen Ausländer- und Asylpolitik sei es, so führte Bundesrat
Koller an der Pressekonferenz aus, eine EWR-konforme Ausländerpolitik zu definieren.
Nach dem Willen des Bundesrat soll inskünftig ein Drei-Kreise-Modell zum Zug
kommen. Der innere Kreis umfasst die EG- und Efta-Staaten. Deren Bürger sollen
schrittweise keinen ausländer- oder beschäftigungspolitischen Beschränkungen mehr
unterliegen, sowie dies ab 1993 auch im Rahmen des geplanten EWR vorgesehen ist.
Im zweiten Kreis des Modells befinden sich einerseits die traditionellen
Rekrutierungsländer ausserhalb des EG- und Efta-Raumes, in denen bisher weniger
qualifizierte Arbeitskräfte angeworben wurden. Konkret war damit Jugoslawien
gemeint. Bürger dieser Staaten sollen nur noch als Saisonniers oder Jahresaufenthalter
in unserem Land arbeiten können, wenn die Reserven aus dem inneren Kreis erschöpft
sind. Dem zweite Kreis ordnete der Bundesrat anderseits alle jene Länder zu, mit denen
die Schweiz enge kulturelle Beziehungen unterhält (Nordamerika, eventuell auch
Australien, Neuseeland und die Länder Ost- und Südosteuropas). Hier erhofft sich der
Bundesrat eine vermehrte Rekrutierung von hochqualifizierten Arbeitskräften. Für die
Staaten des zweiten Kreises wird aber ein strenger politischer Massstab angelegt: sie
müssen demokratisch regiert sein und die Menschenrechte beachten, asylrechtlich also
zu den "safe countries" zählen. Zum dritten Kreis werden alle übrigen Länder
gerechnet; dort würden grundsätzlich keine Arbeitskräfte rekrutiert. Ausnahmen für
vorübergehende Aufenthalte von Spezialisten sollen indessen möglich sein. Ansonsten
wird für Menschen des äussersten Kreises die Schweiz höchstenfalls Asylland bleiben.
Im Bereich der Asylpolitik setzte der Bundesrat zwei Schwerpunkte. Einerseits will er
inskünftig vermehrt dazu beitragen, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in
den Herkunftsländern zu verbessern, um die Ursachen der Auswanderung zu beseitigen.
Andererseits strebt er eine immer engere Zusammenarbeit mit den anderen
europäischen Aufnahmestaaten an (Erstasylabkommen, Harmonisierung des Asylrechts,
Datenaustausch). Zudem bekräftigte er erneut seinen Willen, die durch die dritte
Asylgesetzrevision geschaffenen Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung
möglichst voll auszuschöpfen. 1
BUNDESRATSGESCHÄFT Im Nationalrat wurde der Bericht mit ziemlicher Skepsis aufgenommen. Die meisten
DATUM: 10.06.1991
MARIANNE BENTELI
Redner würdigten zwar, dass sich der Bundesrat um eine Gesamtschau der Probleme
bemüht und eine gute Diskussionsgrundlage geschaffen habe, bemängelten aber die
primär arbeitsmarktpolitische Ausrichtung des Berichts, die offen. sichtliche Abkehr
von der Stabilisierungspolitik der 70er Jahre und die fehlenden Perspektiven in der
Flüchtlingspolitik. Die innereuropäische Öffnung wurde im grossen und ganzen positiv
aufgenommen, ausser bei den SD und Teilen der SVP, welche die fehlenden
demographischen Berechnungen über die Auswirkungen des freien Personenverkehrs
kritisierten. Wenig Freude am Modell der drei Kreise zeigten CVP und SP. Ihrer Ansicht
nach werden damit bereits innerhalb Europas Bürger einzelner Staaten als Menschen
zweiter Klasse diskriminiert. Zudem sei es stossend, meinten einige Votanten, dass
nach dem bundesrätlichen Konzept ausgerechnet Personen aus Ländern, in denen
Menschenrechte immer wieder verletzt werden, keine Chance mehr haben sollen, in
der Schweiz zu arbeiten.
Erwartungsgemäss war es der dritte Kreis, der zu den hitzigsten Debatten führte. Hier
taten sich Ruf (sd, BE) – welcher nicht nur die Rückweisung des Berichtes, sondern gar
den Rücktritt des gesamten Bundesrates verlangte – und Dreher (ap, ZH) durch
Rundumschläge gegen die bundesrätliche Politik hervor. Mit 100:2 Stimmen lehnte der
Rat den Rückweisungsantrag Ruf ab. Deutliche Kritik an der bisherigen Asylpolitik, aber
ohne fremdenfeindliche Untertöne, übte auch die liberale Fraktion; sie regte an, das
Asylgesetz sei abzuschaffen und die überholte Flüchtlingskonvention notfalls zu
kündigen, dafür solle sich die Schweiz bereit erklären, in Absprache mit dem Genfer
Uno-Hochkommissariat jedes Jahr ein bestimmtes Kontingent von Flüchtlingen
vorübergehend aufzunehmen.
Kritisch zur Asylpolitik äusserten sich auch Abgeordnete der FDP und der SVP. Sie
traten vor allem für ein rascheres Asylverfahren und einen konsequenteren Vollzug der
Ausschaffungen ein; falls dies nicht erreicht werden könne, seien Quoten nicht mehr zu
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 2umgehen. CVP und links-grünes Lager forderten dagegen eine Asylpolitik, welche den
internationalen Konventionen zu genügen habe – was eine Kontingents- oder
Quotenregelung ausschliesse – und keine zusätzlichen Diskriminierungen schaffen
dürfe. Einig über die Parteigrenzen war man sich eigentlich nur in der Feststellung, dass
der weltweiten Migration längerfristig nur durch entsprechende Hilfsmassnahmen in
den Herkunftsländern beizukommen sei. 2
BUNDESRATSGESCHÄFT Im Ständerat verlief die Beratung des Berichtes emotionsloser. Ganz klar war hier die
DATUM: 14.06.1991
MARIANNE BENTELI
Flüchtlingspolitik das Hauptthema, die innereuropäische Öffnung wurde kaum berührt.
Auch in der kleinen Kammer mochten die Vertreter von SVP und FDP eine
Kontingentierung oder gar die Anwendung von Notrecht nicht mehr ausschliessen.
Einen neuen Ansatz brachten die beiden FDP-Vertreter Bühler (LU) und Jagmetti (ZH) in
die Diskussion, die anstatt des Drei-Kreise-Modells eine Aufteilung in Ausländer-, Asyl-
und Migrationspolitik vorschlugen, wobei bei letzterer eine Quotenregelung ins Auge
gefasst werden könnte, ohne dass damit internationale Konventionen verletzt würden.
In ähnliche Richtung wie die Vorstellungen Jagmettis geht auch ein Postulat Wiederkehr
(Idu, ZH), welches für Angehörige des dritten Kreises zahlenmässig befristete, auf ca.
drei Jahre beschränkte Arbeitsbewilligungen anregt. Gleich wie im Nationalrat fanden
sich CVP und SP in ihrer Kritik an der nach ihrer Ansicht diskriminierenden
Unterscheidung in drei Kreise. Auch sie sprachen sich aber, wie ihre Kollegen in der
Volkskammer, für ein rasches Verfahren und einen konsequenten Vollzug der
Wegweisungsentscheide aus, allerdings nur unter strikter Wahrung des Non-
refoulement-Prinzips. 3
BUNDESRATSGESCHÄFT Wie der Bundesrat in seinem Bericht über die Legislaturplanung 1991-1995 festhielt, will
DATUM: 10.06.1992
MARIANNE BENTELI
er zumindest mittelfristig das Drei-Kreise-Modell umsetzen und deshalb das Gesetz
von 1931 über den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländern (ANAG) einer
Totalrevision unterziehen. Damit soll eine Öffnung gegenüber Europa erreicht und die
Rekrutierung von qualifizierten Arbeitnehmern gefördert werden. Der Nationalrat
signalisierte allerdings eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dieser Absicht und
überwies diskussionslos ein Postulat seiner Kommission für Rechtsfragen, welches den
Bundesrat ersucht, das Drei-Kreise-Modell im Lichte des Übereinkommens zur
Beseitigung der Rassendiskriminierung noch einmal zu überprüfen und den Räten
Bericht zu erstatten. 4
BUNDESRATSGESCHÄFT Im Rahmen von Swisslex bekräftigte der Bundesrat erneut seinen Willen, das in seinem
DATUM: 23.09.1993
MARIANNE BENTELI
Bericht von 1991 aufgezeichnete Konzept des Dreikreisemodells schrittweise zu
realisieren. Nach einer Übergangsfrist soll das Saisonnierstatut mit dem heute
bestehenden Umwandlungsmechanismus in Daueraufenthaltsbewilligungen, dem in der
Vergangenheit eine Schleusenfunktion für die massive Zuwanderung wenig qualifizierter
Arbeitskräfte zugekommen war, abgelöst werden. Dies kann der Bundesrat jedoch nicht
in eigener Regie beschliessen, da der Umwandlungsanspruch in internationalen
Verträgen festgeschrieben ist. Er will deshalb mit den betreffenden Ländern
Verhandlungen aufnehmen und nach deren Abschluss die Regelung der saisonalen
Arbeitsverhältnisse den europäischen Standards annähern, beispielsweise durch
befristete Aufenthaltsbewilligungen mit Gewährung des Familiennachzugs, falls der
Kurzaufenthalter über die nötigen Mittel und eine entsprechende Wohnung verfügt.
Gleichzeitig beabsichtigt der Bundesrat, die Rechtsstellung der mehrjährigen
Grenzgänger mit Ausnahme des Rechts auf Wohnsitznahme derjenigen der
Daueraufenthalter anzugleichen. Längerfristiges Ziel des Bundesrates ist ein Abbau der
wenig qualifizierten ausländischen Arbeitnehmerschaft und deren Ersetzung durch
ausländische Spezialisten und Kaderleute. 5
BERICHT Mit schwerem Geschütz fuhr die vom Basler Geschichtsprofessor Georg Kreis
DATUM: 24.05.1996
MARIANNE BENTELI
präsidierte Eidg. Kommission gegen Rassismus (EKR) auf, indem sie den Vorwurf erhob,
das Drei-Kreise-Modell, an welchem sich die Ausländerpolitik des Bundesrates seit 1991
orientiert, fördere fremdenfeindliche und kulturell-rassistische Vorurteile gegenüber
den Angehörigen des dritten Kreises, insbesondere jenen aus dem ehemaligen
Jugoslawien, da diese Menschen pauschal als nicht integrierbar und deshalb
unerwünscht gewertet würden. Die Kommission rügte damit erstmals entsprechend
ihrem Mandat eine behördliche Massnahme öffentlich. Sie empfahl dem Bundesrat, ein
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 3Zwei-Kreise-Modell einzuführen, welches Integrationsmassnahmen und Rückkehrhilfen,
aber kein Saisonnierstatut mehr vorsieht. 6
MOTION In seiner Antwort auf eine im Rahmen der Legislaturplanung eingereichte Motion von
DATUM: 06.06.1996
MARIANNE BENTELI
Nationalrätin Bühlmann (gp, LU), Vizepräsidentin der EKR, wies der Bundesrat diesen
Vorwurf entschieden zurück. Das 1991 entwickelte Konzept habe seinerzeit im
Parlament einen breiten politischen Konsens gefunden. Zur Forderung nach einem
neuen Migrationskonzept führte er aus, seiner Ansicht nach hätten die bilateralen
Verhandlungen mit der EU über den freien Personenverkehr absolute Priorität
gegenüber den Diskussionen um ein Zwei- oder Drei-Kreise-Modell. Die Frage nach
einer neuen, umfassenden Ausländerpolitik könne ohnehin erst nach der detaillierten
Auswertung der Vernehmlassung zum Migrationsbericht angegangen werden. Frau
Bühlmann war mit dem Antrag des Bundesrates einverstanden, ihre Motion in ein
Postulat umzuwandeln. Dieses wurde jedoch von Baumberger (cvp, ZH) bekämpft und
schliesslich mit 45 zu 49 Stimmen knapp abgelehnt. 7
GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE Ebenfalls grundsätzliche Kritik an der Politik des Bundesrates übte das Gutachten des
DATUM: 05.08.1996
MARIANNE BENTELI
Genfer Staatsrechtsprofessors Andreas Auer. Gemäss dem Autor ist die
Ausländerpolitik des Bundesrates diskriminierend und verstösst gegen das
internationale Abkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Zwar
habe der Bundesrat seinerzeit bei seiner Ratifizierung der Konvention einen Vorbehalt
in bezug auf seine Ausländer- und Arbeitsmarktpolitik angebracht, doch dieser beziehe
sich lediglich auf einen einzigen Absatz des Abkommens (Saisonnierstatut ohne Recht
auf Familiennachzug) und ändere nichts daran, dass die Schweiz verpflichtet sei, ihre
Ausländerpolitik künftig so zu gestalten, dass sie nicht zur Diskriminierung einzelner
Ethnien führe. Auer hielt fest, dass die Bevorzugung aller EU- oder Efta-
Staatsangehörigen keinerlei rechtliche Probleme verursache. Schliesslich strebe die
Schweiz hier längerfristig die gegenseitige Einführung des freien Personenverkehrs an.
Auch die Auswahl bestimmter Staaten als traditionelle Rekrutierungsgebiete sei an und
für sich zulässig. Doch gehe es nicht an, den Ausschluss bestimmter Staaten damit zu
begründen, dass Menschen dieser nationalen oder ethnischen Gruppen nicht fähig
seien, sich in der Schweiz zu integrieren. Das Drei-Kreise-Modell sei auch mit dem
internationalen Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie
mit der in der Verfassung verankerten Rechtsgleichheit unvereinbar.
Der Staatsrechtler zeigte sodann auf, wie bruchstückhaft die Ausländerpolitik in der
Schweiz geregelt ist. Mehrheitlich beruht sie bloss auf vom Bundesrat erlassenen
Verordnungen und auf Weisungen der zuständigen Bundesämter. Das treffe
insbesondere auch auf das Drei-Kreise-Modell zu, das in keinem Gesetz rechtlich
verankert sei. In einer rechtsstaatlichen Demokratie müssten aber die grossen Linien
der Ausländerpolitik vom Parlament und dem Volk festgelegt werden. Das verlange das
Legalitätsprinzip. Zwar habe die Bundesversammlung seinerzeit formell Kenntnis vom
bundesrätlichen Bericht zur Ausländerpolitik genommen, doch könne dies das Fehlen
einer gesetzlichen Grundlage nicht wettmachen. 8
VERORDNUNG / EINFACHER Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften appellierten im August erneut an den
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.08.1996
Bundesrat, zumindest für die seit Jahren in der Schweiz arbeitenden Saisonniers aus
MARIANNE BENTELI Ex-Jugoslawien eine neue Lösung zu suchen. Bis eine definitive Regelung gefunden sei,
müsste es den Kantonen freistehen, die Bewilligungen zu erneuern. Gleichzeitig hielten
die Wirtschaftsverbände fest, dass sie weder gegen eine Vorzugsstellung von Personen
aus dem EU/Efta-Raum noch gegen einen Stopp von Neurekrutierungen im ehemaligen
Jugoslawien seien. Der Bundesrat zeigte sich aber entschlossen, seinen Entscheid
durchzuziehen. In einem Zeitungsinterview erklärte der Vorsteher des EVD, der
Bundesrat sei in dieser Frage schon genügend Kompromisse eingegangen. Wenn er jetzt
nicht der Umsetzung des Drei-Kreise-Modells zum Durchbruch verhelfe, verliere er
seine Glaubwürdigkeit. Dementsprechend wurden bei der Zuteilung der Kontingente für
die Periode 1996/97 die ex-jugoslawischen Saisonniers definitiv von der Einreise
ausgeschlossen. Betroffen waren rund 10 000 Arbeitnehmer aus dem früheren
Jugoslawien. 9
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 4BERICHT Unter dem Titel "Ein neues Konzept der Migrationspolitik" wurde Ende August der
DATUM: 30.08.1997
MARIANNE BENTELI
Bericht der Expertenkommission "Migration" vorgestellt. Um sich nicht von vornherein
in eine unfruchtbare Grundsatzdiskussion zu verstricken, einigte sich die Kommission
auf ein einheitliches Migrationsmodell für Asyl- und Arbeitssuchende. Jeder
Einwanderer - egal ob Asylbewerber oder nicht - soll ihrer Meinung nach den gleichen
Migrationsprozess durchlaufen: die Einreise in das Zielland, der vorübergehende oder
dauernde Aufenthalt und, je nachdem, die Ausreise. Aus diesen Phasen ergeben sich
vier Themenbereiche, zu denen die Kommission Ziele und Massnahmen entwickelte:
Zulassungspolitik, Integrationspolitik, Ausreise/Rückwanderung und
Migrationsaussenpolitik.
Mit einer Ausreisepolitik soll Sorge getragen werden, dass ausländische
Staatsangehörige ohne Anwesenheitsberechtigung oder nach deren Ablauf die Schweiz
verlassen und nicht illegal im Land bleiben. Ein konsequenter Vollzug soll vor allem
durch verstärkte aussenpolitische Massnahmen, d.h. bi- und multilaterale Abkommen,
verbessert werden. Eine Rückkehrberatung, wie sie im Moment vor allem Personen aus
dem Asylbereich angeboten wird, soll nach Auffassung der Kommission allen
Ausländerinnen und Ausländern offenstehen. Mit einer aktiven Aussenpolitik soll gegen
die Ursachen erzwungener Migration angegangen werden. Dazu gehören eine
Präventivdiplomatie sowie Massnahmen zur Förderung der Menschenrechte, der
Minderheitenrechte und der Demokratie. Auch die Entwicklungszusammenarbeit und
die humanitäre Hilfe wurden als weitere mögliche Verknüpfungspunkte gesehen. In den
traditionellen Herkunfstländern von Asylsuchenden sollten nach Meinung der Experten
insbesondere jene Entwicklungsprojekte gefördert werden, welche Chancen bieten,
Emigration zu verringern.
Die Zulassung von ausländischen Arbeitskräften soll sich nicht mehr nach Branchen
oder Regionen richten, sondern im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen. Die
Kommission schlug unter anderem vor, vom Drei-Kreise-Modell abzurücken und
stattdessen nur noch zwischen EU/Efta-Staatsangehörigen und allen anderen zu
unterscheiden. Für EU-Bürger werden sich Zulassung, Aufenthalt und Bedingungen zur
Arbeitsaufnahme gemäss dem Ergebnis der bilateralen Verhandlungen gestalten. Mit
Ausnahme von Personen, welche traditionelle Fluchtgründe geltend machen können,
sollen nicht-EU/Efta-Bürger nur noch rekrutiert werden können, wenn sie gut- bis
hochqualifiziert sind. Die individuelle Qualifikation soll also ausschlaggebend sein und
nicht das Herkunftsland. Die Kommission regte dabei an, es sei zu prüfen, ob nicht ein
Punktesystem nach amerikanischem, kanadischem oder australischem Modell
einzuführen sei. Qualifikationskriterien könnten Sprachkenntnisse, Ausbildung, Alter
und Berufserfahrung des Bewerbers oder der Bewerberin sein. 10
GERICHTSVERFAHREN Das Bundesgericht stützte in einem weiteren Grundsatzurteil das Drei-Kreise-Modell.
DATUM: 01.10.1997
MARIANNE BENTELI
Es wies die Beschwerde eines jugoslawischen Saisonniers ab, der die Umwandlung in
eine Jahresbewilligung zu spät beantragt hatte. Der seit zwei Jahren geltende
Ausschluss fast aller Ex-Jugoslawen ohne Niederlassungs- oder Jahresbewilligung vom
Schweizer Arbeitsmarkt verletze weder das verfassungsrechtliche Gleichheitsgebot
noch das Diskriminierungsverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK),
der UNO-Menschenrechtspakte und des Rassendiskriminierungsübereinkommens. Die
Vereinbarkeit der Bundesratsregelung mit den internationalen Verträgen überprüfte
das Bundesgericht hier erstmals; einen Verstoss gegen das Gebot der Rechtsgleichheit
hatte es bereits 1996 verneint. 11
BERICHT Der Bundesrat zeigte sich aber selber bereit, vom 1991 eingeführten Drei-Kreise-Modell
DATUM: 31.10.1997
MARIANNE BENTELI
wegzukommen und den Vorschlag der Expertenkommission "Migration" aufzunehmen,
wonach inskünftig nur noch zwischen Angehörigen von EU-/Efta-Staaten und allen
anderen Staaten unterschieden werden soll. Der Bundesrat begründete seine
Haltungsänderung damit, dass der "zweite Kreis" - vor allem Kanada und die USA -
praktisch nie zum Tragen gekommen sei und ein gewisses Legitimationsdefizit für das
umstrittene Modell bestanden habe. Die Einführung des neuen Zulassungsmodells wird
de facto aber keine wesentliche Änderung der geltenden Rekrutierungspraxis
bedeuten. Insbesondere hat der Bundesrat nicht im Sinn, Arbeitnehmer aus Ex-
Jugoslawien wieder als Saisonniers zuzulassen. Nach welchen Kriterien die Qualifikation
von ausländischen Arbeitskräften aus Nicht-EU- oder Efta-Staaten erfolgen wird, wollte
der Bundesrat vorderhand noch offen lassen. 12
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 5VERORDNUNG / EINFACHER In der Ausländerregelung 1998/1999 setzte der Bundesrat die im Vorjahr von der
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.10.1998
Arbeitsgruppe ”Migration” gemachte Empfehlung um und schaffte die bisherigen
MARIANNE BENTELI Rekrutierungsgrundsätze nach dem Drei-Kreise-Modell zugunsten eines dualen
Zulassungssystems ab. Demnach wird nur noch unterschieden zwischen Angehörigen
von EU- bzw. EFTA-Staaten, die prioritär zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit einreisen
dürfen, wenn keine entsprechenden inländischen arbeitslosen Personen auf dem
Arbeitsmarkt verfügbar sind, sowie den Bürgerinnen und Bürgern aller anderen
Nationen, die nur noch in ganz speziellen Fällen rekrutiert werden können. Gleichzeitig
wurde die Zahl der jährlich zu vergebenden Saisonbewilligungen weiter von 99 000 auf
88 000 reduziert. 13
Geringfügige Änderung des Arbeitsgesetzes
(Swisslex, 93.113)
Arbeitnehmerschutz
BUNDESRATSGESCHÄFT Im Rahmen von Swisslex unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine geringfügige
DATUM: 28.04.1993
MARIANNE BENTELI
Änderung des Arbeitsgesetzes mit dem Ziel, die Vorschriften über die
Gesundheitsvorsorge auf die Bundesverwaltung auszudehnen sowie bestimmte
Arbeitnehmerkategorien, beispielsweise Kader und Assistenten, die bisher nicht
eingeschlossen waren, neu den Schutzvorschriften des Gesetzes zu unterstellen. Da die
Vorlage bereits mit dem Eurolex-Paket verabschiedet worden war, nahm die kleine
Kammer die Änderung diskussionslos und einstimmig an. Im Nationalrat setzte sich
jedoch vorerst ein Nichteintretensantrag Gros (lp, GE) mit dem Argument durch, diese
Revision trage nichts zu der vom Bundesrat angesagten Deregulierung und
Revitalisierung der Schweizer Wirtschaft bei. Der Ständerat befand, dies sei nicht der
Ort, um eine Grundsatzdebatte zu führen, und hielt an seinem Entscheid fest, worauf
ihm der Nationalrat folgte. 14
BUNDESRATSGESCHÄFT Im Rahmen von Swisslex stimmten sowohl Stände- wie Nationalrat einer Änderung der
DATUM: 17.06.1993
MARIANNE BENTELI
obligationenrechtlichen Bestimmungen über den Arbeitsvertrag zu, wonach
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer künftig informiert und angehört werden
müssen, wenn sie vom Übergang des Unternehmens auf einen neuen Besitzer
betroffen sind oder wenn Massenentlassungen bevorstehen. Zudem wird festgelegt,
dass der Käufer eines Betriebes die vom Verkäufer abgeschlossenen Arbeitsverträge
übernehmen muss. In beiden Kammern unterlagen Rückweisungs- bzw.
Nichteintretensanträge aus den Reihen der LP, welche in dieser Vorlage einen Verstoss
gegen die Grundsätze der Revitalisierung und Deregulierung sah. Während der
Ständerat in der Detailberatung kaum Änderungen am bundesrätlichen Vorschlag
vornahm, erreichte im Nationalrat das rechtsbürgerliche Lager, dass bei
Betriebsübernahmen die Einhaltung von Gesamtarbeitsverträgen auf ein Jahr reduziert
wurde. Da dies der Praxis in den anderen europäischen Staaten entspricht, schloss sich
der Ständerat hier an. Zudem setzte sich in der Differenzbereinigung eine Milderung
der Sanktionen für die Nichteinhaltung der Informationspflicht bei Massenentlassungen
durch. 15
ANDERES Die im Vorjahr im Rahmen von Swisslex vom Parlament beschlossene und auf den 1.Mai
DATUM: 30.04.1995
MARIANNE BENTELI
1994 in Kraft gesetzte Änderung der obligationenrechtlichen Bestimmungen über den
Arbeitsvertrag, wonach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angehört werden
müssen, wenn Massentlassungen anstehen, trug erste Früchte. Die 340 von der
Schliessung ihres Betriebs betroffenen Angestellten der Monteforno-Werke in Bodio
(TI) erreichten so nach einer viertägigen Arbeitsniederlegung, dass der von der
Unternehmerseite vorgelegte Sozialplan deutlich nachgebessert werden musste.
Weniger Glück hatten die rund 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der zum
Textilunternehmen Gasser gehörenden Baumwollspinnerei in Kollbrunn (ZH). Wegen
des rüden Umgangsstils ihres Arbeitgebers, der wegen versuchten Missbrauchs der
Arbeitslosenversicherung auch vom BIGA scharf gerügt worden war, hatten die
Angestellten einen halbtägigen Warnstreik durchgeführt, worauf Gasser das Werk
kurzerhand schloss und die Belegschaft auf die Strasse stellte. Da diese
Massenentlassung vor dem Inkrafttreten der neuen obligationenrechtlichen Regelung
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 6stattfand, waren die Kündigungen auch ohne Vorliegen eines Sozialplans rechtlich nicht
anfechtbar. 16
Armierung des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung (Swisslex, BRG 93.103)
Unfallversicherung
BUNDESRATSGESCHÄFT Das Parlament stimmte oppositionslos der vom Bundesrat im Rahmen von Swisslex
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI
vorgelegten Armierung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung zu. Sie dehnt
den Geltungsbereich der Vorschriften über die Arbeitssicherheit auf alle in der Schweiz
tätigen Betriebe aus und schreibt gleiche Prämien für Mann und Frau in der
Nichtberufsunfallversicherung verbindlich vor. 17
Familienzulagen in der Landwirtschaft
(Swisslex, BRG 93.104)
Frauen und Gleichstellungspolitik
BUNDESRATSGESCHÄFT Im Rahmen von Swisslex wurde im Bundesgesetz über die Familienzulagen in der
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI
Landwirtschaft die Gleichstellung von Männern und Frauen verwirklicht. Neu haben
auch die Angehörigen der Betriebsleiterin, die im Betrieb mitarbeiten, Anspruch auf
diese Zulage. 18
1) BBl, 1991, III, S. 291 ff.; Lit. Werenfels; NZZ, 16.5.91; Presse vom 28.5.91; Ww, 30.5.91. Haltung der Fraktionen: NZZ, 5.6.91.
Stellungnahme der Kirchen: Presse vom 11.6.91.
2) Amtl. Bull. NR, 1991, S. 996 ff.
3) Amtl. Bull. StR, 1991, S. 869 W. und 879 ff.; NZZ, 6.2.91 (Jagmetti). (Verhandl. B.vers., 1991, VI, S. 118).
4) BBl, 1992, III, S. 49 f.; Amtl. Bull. NR, 1992, S. 2673.
5) BBl, 1993, I, S. 827 f.
6) Presse vom 24.5.96.
7) Amtl. Bull. NR, 1996, S. 708 ff. und 788 ff.
8) Presse vom 5.8.96.
9) Presse vom 7.8., 2.9. und 17.10.96; BüZ, 19.8., 23.8., 24.8. und 28.8.96. Siehe SPJ 1994, S. 233.
10) Lit. Ein neues ..; Presse vom 30.8.97; A. Richter, "Migrationspolitik", in Die Volkswirtschaft, 71/1998, Nr. 3, S. 54 ff. Siehe
SPJ 1996, S. 267.
11) Presse vom 1.10.97. Siehe SPJ 1996, S. 270.
12) Presse vom 31.10.97.
13) Presse vom 9.6. und 22.10.98.
14) BBl, 1993, I, S. 868; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 258, 609 und 794; Amtl. Bull. NR, 1993, S. 1314, 1792 f. und 2045; BBl, 1993, Ill,
S. 796 f.
15) BBl, 1993, S. 880 ff.; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 377 ff., 874 ff. und 1131; Amtl. Bull. NR, S. 1708, 1721 ff., 2345 f. und 2590; BBl,
1993, IV, S. 588 ff.
16) LNN, 23.3.94; TA, 30.4.94; NZZ, 31.8. und 21.9.94. Vgl. SPJ 1993, S. 167 f.
17) BBl, 1993, I, S. 850; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 188 f. und 582; Amtl. Bull. NR, 1993, S. 768 und 1453; BBl, 1993, II, 924 f.
18) BBl, 1993, I, S. 851; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 189 und 582; Amtl. Bull. NR, 1993, S. 769 und 1454; BBl, 1993, II, S. 926.
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIKSie können auch lesen