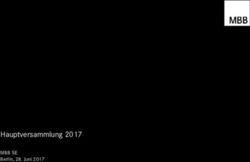Bachelorarbeiten am Lehrstuhl für Marketing und Innovation im Wintersemester 2018/2019 (Runde 4) - Hinweise zu Themen und Auswahlprozess
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bachelorarbeiten am Lehrstuhl für Marketing und Innovation
im Wintersemester 2018/2019 (Runde 4)
Hinweise zu Themen und Auswahlprozess
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 1Zielgruppe und Voraussetzungen
Zielgruppe
Alle, die im Wintersemester 2018/2019 mit ihrer Bachelorarbeit am Lehrstuhl für
Marketing und Innovation beginnen möchten.
Formale Voraussetzungen (siehe Studien- und Prüfungsordnung)
– Ein ordnungsgemäßes Studium
– Immatrikulation im Bachelor-Studiengang „BAE“ oder „Kuwi/ICBS“
– Der Nachweis des Erwerbs von mindestens 80 ECTS-Leistungspunkten in den in § 19
Abs. 1 bis 4 vorgeschriebenen Modulen (StuPO B.Sc. BAE) bzw. mind. 96 ECTS-
Leistungspunkten gemäß § 13 (StuPO B.A. Kuwi/ICBS).
Empfohlene Voraussetzungen
– Mindestens ein Seminarschein im Bereich Marketing
– Besuch von mindestens zwei Marketing-Veranstaltungen
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 2Bewerbungs- und Vergabeprozess
Anzahl Plätze:
Im Wintersemester 2018/2019 wird nur eine beschränkte Anzahl an
Bachelorarbeiten vergeben. Das macht einen Auswahlprozess erforderlich.
Benötigte Unterlagen:
Bewerbungsformular
Kurzes Motivationsschreiben, aus dem Eignung und Kompetenzen für Abschlussarbeit hervorgehen
Kurzlebenslauf (eine Seite)
Abiturzeugnis mit Gesamtnotenschnitt
Aktuelle Übersicht über Noten im Bachelorstudium und vorläufige Gesamtnote (HisQis-Ausdruck)
Unterlagen bitte in einer PDF-Datei, beschriftet mit Nachname_Bewerbung_BA an:
Franziska.Bongers@Uni-Passau.De
Keine abfotografierten Dokumente, bitte benutzen Sie einen Scanner!
Auswahlmechanismus:
– Bestenprinzip, d.h. die leistungsstärksten Bewerber werden zuerst berücksichtigt.
– Härtefälle, d.h. Studierende, denen nur noch die Abschlussarbeit fehlt, werden gebeten, dies bei der
Bewerbung anzugeben.
– Übersteigt die Nachfrage das Angebot, werden in der Regel zunächst Studierende der
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät berücksichtigt.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 3Wichtige Termine
Was? Wann?
Themen online Mitte Oktober 2018
Bewerbungsfrist Bis spätestens 31.10.2018
Bekanntgabe der ersten Zusagen 05.11.2018
Frist zur Annahme der zugesagten Plätze 08.11.2018, 11:00 Uhr
Nachrückverfahren 13.11.2018, 11:00 Uhr
Endgültige Absagen 13.11.2018
Gemeinsamer Kick-off 21.11.2018, Zeit und Raum tba
Kolloquiumstermine 05.12.2018, Zeit und Raum tba
(Teilnahme freiwillig, Fragen bitte spätestens bis zum 30.01.2019, Zeit und Raum tba
vorangehenden Montag an den Betreuer) 06.02.2019, Zeit und Raum tba
Exposé-Sprechstunde & Start- und Anmeldetermin 09.01.2019, Zeit und Raum tba
Zwischenpräsentation 16.01.2019, Zeit und Raum tba
Abgabe der Bachelorarbeit Anfang März 2019 (2 Monate nach Anmeldung,
maßgeblich ist das Datum im Schreiben vom
Prüfungsamt)
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 4Zu den Themen
Es wird empfohlen, eines der vom Lehrstuhl ausgeschriebenen Themen zu bearbeiten. Eine Liste der
angebotenen Themen findet sich auf den folgenden Charts. Bewerber sollten mindestens drei
Themenwünsche angeben und eine Priorisierung vornehmen. Die Zuteilung der Themen erfolgt wieder nach
dem Bestenprinzip, d.h. der beste Bewerber bekommt zuerst seinen Wunsch erfüllt, dann der zweitbeste
Bewerber usw.
Themen werden nicht doppelt vergeben, d.h. es kann einem Teilnehmer auch ein Thema zugeteilt werden,
das er oder sie nicht explizit als Themenwunsch genannt hat.
Nach Vergabe der Themen räumen wir Ihnen eine Bedenkzeit ein, das Thema anzunehmen. Eine Annahme
ist für uns verbindlich, eine spätere Absage nicht mehr möglich.
Alternativ können auch eigene Themenvorschläge gemacht werden. Jedoch sind dies ausschließlich
Literaturarbeiten, die den aktuellen Stand der Forschung zu einem Thema aufarbeiten. Hier sind auch
Kooperationen mit Unternehmen denkbar. Das Thema sollte aber in den Bereich der
Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls fallen (Technologie & Innovation, Online-Marketing,
Kundenmanagement, Internationales Marketing).
Der eigene Themenvorschlag sollte in einem max. einseitigen Exposé beschrieben werden (Relevanz,
Forschungsfragen, erster Literaturüberblick). Der Lehrstuhlinhaber entscheidet ohne weitere Rücksprache,
ob das Thema für eine Bachelorarbeit zugelassen werden kann. Bewerber sollten daher auch angeben, ob
sie im Falle der Nichtzulassung des eigenen Themas Themen aus der Liste bearbeiten oder aber auf die
Anfertigung einer Bachelorarbeit am Lehrstuhl verzichten möchten.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 5Themenliste (I/VII)
1. From foe to friend: Value Co-Creation in IOT-enabled Business Ecosystems
Das Internet-of-Things verändert die Zusammenarbeit und die Wertschöpfung von Unternehmen
fundamental. Diese neue Art der Vernetzung und des Datenaustauschs führt zu einem Wandel
hin vom Einzelunternehmen zu Kooperationen und Partnerschaften innerhalb größerer
industrieller Ökosysteme. Diese bestehen aus mehreren Unternehmen entlang der
Wertschöpfungskette. Ressourcen und Fähigkeiten der Unternehmen im Ökosystem werden
miteinander kombiniert, um gemeinsam strategische Wettbewerbsvorteile zu erzielen und sich
stärker an den Anforderungen des eigentlichen Endnutzers zu orientieren.
Durch eine umfassende Literaturanalyse sollen die wichtigsten Ergebnisse in der bisherigen
Forschung bezüglich Wertschöpfung in industriellen Ökosystemen identifiziert und klassifiziert
werden. Ein besonderer Augenmerk liegt hierbei auf den Veränderungen, die durch die stärkere
Verzahnung der Prozesse durch das Internet-of-Things herbeigeführt werden. Dafür soll zunächst
die entsprechende Literatur identifiziert und anhand geeigneter Kriterien klassifiziert werden.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 6Themenliste (II/VII)
2. Industry‘s Next Top (Business) Model - Die finale Entscheidung zwischen access-
based und ownershiped-based Business Models
Jahrzehntelang basierte das Geschäftsmodell führender Industriefirmen auf dem reinen Verkauf von
Produkten. Bereits in der Vergangenheit verfolgte Rolls-Royce hingegen mit „power by the hour“ einen
anderen Geschäftsmodellansatz als die Konkurrenz. Anstatt das Produkt an sich zu verkaufen, stellte
der Lieferant für Flugzeugturbinen diese als Dienstleistung zu Verfügung und berechnete nur die
tatsächliche Nutzung der Turbinen. Diese Herangehensweise zahlte sich für Rolls-Royce aus und ebnete
den Weg für eine weitere Erfolgsgeschichte des Unternehmens.
Die zunehmende Digitalisierung und der Trend „Internet of things“ geben aktuell den etablierten
Industriefirmen einen neuen Anreiz ihre traditionellen Geschäftsmodelle (ownership-based) zu
überdenken und mehr auf Dienstleistungen zu setzen. Doch inwieweit sind die neuen
Geschäftsmodelle (zum Beispiel access-based) den traditionellen überlegen? Und inwieweit lassen sich
diese in bestehende Klassifizierungen von Geschäftsmodellen einordnen?
Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, den aktuellen Forschungsstand zu Geschäftsmodellen durch eine
umfassende Literaturrecherche aufzuzeigen. Dabei soll zunächst untersucht werden, welche
unterschiedlichen Arten von Geschäftsmodellen existieren. Im Anschluss sollen dann neue (access-
based) und traditionelle (ownership-based) Geschäftsmodelle anhand ausgewählter Kriterien analysiert
werden.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 7Themenliste (III/VII)
3. Digitalisierung im Retailing
Die digitale Transformation hält zunehmend Einzug in physische Ladengeschäfte und bringt als
zukunftsbestimmendes Thema große Chancen mit sich. Im Rahmen einer Bitkom Studie zur
Digitalisierung im Handel aus dem Jahr 2017 räumten allerdings 66% der Händler ein, dass die
Digitalisierung für ihr Unternehmen eine große Herausforderung darstellt. Mehr als 75% sehen
sich zudem als Nachzügler in Sachen Digitalisierung.
Digitale Technologien stellen dabei einen wesentlichen Teil der digitalen Transformation dar. Für
Händler ist es daher von großer Bedeutung, zu wissen, wie digitale Technologien zur
Unterstützung der physischen Ladengeschäfte eingesetzt werden können und welchen Einfluss
die Digitalisierung auf den physischen Store nimmt.
Hier setzt die vorliegende Bachelorarbeit an. Durch eine umfassende Literaturanalyse sollen die
wichtigsten Ergebnisse in der bisherigen Forschung zum Einfluss der digitalen Technologien mit
besonderem Fokus auf die Elemente des erweiterten Marketing-Mix (People, Physical Evidence
& Processes) identifiziert und typologisiert werden.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 8Themenliste (IV/VII)
4. Is Privacy Perfectly Logical? Nicht-kognitive Prozesse bei der Datenpreisgabe-
Entscheidung
In vielen unterschiedlichen Situationen des Alltags sehen sich Konsumenten mit der Möglichkeit
oder gar der Notwenigkeit konfrontiert, persönliche Daten aktiv preiszugeben. Dabei
beeinflussen vielerlei individuelle und situative Einflüsse, wie die Entscheidung hinsichtlich einer
solchen Preisgabe ausfällt. So spielt es eine entscheidende Rolle, ob der Konsument reflektiert
über mögliche positive und negative Konsequenzen nachdenken kann und auch möchte – oder
nicht. Eine Einschränkung dieser kognitiven Reflektion tritt z.B. dann auf, wenn es darum geht,
die Entscheidung unter Zeitdruck oder „einfach nebenbei“ zu treffen.
An dieser Stelle setzt die Bachelorarbeit an. Ziel der Arbeit ist es, Einflussfaktoren
herauszuarbeiten, welche dazu führen, dass eine strikt kognitive Reflektion der Entscheidung zur
Datenpreisgabe beschränkt wird. Mittels umfassender Literaturrecherche sollen diese Einflüsse
und daraus resultierende Prozesse identifiziert und schlüssig klassifiziert werden.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 9Themenliste (V/VII)
5. „Tell me more!“ - Die Bedeutung und der Einfluss von Transparenz bei der
Datenerhebung auf das Konsumentenverhalten
Viele Unternehmen sammeln und analysieren die persönlichen Daten und Informationen von Konsumenten,
um ihre Bedürfnisse und Interessen besser zu identifizieren und Werbemaßnahmen gezielt an die
Konsumenten auszuspielen. Jedoch reagieren Konsumenten kritisch, wenn sie persönliche Daten im Internet
angeben sollen oder ihnen bewusst wird, dass ihre Daten bereits gesammelt wurden.
Gerade vor dem Hintergrund aktueller rechtlicher Entwicklungen rückt die Forderung nach Transparenz
heutzutage sowohl für die Praxis, als auch für die Wissenschaft zunehmend in den Fokus der Betrachtung.
Durch Transparenz rechtfertigen die Unternehmen die Datenerhebung gegenüber den Konsumenten und
versuchen sie davon zu überzeugen, dass sie dem Unternehmen im Umgang mit ihren Daten vertrauen
können. Dabei zeigt sich die Transparenz als wichtiger Einflussfaktor auf die Datenpreisgabe von
Konsumenten.
Wie schaffen Unternehmen Transparenz bei der Erhebung persönlicher Daten? Inwiefern beeinflusst
Transparenz die Wahrnehmung der Konsumenten und das Konsumentenverhalten, wie beispielsweise die
Datenpreisgabe?
Ausgehend von diesen Fragestellungen untersucht die Bachelorarbeit die Rolle von Transparenz bei der
Erhebung und Sammlung persönlicher Daten von Konsumenten. Insbesondere setzt sich die Bachelorarbeit mit
den Auswirkungen von Transparenz auf die Wahrnehmung und das Verhalten der Konsumenten im Rahmen
ihrer Privatsphäre auseinander. Dafür soll zunächst die entsprechende Literatur identifiziert und anhand
geeigneter Kriterien klassifiziert werden.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 10Themenliste (VI/VII)
6. Information Processing im Business-to-Business-Kontext
Innerhalb des industriellen Kaufprozesses nimmt die Identifikation und Evaluation von
Information eine wichtige Rolle ein. Einkäufer können sich dazu unterschiedlichster Kanäle
bedienen: Neben dem klassischen Anruf beim Vertrieb stehen auch Online-Kanäle oder
Vergleichsplattformen zur Verfügung. Aufgrund dieser aktuellen Veränderungen des
Informationssuchverhaltens von Unternehmen soll die Arbeit einen systematischen Überblick
über die Verbreitung und Anwendung der Theorie des Organizational Information Processing im
Business-to-Business-Kontext geben.
Dazu sollen zunächst geeignete Forschungsarbeiten aus den Bereichen Marketing und
Wirtschaftsinformatik (Information Systems) identifiziert werden. Im Anschluss daran sind die
ausgewählten Artikel nach geeigneten Kriterien zu klassifizieren und die Ergebnisse der
Klassifikation vor dem Hintergrund existierender Forschung zu diskutieren.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 11Themenliste (VII/VII)
7. „You are what you (psychologically) own?“ – Ownership und Konsumentenverhalten
Traditionell beschreibt „Ownership“ die Beziehung zwischen einer Person und einem Objekt, in der
das Objekt als persönliches Eigentum bezeichnet wird (Snare 1972). Die Literatur zeigt, dass
Individuen ihrem Eigentum einen besonderen Stellenwert beimessen: sie tendieren dazu, mehr Geld
für den Verkauf eines Objektes zu verlangen, als sie bereit wären, für den Erwerb zu bezahlen (z.B.
Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991; Thaler 1980). Doch nicht nur faktisches Eigentum ist von
Relevanz für das Konsumentenverhalten: mehrere Studien konnten nachweisen, dass auch das
psychologische Eigentum einen wesentlichen Einfluss auf das Konsumentenverhalten hat (z.B.
Carmon, Wertenbroch, & Zeelenberg, 2003; Brasel & Gips, 2014). Es stellen sich die Fragen,
wodurch die Wahrnehmung von Ownership beeinflusst wird und welche Konsequenzen das
Ownership auf das Konsumentenverhalten hat.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Bachelorarbeit an. Ziel ist es, den aktuellen Forschungstand
zur Beziehung von Ownership und dem Konsumenten zu untersuchen. Hierzu soll die entsprechende
Literatur identifiziert und anhand eines geeigneten Klassifikationsschemas eingeordnet werden.
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 12Fragen
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Franziska M. Bongers
Sprechstunde: nach Vereinbarung per Mail
Email: Franziska.Bongers@Uni-Passau.De
Lehrstuhl für Marketing und Innovation, Prof. Dr. Jan H. Schumann, WiSe 2018/2019 13Sie können auch lesen