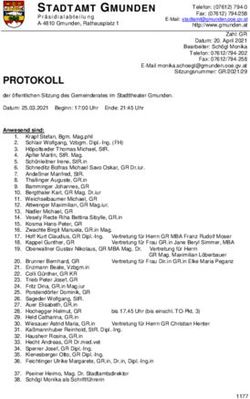Über das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter - Brill
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Über das Visualisieren von auditiven Daten im
Mittelalter
Max Haas
1 Vorbemerkung*
Notationskunde als musikwissenschaftliche Teildisziplin ist eine Hilfs-
wissenschaft. Man lernt, ältere Aufzeichnungsweisen ins heutige Notieren
zu übertragen. Ältere Notierungen werden dadurch lesbarer, zugänglicher.
Notationskunde lehrt zudem, den Ort und den Zeitpunkt der Niederschrift einer
Quelle zu bestimmen. Auch in dieser Hinsicht entpuppt sich Notationskunde
als Analogon zur Textpaläographie, einer Hilfswissenschaft der Geschichts-
wissenschaft. Notation hat aber auch ganz andere Dimensionen. In der Philo-
sophie forscht man seit längerer Zeit zum Problem, wie abstrakte Entitäten
ihre Körperlichkeit erhalten. So hat sich Sybille Krämer damit beschäftigt, was
es bedeutet, dass geistige Akte für sich besehen „nicht raum-zeitlich situiert,
nicht sinnlich wahrnehmbar, nicht zu ergreifen sind“. Und wie es doch gelingt,
solchen geistigen Akten „körperliche Surrogate zu verschaffen und sie damit
hereinzuholen in die raum-zeitlich situierte, materielle Welt, so dass wir sie
in dieser ihrer verkörperten Form eben nicht nur präsentieren, speichern und
zirkulieren, sondern vor allem auch explorieren und erforschen“. „So werden
reale, aber als körperliche Anhaltspunkte fungierende Gegenstände zu Passier-
stellen, um eine Beziehung aufzunehmen zu abwesenden und vor allem: zu
‚rein‘ geistigen Objekten.“1 Notiertes hat den Rang eines solchen Gegenstandes.
Es steht in Beziehung zu Tönendem – das ihm vorausgeht und es bedingt
oder das es ermöglicht – und zu geistigen Akten, die wir zusammenfassend
‚Komponieren‘ nennen. Musikalische Aufzeichnungen vertreten weder die
geistigen Akte noch das Tönende: „zwischen heterogenen Sphären situiert,
stiften sie“ als Aufzeichnungen „durch ihre ‚Vermittlungsarbeit‘ einen Nexus
* [Der vorliegende Text folgt dem Manuskript von Oktober 2017. Editorische Ergänzungen, die
im Zuge der Redaktion notwendig waren, sind an den entsprechenden Stellen durch eckige
Klammern gekennzeichnet; Anm. d. Hg.]
1 Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis, S. 11, dort alle Zitate.
© Max Haas, 2020 | doi:10.30965/9783846763537_008
This is an open access chapter distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access160 Max Haas
zwischen dem Verschiedenen, ohne dessen Divergenz dabei aufheben zu
müssen“.2
Eine Theorie der musikalischen Schrift lässt sich sehr unterschiedlich ent-
wickeln. Wie bereits die Zitate im letzten Abschnitt vermuten lassen, ver-
suche ich in dieser Arbeit, mein Thema, also die Frage nach dem Visualisieren
von auditiven Daten im Mittelalter, mit der „Diagrammatologie“ genannten
philosophischen Richtung zu verbinden. Damit sollte es möglich sein, die
in der Literatur als Hilfswissenschaft aufscheinende musikalische Paläo-
graphie in einem theoretisch gut gerüsteten Kontext zu studieren. Unter
allen visuellen Artefakten bilden Diagramme eine riesige Klasse. Bezieht man
ihre notwendigerweise sehr allgemein formulierten Eigenschaften auf den
Spezialfall musikalischen Notierens, werden die stark aufs Innerfachliche aus-
gerichteten Kriterien erweitert. Der Tendenz nach betrifft diese Erweiterung
den Zusammenhang zwischen den oben genannten geistigen Akten und
den körperlichen Surrogaten. Wir sprechen heute von ‚Musik‘ und meinen
damit nach Zeit und Ort unterschiedliche, von Konventionen und nicht von
Naturgesetzen abhängige Klangorganisationen. Die überkommenen Auf-
zeichnungen sind keine graphische Wiedergabe von Klangorganisationen,
sondern konventionell gestiftete Visualisierungen von auditiven Daten. Alle
Notationen nutzen eine Oberfläche im Sinne einer elementaren Flächigkeit.
Damit sind sie gleichzeitig „Passierstellen […] zu abwesenden und vor allem:
zu ‚rein‘ geistigen Objekten.“
Was ich hier vorlege ist nicht das, was eine entsprechende Theorie der
musikalischen Schrift auf diagrammatologischer Grundlage sein könnte. Wer
übliche geisteswissenschaftliche Verfahren angesichts der Überlegungen zur
Exteriorität des Geistes durchdenkt, wie sie programmatisch Peter Koch und
Sybille Krämer 1997 vorgelegt haben, sieht sich mit philosophischen Grund-
fragen konfrontiert, deren Auffassung weit mehr Zeit benötigt als mir be-
schieden war. Damit die Unfertigkeit mancher Gedanken nicht übertüncht wird,
habe ich Oppositionspaare im Sinne einer Kontrastbildung geformt. Meine
Beispiele vermitteln Gegenbilder des Notierens zu dem Idealfall, der Nelson
Goodman so sehr beschäftigt hat – zum Idealfall, den man sich am ehesten mit
den Noten einer Klaviersonate Wolfgang Amadeus Mozarts vorstellen kann.
Gleichzeitig sind sie ausführlich genug beschrieben worden, um Medien-
wissenschaftler und Philosophen an gemeinsamer diagrammatologischer
Arbeit zu interessieren.
2 Ebd., S. 85.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 161
Ich schreibe in dieser Arbeit einen für sich lesbaren Haupttext, ergänzt
durch die mehr technischen Details in kleiner gedruckten Abschnitten, Fuß-
noten enthalten Nachweise sowie ergänzende Bemerkungen. Sie mögen wie
alles Kleingedruckte beim ersten Lesen übersprungen werden.
Ich stütze mich für allgemein mediaevistische Fragestellungen auf Haas, „Griechische
Musiktheorie in arabischen, hebräischen und syrischen Zeugnissen“ und Musikalisches
Denken im Mittelalter. Darin findet sich (S. 345–488) eine kleine Notationskunde, die als
stillschweigende Vorlage für meinen Text dient. Alternativen dazu: Andreas Jaschinski,
Notation und Manfred Hermann Schmid, Notationskunde. An Einführungen in schrift-
und zeichentheoretische Fragen sei empfohlen: Oliver R. Scholz, Bild, Darstellung,
Zeichen, die Einleitung zu Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis und natürlich
Krämer „Operative Bildlichkeit. Von der ‚Grammatologie‘ zu einer ‚Diagrammatologie‘“,
der grundlegende Aufsatz zu dieser Arbeit. Zur Diagrammatologie seien zusätzlich ge-
nannt: Matthias Bauer und Christoph Ernst, Diagrammatik; Birgit Schneider, Christoph
Ernst, Jan Wöpking (Hg.), Diagrammatik-Reader; Astrit Schmidt-Burkhardt, Die Kunst
der Diagrammatik. – Bildmaterialien zum Mittelalter bieten John Emery Murdoch,
Album of Science sowie die Bände der Musikgeschichte in Bildern, hier vor allem wichtig
Joseph Smits van Waesberghe, Musikerziehung, Bruno Stäblein, Schriftbild der einstim-
migen Musik, und Heinrich Besseler und Peter Gülke, Schriftbild der mehrstimmigen
Musik. – Musica als Disziplin hat ihren sicheren Platz innerhalb der diagrammatischen
Darstellungen von Wissen (Stichwort: arbor scientiarum). Mittelalterliche Gegenbilder
zu dem, was Astrit Schmidt-Burkhardt (Die Kunst der Diagrammatik, S. 39–70) unter
dem Titel „Wissen als Bild“ untersucht, bietet Karl-August Wirth, „Von mittelalterlichen
Bildern und Lehrfiguren“. – Zahlreiche Bildzeugnisse finden sich heute im Internet,
etwa unter den e-codices; die lateinische Musiklehre des Mittelalters ist weitge-
hend komplett vorhanden im Thesaurus musicarum latinarum – eine unkorrigierte
Wiedergabe der Texte ohne kritischen Apparat! –; wesentliche Materialien dazu stel-
len die Mitarbeiter des Lexicon musicum latinum medii aevi bereit. – Zur Funktion der
Schrift in den drei Schriftreligionen: Karl Bertau, Schrift – Macht – Heiligkeit.
2 Schrifttheoretische Aspekte
Schrift- und Bildtheorie sind alte Themen der Geisteswissenschaften, bei
deren Behandlung Notationen gelegentlich angesprochen werden. Ich liefere
eine Skizze wichtiger Ansätze.
(a) Ernst Cassirer (1874–1945) fasste für sein amerikanisches Publikum im
Exil Hauptgedanken seines großen, dreibändigen Hauptwerks Die Philosophie
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access162 Max Haas
der symbolischen Formen in einer kleineren Arbeit unter dem Titel An Essay on
Man zusammen. Darin findet sich ein kleines, im Original etwas mehr als drei
Seiten umfassendes Kapitel mit dem Titel „A clue to the nature of man: the
symbol“ („Ein Schlüssel zum Wesen des Menschen: das Symbol“). Cassirer be-
tont im Rückgriff auf die Biologie von Jakob Johann von Uexküll (1864–1944),
dass alle Lebewesen in einem Wirknetz und in einem Merknetz leben. Wichtig
daran war, dass nicht isolierte Eigenschaften von Menschen und Tieren fest-
gestellt wurden, sondern das, was sie in ihrer Umwelt ausmacht. Den ent-
scheidenden Unterschied zwischen Mensch und Tier sieht Cassirer dann
darin, dass nur Menschen darüber hinaus ein „Symbolnetz“ oder Symbol-
system errichten können:3 Der Mensch ist ein animal symbolicum.4
Diese Bestimmung des Menschen ist zwischenzeitlich oft zitiert worden,
der Begriff „Symbol“ ist nachgerade verschlissen. Ich glaubte, gut daran zu tun,
eine Erinnerung zu wecken. Cassirer suchte einen Begriff, um „die Formen der
Kultur in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit zu erfassen“ und glaubte, mit der Er-
weiterung vom Menschen vom animal rationale zu einem animal symbolicum
die nötige Breite anzudeuten.5 Cassirers Programm hat sich nicht erledigt,
aber zu Teilen sicher differenziert. Eine der Differenzierungen betrifft die
Frage, was denn Schrift sei, was natürlich auch die Notenschriften betrifft. Man
mag in neuerer Zeit zwei Wege ausmachen. Erstens hat Jack Goody auf Claude
Lévi-Strauss’ Buch vom „wilden Denken“ reagiert und daran erinnert, dass vor
Ferdinand de Saussure Schrift als niedergeschriebene Sprache verstanden
wurde.6 Nach Saussure (langue – parole) hat sich diese Einstellung gewandelt;
aus sozial- und kulturanthropologischer Optik macht Jack Goody geltend, die
Achse langue – parole sei um den Faktor der écriture zu erweitern. Das heißt:
Wenn es nicht so ist, dass Schrift automatisch die gesprochene Sprache spiegelt,
muss sie einen eigenen Platz erhalten. Das schon darum, damit im Falle von
Personen, die als literat gelten, die Frage Platz hat, wieweit die Schrift oder
das Schreiben ihr Sprechen beeinflusst. Schrift ist dann nicht das Endprodukt,
sondern gleichzeitig der Proberaum, in dem sich die parole erproben und
3 Cassirer, Versuch über den Menschen, S. 50.
4 Ebd., S. 51. Ein anderer einführender Text Cassirers, allerdings aus der Anfangszeit, ist „Das
Symbolproblem und seine Stellung im System der Philosophie“.
5 Cassirer, Versuch über den Menschen.
6 Es geht zunächst um Lévi-Strauss, Das wilde Denken, und dann, was die Schrift oder das
Schreiben betrifft, immer wieder um das berühmte Kapitel „Schreibstunden“ in ders.,
Traurige Tropen, S. 288–300.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 163
verändern lässt.7 Soweit bis heute angenommen wird, notierte Musik sei auf-
geschriebene Musik, ist der Befund zu befragen. Zweitens hat – interessanter-
weise in der Nachfolge Cassirers – Nelson Goodman ein induktives Vorgehen
in Bezug auf Sprach- und Schriftanalyse gefordert.8 Sybille Krämer, Ekkehard
König und Christian Stetter haben daraus sehr weitreichende Konsequenzen
für den Umgang mit Schrift abgeleitet, die selbstverständlich auch alle Noten-
schriften betreffen.9
(b) Ludwig Wittgenstein (1889–1951). Der Philosoph Hans Julius Schneider
hat bei einer neuerlichen Lektüre des Tractatus, abweichend von einer üb-
lichen Auslegungspraxis, den Eindruck erhalten, es fänden sich darin „viele
Bemerkungen über das Funktionieren der Sprache“, „die nur dann plausibel
erscheinen […], wenn man dabei weder Sprachen von der Art der natürlichen
Sprachen noch Bilder oder Zeichnungen, sondern Notationssysteme vor
Augen hat.“10 Solche Systeme sind weit einfacher gestaltet als etwa Sprache: Es
gibt in ihnen keine Hierarchie im Sinne von Ober- und Unterbegriffen. „Das
Notationssystem kann sich nicht ‚außerhalb seiner selbst‘ aufstellen“.11 Das
Notationssystem enthält in sich keine metasprachlichen Ausdrücke. Sie bilden
keine Negationen und keine Alternativen (‚entweder A oder B‘; es gibt keine
Zeichen, die dem logischen Apparat mit ⊂, ⊃, ∈, ∋ etc. entsprechen). Es geht
Wittgenstein zufolge um den „Bereich der Melodien“, dem „im Tractatus […]
der Bereich der natürlichen Welt“ entspricht.
7 Vgl. Goody, „Woraus besteht eine Liste“, S. 341. Zur Achse „langue (Sprache, Sprach-
system) – parole (mündliche Rede, Sprechen)“ kommt die Verbindung „écriture (Schrift,
Schreiben)“ hinzu. Die drei Faktoren bilden ein Dreieck.
8 Goodman, Languages of Art. Ausgezeichnete Ein- und Hinführungen zu Goodman bieten
Scholz, Bild, Darstellung, Zeichen und Krewani, Philosophie der Malerei bei Jacques Derrida.
Die ausführlichste Untersuchung in Form einer Untersuchung der symboltheoretischen
Grundlagen von Medientheorie und Sprachwissenschaft liefert Stetter, System und Per-
formanz, gleichsam als Weiterführung und Verdichtung seines Opus magnum, Schrift und
Sprache aus dem Jahre 1999.
9 Krämer/König (Hg.), Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen?; Stetter, „Bild, Diagramm,
Schrift“.
10 Ich beziehe mich insgesamt auf Schneider, „Satz – Bild – Wirklichkeit“; ders., „‚Sätze
können nichts Höheres ausdrücken‘“ und ders., „‚Nur erscheint dadurch der Unterschied
der Bedeutungen zu gering.‘“. Das Zitat: Schneider, „Satz – Bild – Wirklichkeit“, S. 82; vgl.
zusätzlich Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis, S. 289f.
11 Schneider, „Satz – Bild – Wirklichkeit“, S. 87 mit Bezug auf Wittgenstein, Tractatus
logico-philosophicus 4.12: „Der Satz kann die gesamte Wirklichkeit darstellen, aber er kann
nicht das darstellen, was er mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie darstellen zu
können – die logische Form. Um die logische Form darstellen zu können, müssten wir uns
mit dem Satze außerhalb der Logik aufstellen können, das heißt außerhalb der Welt.“
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access164 Max Haas
Daher kann man sagen, eine ‚Sprache‘ der dort vorgestellten Art […] könne alles
‚beschreiben‘, was in der natürlichen Welt auftreten kann. Unter dieser ‚natür-
lichen Welt‘ ist dabei die Gesamtheit der möglichen ‚Sachverhalte‘ im Sinne von
Konfigurationen von Gegenständen zu verstehen, deren fraglose Identifizierbar-
keit unterstellt wird. Wichtig ist für unseren Zusammenhang dabei die Tatsache,
dass die Ausdruckskraft eines Notationssystems nicht darüber hinausreicht.12
Notationen reihen dieser Auffassung zufolge Dinge aneinander; sie haben
niemals die Mächtigkeit von Sprachzeichen, die Sprache repräsentieren. Wer
den Topos von der ‚Musik als einer Sprache‘ gebraucht, sieht sich bereits auf-
grund dieser scheinbar einfachen Feststellungen gefordert, den Ausdruck zu
präzisieren.13
(c) Nelson Goodman (1906–1998). Mein Bezug auf die sehr wichtige Theorie
von Nelson Goodman, unterbreitet in Languages of Art, ist recht lose. Ich tue
gut daran, den Zusammenhang zu klären. Goodman unterbreitet im vierten
Kapitel „Die Theorie der Notation“. Er hält fest, dass „eine primäre Funktion
der Partitur, gleichgültig ob sie je als Anweisung für eine Aufführung ver-
wendet wird oder nicht, […] in der definitiven Identifikation eines Werkes von
Aufführung zu Aufführung“ besteht.14 Die Anforderungen an das ‚Notation‘ ge-
nannte Symbolschema müssen garantieren, dass ich von einer Partitur eine
gültige, dem Original gleichwertige Kopie herstellen kann. An Kriterien ge-
hören dazu etwa syntaktische Disjunktivität: Gibt es Charaktere (die Klasse
der /a/) und dazu gehörend Marken (die einzelnen /a/)? Wobei gilt, dass eine
Marke /a/ nie gleichzeitig auch eine Marke /d/ sein kann. Ein weiteres Kriterium
bildet die syntaktische Differenziertheit. Sie garantiert, dass in einer endlichen
Zahl von Schritten bestimmt werden kann, zu welchem Charakter eine Marke
gehört. (Ich kann auf dem Klavier, von c ausgehend, in einer endlichen Zahl
von Schritten bestimmen, wann genau g erreicht ist). Goodman arbeitet mit
einer extensionalen Semantik. Darum garantieren korrespondierend dazu die
Kriterien der semantischen Disjunktivität und der semantischen Differenziert-
heit, dass die syntaktischen Kriterien sich auf die gesamte Extension der Daten
beziehen lassen.
Musikwissenschaftlich tut man gut daran, diese Theorie von ‚Notation‘
nicht als Theorie einer Partitur in musikgeschichtlich relevanter Lesart zu ver-
stehen. Sie funktioniert, wenn man sich Mozarts Sonaten vorstellt, mit dem
durch ein Klavier garantierten Test der Extensionalität. Die Disjunktivität ist
12 Schneider „‚Nur erscheint dadurch der Unterschied der Bedeutungen zu gering.‘“, S. 175.
13 ‚Musik als Sprache‘ oder ‚Musik und Sprache‘ sind ältere Topoi in musikbezogenen
Diskursen – siehe Bayerl, Von der Sprache der Musik zur Musik der Sprache.
14 Goodman, Sprachen der Kunst, S. 125.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 165
bereits dann nicht mehr garantiert, wenn die Stimmung nicht mehr wohl-
temperiert ist; die syntaktische Differenziertheit funktioniert nicht, wenn die
Möglichkeiten eines Saiteninstruments die Grundlage bilden.
Werner Kogge betont zu Recht, dass „Symbolsysteme […] genau dann
und genau so weit logisch analysierbar“ sind „als sie notational verfasst sind.
Notationalität ist aber nichts anderes als das ‚Medium‘ eindeutig bestimmter
Strukturen und Operationen, also der Logik.“15 Goodman nutzt das Symbol-
schema ‚Notation‘ als idealtypischen Ausgangspunkt, um seine Kriterien ohne
Wenn und Aber darlegen zu können. Was sich daraus ableiten lässt, ist diesen
Kriterien verpflichtet, folgt ihnen aber weniger stark oder zum Teil überhaupt
nicht.
Im Bereich mittelalterlicher Aufzeichnungsweisen gibt es keine ‚Notation‘
im Sinne Goodmans. Dies zeigt sich bereits an der Tatsache, dass wir für das
Übertragen und Interpretieren von Aufzeichnungen keinerlei Abschriften be-
nutzen, sondern immer mit Mikrofilmen arbeiten. Es geht um handschriftliches
Material, bei dem Schreiber alle Möglichkeiten neben der Schematisierung
nutzen. Dennoch ist Goodmans Vorstellung von Notation als Bezugspunkt
außerordentlich nützlich, wie sich im Folgenden zeigen wird.
(d) Diagrammatologie: Man hat nach Saussure herausgefunden, dass Schrift
mehr ist als die Aufbewahrung von Gesprochenem. Und mit dem Schlacht-
ruf „Wider die Diskursivierung der Kultur“ hat man mit der Idee aufgeräumt,
Kultur sei ein Text.16 Man hat verstanden, dass es nicht darum geht, zu den
Texten die Bilder hinzuzunehmen und unter dem Duo ‚Text und Bild‘ zu ver-
walten, sondern dass Bilder insgesamt wesentliche Erkenntnisse liefern.
Es geht um eine „jenseits der Dichotomie von Wort und Bild“ angesiedelte
„Schriftbildlichkeit“, die in die Frage mündet, ob es möglich ist, Derridas
Grammatologie zu einer Diagrammatologie zu erweitern. „Tatsächlich spielen
in Derridas ‚Grammatologie‘ lautsprachenunabhängige Praktiken des Schrift-
gebrauches, wie das mathematische Formalisieren, die logischen Kalkülen, die
Programmiersprachen, die musikalischen Notationen und choreographischen
Systeme eine eher unbedeutende Rolle.“ Versucht man, sie als Faktoren ernst
zu nehmen, dann wird verständlich, warum Sybille Krämer fragt:
Können wir die abendländische Episteme (auch) als eine ‚diagrammatologische
Vernunft‘ verstehen oder gar ausweisen? Spielen […] in das Sichtbare vergegen-
ständlichte räumliche Strukturen und Schemata kognitiver Sachverhalte nicht
15 Kogge, „Erschriebene Denkräume“, S. 148.
16 Sybille Krämer und Horst Bredekamp leiten ihren Sammelband Bild, Schrift, Zahl vom
Jahre 2003 ein mit dem Titel „Kultur, Technik, Kulturtechnik: Wider die Diskursivierung
der Kultur“.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access166 Max Haas
nur in der Darstellung, sondern auch beim Erwerb und beim Begründen von
Wissen eine grundlegende Rolle?17
Wenn Sybille Krämer den Aspekt der operativen Bildlichkeit in sechs Aspekten
skizziert, ist damit nicht die diagrammatologische Theoriebildung erfasst,
sondern mit ihrer Hilfe ein Instrument geschaffen, mit dem sich kasuistisch
arbeiten lässt. Krämer schafft „Passierstellen“ aus eigenem Recht:
Es geht um (1) die Flächigkeit und mit ihr verbunden um die Zweidimensionali-
tät und die Simultaneität des Präsentierten; um (2) die Gerichtetheit, mit der
auf der Fläche eine Orientierung möglich wird; um (3) den Graphismus, für
den die Präzision des Striches die Elementaroperation und Urszene bildet; um
(4) die Syntaktizität, welche eine Grammatikalität wie auch die Lesbarkeit ein-
schließt; um (5) die Referenzialität, mit der Repräsentation und transnaturale
Abbildung eine Rolle spielen; schließlich (6) um die Operativität, die nicht nur
Handhabbarkeit und Explorierbarkeit ermöglicht, sondern der zugleich eine
gegenstandskonstituierende, eine generative Funktion zukommt. Alle diese ver-
schiedenen Facetten liefern Tendenzbeschreibungen: Ausnahmen und gegen-
läufige Beispiele zu finden, wäre immer auch möglich.18
Ich werde mich auf diese sechs Kriterien im Folgenden immer wieder beziehen.
Eine ausführlichere Darstellung hätte die Revision und Erweiterung dieser
sechs Kriterien zu einem Ensemble von zwölf Thesen zu berücksichtigen. Ich
gebe hier die Thesen wieder, da bereits deren Text ohne die erläuternden Zu-
sätze die Dimension der diagrammatologischen Arbeit verständlicher macht.
Man lese bei Sybille Krämer die erläuternden Ausführungen nach:19
1. Bild-Text-Verbindung
Diagramme sind nicht selbsterklärend. Kein Diagramm erfüllt ohne das Umfeld
eines begleitenden Textes heuristische oder gar demonstrative Funktionen. Dia-
gramme verkörpern eine textverankerte und textgebundene Form des Bild-
lichen, wobei dieser Textbezug auch durch eine mündliche Praxis gestiftet
werden kann [S. 60–62].
2. Extrinsische Materialität
Diagramme sind raum-zeitlich situierte „Dinge“, denen eine extrin sische
Materialität zukommt, deren Besonderheit es ist, hinsichtlich ihrer konkreten
Stofflichkeit prinzipiell auswechselbar zu sein. Daher ist die Materialität des
Diagramms imprägniert von einer Immaterialität [S. 62–65].
17 Die angeführten Textstellen in diesem Abschnitt stammen aus Krämer, „Operative Bild-
lichkeit“, S. 94, 97f.
18 Ebd., S. 98.
19 Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis, S. 60–86.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 167
3. Flächigkeit
Durch Flächigkeit wird ein artifizieller Sonderraum geschaffen, welcher auf der
Annullierung eines uneinsehbaren Dahinter/Darunter beruht und einen
synoptischen Überblick stiftet, der uns im dreidimensionalen Umgebungsraum –
gewöhnlich – versagt ist [S. 65–67].
4. Graphismus
Die menschliche Artikulationsform des Graphismus geht hervor aus der Inter-
aktion von Punkt, Linie und Fläche und bildet eine gemeinsame Wurzel der
Zeichnung wie der Schrift, folgenreich für kognitive wie ästhetische Belange
[S. 68–70].
5. Relationalität
Diagramme stellen Relationen mit Hilfe von Relationen dar. Das Relationale
fungiert in einer Doppelrolle einerseits als Medium und andererseits als Bezugs-
objekt diagrammatischer Sichtbarmachung [S. 70f.].
6. Gerichtetheit
Das Ausgerichtsein ist die Conditio sine qua non des Einsatzes diagrammatischer
Inskriptionen; diese Gerichtetheit zeigt sich in einer medialen, einer handlungs-
bezogenen und einer nutzerbezogenen, also phänomenalen Dimension
[S. 71–73].
7. Simultaneität/Synopsis
Die Simultaneität als Synopsis des Nebeneinanders ermöglicht das An-
ordnungsprinzip der „übersichtlichen Darstellung“. Zu dem, was im Überblick
gezeigt werden kann, gehört auch die vorwegnehmende Präsentation zu-
künftiger Verläufe in Form von Programmen, Instruktionen und Vorhersagen:
Diagramme sind ein Scharnier zur Umwandlung räumlicher Anordnung in
zeitliche Abfolge und vice versa [S. 73–76].
8. Schematismus
Diagramme sind schematische Darstellungen, die – im Prinzip – auf Re-
produzierbarkeit hin angelegt sind. Zwischen dem zugrundeliegenden, also un-
sinnlichen Schema und seiner konkreten Instantiierung ist zu unterscheiden.
Dieser Schematismus trennt das Diagramm vom Bild als Kunstwerk [S. 76–78].
9. Referenzialität
Diagramme sind nicht selbstgenügsam, sondern stellen etwas dar. Sie sind
primär durch Fremdbezug und nicht durch Selbstbezug charakterisiert. Es gibt
stets ein „Außerhalb“ des Diagramms. Diagramme können eine Form visueller
Propositionalität generieren und somit – unter bestimmten Bedingungen – auch
als visuelle Behauptungen fungieren [S. 78–80].
10. Sozialität
Diagramme eröffnen die Anschauung von etwas, das individuell wahrgenommen
wird, und zwar „im Modus des Wir“. Eingebettet in normativ geprägte Praktiken,
die keineswegs explizit sein müssen, sondern oftmals implizit in kulturellen
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access168 Max Haas
Gebräuchen verankert sind, organisieren Diagramme geteilte epistemische Er-
fahrungen [S. 80–83].
11. Operativität
Gleich einer Karte, welche Bewegungen in einem unvertrauten Terrain eröffnet,
ermöglichen Diagramme, dass wir praktisch oder theoretisch etwas tun, was
ohne Diagramm schwer oder überhaupt nicht auszuführen ist. Diagramme sind
graphische Denkzeuge; sie eröffnen kognitive Bewegungsmöglichkeiten, inso-
fern ihrem Gebrauch ein transfiguratives Potenzial innewohnt, kraft dessen
graphische Konstellationen und deren handgreifliche Manipulation als
intellektuelle Tätigkeiten interpretierbar werden [S. 83–85].
12. Medialität
Als Medium betrachtet nehmen diagrammatische Visualisierungen eine Mittler-
stelle ein: Zwischen heterogenen Sphären situiert, stiften sie durch ihre „Ver-
mittlungsarbeit“ einen Nexus zwischen dem Verschiedenen, ohne dessen
Divergenz dabei aufheben zu müssen [S. 85f.].
3 Szenario 1: Gedankliche Voraussetzungen im Mittelalter:
die Saitenteilung
Auditive Daten haben kein Gegenstück in der sichtbaren Welt. Übersetzungen
aus anderen metaphorischen Ebenen sind dafür nötig. Als überaus nützlich
verstanden wurde in der griechischen Antike, dann im gesamten Mittel-
alter die Herleitung bestimmter Töne durch Saitenteilung. Abb. 7.1 zeigt das
Konstrukt einer Saite, die über einer Rolle geführt und durch ein Gewicht
angespannt wird. Sie erklingt zwischen den beiden Stegen bei 1:1 und 0. Ver-
kürzt man die Saite mit einem weiteren Steg von links nach rechts, so ergibt
sich – gemessen an der Länge l – ein höherer Ton bei 9/12 (= 3/4: Quarte), ein
nächster höherer Ton bei 8/12 (= 2/3: Quinte) und schließlich ein dritter bei
6/12 (= 1/2: Oktave). Dass man genau diese Positionen auf der Saite beachtet,
ergibt sich aus der Bedeutung der Tetraktys, also der ersten vier der natür-
lichen Zahlen: 1:2:3:4.20
20 Ich übernehme die Art der Darstellung und der Erklärung sehr weitgehend aus dem
Artikel „Monochord“ der Wikipedia.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 169
Abb. 7.1 Monochord
Rationale Zahlen scheinen demnach das ideale Mittel, um Saitenteilungen
wiederzugeben, da sie die eigene Tonerzeugung am Monochord numerisch
wiedergeben. Mit den Proportionen, die sich aus solcher Saitenteilung er-
geben, lässt sich rechnen. Die Addition von Intervallen wird als Multi-
plikation, die Subtraktion als Division ausgedrückt. Also: Quarte plus Quinte =
3/4 * 2/3 = 6/12 = 1/2. Oder Quinte minus Quarte: 2/3 : 3/4 = 8/9 (Ganzton) etc.
(Neben den rationalen Zahlen verwendet man heute oft eine logarithmische
Darstellungsweise, bekannt als cents. Sie erleichtert gerade bei unübersicht-
lichen Zahlenverhältnissen die Übersicht. Dabei gilt: die Oktave umfasst 1200
cents, der Halbton demnach 100 cents).21
4 ‚Musik‘ ist der Name einer Reflexionsform
Damit wir uns im westeuropäischen Bereich von Notationen zurechtfinden,
sind einige allgemeine Aspekte anzusprechen. Sie helfen, den Stoff einzu-
ordnen.
Die Dinge dieser Welt haben keine Sprache. Sie sagen nicht, wie sie heißen.
Wir gebrauchen Sprache, wir benennen. Indem wir das nicht-sprachliche Ge-
schehen, das wir ‚Musik‘ nennen, zur Sprache bringen, benennen wir natürlich
nicht die Sache, wie sie ist, sondern wie wir sie dank Sozialisation und weiteren
Bildungsanstrengungen aufzufassen gelernt haben. Was wir genau hören, ist
unklar. Wenn wir aber vom Gehörten reden, benutzen wir die antrainierten
Sprachregelungen. Sich in historischer Optik darüber klar zu werden, was
der Begriff Musik in älterer Zeit besagt, heißt demnach, Auffassungen von
Menschen in Bezug auf den Umgang mit auditiven Daten zu erkunden, indem
21 Seien a und b Zähler und Nenner einer rationalen Zahl, dann werden cents so berechnet:
log(a/b) * 1200/log(2).
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access170 Max Haas
wir die alten Texte lesen und versuchen, einschlägige Sprachregelungen zu
verstehen.22 Machen wir uns also klar, was die Mittelalterlichen meinen, wenn
sie von ‚Musik‘ reden.
Seit Boethius meint ‚Philosophie‘ nicht Philosophie im heutigen Sinn. Unter
philosophia versteht man die Gesamtheit an Wissen. Die Analyse des Wissens
basiert auf einer aristotelischen Grundlage. Kurz gesagt ist es nützlich, zwei
Aristotelismen zu unterscheiden: den einen, der bis heute Philosophen die
Möglichkeit zu Diskussionen mit ihrem großen Vorgänger liefert. Der andere
liefert die Grundbestandteile an Weltorientierung. Wir sprechen heute vom
gesunden Menschenverstand, obgleich diese Orientierungsmomente keines-
wegs selbstverständlich sind. Denn es ist der Welt nicht ablesbar, dass es Kate-
gorien für Raum und Zeit gibt, dass im Raum zwischen links und rechts, oben
und unten, vorne und hinten unterschieden wird und dass man sich in der Zeit
zurechtfinden kann, wenn man „später“ von „früher“ oder „nachher“ von „vor-
her“ unterscheidet.
Eine elementare Wissensorientierung bietet die aristotelische Unter-
scheidung von Physik und Mathematik. Wir sagen zum Beispiel, dass ein
Elefant 4,5 Tonnen wiegt, ein Baum 34 Meter hoch ist und ein Tisch die Maße
1*2 Meter hat. Elefant, Baum und Tisch sind physikalische Objekte. Ihnen ist
gemeinsam, dass sie dem Entstehen und Vergehen (generatio und corruptio)
ausgesetzt sind oder, wie die Formel heißt, der Bewegung (kinesis, motus)
unterliegen. Zahlen dagegen sind intelligible, unveränderbare Objekte. Wenn
der Elefant stirbt, bleibt die Zahl „4,5“ erhalten. Sie hat offensichtlich eine
andere Existenzform.
22 Ich gebe einem Philosophen das Wort. Peter Winch (Die Idee der Sozialwissenschaft und
ihr Verhältnis zur Philosophie, S. 25) hat formuliert: „Wir können also nicht […] sagen,
die philosophischen Probleme entsprängen der Sprache und nicht der Welt, denn in-
dem wir die Sprache erörtern, erörtern wir faktisch die Frage, was als zur Welt gehörig
angesehen werden soll. Unsere Vorstellungen davon, was dem Bereich der Wirklichkeit
angehöre, entstammen der Sprache, deren wir uns bedienen. Unsere Begriffe regeln die
Form unserer Welterfahrung. Es dürfte gut sein, sich an die Trivialität zu erinnern, dass
wir, wenn wir von der Welt sprechen, von dem sprechen, was wir mit dem Ausdruck ‚die
Welt‘ faktisch meinen: wir haben keine Möglichkeit, uns jenseits der Begriffe zu begeben,
in deren Rahmen wir Gedanken über die Welt fassen […] Die Welt ist für uns das, was
sich uns durch diese Begriffe hindurch darbietet. Das heißt nicht, dass unsere Begriffe
sich nicht wandeln könnten; aber wenn sie das tun, bedeutet es, dass auch unser Begriff
der Welt sich gewandelt hat“. – Winch nimmt hier Bezug auf Wittgenstein, Tractatus
logico-philosophicus 5.6: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner
Welt“.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 171
Auf dieser Basis gibt es ein Verständnis von Klangorganisationen, in dem
Geräusch, Lärm, Knistern, Rauschen und andere Daten, die unser Gehör
aufnimmt, von den auditiven Daten unterschieden werden, denen – wie
wir intuitiv vermuten – eine gewisse Ordnung zugrunde liegt. Man hat seit
der griechischen Antike immer wieder vermutet, dass solche Ereignisse aus
einem physikalischen und einem mathematischen Datum bestehen. Das
physikalische nannte man ‚Ton‘, das mathematische ‚Zahl‘. Man definiert
Klangorganisationen, die so erfasst werden können, als „Zahl verbunden mit
den Tönen“ (numerus relatus ad sonos). Man gewinnt damit eine Reflexions-
form, eine Betrachtungsweise. Für die Musikgeschichte ist sie als Gemein-
gut der drei Schriftreligionen – des Judentums, des Christentums und des
arabischen Islams – von größter Bedeutung. Der Graezismus wird in die ver-
schiedenen Sprachen aufgenommen – musica (lateinisch), mūsīqī oder mūsīqā
(arabisch, hebräisch, syrisch) – und zeigt als Fremdwort in diesen Sprachen
an, dass die Grundbedeutung auf das Griechische zurückgeht. Und man lernt,
dass die beiden Komponenten, die physikalische und die mathematische, zur
Diskussion stehen. Dass es beim Sprechen von Musik um die Kombination
eines physikalischen mit einem mathematischen Faktor geht, ist im
Abendland – im Rahmen der drei Schriftreligionen also – Gemeingut bis in
die Leibnizzeit hinein. Dabei kann der Formalaspekt, also die Zahl, höher ge-
wichtet werden – das ist etwa bei Boethius der Fall –, sodass der physikalische
Anteil nahezu verschwindet. Es dauert bis ins 12./13. Jahrhundert, also bis zur
Zeit des Bekanntwerdens der physikalischen Schriften von Aristoteles, dass die
physikalische Komponente zu ihrem Recht kommt.
Gemeingut weit über die Leibnizzeit hinaus ist die Beachtung des mathe
matischen Faktors im Sinne einer Quantifizierung der Qualität ‚Ton‘ mit ihren
drei Bereichen: Tonhöhenorganisation – Tonverlaufsorganisation – Tonstärke.23
Von Reflexionsform oder Betrachtungsweise zu sprechen, mag ungewöhn-
lich scheinen, da wir etwa seit dem 18. Jahrhundert den Begriff ‚Musik‘ in fast
allen Sprachen als Sachbegriff verwenden, den wir intuitiv aufgrund unserer
23 Die mathematischen Ansätze der letzten Jahrzehnte – Allen Forte, David Lewin, Guerino
Mazzola u.a. – haben in dem Sinne keine Vorläufer, auch wenn sie natürlich eine
mathematische Tradition für sich reklamieren können. Der dauernde Verweis auf das
Mathematische der Musik war der Versuch, „der Musik selbst einen entsprechend hohen
Wert zuzusprechen und so die Bildungsrelevanz des musikalischen Wissens gesellschaft-
lich zu verankern“ (Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, S. 120). Interessant ist,
dass die tatsächliche Grundproblematik, die Schwierigkeit, denkerisch eine Quanti-
fizierung von Qualitäten zu vollziehen, erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde,
maßgeblich durch die Pionierarbeiten von Anneliese Maier.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access172 Max Haas
elementaren Sozialisation richtig einsetzen. Man mag sich die Idee einer
Reflexionsform verdeutlichen im Gedanken an eine Person, die zu einem
Problem aus soziologischer oder aus psychologischer oder aus philosophischer
Sicht Stellung bezieht. Gemeint ist jeweils eine bestimmte Reflexionsform im
Sinne einer Art der Betrachtung mit bestimmten Voraussetzungen und einer
bestimmten Blickrichtung. In Ethnien und Sozietäten, die Informationen noch
weitgehend mit dem Gehör aufnehmen – der Übergang von einer Gesprächs-
zu einer Schriftkultur datiert aus dem ausgehenden 18. und beginnenden
19. Jahrhundert – ist das Vokabular, das sich mit der Aufnahme auditiver Daten
befasst, weit reicher als wir es heute gewohnt sind. Unser hoch differenziertes,
auf Schrift und Schreiben gemünztes Vokabular geht zurück auf das Auf-
kommen überwiegender Schriftlichkeit, damit auf die Vorherrschaft des
Sehens gegenüber dem Hören. Aufs Auditive bezogene Nominalformen wie
lateinisch modulamen, cantus, carmen, hymnus, canticum, musica, arabisch
ṭarab, ġīnā’, laḥn, mūsīqī oder hebräisch šīr, neʿimā, taʿam lassen sich nur mit
Mühe ins Deutsche übersetzen, da Äquivalente fehlen. Die Bedeutungsfelder
müssen mit großer Mühe rekonstruiert und umschrieben werden.
In der philosophia, also in der Gesamtheit an Wissen, arbeitet man in einer
Hierarchie des Wissens, in der Fächer durch Unterstellungsverhältnisse ge-
kennzeichnet sind. Der lateinische Sprachgebrauch kennt dafür subalternatio.
Die musica ist der Mathematik und der Physik unterstellt; sie selber hat unter
sich die Metrik als Teil der Grammatik. Anders gesagt: Es gibt im Mittelalter
(und darüber hinaus bis in die Leibnizzeit) keine Theorie der Schrift, die nur
das Anliegen der musica ist; von musica zu reden heißt immer, sie im Gesamt
des Wissens, innerhalb der philosophia zu lokalisieren.24
5 Ganzes – Teil
Zur Reflexionsform ‚Musik‘ gehört das Bestreben, die spezifische Kombination
von Sinneswahrnehmung (physikalischer Aspekt) einerseits und von Be-
rechnung mit Hilfe der Saitenteilung (mathematischer Aspekt) andererseits zu
erkunden. Wesentlich daran ist die philosophische Komponente. Es gilt, dass
ein Ganzes (hier: die Oktave) nach den Teilen zu befragen ist, die das Ganze
24 Diese Unterstellungsverhältnisse – mit subalternatio, subalternare ausgedrückt – nennt
man in philosophie- und wissenschaftshistorischer Sprechweise „Subalternations-
theorie“. Das Material ist sehr vielfältig – siehe Haas, Musikalisches Denken im Mittelalter:
Index, S. 682: Subalternation. Man findet Belege innerhalb der mittelalterlichen Musik-
lehre durch Absuchen des Thesaurus musicarum latinarum.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 173
ausmachen. Anders gesagt: Man will wissen, woraus das Ganze (die Oktave)
besteht. Eine gültige Antwort auf die Frage liegt nur dann vor, wenn die
Elemente, die das Ganze ausmachen, von „gleicher logischer Stufe“ sind.25 Man
kann also nicht irgendwelche Gegenstände suchen, die das Ganze ‚irgendwie‘
ausmachen, sondern sucht ein Element, das in bestimmter Anzahl das Ganze
ausmacht. Daraus entsteht in diesem Falle ein Problem, da es sich zeigen
lässt, dass es keine rationale Zahl gibt, die als Element der Oktave fungiert.
Umgekehrt gesagt: Wird die Oktave als ‚Ganzes‘ verstanden und der ‚Teil‘ ge-
sucht, aus dem die Oktave besteht, kann dieser Teil im Bereich der rationalen
Zahlen definitiv nicht gefunden werden. Man interessiert sich darum für An-
näherungswerte. Stapelt man zwölf Quinten übereinander, erzeugt man einen
Wert, der wiederum beinahe sieben Oktaven entspricht. Die Differenz ist ein
sehr kleines, ‚Komma‘ genanntes Intervall. Genau dieses kleinste Intervall
findet sich auch dann, wenn man die Differenz zwischen sechs Ganztönen
und einer Oktave berechnet. Man kann dieses Komma berechnen (in cents
ausgedrückt geht es um 23.46 cents, also um einen Achtelton). Sicher hört man
dieses kleine Intervall, aber man hört es nicht als Komma von 23.46 cents. Was
die Mittelalterlichen interessiert, ist der unaufhebbare Unterschied zwischen
der Genauigkeit der eigenen Sinneswahrnehmung und der berechenbaren
Genauigkeit.
Das Problem vom Ganzen und den Teilen beschäftigt auch die mittelalterliche
Kompositionslehre. Der poietische Prozess – der Akt der Herstellung – ist dadurch
gekennzeichnet, dass es kompositorisch um eine kontingente Datenfolge geht. Will
man festhalten, woraus diese Folge besteht, kann man die Intervallmöglichkeiten im
Satz aufzählen, hat aber mit diesen statischen Elementen keine Antwort gegeben auf
die Frage, wie bei einem poietischen, also der Kontingenz unterstehenden Gebilde der
Faktor der Kontingenz eingebracht wird. Das heißt, wenn in einem Zusammenhang
eine Regel besagt, man gehe aus der Sexte in die Quinte, muss klar sein, dass der Schritt
6→5 zu einem kontingenten Verfahren gehört. Man kann aus der 6 in die 5 gehen, aber
es gibt auch andere Möglichkeiten. Will man diese besondere Verfassung des Satzes
darstellen, kann man in Form einer Klangschrittlehre mögliche Schrittfolgen dar-
stellen und gleichzeitig am Beispiel verdeutlichen, dass es Möglichkeiten sind. (Nach
Maßgabe der Mittelalterlichen gibt es keine theoretische, also der Notwendigkeit un-
terliegende Bedingung für einen Intervallschritt).26
25 Lorenz, Art. „Element“, S. 309.
26 [Fußnote fehlt, leider nicht ermittelt, d. Hg.]
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access174 Max Haas
Eine Spielform des gleichen Kriteriums ist hier darum zu erwähnen, weil auf ihr
die enorm wirkungsmächtige Analogie zwischen Sprache und Musik beruht.
Der entscheidende Textteil bildet den Anfang der Musica enchiriadis. Er besagt
sinngemäß, dass Sprache sich aus kleinsten Bestandteilen zusammensetzt:
Buchstaben ergeben Silben, Silben ergeben Wörter, und Wörter ergeben Sätze.
Und genauso steht es um die Musik. Genial an diesem auf den Kommentar
des Calcidius zu Platons Timaios abgestützten Vergleich ist der Umstand, dass
die notwendigen Einzelheiten nicht richtig zusammenpassen, die Idee des
Vergleichs aber absolut klar ist.27 Kinder können das an Grammatik, also an
Erlernen des Lateins, einsetzen, um zu verstehen, was musikalisch los ist. Und
wiederum geht es dabei um den Aufweis, dass musikalische Einheiten aus
kleinsten Einheiten bestehen, die Zusammensetzungen bilden.
6 Kategorienlehre
Man kennt dank der Überlieferung eines kleinen Textes von Boethius, De
trinitate II, die aristotelische Unterteilung der Philosophie in Metaphysik,
Mathematik und Physik.28 Allerdings werden die physikalischen Schriften von
Aristoteles im lateinischen Mittelalter erst im 12. Jahrhundert übersetzt und
dann vom 13. Jahrhundert an rezipiert. Doch muss man nicht so lange warten,
bis die Reflexionsform ‚Musik‘ mit ihrer mathematischen und physikalischen
Komponente verstanden wird. Man kann sie auch mit Hilfe der Kategorien-
schrift von Aristoteles angehen, die Boethius selber vom Griechischen ins
Lateinische übersetzt hat. Daraus kennt man grundlegende strukturierende
Techniken, um mit dem Bereich von philosophia umzugehen; Boethius führte
in seiner propädeutischen mathematischen Schrift De arithmetica wohl in
pädagogischer Absicht alternative Ausdrücke ein: Er schrieb von magnitudo
27 Klaus-Jürgen Sachs, der die Sachlage umsichtig erörtert, bemerkt dann auch völlig zu
Recht, „der Autor“ benutze „die Parallelisierung eher als Hilfsmittel zur Veranschau-
lichung denn als ontologische Beschreibung“ (Sachs, „Musikalische Elementarlehre im
Mittelalter“, S. 114). – Der einschlägige Text der Musica enchiriadis (hg. von H. Schmid,
Musica et scolica enchiriadis, Abschnitt 3.2–5): „Sicut vocis articulatae elementariae atque
individuae partes sunt litterae, ex quibus compositae syllabae rursus componunt verba et
nomina eaque perfectae orationis textum, sic canorae vocis ptongi, qui Latine dicuntur
soni, origines sunt et totius musicae continentia in eorum ultimam resolutionem desinit.“
Die Quelle ist Calcidius I, 44, in: Waszink, Studien zum Timaios-Kommentar des Calcidius,
92.10–19.
28 Boethius, De trinitate , in der Ausgabe von Stewart/Rand/Tester (Hg.), Boethius, S. 8–12 =
Patrologia latina, Bd. 64, Spalte 1250A–1251A.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 175
(Größe) statt von quantitas continua und von multitudo (Menge) statt von
quantitas discreta.29 In tabellenförmiger Anordnung ergibt sich folgendes
Instrumentarium für den intellektuellen Werkzeugkasten:
Ton (sonus) Zahl (numerus)
Fachbereich Physik Mathematik
Kategorie Qualität Quantität
Begriffe (propädeutisch) magnitudo ([intensive] multitudo (Menge,
Größe) extensive Größe)
Begriffe (philosophische quantitas continua / quantitas discreta
Sprache) qualitas
Modalität skalierbar nicht skalierbar
secundum magis et minus non secundum magis et
minus
Abb. 7.2 Tabellarische Übersicht der kategorialen Kriterien
Im folgenden Abschnitt betrachten wir einige Diagramme und untersuchen,
was genau von den bislang aufgezählten Voraussetzungen aufgenommen
wird. Welche Besonderheiten diesen Diagrammen eigen sind, wird uns später
beschäftigen.
7 Diagramme
Solche Gemengelagen werden diagrammatisch ausgedrückt, indem man eine
Folge von Toncharakteren oder von Zahlwerten samt ihren Beziehungen auf-
listet. Beziehungen zwischen Toncharakteren sind als Proportionen fasslich;
Beziehungen zwischen Zahlwerten geben Proportionen, die sich wiederum als
Intervall darstellen lassen. In der musiktheoretischen Darstellung wird nicht
versucht, das Auseinanderklaffen zwischen gehörsmäßigem Urteil und Be-
rechnung zu zeigen, sondern erinnert an die Ausgangsbasis, also an die ersten
Intervalle, die sich mit der Folge 1:2:3:4 erzeugen lassen.
29 Vgl. Boethius, De institutione arithmetica, Abschnitt I,1, S. 8, Z. 15–23.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access176 Max Haas
Abb. 7.3 zeigt eine Doppeloktave (systema teleion) mit den Toncharakteren (von oben)
A B C D E F G A B C D E F G A. Im linken und rechten Halbkreis eingetragen sind die
Doppeloktave (disdiapason) A–A und die beiden Oktaven (diapason). Dann links
Oktave plus Quarte (diapason ac diatessaron) und Quinte und Oktave (diapente ac dia-
pason). Dann (oben beginnend) links Quinte und Quarte (diapente: A–E, diatessaron:
E–A). Rechts komplementär dazu Quarte und Quinte (A–D, D–A). Die Figur ist offen-
sichtlich gezeichnet worden, um darzulegen, dass die Grundintervalle mehrfach kons-
truiert sind. Das heißt: An jeder Schnittstelle (links: A–E, E–A, A–E, E–A und rechts:
A–D, D–A, A–D, D–A) gibt es immer mehr als einen einzigen Halbbogen. Die Figuration
über zwei Oktaven zeigt die genaue Wiederholung der jeweiligen Oktavkonfiguration
und die beidseitige Anlage, graphisch unterstützt durch die Ausbildung der beiden
Hälften zu einem Kreis, legt die Symmetrie offen. Insgesamt wird offensichtlich, wie
sich in einer zwei Oktaven umfassenden Folge von Toncharakteren die Grundintervalle
Quarte und Quinte mit ihren Zusammensetzungen abbilden.
Abb. 7.3 Diagramm der Musica enchiriadis, Einsiedeln, Stiftsbibliothek,
Codex 79 (522), S. 12 (vgl. H. Schmid, Musica et scolica enchiriadis,
S. 29). Die Handschrift entstand im letzten Viertel des
10. Jahrhunderts; die Musica enchiriadis datiert aus dem Ende des
9. oder dem Beginn des 10. Jahrhunderts
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 177
Weitgehend gleich, aber mit anderer Betonung der Einheiten – es geht um Abbildungen
in pädagogisch orientierter Literatur – zeigt die folgende Darstellung (Abb. 7.4) die
Zusammensetzung einer Doppeloktave, wenn von den numerischen Werten der
Intervalle ausgegangen und deren Verbindung studiert wird. Hier liegt nicht eine Folge
von Toncharakteren vor wie in Abb. 7.3, sondern eine Zahlenfolge: 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24.
Die Bogen zeigen Intervalle an, die mit dem Proportionsnamen gekennzeichnet sind.
Von links nach rechts gelesen vier Quarten, also vier Mal Proportion 3:4, nämlich 6:8 =
sesquitertium (3:4): 8:12, 12:16, 18:24. Und vier Quinten, also vier Mal Proportion 2:3,
nämlich 6:9 (sesqualter), 8:12, 12:18, 16:24. Zusätzlich wird angezeigt, dass 6:12 und 12:24
eine proportio dupla, also eine Oktave abgeben (mit dem Schriftzug duplum gekenn-
zeichnet), und 6:24 eine proportio quadrupla (quadruplum).
Abb. 7.4 Scolica enchiriadis S. II, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 79 (522), S. 76 (vgl.
H. Schmid, Musica et scolica enchiriadis, S. 111)
Wenn es nun klar ist, mit welchen Proportionen, also mit welchen Ton-
charakteren gearbeitet wird, kann man kontingente Datenfolgen in einem
Koordinatensystem abbilden. Die Zeichen der y-Achse regeln das, was an Ton-
charakteren möglich ist, und auf der x‑Achse werden die Daten eingetragen.
Als theoretisches Konstrukt kann das dann so aussehen:
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free access178 Max Haas
Abb. 7.5 Beispiel aus der Musica enchiriadis, S. 22 (vgl. H. Schmid, Musica et scolica enchi-
riadis, S. 49)
Die Umzeichnung und Übertragung von Abb. 7.5:
Abb. 7.6 Die vorgegebene Stimme (vox principalis) ist hohl eingezeichnet, die dazu ge-
schriebene zweite Stimme (vox organalis) ist schwarz
Mit dem Konstrukt wird etwas exemplifiziert. Damit die Exemplifikation ge-
lingt, müssen die Toncharaktere eindeutig feststellbar sein. Feststellen lässt sich
dann, dass zwei Stationen in diesem kleinen Satz wichtig sind, nämlich jene
über den Silben 2 – cae-[li] – und 11 – [undi]- so- [ni] –. Man kann sie temporal
als ‚v[orher]‘ und ‚n[achher]‘ auffassen. Die Lehre sagt: wenn man bei ‚vorher‘
A tut – man geht nicht ins Quartorganum, das die Silben 4–10 bestimmt –,
dann gibt es bei ‚nachher‘ (Silbe 3 bzw. Silbe 12) keinen Fehler (umgekehrt:
wenn man bei ‚vorher‘ nicht A macht, wird ‚nachher‘ falsch). Denn: Eine
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessÜber das Visualisieren von auditiven Daten im Mittelalter 179
mechanische Anwendung von Quarten wie in den Silben 4–10 führt bei Silbe 3
und Silbe 12 zu einem ‚verbotenen‘ Intervall, nämlich zum Tritonus B–e. Kinder
lernen mit einer solchen Übung, jeden Klang als Station wahrzunehmen, die
eine bestimmte Entscheidung fordert. Da die falsche Entscheidung bei Silbe 2
und Silbe 11 erst danach das falsche Ergebnis zeitigt, lernen Kinder, in diesem
temporalen Setting ‚vorher‘ und ‚nachher‘ aufeinander zu beziehen. Sie lernen
einen Aspekt der Zeit.
8 Aspekte der Diagrammatik 1: Voraussetzungen
Damit eine Darstellung als Diagramm aufzufassen ist, muss sie sechs Kriterien
genügen: Flächigkeit, Gerichtetheit, Graphismus, Syntaktizität, Referenzialität
und Operativität.30 Die Abb. 7.3–7.5 können mühelos mit diesen allgemeinen
Kriterien zusammengebracht werden:
(1) Ein Diagramm offeriert eine flächige Ansicht, erlaubt daher dem Auge,
gleichzeitig ein Vielerlei wahrzunehmen (im Unterschied zur Wahr-
nehmung auditiver Daten oder dem Tasten mit der Hand): Flächigkeit;
(2) Diagramme haben eine Ausrichtung, zeigen auf „vorne und hinten, oben
und unten, innen und außen, zentral und peripher“: Gerichtetheit;
(3) Diagramme benötigen Linien als organisatorische Elemente: Graphismus;
(4) „jede regelhafte Anordnung graphischer Markierungen“ bedarf einer
syntaktischen Organisation, bestehend aus diskreten Einheiten. Sie er-
lauben es, „etwas als etwas wieder“ zu „erkennen“. Ein Spezialfall einer
solchen Organisation ist die Notation: sie unterliegt den Kriterien von
Disjunktivität und endlicher Differenziertheit, wie bereits oben erwähnt:
Syntaktizität;
(5) Die Abb. 7.3–7.5 gehören zu den graphischen Elaboraten, für die ein
„Fremdbezug fundamental“ ist. Es gibt ein „Außerhalb“, Bezugspunkte,
auf die ein Diagramm sich bezieht: Referenzialität;
(6) Diagramme haben eine starke Virtualität in dem Sinne, dass in ihnen
Arbeitsmöglichkeiten angelegt sind. Sie bieten Material an, mit dem
operiert werden kann. So ist das Material von Abb. 7.3 und Abb. 7.4
30 Ich stütze mich auf Krämer, „Operative Bildlichkeit“, S. 98–105, deren Ausführungen
ich enorm verkürze. Es geht nicht darum, den Bereich der Diagrammatik oder
Diagrammatologie (Grammatologie → Dia-Grammatologie) auszuloten, sondern an-
zuzeigen, wo und wie man für die Analyse musikwissenschaftlich relevanter Graphien
an einschlägigem Wissen andockt. Alle als Zitat gekennzeichneten Textteile dieses Ab-
schnitts stammen aus der zitierten Arbeit von Krämer.
Max Haas - 9783846763537
Downloaded from Brill.com06/09/2022 08:39:00PM
via free accessSie können auch lesen