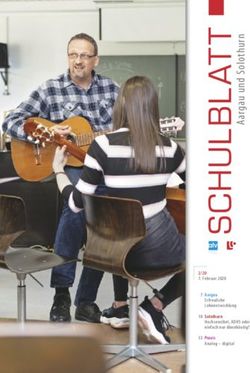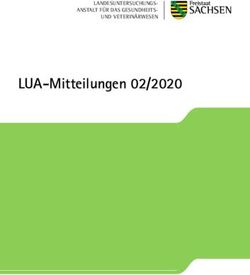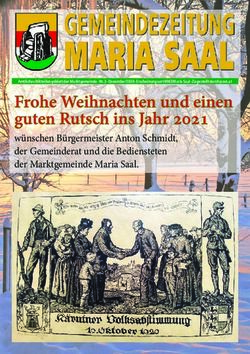COMPUTERSPIELSUCHT HINTERGRÜNDE UND AUSWIRKUNGEN DER - Eine Bachelorarbeit von Daniel Laesser - Zenodo
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
HINTERGRÜNDE UND AUSWIRKUNGEN DER
CO MP U TE R SP I E L SU C HT
AUF MÄNNLICHE JUGENDLICHE
ZWISCHEN 12 UND 19 JAHREN
Eine Bachelorarbeit von Daniel LaesserBachelor-Arbeit
Ausbildungsgang Sozialpädagogik
Kurs VZ 2014 – 2017
Daniel Laesser
Hintergründe und Auswirkungen der Computerspielsucht auf männliche
Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren
Ein Überblick über das Themengebiet der Computerspiele und die Bedeutung für die
sozialpädagogische Praxis
Diese Bachelor-Arbeit wurde im August 2017 eingereicht zur Erlangung des vom Fachhochschulrat der
Hochschule Luzern ausgestellten Diploms für Sozialpädagogik.
Diese Arbeit ist Eigentum der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Sie enthält die persönliche
Stellungnahme des Autors/der Autorin bzw. der Autorinnen und Autoren.
Veröffentlichungen – auch auszugsweise – bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Leitung
Bachelor.
Reg. Nr.:Originaldokument gespeichert auf LARA – Lucerne Open Access Repository and Archive der Zentral- und
Hochschulbibliothek Luzern
Dieses Werk ist unter einem
Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Schweiz Lizenzvertrag
lizenziert.
Um die Lizenz anzuschauen, gehen Sie bitte zu https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/
Oder schicken Sie einen Brief an Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California
95105, USA.
Urheberrechtlicher Hinweis
Dieses Dokument steht unter einer Lizenz der Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle
Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Schweiz http://creativecommons.org/
Sie dürfen:
Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
Zu den folgenden Bedingungen:
Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur
Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder
angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber
unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
Nicht kommerziell — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.
Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt
aufbauen dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers
dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte nach Schweizer Recht unberührt.
Eine ausführliche Fassung des Lizenzvertrags befindet sich unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/ch/legalcode.deVorwort der Schulleitung Die Bachelor-Arbeit ist Bestandteil und Abschluss der beruflichen Ausbildung an der Hoc h- schule Luzern, Soziale Arbeit. Mit dieser Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie fähig sind, einer berufsrelevanten Fragestellung systematisch nachzugehen, Antworten zu dieser Frageste l- lung zu erarbeiten und die eigenen Einsichten klar darzulegen. Das während der Ausbildung erworbene Wissen setzen sie so in Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die eigene beru f- liche Praxis um. Die Bachelor-Arbeit wird in Einzel- oder Gruppenarbeit parallel zum Unterricht im Zeitraum von zehn Monaten geschrieben. Gruppendynamische Aspekte, Eigenverantwortung, Auseina n- dersetzung mit formalen und konkret-subjektiven Ansprüchen und Standpunkten sowie d ie Be- hauptung in stark belasteten Situationen gehören also zum Kontext der Arbeit. Von einer gefestigten Berufsidentität aus sind die neuen Fachleute fähig, soziale Probleme als ihren Gegenstand zu beurteilen und zu bewerten. Sozialpädagogisches Denken und Handeln ist vernetztes, ganzheitliches Denken und präzises, konkretes Handeln. Es ist daher nahe liegend, dass die Diplomandinnen und Diplomanden ihre Themen von verschiedenen Seiten beleuchten und betrachten, den eigenen Standpunkt klären und Stellung b eziehen sowie auf der Hand- lungsebene Lösungsvorschläge oder Postulate formulieren. Ihre Bachelor-Arbeit ist somit ein wichtiger Fachbeitrag an die breite thematische Entwicklung der professionellen Sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Praxis und Wi ssenschaft. In diesem Sinne wünschen wir, dass die zukünftigen Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit ihrem Beitrag auf fachliches Echo stossen und ihre Anregungen und Impulse von den Fachleuten auf- genommen werden. Luzern, im August 2017 Hochschule Luzern, Soziale Arbeit Leitung Bachelor
Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist,
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Friedrich Schiller (1795),
zit. in Arthur Jung (1875), S. 242.Abstract Ausgangslage Interaktive Medien sind in der heutigen Gesellschaft weit verbreitet. Insbesondere Computerspiele erfreuen sich bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren grosser Beliebtheit. So nutzen 91% der männlichen Ju- gendlichen regelmässig Computerspiele. Computerspie- le weisen auch Risiken auf. Im DSM-5 wurden diagnos- tische Kriterien einer Computerspielsucht definiert, welche nun in der Forschung Einfluss finden. Zielsetzung Der Autor zeigt Hintergründe und Auswirkungen der Computerspielsucht anhand von 12- bis 19-jährigen männlichen Jugendlichen auf, um den Professionellen der Pädagogischen Arbeit durch Grundwissen mehr Si- cherheit zu bieten. Es werden Handlungsempfehlungen für die sozialpädagogische Praxis abgegeben. Umsetzung Eine Analyse der bestehenden Literatur unter anderem aus den Bereichen der Sozialpädagogik ermöglichen den Wissensaufbau zum Themenfeld der Computer- spielsucht mit ihren Hintergründen und Auswirkungen. Ergebnisse Eine Computerspielsucht hat vielfältige Auswirkungen auf das soziale Umfeld, auf die körperliche und die psy- chische Gesundheit und auf die intellektuelle Leistungs- fähigkeit. Diese werden in dieser Bachelorarbeit darge- legt. Schlussfolgerungen Im Bereich der Aus- und Weiterbildung braucht es mehr und bessere Angebote zum Fachbereich Medienkompe- tenz, unter anderem mit dem Themenbereich Computer- spiele. Nebst dem braucht es Langzeitstudien, um die Auswirkungen einer Computerspielsucht darlegen zu können.
Inhaltsverzeichnis Vorwort.................................................................................................. 1 1. Einleitung........................................................................................... 3 1.1 Hypothesen und Fragestellungen....................................................................4 1.2 Zielsetzung....................................................................................................7 1.3 Berufsrelevanz und AdressatInnen. . ................................................................8 1.4 Aufbau der Arbeit..........................................................................................8 2. Computerspiel.................................................................................. 10 2.1 Definition Computerspiel.............................................................................10 2.2 Computerspielnutzung von Jugendlichen......................................................12 2.3 Computerspiele als Teil der Kultur...............................................................15 2.4 Jugendschutz ..............................................................................................17 2.5 Spielgenres..................................................................................................19 2.6 Funktionen des Spielens. . .............................................................................20 2.7 Motivation des Spielens...............................................................................22 3. Computerspielsucht.......................................................................... 24 3.1 Sucht...........................................................................................................24 3.2 Differenzierung einer Internet- und einer Computerspielsucht . . .....................25 3.3 Computerspielsucht im DSM-5.. ...................................................................26 3.4 Entstehung einer Computerspielsucht...........................................................28 3.4.1 Neurobiologische Sicht........................................................................28 3.4.2 Lernpsychologische Sicht....................................................................29 3.4.3 Systemische Sicht................................................................................30 3.4.5 Entstehung einer Computerspielsucht auf Basis des DSM-5..................31 3.5 Prävalenz der Computerspielsucht................................................................32 3.6 Risikofaktoren.............................................................................................33 3.6.1 Personenbezogene Risikoindikatoren.. ..................................................34 3.6.2 Spielbezogene Risikoindikatoren.. ........................................................35 3.6.3 Sozialisationsbezogene Risikoindikatoren............................................35 4. Auswirkungen der Computerspielsucht. . ............................................ 37 4.1 Computerspielsucht als psychische Primärerkrankung..................................37 4.2 Soziale Auswirkungen. . ................................................................................37 4.3 Auswirkungen auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit................................39 4.4 Gesundheitliche Auswirkungen....................................................................40 4.4.1 Körperliche Gesundheit.......................................................................40 4.4.2 Psychische Gesundheit. . .......................................................................41 5. Schlussfolgerungen........................................................................... 43 5.1 Bedeutung für die Praxis..............................................................................43 5.1.1 Ausbildungsstätten. . .............................................................................44 5.1.2 Institutionen der Sozialpädagogik........................................................45
5.2 Fazit............................................................................................................46
5.3 Ausblick......................................................................................................47
Anhang....................................................................................................I
A Literaturverzeichnis...........................................................................................II
B Abbildungsverzeichnis..................................................................................... IX
C Tabellenverzeichnis. . ......................................................................................... X
D Glossar........................................................................................................... XII
Abbildungen
Abbildung 1: Anzahl der Publikationen zur Computerspielsucht ...................................... 5
Abbildung 2: Veranschaulichung eines Personal Computers der Marke HP..................... 10
Abbildung 3: Freizeitaktivitäten der Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren . 13
Abbildung 4: Lieblingscomputerspiele der Schweizer Jugendlichen 2016 ...................... 15
Abbildung 5: Postulierte pathologische Nutzungsweisen der Internet- und
Computerspielabhängigkeit und die Abhängigkeit von Onlinespielen als
ihr Überschneidungsbereich.......................................................................... 26
Abbildung 6: Zusammenhänge der diagnostischen Elemente einer MMORPG-Sucht .... 32
Abbildung 7: Das Suchtdreieck als mögliches Einordnungsschema von Risikofaktoren
für Computerspielabhängigkeit................................................................... 34
Tabellen
Tabelle 1: PEGI-Altersempfehlungen nach PEGI ............................................................ 18
Tabelle 2: PEGI-Inhaltssymbole ...................................................................................... 19
Tabelle 3: Die Spielgenres ............................................................................................... 20Vorwort
Der Autor dieser Bachelorarbeit ist selbst ein Konsu-
ment von diversen Spielen und bezeichnet das Spielen
als eine seiner Leidenschaften. Der Autor liebt jegliche
Spiele, sei dies ein Brettspiel wie Siedler von Catan, ein
Konsolenspiel wie Fifa 17 oder ein Kubb in der Jung-
schar. Nebst diesem persönlichen Interesse ist der Autor
dieser Bachelorarbeit in seinen verschiedenen Praktika
sehr häufig mit elektronischen Spielen konfrontiert wor-
den, sei dies in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie mit
Kindern zwischen 6 und 13 Jahren oder in einer Tages-
sonderschule mit 13- bis 17-jährigen Jugendlichen. Das
Spiel, sowohl elektronische Spiele als auch sonstige
Spiele wie bspw. Rollenspiele oder Brettspiele, ist für
Kinder und Jugendliche gemäss den Beobachtungen des
Autors von grosser und wichtiger Bedeutung und macht
bei ihnen einen grossen Teil ihres Lebens aus. Zudem
war in den Institutionen gemäss den Erfahrungen des
Autors kein umfassendes Medienkonzept vorhanden,
sondern nur eine Regelung bezüglich der Nutzungszei-
ten und ein Verbot von gewalthaltigen Computerspielen,
was der Autor auf eine Unsicherheit in Bezug auf elekt-
ronischen Spielen zurückführt. Darum möchte der Autor
mit dieser Bachelorarbeit einen Teil dazu beitragen,
dass dieses momentan schlecht überschaubare Gebiet
der Computerspiele erhellt wird und dadurch bei den
Leserinnen und Lesern dieser Bachelorarbeit eine allfäl-
lige Unsicherheit vermindert werden kann. Zudem er-
hofft sich der Autor, dass der Bereich Computerspiele
auch im Fachgebiet der Sozialpädagogik ein grösseres
Gewicht und eine grössere Beachtung erhält.
Folgenden Personen dankt der Autor für die Unterstüt-
zung und Rat:
Meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden für
die Zeit während des Erstellens der Bachelorarbeit, ins-
besondere auch für die Geduld und das Verständnis.
Weiter auch ein grosses Dankeschön an Olivier Steiner,
Isabel Willemse und Renato Hüppi für die Fachpoolge-
spräche, die den Horizont erweitert haben und bei der
Eingrenzung der Fragestellung sehr geholfen haben.
Zum Schluss gilt der Dank auch allen Mitstudierenden,
welche im Bachelorkolloquium mitgedacht haben und
dem Autor damit weitergeholfen haben.
12
1 Kapitel 1
Einleitung
Die Medien sind gemäss Sabine Feierabend, Ulrike Karg und Thomas Rathgeb (2014) in
der heutigen Gesellschaft tief verankert und für unseren Alltag von besonderer Bedeutung
(S.29). Der Durchbruch der interaktiven Medien hatte nach Florian Rehbein und Thomas
Mössle (2012) tiefgreifende Auswirkungen auf den Alltag der meisten Menschen. So ha-
ben die interaktiven Medien die menschliche Kommunikation sowie die Freizeitgestal-
tung verändert und auf weitere Bereiche wie bspw. auch die Arbeit Auswirkungen (S.392).
Die interaktiven Medien beeinflussen damit wichtige Lebensbereiche und elementare
Grundbedürfnisse wie z.B. den Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit (ebd.). Dass die in-
teraktiven Medien überhaupt eine solche Bedeutung erlangen konnten, liegt hauptsächlich
am technologischen Fortschritt, insbesondere der Durchbruch des Internets hat bei diesem
Prozess eine entscheidende Rolle gespielt. Gemäss The World Bank (ohne Datum) ist die
Zahl der weltweiten Internetnutzer von 6,77 % im Jahr 2000 auf 43,86 % im Jahr 2015 ge-
stiegen, was die Bedeutung der interaktiven Medien und die Nutzung des Internets unter-
streicht. In der Schweiz kommen die Zahlen zur Internetnutzung von der JAMES-Studie
von Gregor Waller, Isabel Willemse, Sarah Genner, Lilian Suter und Daniel Süss (2016), so
besitzen 97 % der Haushalte mit Jugendlichen einen Internetzugang (S.13). Nebst einem
Internetzugang besitzen nach Waller et al. (2016) 76 % der Jugendlichen einen eigenen
Computer und 41 % eine feste Spielkonsole (S.17). Auch die Bedeutung der Computer-
spiele hat stark zugenommen, wenn man die Nutzungszeiten genauer betrachtet. So hat
sich nach Rehbein die Nutzungszeit von Computerspielen bei 15-jährigen Jugendlichen
zwischen 2000 und 2007 mehr als verdoppelt und beträgt nun rund 56 Minuten bei den
Mädchen und 141 Minuten bei den Jungen (Rehbein, 2011; zit. in Rehbein & Mössle,
2012, S.392). Anhand dieser Nutzungszahlen wird die Bedeutung der interaktiven Medien
für unsere Gesellschaft deutlich.
Da die Medien wie erläutert in unserer Gesellschaft tief verankert sind, wachsen Jugend-
liche nach Daniel Süss und Eveline Hipeli (2010) heutzutage multimedial auf und wer-
den in den Medien als Generation @, Multimedia-Generation oder als Gamer-Generati-
on beschrieben (S.144). Die Medien sind im Alltag von Jugendlichen von zentraler
Bedeutung und ein wichtiges Element im Sozialisationsprozess (ebd.). Dies lässt sich
auch am Nutzungsverhalten der Jugendlichen verdeutlichen. So werden nach der
JAMES-Studie 2016 von Waller et al. (2016) von den medialen Freizeitaktivitäten das
Smartphone mit Abstand am meisten genutzt. Konkret heisst dies, dass 99 % der Schwei-
zer Jugendlichen ihr Handy täglich oder mehrmals pro Woche gebrauchen (S.22). Wenn
man weitere Kennzahlen der Mediennutzung von 12- bis 19-jährigen Jugendlichen ge-
nauer betrachtet, kann man erkennen, welch grosse Bedeutung die Medien in ihrem Le-
ben und ihrem Alltag haben (vergleiche Punkt 2.2).
Der Fokus dieser Bachelorarbeit liegt auf einem besonderen Teil der medialen Frei-
zeitaktivitäten nämlich den Computerspielen. Nach Waller et al. (2016) wird das Gamen
von 40 % der Schweizer Jugendlichen täglich oder mehrmals pro Woche betrieben (S.23).
Dabei scheint das Gamen bei männlichen Jugendlichen weit verbreitet zu sein, denn ge-
mäss der JAMES-Studie von Waller et al. (2016) beschäftigen sich 91% der männlichen
3Jugendlichen regelmässig mit Computerspielen (S.59). Wenn man nun aufgrund der Nut-
zungszahlen davon ausgeht, dass das Computerspielen zur Lebenswelt von männlichen
Jugendlichen gehört, braucht es bei der täglichen Arbeit mit Jugendlichen ein fachlich
grundiertes Wissen über Computerspiele. Dieses soll mit dieser Bachelorarbeit dargelegt
werden.
1.1 Hypothesen und Fragestellungen
Aus den bisherigen Erfahrungen des Autors wird die Hypothese aufgestellt, dass viele
Fachpersonen der Sozialen Arbeit, viele Lehrpersonen sowie weitere Fachpersonen in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und viele Eltern eine Unsicherheit im Umgang mit
Computerspielen aufweisen und ihnen der Umgang damit schwerfällt. Dies liegt insbeson-
dere daran, dass einerseits in den Medien zumeist ein negatives Bild von Computerspiele-
rinnen und Computerspielern gezeichnet wird, wie man an den sogenannten Killerspielen
sehen kann. Beispielhaft für diesen Diskurs in den Medien steht nach Peter Nauroth, Jens
Bender, Tobias Rothmund und Mario Gollwitzer (2014) die öffentliche Berichterstattung
nach den Gewalttaten an deutschen Schulen in Erfurt im Jahr 2002, Emsdetten im Jahr
2006 und Winnenden im Jahr 2009 und die Diskussion über die Folgen des Konsums von
gewalthaltigen Computerspielen (S.82). Andererseits vermutet der Autor, dass sich die
Fachpersonen der Sozialen Arbeit, die Lehrpersonen und die Eltern selber in der Welt der
Computerspiele nicht oder nur sehr selten bewegen und durch diese Unkenntnis der Com-
puterspiele eine Wissenslücke haben, welche Unsicherheiten auslösen kann. Den Grund
dafür sieht der Autor der Arbeit vor allem darin, dass viele Fachpersonen der Sozialen Ar-
beit, viele Lehrpersonen und viele Eltern als Digital Immigrants aufgewachsen sind und
nicht zur Generation Y gehören. Die Generation Y ist gemäss Wolfgang Appel (2013) die
Generation, welche von 1986 bis 2000 geboren wurde und mit der Informationstechnolo-
gie aufgewachsen ist (S.4). Im Gegensatz dazu steht die Generation der Digital Immigrants,
welche nach Appel (2013) «den Umgang mit modernen Techniken wie eine Fremdspra-
che» erlernen müssen (S.6). Deshalb haben die Digital Immigrants gegenüber der Genera-
tion Y einen grossen Nachteil im Umgang mit den interaktiven Medien. Dass wie vom
Autor vermutet ein Grossteil der Fachpersonen im Sozialbereich noch Digital Immigrants
sind, lässt sich auch mit einer Statistik über die Altersstruktur der Arbeitnehmer im Sozial-
bereich belegen. Denn nach Miriam Frey, Nils Braun und Philipp Waeber (2011) sind
66 % der Beschäftigten in Sozialberufen älter als 35 Jahre (S.10f). Damit können zwei
Drittel der Beschäftigten im Sozialsektor als Digital Immigrants bezeichnet werden, was
die Hypothese des Autors unterstreichen könnte.
Schliesslich stellt der Autor weiter die Hypothese auf, dass aufgrund dieser verschiedenen
Einflüsse das Thema der Computerspiele in der Ausbildung des Fachbereichs Sozialpäda-
gogik nur am Rande behandelt wird. Als Beispiel hierzu kann der Studienführer der Hoch-
schule Luzern (2017) beigezogen werden, in welchem es nur ein Wahlmodul zum Thema
Medien gibt, eine Blockwoche zu den Medienkompetenzen für die Soziale Arbeit (S.79).
Der Studienplan des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule
(2017) zeichnet ein ähnliches Bild, denn auch dort spielt das Thema Medien zumindest bei
den Modulbezeichnungen keine Rolle. Einzig gibt es gemäss der Berner Fachhochschule
(ohne Datum) ein Wahlmodul zur Sozialen Arbeit in der digitalen Gesellschaft, wobei dort
der Schwerpunkt aber eher auf der Kommunikation und den Social Media liegt. Deshalb
4geht der Autor davon aus, dass Computerspiele in diesem Modul nicht oder nur am Rande
behandelt werden, was die Hypothese bestätigen könnte. Allerdings ist bezüglich der Aus-
bildung auch zu sagen, dass sich die Forschung in den letzten Jahren gerade im Themen-
bereich der Computerspiele stark entwickelt hat, wie man an der Anzahl der Publikationen
zur Computerspielsucht sehen kann (siehe Abbildung 1). Dementsprechend könnten diese
Forschungen auch in naher Zukunft Einfluss auf die Ausbildung im pädagogischen Fach-
bereich haben.
Abbildung 1: Anzahl der Publikationen zur Computerspielsucht
(leicht modifiziert nach Rehbein & Mössle, 2012, S. 392)
Auf der Grundlage dieser Hypothesen möchte der Autor mit dieser Bachelorarbeit ein Teil
dazu beitragen, dass die Unsicherheit bei Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Um-
gang mit Computerspielen sinkt und Einfluss in der Ausbildung und in der Praxis findet. Der
Fokus dieser Bachelorarbeit liegt darum einerseits auf einem Überblick über Computer-
spiele und die Nutzung der Jugendlichen und andererseits auf einer Computerspielsucht und
deren Auswirkungen. Die Computerspielsucht ist in der Forschung aktuell ein grosses The-
ma, insbesondere seit der Revision des Diagnostic and statistical manual of mental deseases
[DSM-5] der American Psychiatric Association [APA], welche im Jahr 2013 die fünfte Edi-
tion herausgegeben hat. Denn in dieser Revision wurde gemäss Florian Rehbein, Thomas
Mössle, Nicolas Arnaud und Hans-Jürgen Rumpf (2013) die Computerspielabhängigkeit in
den Anhang des DSM-5 aufgenommen und im Sinne einer Forschungsdiagnose einheitliche
Diagnosekriterien vorgegeben (S.570). Dass die Bedeutung in der Forschung zur Computer-
spielsucht zugenommen hat, lässt sich, wie bereits erwähnt, auch an der Anzahl Publikatio-
nen zur Computerspielsucht sehen (siehe Abbildung 1).
Als Grundlage für diese Bachelorarbeit dient die folgende Fragestellung:
Was sind die Hintergründe und Auswirkungen der Computerspielsucht
von 12- bis 19-jährigen männlichen Jugendlichen?
Der Autor dieser Bachelorarbeit hat sich in der Fragestellung auf die männlichen Ju-
gendlichen fokussiert, weil Computerspiele vor allem von männlichen Jugendlichen
genutzt werden. Dies zeigt die bereits erwähnte JAMES-Studie von Waller et al. (2016),
5welche beschreibt, dass 91 % der männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren
in der Schweiz ab und zu oder regelmässig Computerspiele nutzen (S.59). Dementspre-
chend sind nach Florian Rehbein (2014) vor allem männliche Jugendliche gefährdet,
an einer Computerspielsucht zu erkranken, was auch den Fokus der Fragestellung be-
gründet.
Des Weiteren vermutet der Autor aufgrund seiner Praxiserfahrungen, dass in den sozialpä-
dagogischen Einrichtungen der Schweiz zu einem grösseren Teil männliche Kinder und
Jugendliche sind. In der Schweiz gibt es jedoch keine verlässlichen Zahlen zu den Ge-
schlechterverteilungen in den sozialpädagogischen Einrichtungen, lediglich zur Anzahl
der verschiedenen Fremdplatzierungen gibt es gemäss der Konferenz für Kindes- und Er-
wachsenenschutz [KOKES] (2015) Zahlen. Als Vergleich wurden darum die Zahlen des
statistischen Bundesamtes DSTATIS von Deutschland hinzugezogen. In der Statistik über
die Erzieherischen Hilfen / Beratungen des statistischen Bundesamtes DSTATIS (2015) er-
halten knapp 100 000 Kinder und Jugendliche eine Hilfe im Sinne der Heimerziehung. Da-
von sind 65 552 männliche Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 27 Jahren, und 33 362
weibliche Kinder und Jugendliche, was bedeutet, dass rund 66 % der Kinder und Jugendli-
chen in der Heimerziehung männlich sind (ebd.). Dies verdeutlicht, dass in der sozialpäd-
agogischen Praxis der Heimerziehung in Deutschland zu einem grösseren Teil mit männli-
chen Jugendlichen gearbeitet wird, und aufgrund dieser Zahlen vermutet der Autor für die
Schweiz eine ähnliche Geschlechterverteilung. Aus diesen Gründen fokussiert sich diese
Bachelorarbeit auf die männlichen Jugendlichen in der Schweiz, weil diese für die sozial-
pädagogische Praxis von besonderer Bedeutung sind.
Das Altersspektrum wurde in der Fragestellung so eingegrenzt, weil das Thema der Compu-
terspiele erst zwischen 12 und 19 Jahren von grösserer Bedeutung wird. In der MIKE-Studie
von Lilian Suter et al. (2015) gamen zwar 61 % der Kinder zwischen 6 und 13 Jahren einmal
oder mehrmals pro Woche (S.32). Da aber gemäss Suter et al. (2015) von den Kindern nur
15 % einen Computer oder einen Laptop und nur 9 % eine feste Spielkonsole im eigenen
Zimmer besitzen, kann davon ausgegangen werden, dass die Eltern bei der Nutzung von
Computerspielen eine grössere Kontrolle ausüben als bei Jugendlichen und darum die Nut-
zungszeiten noch vonseiten der Eltern bestimmt werden (S.26). Dies zeigt sich auch an den
Nutzungszeiten von Computerspielen. So spielen gemäss Suter et al. (2015) Kinder zwi-
schen 6 und 13 Jahren nach Angaben der Eltern durchschnittlich 24 Minuten pro Tag (S.35).
Wenn man dies mit den Zahlen der JAMES-Studie von Waller et al. (2016) vergleicht,
sieht man grosse Unterschiede: 76 % der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren besit-
zen einen eigenen Computer und 41 % der Jugendlichen eine eigene feste Spielkonsole
(S.17). Gleichzeitig spielen gemäss Waller et al. (2016) die Jugendlichen unter der Woche
im Mittelwert 81 Minuten pro Tag und am Wochenende 158 Minuten pro Tag (S.59). An
diesen Zahlen kann man erkennen, dass die Computerspiele für die Jugendlichen von grö-
sserer Bedeutung sind als noch im Kindesalter, weshalb der Autor die Fragestellung auf
dieses Alter begrenzt hat.
Bei dieser Altersspannweite ist zu beachten, dass die JAMES-Studie von Waller et al. (2016)
ergeben hat, dass die Wichtigkeit der Computerspiele mit zunehmendem Alter abnimmt,
so nutzen 57 % der 12- und 13-jährigen Jugendliche Computerspiele täglich oder mehr-
mals pro Woche, währenddem nur noch 27 % der 18- und 19-jährigen täglich oder mehr-
mals pro Woche gamen (S.23). Dementsprechend wird während diesem Alter der Grund-
stein für die spätere Mediennutzung der Jugendlichen gelegt und ist in Bezug auf Medien
6die prägendste und die wichtigste Zeit für die Jugendlichen. Dies könnte damit zusammen-
hängen, dass nach der obligatorischen Schulzeit für viele Jugendliche mit der Lehre oder
einer gymnasialen Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt beginnt und dadurch weniger
Zeit für mediale Freizeitaktivitäten vorhanden sind oder dass sich die Prioritäten verschie-
ben. Sicher ist jedoch, dass in der gewählten Altersspannweite in der Hauptfrage die Rele-
vanz von Computerspielen für männliche Jugendliche von grosser Bedeutung ist.
Aufgrund der Hauptfragestellung haben sich verschiedene Unterfragen ergeben, die in die-
ser Bachelorarbeit ebenfalls beantwortet werden sollen. Diese sollen einerseits dazu die-
nen, dass die Leserin und der Leser ein Verständnis von Computerspielen und einer Com-
puterspielsucht erhält, und andererseits, dass die Grundlagen für die Beantwortung der
Hauptfragestellung geliefert werden können:
Was sind Computerspiele? Von wem werden sie gespielt und aus welchen Gründen?
Wie definiert sich eine Computerspielsucht?
Was sind mögliche Auswirkungen einer Computerspielsucht auf 12- bis 19-jährige
männliche Jugendliche?
Was bedeuten die Erkenntnisse aus der Bachelorarbeit für die Praxis der
Sozialpädagogik?
1.2 Zielsetzung
Diese Bachelorarbeit verfolgt zwei Ziele. Auf der einen Seite soll diese Arbeit einen Ge-
samtüberblick über Computerspiele und die Nutzung durch Jugendliche liefern. Damit soll die
Unsicherheit der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gemäss der Hypothese des Autors
vermindert werden, indem ein fachliches Grundwissen geliefert wird. Auf der anderen Seite
soll ein spezifischer Blick in ein schlecht überschaubares und einem starken Wandel unterwor-
fenes Feld der Computerspielsucht ermöglicht werden. Dabei wird der aktuelle Forschungs-
stand miteinbezogen und die Auswirkungen einer Computerspielsucht werden beleuchtet. Das
Ziel dieser Bachelorarbeit ist darum, in Anbindung an die Fragestellung, aufzuzeigen,
· … was Computerspiele sind und von wem sie genutzt werden,
· … was eine Computerspielsucht ist und was für Auswirkungen sie hat,
· und welche Bedeutung die gewonnenen Erkenntnisse für die Praxis
der Sozialpädagogik haben.
Dabei ist stets zu beachten, dass sich das Forschungsfeld der Nutzung von Computerspielen
und der Computerspielsucht stetig weiterentwickelt und ausdifferenziert. Vor allem im Be-
reich der Auswirkungen von Computerspielen wird aufgrund der neuen Version des DSM-5
der American Psychiatric Association (2013) momentan stark geforscht. Zudem kommt
dazu, dass sich das Feld der Computerspiele sehr schnell verändert, da die Innovationskraft
in diesem Bereich sehr gross ist. Aus diesen Gründen ist diese Bachelorarbeit nur eine mo-
mentane Bestandsaufnahme des Wissensstandes und dementsprechend in einigen Jahren
von neueren Forschungen überholt.
71.3 Berufsrelevanz und AdressatInnen
Da wie bereits unter Punkt 1.1 genauer erläutert, viele Kinder und Jugendliche in sozialpä-
dagogischen Heimen männliche Jugendliche sind und das Computerspielen zur Lebens-
welt von männlichen Jugendlichen in diesem Alter gehört, ist das Thema der Computer-
spiele für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, welche in ihrem sozialpädagogischen
Alltag mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, von grosser Bedeutung. Wenn man nach
Uwe Uhlendorff (2012) das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit beherzigt,
sollten sich Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ein Bild der Lebenswelt der Klien-
tinnen und Klienten und dieser Deutungen der Lebenswelten machen (S.710). Dies bedeu-
tet, dass man ein fachliches Grundwissen über die Computerspiele haben sollte, um mit
männlichen Jugendlichen lebensweltorientiert arbeiten zu können.
Die Adressatinnen und Adressaten dieser Bachelorarbeit sind damit einerseits Fachperso-
nen, welche mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und sich über die Thematik der Com-
puterspiele ein Fachwissen aneignen möchten. Dies umfasst sowohl Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen als auch weitere Fachpersonen wie beispielsweise Schulsozial-
arbeitende oder Lehrpersonen. Andererseits richtet sich diese Bachelorarbeit aber auch an
die Ausbildungsinstitutionen und Praxisorganisationen von pädagogischen Fachpersonen,
weil sie unter anderem auch für das fachliche Grundlagenwissen über verschiedene The-
men in Aus- und Weiterbildung verantwortlich sind und dieses weitervermitteln. Dabei
ist zu bedenken, dass nicht alle Praxisorganisationen und alle Ausbildungsinstitutionen
gleich angesprochen sind, da das Praxisfeld der Sozialpädagogik und insbesondere der
Sozialen Arbeit ausgesprochen heterogen ist. Wenn man die Arbeitsfelder der Sozialen
Arbeit von Gregor Husi und Simone Villiger (2012) beizieht, kann man sehen, dass be-
reits im Feld der Sozialpädagogik bspw. sozialpädagogische Institutionen mit Menschen
mit einer Beeinträchtigung nicht gleich angesprochen sind wie das Arbeitsfeld der
Heimerziehung, in welchem man als Fachperson täglich mit Kindern und Jugendlichen
zu tun hat (S.46).
Da die Medien heutzutage ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft geworden sind
und möglicherweise unseren Alltag sogar noch weiter verändern werden, muss sich die
Profession der Sozialen Arbeit mit diesen Veränderungen beschäftigen. Insbesondere die
Fachpersonen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, welche als zentrale Aufgabe
die Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen haben, brauchen für eine
lebensweltorientierte ein Grundwissen über Computerspiele und über weitere elektroni-
sche Medien. Aus diesen Gründen erachtet der Autor der Bachelorarbeit das Thema der
Computerspielsucht als Relevant für die Praxis der Sozialpädagogik.
1.4 Aufbau der Arbeit
In dieser Arbeit werden in Kapitel zwei und drei die relevanten Punkte zur Beantwortung
der Fragestellung aufgeführt.
Kapitel zwei soll dabei das Grundwissen über Computerspiele an sich liefern. Dies bein-
haltet eine wissenschaftliche Definition von Computerspielen sowie eine Beschreibung
der Nutzerinnen und Nutzer von Computerspielen mit Fokus auf 12- bis 19-jährige Ju-
gendliche. Anschliessend wird die Bedeutung der Computerspiele als Teil der heutigen
Kultur beleuchtet. Um den Leserinnen und Lesern einen tieferen Einblick in das Themen-
8feld der Computerspiele zu ermöglichen, werden jugendschutzrelevante Bemühungen und
die verschiedenen Spielgenres dargelegt. Zum Schluss des Kapitels wird anhand von
Funktion und Motivation erläutert, warum überhaupt Computerspiele gespielt werden.
Kapitel drei dient zur Wissenserweiterung über die Computerspielsucht. Dabei werden
Diagnosekriterien beschrieben und insbesondere das Suchtkonzept steht im Vordergrund.
Zudem werden Hintergründe zur Entstehung der Computerspielsucht unter den Aspekten
der Neurobiologie, der Lernpsychologie, der systemischen Sicht und auf Basis von DSM-5
dargelegt. Zum Abschluss werden die Prävalenz von Computerspielsucht sowie die perso-
nenbezogenen, spielbezogenen und sozialisationsbezogenen Risikofaktoren diskutiert.
Das Ziel des vierten Kapitels ist es die Auswirkungen der Computerspielsucht gemäss dem
aktuellsten Forschungsstand zu erläutern. Der Fokus liegt dabei gemäss der Fragestellung
dieser Bachelorarbeit auf den jugendlichen Betroffenen. Es werden die sozialen Auswir-
kungen im Umfeld, die Auswirkungen auf die intellektuelle Leistunngsfähigkeit und die
gesundheitlichen Auswirkungen diskutiert.
Kapitel fünf zeigt die Bedeutung dieser Bachelorarbeit für die Praxis. Computerspielsucht
bildet ein wesentlicher Bestandteil von männlichen Jugendlichen und muss ausgehend von
der Lebensweltorientierung auch in Aus- und Weiterbildung der Sozialen Arbeit mehr Ge-
wicht erlangen, damit Unsicherheiten beseitigt werden können. Zur Prävention von Com-
puterspielsucht sollten Kinder und Jugendliche zudem eine gute Ausbildung in Medien-
kompetenz erhalten. Das Fazit liefert eine zusammenfassende Beantwortung der
Fragestellung. Im Ausblick wird die zunehmende Digitalisierung angesprochen.
92 Kapitel 2
Computerspiel
Das folgende Kapitel soll das Grundwissen über Computerspiele liefern. Ausgehend von
verschiedenen Definitionen wird der Bereich der Computerspiele erhellt. Zudem werden
die relevanten Aspekte von Computerspielen dargelegt. Darunter fallen sowohl die Nut-
zung von Computerspielen und das Computerspiel als Teil der Kultur als auch die Situati-
on des Jugendschutzes und die Darlegung der diversen Spielgenres. Zudem sind die Funk-
tionen und Motive der Computerspielnutzung und die Chancen und Herausforderungen
des Gamens von zentraler Bedeutung.
2.1 Definition Computerspiel
Computerspiele sind nach Friedrich Krotz (2009) «Spiele mit dem Computer», wobei der
Computer sowohl die Spielumgebung als auch den Gegner des Spiels simuliert (S.27). Bei
dieser simplen Definition von Krotz stellt sich die Frage, was dabei genau als Computer ver-
standen wird. Denn im normalen Sprachgebrauch versteht man unter einem Computer einen
Personal Computer oder abgekürzt auch PC. Ein Personal Computer wird nach der Brock-
haus Enzyklopädie Online (2017b) als «einen leistungsfähigen Einzelplatzrechner, der indi-
viduell konfiguriert und erweitert werden kann und dessen Einsatzgebiet nicht auf spezielle
Aufgaben eingeschränkt ist», definiert. Ein Personal Computer ist ein modulares Komplett-
system, welches vor allem für den Heim- und Bürogebrauch verwendet wird (ebd.). Als Vi-
sualisierung eines Personal Computers dient die Abbildung 2.
Abbildung 2: Veranschaulichung eines Personal Computers der Marke HP
(HP, ohne Datum)
In der Definition von Krotz ist der Begriff Computer im wissenschaftlichen Sprachgebrauch
und damit als umfassender zu verstehen. Die Brockhaus Enzyklopädie Online (2017a) defi-
niert einen Computer als eine «elektronisch arbeitende Einrichtung, die Probleme dadurch
löst, dass sie Daten nach einem vorgegebenen Algorithmus beziehungsweise Programm ver-
arbeitet». Der Computer setzt sich aus der Hardware zusammen, welche alle technischen
und realen Komponenten beinhaltet und die Probleme durch diese Hardware löst. Dazu ge-
10hören alle Bauteile, die im Inneren auf elektronische oder mechanische Impulse reagieren
(Brockhaus Enzyklopädie Online, 2017a). Dies bedeutet, dass nebst einem PC auch weitere
elektronische Geräte wie bspw. ein Smartphone, eine Spielkonsole oder auch der Boardcom-
puter eines Flugzeugs zur Kategorie des Computers gezählt werden und damit der Begriff
Computer umfassender als im normalen Sprachgebrauch zu verstehen ist.
Nachdem Krotz (2009) die Computerspiele als «Spiel mit dem Computer» definiert, benötigt
es für eine Definition nun noch eine Definition des Spiels (S.27). Die geläufigste wissen-
schaftliche Definition stammt von John Huizinga (2009), welcher den Begriff «Spiel» wie
folgt definiert:
Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festge-
setzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt
bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von ei-
nem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des «Anderssein» als
das gewöhnliche Leben. (S.37)
Diese Definition ergänzt Herbert Goetze (2002), indem er verschiedene übergreifende
Merkmale, welche sich bei einem Spiel beobachten lassen, definiert (S.17). Diese sind
folgende:
· Positiver Affekt, Freude
· Freiwilligkeit, Selbstkontrolle, intrinsische Motivation
· Aktivität, Engagement
· Flexibilität, Variation
· Prozessorientierung
· Quasi-Realität
Der Begriff Spiel lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung nicht vollständig und
abschliessend definieren, weil stets kulturelle und historische Einflüsse auf den Begriff Spiel
sowie die Definition von Spiel einwirken (Krotz, 2009, S.27). Als Beispiel für eine unter-
schiedliche Bedeutung des Worts Spielen kann die englische Sprache beigezogen werden, in
welcher das Wort «play» nicht dasselbe wie das Wort «game» bedeutet, obwohl es in der
deutschen Übersetzung beides Spiel bedeutet (Krotz, 2009, S.27f). Hans Mogel (2008) un-
terscheidet die Spiele in unterschiedliche Spielformen, welche von Menschen gespielt wer-
den (S.137). Diese sind aufeinander aufbauend und von ihm folgend benannt (ebd.):
1. Funktionsspiel
2. Experimentierspiel
3. Frühes Symbolspiel
4. Konstruktionsspiel
5. Ausdifferenziertes Symbol- und Rollenspiel
6. Regelspiel
Trotz dieser nicht abschliessenden Definition reicht die obige von Huizinga in Ergänzung
mit den Merkmalen von Goetze und den Spielformen von Mogel aus, um sich darüber ei-
nig zu werden, was als Spiel bezeichnet werden kann und was nicht.
11Allerdings gilt es weiter zu beachten, dass sich sprachliche Ungenauigkeit bezüglich des Be-
griffs Computer auch im allgemeinen Sprachgebrauch für den Gebrauch des Worts Compu-
terspiel wiederfinden lässt. Man versteht normalerweise unter einem Computerspiel eine
Software, welche auf einem Personal Computer läuft und spielerische Inhalte aufweist. Im
Gegensatz dazu bezeichnet man Software, welche auf Spielkonsolen wie der Xbox One oder
der Playstation 4 installiert werden. Im normalen Sprachgebrauch als Videospiele. Dies wi-
derspiegelt auch die Definition des Duden (ohne Datum, a), welche Computerspiele als
«Spiel, das mithilfe eines an einen Personal Computer angeschlossenen Monitors, der als
Spielfeld, -brett dient, gespielt werden kann» definiert. In der englischen Sprache gibt es die-
se Begriffsunschärfe nicht. Der English Oxford Dictionary (ohne Datum, b) definiert
video game als «a game played by electronically manipulating images produced by a compu-
ter program on a monitor or other display». Nebst dem Begriff video game gibt es auch den
Begriff des computer game, welche nach dem English Oxford Dictionary (ohne Datum, a)
soviel bedeutet wie «a game played using a computer, typically a video game». Damit um-
fassen diese beiden Begriffe im Englischen die wissenschaftliche Definition des deutschen
Worts Computerspiele und können als Synonyme verwendet werden.
Eine weitere Definition des Begriffs Computerspiels stammt von Christoph Klimmt (2004),
welcher Computerspiele als «interaktive Medienangebote, die zum Zweck der Unterhaltung
hergestellt und genutzt werden», definiert (S.696). Gemäss dieser Definition fallen alle elek-
tronischen Spiele, welche interaktiv genutzt werden unter den Begriff Computerspiel. Dem-
entsprechend beinhaltet der wissenschaftliche Begriff des Computerspiels im Gegensatz
zum alltäglichen Sprachgebrauch auch Videospiele. Trotzdem gilt es zu berücksichtigen,
dass es im Fachdiskurs viele verschiedene Synonyme für Computerspiele gibt und dadurch
Missverständnisse entstehen können. Diese sind, um nur einige Beispiele zu nennen, interak-
tive Unterhaltungssoftware, Games oder elektronische Spiele. In dieser Bachelorarbeit wird
der Begriff Computerspiel im Sinne der wissenschaftlichen Definition verwendet und
schliesst damit nebst dem Computerspiel im alltäglichen Sprachgebrauch auch die Video-
spiele und die Smartphonespiele ein, sofern nicht explizit etwas anderes erwähnt wird. Die
weiteren Synonyme, die in dieser Arbeit für Computerspiele verwendet werden, sind eben-
falls im wissenschaftlichen Sprachgebrauch der Computerspiele zu verstehen.
Jürgen Fritz (2011) hat ebenfalls ein breites Verständnis von Computerspielen (S.15). Er ver-
steht darunter nebst der Software, die der eigentliche Spielinhalt ist, auch die Hardware und
immer häufiger auch ein Netzwerk, sowohl lokal als auch online. Auf Grundlage dieser rea-
len Gegenstände simuliert der Computer einen virtuellen Raum, die virtuelle Spielwelt. Die-
ser virtuelle Raum ist nicht «den Zwängen, Gesetzen, Regeln und Notwendigkeiten der rea-
len Welt unterworfen» (ebd.). Die virtuelle Spielwelt bietet schliesslich den Raum für
Spielprozesse. Damit wird sogleich klar, dass es für Computerspiele immer eine Spielerin
oder einen Spieler braucht, da es ohne aktive Beteiligung einer Spielerin oder eines Spielers
zu keinem Spielprozess kommt. Dementsprechend ist sein Verständnis von Computerspielen
fokussiert auf den Spielprozess, welcher als zentrales Merkmal von Spielen gesehen wird
(ebd.).
2.2 Computerspielnutzung von Jugendlichen
In der JAMES-Studie von Waller et al. (2016) wurde eine repräsentative Erhebung des Me-
dienverhaltens von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in der Schweiz durchgeführt
12und ausgewertet (S.2). Im Folgenden wird die Mediennutzung von 12- bis 19-jährigen Ju-
gendlichen in der Schweiz behandelt. Im Fokus stehen dabei gemäss der Hauptfragestel-
lung die männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, es werden aber zu Ver-
gleichszwecken auch die weiblichen Jugendlichen beigezogen.
Um die Nutzung der elektronischen Medien besser einordnen zu können, hat die
JAMES-Studie 2016 nebst den medialen Freizeitaktivitäten auch die Freizeitaktivitäten
der Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ohne Medien erhoben. Dabei ist
zu beobachten, dass gemäss Waller et al. (2016) die häufigsten nonmedialen Freizeitbe-
schäftigungen seit einigen Jahren konstant blieben (S.10). Die meistgenannten Aktivitä-
ten von den Jugendlichen, welche täglich oder mehrmals pro Woche ausgeübt werden,
waren Freunde treffen (79 %), Sport treiben (66 %) und ausruhen und nichts tun (58 %)
(ebd.). Als Veranschaulichung von allen Freizeitaktivitäten, welche von Schweizer Ju-
gendlichen täglich oder mehrmals pro Woche genutzt werden, dient Abbildung 3.
Freizeitaktivitäten der Schweizer Jugendlichen
zwischen 12 und 19 Jahren
Prozentangaben: Täglich / mehrmals pro Woche
Abbildung 3: Freizeitaktivitäten der Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren
(eigene Darstellung auf der Basis von Waller et al., 2016, S.10)
In der Schweiz ist gemäss Waller et al. (2016) bei den medialen Freizeitbeschäftigungen von
männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren das Computerspielen bereits die fünft-
häufigste Beschäftigung nach der Handynutzung, der Internetnutzung, dem Musikhören und
dem Fernsehen, welche täglich oder mehrmals pro Woche ausgeübt werden (S.24). Dabei
spielen von den 12- bis 19-jährigen männlichen Jugendlichen 64 % täglich oder mehrmals
pro Woche Games (ebd.). Das bedeutet, dass Computerspiele für die Jugendlichen ähnlich
wichtig sind wie das Sport treiben. Bezüglich der Geschlechterrolle gibt es einen grossen und
relevanten Unterschied der Nutzung von Computerspielen, die Anzahl der männlichen Gamer
ist rund fünfmal grösser als die Anzahl Mädchen, welche täglich oder mehrmals pro Woche
Computerspiele nutzen (ebd.). Wenn man die Zahlen betrachtet, bei welchen die Jugendli-
chen nur ab und zu gamen, ist der Unterschied nicht mehr ganz so gross. Von den weiblichen
13Jugendlichen spielen 42 % ab und zu, während sich bei den männlichen Jugendlichen der un-
regelmässige Computerspielkonsum auf 91 % beläuft (Waller et al., 2016, S. 59). Der Unter-
schied bleibt also dennoch signifikant (ebd.).
Damit geklärt werden kann, ob und mit welcher Hardware die Medien genutzt werden, hat
die JAMES-Studie von Waller et al. die Geräteverfügbarkeit der Jugendlichen zwischen
12 und 19 Jahren erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass 99 % der Jugendlichen gemäss Waller
et al. (2016) ein eigenes Handy und 45 % eine eigene portable Spielkonsole wie bspw. einen
Nintendo DS oder eine Playstation Portable besitzen (S.17). Weiter sind 76 % der Jugendli-
chen in der Schweiz in Besitz eines Computers und 41 % verfügen über eine feste Spielkon-
sole (ebd.). Dies hat auch Einfluss auf das Nutzungsverhalten, denn ist man im Besitz eines
eigenen Geräts, kann dieses auch eigenständig und frei genutzt werden (Waller et al., 2016,
S.16). Wenn man zusätzlich die Prozentzahlen betrachtet, welche für Geräte in einem Haus-
halt mit Jugendlichen vorhanden sind, kommt man auf noch höhere Prozentzahlen. So besit-
zen gemäss Waller et al. (2016) 100 % der Haushalte ein Handy, 99 % einen Computer und
78 % eine feste Spielkonsole (S.13). Auf all diesen Geräten ist es möglich, Computerspiele zu
spielen, weshalb man davon ausgehen kann, dass so gut wie alle Jugendlichen Zugang zu
Computerspielen haben, egal auf welchem Medium sie gespielt werden.
Wenn man die Nutzung von Games generell betrachtet, sieht man eine weitere Auffälligkeit.
Die Nutzung der Computerspiele nimmt gemäss Waller et al. (2016) ab, je älter die weibli-
chen sowie männlichen Jugendlichen werden. Von den 12- und 13-jährigen Jugendlichen nut-
zen 57 % die Computerspiele täglich oder mehrmals pro Woche, während nur noch rund 27 %
der 18- und 19-jährigen Jugendlichen täglich oder mehrmals pro Woche Computerspiele nut-
zen (S.23). Bezüglich den Landesteilen der Schweiz, dem sozioökonomischem Status, der
Herkunft, dem Schultyp und dem Wohnort gibt es beim Prozentanteil der Gamerinnen und
Gamer, welche zumindest ab und zu gamen, keinen relevanten Unterschied (Waller et al.,
2016, S. 59). Die Nutzungszeit der Jugendlichen beträgt unter der Woche durchschnittlich
(Median) eine Stunde pro Tag, während am Wochenende rund zwei Stunden gespielt wird
(ebd.). Auch hier ist ein starker Geschlechterunterschied zu finden, wobei die Jungen signifi-
kant länger spielen als die Mädchen (ebd.). Diese Zahl der Nutzungszeit ist mit Vorsicht zu
geniessen, da die Jugendlichen ihre Zeiten im Rückblick selbst eingeschätzt haben und es da-
durch nicht zu den tatsächlichen Zeitangaben gekommen sein könnte (ebd.).
Einen weiteren grossen Geschlechterunterschied gibt es bei den verschiedenen Nutzungsfor-
men von Computerspielen. Gemäss Waller et al. (2016) spielen männliche Jugendliche rund
doppelt so häufig täglich oder mehrmals pro Woche wie weibliche Jugendliche alleine oder
mit anderen Personen im selben Raum (S.60). Noch grösser fällt der Unterschied beim On-
linespielen mit anderen Menschen aus, von den Mädchen spielen nur 7 % mit anderen online,
während dies bei den Jungen 58 % täglich oder mehrmals pro Woche der Fall ist (ebd.). Dies
lässt sich auch damit begründen, dass bereits die Prozentzahl der spielenden Mädchen gerin-
ger ist.
Des Weiteren wurden auch nach den Lieblingsgames der Schweizer Jugendlichen gefragt.
Die Lieblingscomputerspiele der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren sind die FIFA-Rei-
he, gefolgt von der Call of Duty Spielserie und der Grand Theft Auto [GTA] Spielreihe (siehe
Abbildung 4). Auf der Abbildung 4 ist die Nennung eines Wortes durch die Stichprobe umso
häufiger, je grösser ein Wort geschrieben ist, um die Nennungen bildlich zu veranschaulichen.
Ein Grossteil dieser Spieltitel lässt sich auch unter Punkt 2.5 wiederfinden, wo die Games den
jeweiligen Spielgenres zugeteilt wurden.
14Abbildung 4: Lieblingscomputerspiele der Schweizer Jugendlichen 2016
(JAMES, 2016, S. 61)
2.3 Computerspiele als Teil der Kultur
Nach Winfred Kaminski (2010) gehören Spiele zur Kultur (S.36). Demzufolge würden
auch Computerspiele zur Kultur gehören, wenn man gemäss Definition von Krotz (2009)
davon ausgeht, dass Computerspiele Spiele mit dem Computer sind (S.27). Ob Compu-
terspiele aber tatsächlich zur Kultur gehören, ist offen, denn in den Medien werden
Computerspiele oft als wertlos und als sinnloser Zeitvertreib dargestellt (Kaminski,
2010, S.37). Aus diesem Grunde werden nach Kaminski (2010) elektronische Spiele von
älteren Menschen auch oft abgelehnt und nicht als Kultur akzeptiert, obwohl sie bei jün-
geren Spielerinnen und Spieler bereits seit einiger Zeit akzeptiert sind (S.36). Die Frage,
was für eine Gesellschaft bedeutsam ist und was nicht, kann nicht abschliessend geklärt
werden, da dies immer eine individuelle Perspektive voraussetzt. Jedoch wird im Fol-
genden anhand verschiedener Merkmale versucht zu erläutern, warum Computerspiele
heute zur Kultur gehören.
Wie in Kapitel 1 beschrieben, hat die Wichtigkeit der Medien und insbesondere der
Computerspiele in den letzten Jahren stetig zugenommen. Aufgrund verschiedener Ent-
wicklungen wie beispielsweise dem technologischen Fortschritt verändert sich der Me-
dienkonsum der Menschen ständig und wird sich noch stärker verändern, wenn man
beispielsweise die Entwicklung von Virtual Reality betrachtet. Die Nutzung von Medien
ist für Menschen der heutigen Zeit alltäglich geworden, jedoch unterscheidet sich die
individuelle Nutzung und Präferenzen der Personen sehr stark. Die einen lesen regel-
mässig Zeitung auf ihrem Smartphone, die anderen nutzen häufig Computerspiele. Vor
allem männliche Jugendliche nutzen die Computerspiele regelmässig, wie die
15JAMES-Studie 2016 zeigt. Wenn man diese wichtigsten Kennzahlen zur Nutzung ge-
nauer betrachtet, kann man die Wichtigkeit der Computerspiele für die Lebenswelt der
männlichen Jugendlichen herauslesen (vergleiche Punkt 2.2). Wenn man davon ausgeht,
dass etwas zur Kultur gehört, weil es gemäss der lateinischen Wortherkunft cultivare
gepflegt wird, sollten gemäss den Nutzerzahlen elektronische Spiele als Kultur gelten.
Insbesondere aus dieser Perspektive sind Computerspiele Teil der männlichen Jugend-
kultur, weil sie nach Kaminski (2010) zur Freizeitkultur und zur Unterhaltungskultur
gehören, da sie von den meisten Jugendlichen genutzt werden (S.37).
Dass die Computerspiele für eine Vielzahl von Menschen von Bedeutung sind und damit
auch als Kultur angesehen werden können, lässt sich an den Umsatzzahlen der Compu-
terspielbranche erkennen. In der Schweiz setzte die Gameindustrie gemäss PWC (ohne
Datum) im Jahr 2016 rund 415 Millionen Franken um. Während demselben Zeitraum
hat die Filmindustrie gemäss PWC (ohne Datum) einen Umsatz von 575 Millionen
Franken erwirtschaftet, um einen Vergleich mit einer anderen Medienindustrie aufzuzei-
gen. Wenn man diese Zahl mit einem anderen europäischen Land vergleicht, das der
Schweiz ähnlich ist, kann man Schweden herbeiziehen, welches eine ähnliche Bevölke-
rungszahl und ein ähnliches Wohlstandniveau hat. Die Gameindustrie hat in Schweden
im Jahr 2016 gemäss Newzoo (2016) rund 360 Millionen Franken umgesetzt. Wenn man
diese beiden Länder miteinander vergleicht, wird ersichtlich, dass die Gameindustrie in
der Schweiz einen höheren Umsatz generiert hat, was darauf hindeuten könnte, dass die
Computerspiele in der Schweiz eine wichtige Bedeutung haben. Für den weltweiten
Markt hingegen ist die Schweiz hingegen kaum relevant, so betrug der globale Umsatz
der Gameindustrie im Jahr 2016 gemäss Newzoo (2017a) rund 98 Milliarden Franken.
Bereits anhand dieser verschiedenen Zahlen kann man die Wichtigkeit der Gameindust-
rie erahnen, welche gemäss der Studie von Newzoo (2017a) zu den Umsatzzahlen wei-
ter zunehmen wird.
Am Beispiel der Zuschauerzahlen von eSports-Wettkämpfen lässt sich ebenfalls die
Wichtigkeit von Computerspielen erkennen. Gemäss Newzoo (2017b) verfolgten welt-
weit im Jahr 2016 rund 322 Millionen Zuschauer jegliche Arten von eSports (S.17). Für
das Jahr 2020 rechnet Newzoo mit Zuschauerzahlen im Bereich von 589 Millionen, was
im Verhältnis zu 2016 eine Steigerung um 83 % bedeutet (ebd.). Dieses Wachstum des
eSports lässt erkennen, dass auch hier ein Wandel in der Gesellschaft stattfindet und die
Computerspiele als Kulturgut gelten.
Es gibt auch Bestrebungen, dass Computerspiele als offizielles Kulturgut anerkannt wer-
den. In Deutschland beispielsweise wurde gemäss Thomas Schwietring (2013) bereits
der Bundesverband der Entwickler von Computerspielen als Mitglied in den deutschen
Kulturrat aufgenommen und wurde damit ein erster Schritt in die Richtung gemacht,
dass Computerspiele offiziell als Kultur anerkannt werden (S.28).
Auch Jürgen Fritz (2010) bezeichnet Computerspiele als einen wesentlichen Bestandteil
der Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen (S.269). Er begründet dies mit
verschiedenen Studien von Deutschland zur Häufigkeit der Nutzung von Computerspie-
len, der KIM-Studie 2006 und der JIM-Studie 2006. Diese beiden Studien sind die deut-
sche Version der JAMES-Studie der Schweiz.
Aus diesen Punkten lässt sich erschliessen, dass die Computerspiele mit ihrer mittler-
weile über 50-jährigen Geschichte zur Kultur gehören, auch wenn diese Aussage nicht
von allen Personen geteilt wird.
16Sie können auch lesen