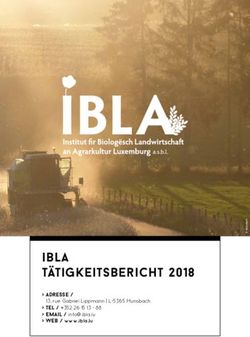Der Action Plan Nordrhein-Westfalen - UrbanLinks 2 Landscape (UL2L) Unlocking the resources and adaptive capacities of urban landscapes for ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Action Plan Nordrhein-Westfalen
UrbanLinks 2 Landscape (UL2L)
Unlocking the resources and adaptive capacities of
urban landscapes for sustainable growth by inserting
new forms of active land use and ecosystem servicesProject title: Unlocking the resources and adaptive capacities of urban land-
scapes for sustainable growth by inserting new forms of active
land use and ecosystem services
Project acronym: UrbanLinks 2 Landscape (UL2L)
Index Number: PGI04846
Topic: Environment and resource efficiency
Specific objective: 4.1 Improving natural and cultural heritage policies
Partner organisation: Rhineland Regional Council
Country: Germany
NUTS 1: Nordrhein-Westfalen
NUTS 2: LVR Köln
Contact: Roswitha Arnold
Mail: Roswitha.Arnold@lvr.de
Phone: +49-221-8093586
Action Plan submitted: May 31, 2020
Signature
vorgelegt am 31. Mai 2020
Autor*innen:
Roswitha Arnold
Dominik Biergans
Katrin Prost
Landschaftsverband Rheinland
2Präambel Inhaltsverzeichnis
Der hier vorgelegte Action Plan des LVR-Pro- 1. Kurzübersicht UL2L 4
jektes „UrbanLinks 2 Landscape“ – UL2L wurde
im Zeitraum von Oktober 2019 bis April 2020 2. From Plan to Action 5
in mehreren Sitzungen von den Stakeholdern 2.1 Thematischer Hintergrund 5
des LVR begleitet und erarbeitet. und Projektziele
2.2 Angesprochene Förderstruktur 6
In der Sitzung am 13.05.2020 haben die Stake- 2.3 Projektphase 1: 7
holder die nun vorgelegte Fassung des Action der Weg zum Action Plan
Plans mit den ausgewählten Maßnahmen für 2.3.1 Internationale Kooperation, 7
die Projektphase 2 einstimmig verabschiedet. interregionales Lernen und
Good Practices
Ebenso wurde der Action Plan den Mitgliedern 2.3.2 Zusammenarbeit mit den 13
der „Kommission Europa“ in ihrer Sitzung am Stakeholdern
20.05.2020 zur Beratung vorgelegt. Die politi-
sche Vertretung unterstützt die Vorhaben des 3. Der Action Plan 15
Action Plans vollumfänglich und hat der Vorla- 3.1 Inhaltliche Gestaltung und 15
ge einstimmig zugestimmt. Auswertung der Experteninterviews
3.2 Die Maßnahmen 19
3.2.1 Workshop Landschaftspark 21
Mönchengladbach-Wanlo: Eingang
zum Grünen Band Garzweiler
3.2.2 Inklusiver Fuß- und Radweg in 25
Klimalandschaft: Reallabor zwischen
Schloss Dyck und Jüchen-Süd
3.2.3 Parkpflegeseminar: 28
Gemeinsames Gärtnern im Park
3.2.4 Planer*innenworkshop: 32
Neue Perspektiven für alte Kulturland-
schaften – Integration historischer Kultur-
landschaft in aktuelle Planungen
4. Das gelernte Umsetzen: 35
Ausblick auf die zweite Projektphase
31. Kurzübersicht UL2L Am Projekt sind folgende internationale Partner
beteiligt:
Der Nutzungsdruck auf freie Flächen und
Brachflächen ist durch eine stetig steigende • Landschaftsverband Rheinland
Flächennachfrage gerade in den Städten und (Deutschland, Lead Partner)
den stadtnahen Bereichen ein Faktor, der zur
Konkurrenz zwischen verschiedenen Arten der • Surrey County Council (England)
Nutzung des Raums führt. So konkurrieren
Ansprüche aus den Bereichen Wohnungsbau • Silesia Park (Polen)
und Infrastruktur, der Land- und Energiewirt-
schaft oder dem Natur- und Umweltschutz um • Umbria Regional Authority (Italien)
diese Flächen. Gleichzeitig wachsen die Anfor-
derungen an Flächen, denn durch den hohen • Kristianstad Municipality (Schweden)
Nutzungsdruck müssen sie multifunktionale
Alleskönner darstellen. Dies gilt sowohl für ur- • Kuldiga District Municipality (Lettland)
bane und rurale Flächen, im Besonderen aber
auch für Flächen in den Übergangsbereichen • Stiftung Schloss Dyck (Deutschland).
zwischen Stadt und Land. Das Projekt Urban-
Links 2 Landscape (UL2L) widmet sich dieser Der Landschaftsverband Rheinland ist neben
Freiflächenentwicklung und den Fragestel- seiner Funktion als Lead Partner mit einem
lungen rund um die Gestaltung der Flächen eigenen Teilprojekt beteiligt.
unter Berücksichtigung ihrer ökonomischen,
sozialen und ökologischen Funktionen sowie Die Laufzeit des Projekts beträgt vier Jahre und
der Einbindung lokaler Akteure. Das Projekt ist in zwei Projektphasen eingeteilt. Die erste
adressiert weiterhin die Förderstruktur EFRE. Projektphase vom 01. Juni 2018 bis 31. Mai 2020
NRW „Wachstum und Beschäftigung“ 2014- hat sich dem interregionalen Lernen und der
2020, finanziert aus dem Europäischen Fond Erstellung des vorliegenden Action Plans gewid-
für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie vom met. Die zweite Projektphase vom 01. Juni 2020
Land NRW, um erarbeitet Impulse und Vor- bis 31. Mai 2022 ist für die Implementation der
schläge für eine künftige Förderstruktur und Maßnahmen des Action Plans vorgesehen.
Förderkriterien.
Der vorliegende Action Plan präsentiert die
Das Projekt wird mit einem Volumen von strukturelle, methodische und inhaltliche Ar-
1.004.903 € über das Programm Interreg beit des Projekts, die Ergebnisse der ersten
Europe der Europäischen Union gefördert. Projektphase einschließlich der geplanten
Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt Maßnahmen und gibt einen Ausblick auf die
1.193.175,00 €. Umsetzung in der zweiten Projektphase.
42. From Plan to Action de Anforderungen geschützt werden sollen,
und/oder b) einen Verbund bilden, der ihre
2.1 Thematischer Hintergrund und nachhaltige Nutzung fördert. Handelt es sich
Projektziele um Flächen ohne Funktionsbelegung werden
diese auch Brachflächen genannt; sind es Flä-
Freie und offen gestaltete Flächen sind prägen- chen, deren Funktionsbelegung sich in einer
der Bestandteil der Landschaft und in der Land- Umwandlung befindet, werden sie als Konver-
schaftsentwicklung von besonderem Wert. Sie sionsflächen definiert.
sind Träger unterschiedlichster ökologischer,
sozialer, ökonomischer und kultureller Funk- Neben der großen Nachfrage nach Flächen be-
tionen und unterliegen gleichzeitig stetig wan- steht gleichzeitig eine hohe Erwartung an die
delnden Nutzungsansprüchen. Dies gilt dabei Nutzungsart - sozusagen der Anspruch nach
sowohl für urbane als auch rurale Freiflächen, einem „multifunktionalen Alleskönner“. Be-
im Besonderen aber für Flächen im Übergangs- sonders in Hinblick auf den Klimawandel wird
bereich zwischen Stadt und (Um)Land, die eine das Bewusstsein für die Freiraumfunktionen
Verbindung beider Landschaften darstellen. eines Raumes immer präsenter. Zu den Funk-
tionen der grünen Infrastruktur gehören Frei-
Der Erhalt und die Entwicklung von Freiflächen zeitaneignungen, soziale Erwartungen, Öko-
stehen immer in starker Konkurrenz zu ande- systemdienstleistungen wie beispielsweise
ren Nutzungsvorhaben. Verschiedene Sektoren Frischluftproduktion, Hitzeschutz und Regen-
und unterschiedliche Akteure, wie der Sied- wasserversickerungsflächen aber auch die Auf-
lungsbau, die Landwirtschaft, die Energiewirt- wertung der Flächen zum Schutz und Erhalt der
schaft oder Industrie, bekunden eine große biologischen Vielfalt und des kulturlandschaft-
Nachfrage nach Flächen, was zu einem hohen lichen Erbes. Zusätzlich gewinnen Funktionen
Nutzungsdruck führt. Davon sind insbesonde- wie die Gesundheitsförderung und das städti-
re brachliegende Freiflächen betroffen, deren sche Gärtnern an Bedeutung, da sie zusätzlich
Nachnutzung noch nicht festgelegt und deren für die Bürger*innen einen Mehrwert bieten.
Gestaltung noch nicht beschlossen ist.
Diese grünen und sozialen Funktionen sind be-
Da die Gestaltungsmöglichkeiten und Funkti- reits Teil von städtebaulichen und landschafts-
onsbelegung von Freiflächen zentraler Gegen- planerischen Maßnahmen und Förderprogram-
stand des Projekts sind, ist eine projektbezoge- men, jedoch müssen der Wert von Freiflächen
ne Definition des Terms Freifläche notwendig. und die Bedeutung ihrer nachhaltigen Nutzung
Die hier angesprochenen Freiflächen sind in angesichts des anhaltenden Ressourcenver-
der Regel Kulturlandschaften, die durch geziel- brauchs und dem Anstieg der versiegelten Flä-
te Eingriffe aufgewertet werden können und che immer wieder neu kommuniziert werden.
so a) vor einer Nutzung durch konkurrieren- Dazu ist es nötig, neue Nutzungsformen und
5Kategorien der Landnutzung zu erkennen und 2.2 Angesprochene Förderstruktur
eine veränderte Planungskulisse zu schaffen.
Eine integrierte Stadtplanung in Hinblick auf EFRE.NRW „Wachstum und Beschäftigung“ 2014-
den Dreiklang ökonomischer – ökologischer 2020 ist ein operationelles Förderprogramm,
– sozialer Funktionen mit Beteiligung relevan- angesiedelt im Ministerium für Wirtschaft, Inno-
ter Entscheidungsträger*innen und Zivilgesell- vation, Digitalisierung und Energie des Landes
schaft kann zu einer nachhaltigen Entwicklung Nordrhein-Westfalen und finanziert aus dem Eu-
beitragen. ropäischen Fond für Regionale Entwicklung (EFRE)
sowie vom Land NRW. Es verbindet Europäische
Das Projekt UrbanLinks 2 Landscape (UL2L) Strategien zur Regionalentwicklung mit den re-
widmet sich der Erschließung neuer Ansätze gionalen Anforderungen und der ökonomischen,
zur nachhaltigen Gestaltung von Freiflächen sozialen und ökologischen Situation in NRW.
und neuen Formen der aktiven Landnutzung Das Programm basiert auf vier Prioritätsachsen:
unter Einbezug von Ökosystemdienstleistun-
gen und anderen Funktionen. Wie sich im Pro- • Prioritätsachse 1: Stärkung von Forschung,
jekttitel zeigt, liegt der Fokus im Besonderen technologischer Entwicklung & Innovation
auf den Übergangsbereichen zwischen Stadt
und Land, da sie als gestaltbare Raumeinhei- • Prioritätsachse 2: Steigerung der Wettbe-
ten unter starkem Nutzungsdruck stehen aber werbsfähigkeit von KMU
auch große Potentiale aufweisen. So können
diese Räume, belegt mit verschiedenen grü- • Prioritätsachse 3: Förderung der Bestre-
nen Funktionen, harmonisierende Übergänge bungen zur Verringerung der CO2-Emissionen
in die umgebende Kulturlandschaft schaffen
und städtische Siedlungen, beispielsweise in • Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadt- und
Hinblick auf die Verbesserung des Stadtklimas Quartiersentwicklung / Prävention.
oder als Erholungsort, entlasten.
Im Rahmen des Projekts UL2L wird die Prio-
Ziel des Projektes ist es, unter Einbezug interna- ritätsachse vier angesprochen. Deren spe-
tionaler Good Practices und lokaler Akteur*in- zifische Ziele sind 1) die Verbesserung der
nen, Potentiale der Freiflächen und Synergien Integration benachteiligter gesellschaft-
zu ermitteln, den Wert von natürlichem und licher Gruppen in Arbeit, Bildung und in
kulturellem Kapital zu beschreiben sowie Im- die Gemeinschaft, 2) die ökologische Revi-
pulse für die Förderkulisse, vorwiegend EFRE. talisierung von Städten und Stadt-Umland-
NRW, in Hinblick auf die ökologische und be- gebieten und 3) die Entwicklung und Aufbe-
darfsgerechte Entwicklung von Freiflächen zu reitung von Brach- und Konversionsflächen
geben. zu stadtentwicklungspolitischen bzw. öko-
logischen Zwecken (www.efre.nrw.de).
6Die inhaltliche Bearbeitung des Projekts UL2L 2.3 Projektphase 1: der Weg zum
zielt darauf ab, Bedarfe zu ermitteln, ent- Action Plan
sprechende Maßnahmen zu entwickeln sowie
Impulse für das Förderprogramm EFRE.NRW 2.3.1 Internationale Kooperation, inter-
und die entsprechende Prioritätsachse zu ge- regionales Lernen und Good Practices
ben. Dies wird über die Auseinandersetzung
mit Themenschwerpunkten wie Klimawandel Die Idee zu UL2L basiert teilweise auf Ergeb-
im urbanen und ruralen Raum, gemeinschaft- nissen des vormaligen INTERREG IVC Projekts
liches gärtnern als soziale und ökologische „Hybrid Parks – Combining abilities, creating
Raumgestaltung oder der Wahrnehmung synergies, enhancing performances“ (2012 -
vernachlässigter Flächen und Landschafts- 2014), bei dem der Lead Partner LVR neben
elemente hinsichtlich potentieller Funktionen 15 weiteren europäischen Regionen ebenfalls
sowie die Kooperation mit lokalen und inter- Partner war. Inhalt von Hybrid Parks war, den
nationalen Expert*innen und Stakeholdern Beitrag und die Potentiale von Parks im Rah-
umgesetzt. men von Umwelt- und Klimaanforderungen
sowie ihre Funktionen in sozialen und ökono-
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, mischen Zusammenhängen zu identifizieren,
Digitalisierung und Energie und das Ministe- hierzu vorhandenes Wissen zu bündeln und
rium für Heimat, Kultur, Bauen und Gleich- als Modell für Europa vorzustellen.
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen
haben in einem Letter of Support dem LVR Die aktuelle Diskussion zur Gestaltung urba-
zugesprochen, die aus dem Projekt abgeleite- ner und ruraler Bereiche, neue Fragestellun-
ten Erkenntnisse und Vorschläge zu berück- gen zu Formen aktiver Flächennutzung und
sichtigen. Einbindung von Funktionen wie Ökosystem-
leistungen sollten in einem neuen EU-Pro-
jekt konzentriert bearbeitet werden. Sowohl
Partnerinnen und Partner aus Hybrid Parks,
aber auch aus dem vorangegangenen INTER-
REG-Projekt European Garden Heritage Net-
work, ein Netzwerk von europäischen histo-
rischen und zeitgenössischen Gärten, sowie
weitere Akteur*innen aus der Europäischen
Union wurden über die neue Projektidee in-
formiert und zur Beteiligung eingeladen. Es
entstand die Kooperation von Institutionen
und Organisationen aus sechs Ländern:
7• Landschaftsverband Rheinland (Lead in Form einer Working Group oder über den
Partner), Deutschland Newsletter.
• Umbria Regional Authority, Regional Die Good Practices wurden im Vorfeld von
Directorate of Agriculture, Environment, den einzelnen Projektregionen identifiziert
Energy, Culture, cultural heritage and und nach der Inaugenscheinnahme und Be-
spectacle, Italien wertung durch die Partner*innen zum Teil
auf der Projektwebseite publiziert. Einige die-
• Surrey County Council, Vereinigtes ser Good Practices wurden nach der Prüfung
Königreich und Bewertung durch die Expert*innen des
Programmsekretariats wegen ihres besonde-
• Kristianstad Municipality, Schweden ren Innovationsgehalts zudem in die Policy
Learning Platform der Interreg Europe Pro-
• Silesia Park (Silesia Voivodship Park of gramms aufgenommen.
Culture and Rest), Polen
Die Good Practices werden definiert als Initia-
• Kuldiga District Municipality, Lettland tiven (Projekte, Methoden, Prozesse etc.), die
in einem Schwerpunktthema des Programms
• Schloss Dyck Foundation. Centre for erfolgreich umgesetzt wurden und das Poten-
Garden Art and Landscape Design tial aufweisen, auch in andere europäische
(advisory partner), Deutschland. Regionen transferiert zu werden. Es handelt
sich dabei um Projekte, in denen brachlie-
Ein zentraler Bestandteil der methodischen gende, vernachlässigte oder noch freie Flä-
Arbeit des INTERREG-Projekts ist der Aus- chen und Landschaftsstrukturen revitalisiert
tausch zwischen den einzelnen Partnerlän- und in Hinblick auf neue Funktionen gestaltet
dern sowie der Einbezug lokaler Stakehol- wurden. Diese Funktionen können Teil grüner
der, Expert*innen und Einflussträger*innen. Infrastruktur sein, erhaltende Landschafts-
Grundlegende Idee ist, sowohl bei der Arbeit maßnahmen beinhalten, einen Beitrag zum
auf internationaler als auch lokaler Ebene, sozialen Gefüge darstellen oder auch der
die Förderung des interregionalen Lernens. Gesundheitsvorsorge dienen. In jedem Fall
Gewährleistet wurde dies über verschiedene dienen sie der Regionalentwicklung, der Ver-
Maßnahmen wie das Anlegen einer Daten- knüpfung städtischer und ländlicher Räume
bank mit Good Practice Beispielen, Work- und weisen einen Mehrwert für die Bürgerin-
shops und Study Tours in den verschiedenen nen und Bürger auf.
Partnerländern sowie über die regelmäßige
Kommunikation und Projektupdates zwi- Eine Übersicht aller von den Projektpart-
schen den Projektbeteiligten, insbesondere ner*innen identifizierten Good Practices ist
8auf der Projekthomepage zu finden. Die Pro- angelegt und der Park wird bis zu seiner Fertig-
file enthalten eine Beschreibung des Projekts stellung in 20 bis 30 Jahren auf hundert Hektar
oder der Maßnahme, der aufgewendeten den gesamten Pulheimer Norden bogenförmig
Ressourcen und Finanzmittel sowie eine Eva- umspannen. Der erste Abschnitt wurde aus EF-
luation über den Erfolg des Projekts. RE-Mitteln, aus Mitteln der Städtebauförderung
sowie von der Stadt Pulheim finanziert.
Die von der deutschen Projektleitung ausge-
wählten Good Practices sind der Nordpark in Der Nordpark ist so angelegt, dass er einen
Pulheim, der BernePark in Bottrop und die harmonischen Übergang von der Siedlungs-
Tagebaulandschaft Garzweiler. fläche in die angrenzende Agrarlandschaft
schafft. Dazu wurden Elemente der Agrar-
landschaft wie Ackerstrukturen und Entwässe-
rungsgräben, aber auch Elemente der Kultur-
landschaft, wie Streuobstwiesen, aufgegriffen.
Zusätzlich wurden Ruhezonen mit Bänken und
Mobilitätsparcours eingebaut, um eine vielfäl-
tige Nutzung zu ermöglichen. Der Park ist bar-
rierefrei gestaltet.
“Mobilitätsparkour“ im Nordpark Pulheim
Geographisch befindet sich die Stadt Pulheim
im Einzugsbereich der Großstadt Köln. Der
Nordpark schafft in diesem Zusammenhang
auch eine Verbindung zwischen dem eher
ländlich gestalteten Randgebiet des Rhein-Erft-
Kreises zum Radius des Naherholungsgebietes
„Äußerer Grüngürtel“ der Großstadt Köln.
Durch die Konversion von Agrarland in einen
Streuobstwiese mit Drainagegräben Landschaftspark und den fließenden Über-
gang urbaner in rurale Strukturen konnte ein
Der Nordpark in Pulheim ist ein gestalteter großer Mehrwert für die lokale Bevölkerung
Landschaftspark, dessen Konzept im Rahmen geschaffen werden.
der REGIONALE 2010 entwickelt wurde. Der
erste Abschnitt des Landschaftsparks wurde Wegen fehlender Grünflächen im Stadtinne-
2012 eröffnet, der zweite Realisierungsab- ren bietet der Nordpark die Möglichkeiten
schnitt öffnete 2014 für Besucherinnen und Be- eines sozialen Raums und der Gesundheits-
sucher. Das Projekt ist als Generationenprojekt förderung. Die nachhaltige und klimafreundli-
9che Gestaltung bringt Vorteile für Biodiversität Der BernePark ist ein außergewöhnliches Bei-
und das Anlegen der Streuobstwiesen einen spiel für die Umnutzung alter technischer An-
direkten Nutzen für die Besucher*innen. Zu- lagen. Der entstandene Park ist sowohl Ort
dem ist der Park, durch Einbettung in den sozialer und kultureller Begegnung als auch
Grünraum „Am alten Rhein“ und durch Anbin- touristische Attraktion.
dung an eine Fahrradroute, auch im regiona-
len Kontext von Bedeutung. Durch seinen Anschluss an den Emscherrad-
weg und die Lage zwischen dem Gasometer in
BernePark in Bottrop ist ein altes Kläranlagen- Oberhausen und dem Nordsternpark Gelsen-
gelände, das in einen Park mit Gastronomie und kirchen ist der BernePark auch regional von
besonderem Hotelbetrieb umgewandelt wurde. Bedeutung.
1997 wurde der Betrieb des Klärwerks mit zwei
Klärbecken eingestellt, weswegen das Gelände Das Rheinische Revier ist Europas größtes
zunächst brachlag. Im Rahmen der EMSCHER- Braunkohleabbaugebiet. Der vorzeitige Aus-
KUNST.2010, ein Kunstfestival, wurde das Ge- stieg aus der Braunkohleförderung ist sowohl
lände von Künstler*innen und Landschaftsar- landes- als auch bundespolitisch von großer
chitekt*innen für rund 6 Mio. Euro revitalisiert. Bedeutung. Hierbei stehen neben einer vor-
Eines der Becken wurde erhalten und ist über bildhaften Bewältigung des Strukturwandels
eine Brücke begehbar, das zweite Becken wur- für die Braunkohlereviere vor allem zukunfts-
de einem Amphitheater nachempfunden und gestaltende Maßnahmen in den Themen Kli-
beherbergt ein “Theater der Pflanzen”. Beson- maschutz, Wirtschaftsförderung, Nutzungs-
deres Highlight ist das Parkhotel, in dem man folgen und -entwicklung im Mittelpunkt.
Quartier in umgebauten Betonröhren bezieht.
Folgelandschaft des Tagebau Garzweiler (www.landfolge.de)
10Die Bundesregierung hatte 2018 die Kom- Regionalentwicklung bietet. In diesen Prozess
mission „Wachstum, Strukturwandel und Be- wurde schon früh die lokale Bevölkerung mit
schäftigung“ eingesetzt, um einen breiten ge- einbezogen.
sellschaftlichen Konsens über die Gestaltung
des energie- und klimapolitisch begründeten Im Jahr 2017 haben die Stadt Mönchenglad-
Kohleausstiegs und des damit verbundenen bach, die Stadt Erkelenz, die Stadt Jüchen und
Strukturwandels in Deutschland herzustellen die Gemeinde Titz daraufhin einen Zweckver-
und die unterschiedlichen Interessen auszu- band zur gemeinsamen Entwicklung der Tage-
gleichen. baufolgelandschaft Garzweiler und ihrer Um-
gebung gegründet.
Vom Bund und von den Ländern ist für die
Braunkohlereviere in Deutschland ein Sofort- Als Träger öffentlicher Belange nimmt der
programm mit einem Volumen von 260 Milli- Zweckverband „Landfolge Garzweiler“ auch
onen Euro aufgelegt worden; hieraus fließen Aufgaben in den gesetzlichen Planungsver-
rd. 90 Millionen Euro für das Rheinische Re- fahren wahr und führt die Abstimmung der
vier in Nordrhein-Westfalen (37 %). Das Land gemeinsamen Planungen, die gemeinsame
Nordrhein-Westfalen wird dieses Sofortpro- Weiterentwicklung der Perspektiven, die Qua-
gramm ergänzen und eine Kofinanzierung litätssicherung sowie die gemeinsame Flä-
(ROP) übernehmen. chenentwicklung und –bewirtschaftung durch.
Im Rheinischen Revier sind strategische Zu- Das oben genannte Drehbuch zur Erarbeitung
kunftsfelder identifiziert worden, die sich aus von Entwicklungsperspektiven ist „die Grund-
den Stärken der Region ergeben und erfolg- lage für alle weiteren planerischen Schritte
versprechende Potenziale für einen Struktur- bis zum Jahr 2035“ (www.landfolge.de). Wei-
wandel bieten. Innerhalb des Rheinischen terhin zeichnet es eine visionäre Entwick-
Reviers liegt der Tagebau Garzweiler, in dem lungsperspektive bis zum Jahr 2085, in dem
voraussichtlich noch bis 2038 Kohle geför- die Rekultivierung der Fläche abgeschlossen
dert wird. sein soll. Die rekultivierte Landschaft soll
aus einem See, einer Reallabor-Landschaft
Bereits 2016 wurde im Rahmen eines einwö- mit Rückführung von Flächen an die Land-
chigen Workshops von allen betroffenen Städ- wirtschaft und Energiegewinnung sowie an
ten und Kommunen eine gemeinsame, visio- Forschungsinstitute und einem Innovation
näre Entwicklungsperspektive („Drehbuch“) Valley zur Erprobung neuer Unternehmens-
erarbeitet, die sich mit den ökonomischen, und Wohnformen bestehen. Eine verbinden-
siedlungs- und infrastrukturellen, sozialen de Grünstruktur, das voraussichtlich „Grüne
und ökologischen Auswirkungen auseinan- Band“, wird die Teilbereiche verknüpfen.
dersetzt sowie Konzepte für eine nachhaltige
11Die Konzeption präsentiert neue Ansätze der auch verschiedene Veranstaltungen dem in-
Regionalentwicklung und bietet Chancen so- ternationalen Austausch.
wohl für Natur als auch für Kultur und Gesell-
schaft. Die frühe Beteiligung der Öffentlich- In der ersten Projektphase wurden fünf
keit an den Strategien für langfristige soziale, Workshops durchgeführt, von denen sich ei-
ökonomische und landschaftliche Lösungen ner dem Thema „good practice examples and
sowie die Zusammenarbeit zwischen den vier challenges within the partnership and out-
Verbandskommunen ist beispielhaft. Trotz side“ (dt. Good Practices, Herausforderun-
des großflächigen Maßstabs der Maßnah- gen der internen und externen Kooperation)
men in Garzweiler sind einzelne Lösungsan- widmete, drei weitere den Themen “Planning
sätze und innovative Konzepte auch auf klei- Procedures & Criteria” (dt. Planungsverfahren
nere Räume zu übertragen, weswegen dieses und Kriterien), “Accessibility & Design” (dt.
Beispiel großes Potential für interregionales Zugänglichkeit und Gestaltung), “Business
Lernen bietet. Partnerships” (dt. Geschäftsbeziehungen)
und der fünfte dem Thema „Interregional Ex-
Die Überlegungen zur Folgenutzung des Ta- change on the action plan“ (dt. Überregiona-
gebaus Garzweiler bilden mit ihren Themen ler Austausch zum Action Plan). Zudem steht
eine Reihe von Merkmalen des Projektinhal- noch eine dreitägige Study Tour aus, bei der
tes von UL2L ab; die Entwicklung und Umset- intensiv mit den Good Practices der Region
zung von Maßnahmen aus dem vorgelegten gearbeitet wird.
Action Plan sind für die Akteur*innen von ho-
hem Interesse. Die Workshops und Study Touren, ausge-
richtet vom jeweiligen Partnerland, dienen
Good Practices und Internationaler Aus- neben dem thematischen Austausch zu Pro-
tausch jektinhalten auch dazu, Probleme und Her-
Ebenso wie sich die deutschen Good Practices ausforderungen innerhalb des Projekts zu
in Typus, Gestaltung und Maßstäblichkeit un- diskutieren sowie ein internationales Netz-
terscheiden, weisen auch die Good Practices werk zu knüpfen.
aus den anderen Partnerregionen eine große
Diversität auf. Da das interregionale Lernen
ein essentieller Baustein der Arbeit von UL2L
ist, ergibt sich aus der Diversität der Beispiele
ein bunter Pool von Möglichkeiten und Ideen.
Somit können bei der Gestaltung der eigenen
Maßnahmen die internationalen Konzepte
übernommen und Projektansätze transferiert
werden. Neben den Good Practices dienten
122.3.2 Zusammenarbeit mit den Stake- • Stiftung Schloss Dyck, Zentrum für
holdern Gartenkunst und Landschaftskultur
(Funktion: Advisory Partner), Jens Spanjer
Die Arbeit innerhalb des nordrhein-westfä- (Vorstand), Martin Wolthaus (Öffentlich-
lischen Projektteams fand nicht nur im Aus- keitsarbeit)
tausch mit den internationalen Partnern
statt, sondern im Besonderen mit lokalen Sta- • Amt für Landschaftspflege und Grün-
keholdern, die für eine Teilnahme am Projekt flächen der Stadt Köln, Dr. Joachim Bauer
gewonnen werden konnten. Die Stakeholder, (stellvertretender Amtsleiter)
Vertreter*innen verschiedener politischer und
nichtpolitischer Institutionen, fungierten ei- • Garten-, Friedhofs- und Forstamt der
nerseits als Expert*innen zur Identifizierung Landeshauptstadt Düsseldorf, Doris
lokaler Probleme und Möglichkeiten, zum Törkel (Amtsleitung)
Austausch und zur Reflexion inhaltlicher Ent-
wicklungen des Projekts und andererseits als • Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL),
Partner bei der Entwicklung und Umsetzung Amt für Denkmalpflege, Landschafts- und
von Maßnahmen für den Action Plan im Be- Baukultur in Westfalen Referat für die
reich der Freiflächenentwicklung. städtebauliche Denkmalpflege, Garten-
kultur, Gartendenkmalpflege und Kultur-
Um eine qualitativ hochwertige und diversi- landschaftsentwicklung, Dr. Dorothee
fizierte Arbeit erbringen zu können, wurden Boesler (Referatsleitung)
Stakeholder aus verschiedenen Institutionen
und mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf • Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL),
den Raum und die Raumentwicklung ausge- Amt für Denkmalpflege, Landschafts- und
wählt. Baukultur in Westfalen, Vermittlung und
Baukultur, Udo Woltering (Sachbereichs-
Diese sind: leitung)
• Ministerium für Heimat, Kommunales, • Region Köln/Bonn e.V., Reimar Molitor
Bau und Gleichstellung (Funktion: Letter (geschäftsführender Vorstand)
of Support), Evamaria Küppers-Ullrich
(Referatsleitung), Ingeborg Sommerhäuser • Zweckverband LandFolge Garzweiler,
Volker Mielchen (Geschäftsführer)
• Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes • Regionalverband Ruhr (RVR), Referat
Nordrhein-Westfalen (Funktion: Letter Regionalpark/Emscher Landschaftspark/
of Support), Christian Roesgen Freiraumsicherung, Frank Bothmann
13sowie auf lokaler, regionaler und internationaler
Ebene als auch durch die unterschiedlichen
• Landschaftsverband Rheinland (LVR), Fachhintergründe der Beteiligten inhaltlich
Kulturausschuss, Prof. Dr. Jürgen Wilhelm sehr differenziert gestaltet werden, Ressour-
cen gebündelt und Erfahrungen eingebracht
• Landschaftsverband Rheinland (LVR), werden, um eine bessere Nutzung öffentli-
Kulturausschuss, Prof. Dr. Leo Peters cher Freiflächen und eine nachhaltige Regio-
(stellvertretender Vorsitzender) nalentwicklung zu gewährleisten.
• Landschaftsverband Rheinland (LVR),
Umweltausschuss, Rolf Fliß (Vorsitzender)
• Landschaftsverband Rheinland (LVR),
Kommission Europa, Lars Oliver Effertz
(Vorsitzender).
Die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern
basierte vorwiegend auf regelmäßigen Ar-
beitsmeetings. In diesen wurden Projekt-
inhalte und –fortschritte besprochen und
diskutiert. Teilweise waren die Stakeholder
auch im Rahmen der internationalen Mee-
tings beteiligt.
Zusätzlich wurden, in Vorbereitung des Ac-
tion Plans, Interviews mit den Stakeholdern
geführt. Diese Interviews dienten der Iden-
tifizierung wichtiger Themen rund um die
Freiflächenentwicklung sowie der Diskussion
der Funktionen dieser Flächen. Weiterhin
wurden die geplanten Maßnahmen in enger
Ab- und Rücksprache mit den Stakeholdern
entwickelt.
Durch die unterschiedlichen Projektpart-
ner*innen und den Einbezug der lokalen Sta-
keholder konnte die Zusammenarbeit sowohl
143. Der Action Plan Arbeitsgruppe ergab sich schnell das Bild, dass
diese rahmengebenden Themen nur einen Teil
3.1 Inhaltliche Gestaltung und Aus- der derzeit drängenden Entwicklungen wider-
wertung der Experteninterviews spiegeln. Daher wurde im Laufe der Arbeit an
UL2L das Spektrum an Themen erweitert. Im
In der ersten Phase des Projekts wurden gute Rahmen von Expert*inneninterviews mit den
Beispiele für die Gestaltung von urbanem Grün jeweiligen Stakeholdern wurden somit nicht
und urbanen Freiflächen definiert. Zusätzlich nur die im Projektantrag definierten Themen
wurden die den Beispielen unterliegenden Pro- besprochen, sondern auch eine Reihe anderer
zesse im Zuge der LVR Stakeholdermeetings Schwerpunkte. Alle Themen beziehen sich auf
und in Interviews mit einzelnen Stakeholdern die Entwicklung von Freiflächen und wurden
besprochen. Die Ergebnisse der rahmengeben- von den Stakeholdern auf einer Skala von 1 =
den, inhaltlichen Erörterung werden im Folgen- sehr wichtig bis 4 = nicht wichtig bewertet.
den wiedergegeben.
Die Interviews wurden aufgrund des Zeitauf-
Im Rahmen des Projektentwurfs wurden be- wands nur mit einem Teil der Stakeholder ge-
reits einige Themen als wichtig identifiziert. führt, dennoch bieten sie aufgrund der hohen
Hierzu gehörte die Entwicklung von Freiflächen fachlichen Diversität der Gesprächspartner*in-
mit Blick auf Ökosystemdienstleistungen, Ge- nen eine gute Grundlage zur Auswertung.
sundheit, Urban Gardening und regionale Iden-
tität. In den regelmäßigen Debatten der Stake- Die Bewertung der Themen durch die Stakehol-
holder-Gruppe und auch der internationalen der sieht wie folgt aus:
Rang Thema Wert
1 Klimawandelanpassung 1,25
2 Beteiligungsverfahren 1,88
3 Soziale Inklusion 1,93
4 Ökosystemdienstleistungen 2,06
5 Kulturlandschaft 2,13
6 Gesundheit 2,13
7 Regionale Identität (Gemeinschaftsgefühl) 2,19
8 Urban Gardening/Gemeinsames Gärtnern 2,25
9 Sportangebote 2,25
10 Klimawandelabschwächung 2,57
Tabelle 1 – Ergebnis der Stakeholderbefragung.
Ranking der Themen nach durchschnittlicher Bewertung;
Wertung von 1 = sehr wichtig bis 4 = nicht wichtig, 0 = keine Angabe.
151 Klimawandelanpassung angenommen wird. Beteiligungsverfahren sind
somit ein wichtiger Baustein, der zum guten Ge-
Die Stakeholder haben die Anpassung an den Kli- lingen der Gestaltung von Freiflächen und zur An-
mawandel klar als drängendstes Thema mit Blick eignung des Raums durch die Bürger*innen bei-
auf die Entwicklung von Freiflächen identifiziert. trägt, da diese eine direkte Beziehung zum Raum
Es zeigt sich, dass es trotz der unterschiedlichen haben oder entwickeln können. Eine nicht erfolg-
Maßstäbe, aus denen heraus die Stakeholder te Beteiligung kann im Nachhinein schaden.
das Thema betrachten, übereinstimmende Pro-
blembeschreibungen gibt. So wurde herausge- 3 Soziale Inklusion
stellt, dass Grün- und Freiflächen, sowohl in der
Stadt als auch in Stadt-Umland-Gebieten, neue Mit einer hohen Relevanz wurde auch die sozia-
Funktionen übernehmen. Sei es der Park in der le Inklusion, die gesellschaftliche Akzeptanz und
Stadt, der mit klimaangepassten Gehölzen be- Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihres Alters,
pflanzt wird und Versickerungsflächen für Nie- ihrer Herkunft oder körperlicher Einschränkun-
derschlag bietet, oder die Flächen rund um die gen, von den Stakeholdern bewertet. So ist es
Städte, die zur Frisch- und Kaltluftproduktion derzeit erkennbar, wie umfangreich Frei- und
genutzt werden. Auch die Interaktion zwischen Grünflächen zu einer inklusiveren Gesellschaft
städtischen und ländlichen Räumen nimmt im beitragen können. Sei es über Gemeinschafts-
Zuge des Klimawandels zu, da die Menschen gärten, bürgerschaftliches Engagement oder
nach Abkühlung und Zugang zu Wasser suchen. auch Veranstaltungen die den Raum für verschie-
Der Anspruch an Freiflächen steigt also stark mit dene gesellschaftliche Gruppen erschließen. Das
Blick auf den Klimawandel. Dies lässt den Schluss Potential von Freiflächen zur sozialen Inklusion
zu, dass Klimaanpassungsmaßnahmen bei der ist hoch und noch nicht ausgeschöpft. Dies gilt
Neu- oder Umgestaltung von Frei- und Konver- im Besonderen für den städtischen Kontext.
sionsflächen immer mitgedacht werden sollten.
4 Ökosystemdienstleistungen
2 Beteiligungsverfahren
Ökosystemdienstleistungen bieten durch die
Auf dem zweiten Rang finden sich die Beteili- Auflistung der Leistungen von Grünflächen, wie
gungsverfahren. Das Einbinden von betroffenen beispielsweise Frischluftproduktion oder Versi-
Bürger*innen und anderen Beteiligten stellt eine ckerung von Niederschlag, die Möglichkeit eine
große Herausforderung in der zielgerichteten Vergleichbarkeit von Grünflächen zu anderen
Planung zur Entwicklung von Freiflächen dar. Nutzungsformen, wie beispielsweise Straßen,
Den Nutzungsbedürfnissen der Bürger*innen herzustellen. Diese Überlegungen können die
sollte durch die frühe Beteiligung bei der Konzep- Wahrnehmung von Grün und die Argumente für
tionierung entsprochen werden, um sicherzustel- Grün stärken, jedoch besteht das Problem, dass
len, dass der Raum entsprechend genutzt und die Leistungen häufig nicht erfasst sind. Berei-
16che wie die Regenwasserversickerung, der Erhalt ting: „Insbesondere größere Freiflächen an me-
der Biodiversität oder auch die Bindung von CO2 dizinischen Einrichtungen, z.B. Krankenhäusern
durch verschiedene Gehölze sind nicht immer werden zunehmend als nur noch als potentielle
exakt zu beziffern. Die Bevölkerung hat den Wert Erweiterungsflächen für die Einrichtungen gese-
der Ökosystemdienstleistungen dennoch bereits hen. Ihre Funktion, zur Gesundung der Patienten
erkannt und fordert die verstärkte funktionale beizutragen, werden nicht mehr genutzt.“
Nutzung der Potentiale von Grün beispielsweise
bei Klimafragen ein. 7 Regionale Identität
5 Kulturlandschaft Die Identifikation mit Frei- und Grünflächen wird
als Konsequenz aus der Nutzung der angelegten
Die Relevanz der Kulturlandschaft mit Blick auf Grünstruktur beschrieben. Diese Identifikation
die Entwicklung von Freiflächen wird durch die wird durch vielfältige Aspekte gefördert, ange-
Stakeholder anerkannt. Wichtige kulturelle Werte fangen bei den Hobbymannschaften im Park
können in die Neu- oder Weiterentwicklung von über die Nutzung lokaler Plätze als Treffpunkt
Freiflächen einbezogen werden oder es entste- bis hin zum Zugehörigkeitsgefühl in ganzen
hen gar neue Kulturlandschaften. So sind gerade Quartieren oder sogar Regionen, wie dem Rhein-
auch städtische Strukturen wie beispielsweise land, Westfalen oder dem Ruhrgebiet. Neben
der Kölner Grüngürtel Teil der Kulturlandschaft. der Möglichkeit sich regional über den Raum zu
identifizieren, wird im Kleineren auch die örtliche
6 Gesundheit Identität als kulturelle Voraussetzung für ein gu-
tes Miteinander genannt. Eine liberale Planung
Der gesundheitliche Nutzen von Freiflächen wird der Flächen ermöglicht eine möglichst individu-
von den Stakeholdern als wichtig eingeschätzt. elle Nutzung sowie Aneignung und fördert somit
Sie bieten Möglichkeiten für Erholung und Be- die Identifikation.
wegung, die von diversen Bevölkerungsgrup-
pen wahrgenommen werden. So dienen diese 8 Urban Gardening
Räume der Gesundheit und Lebensqualität von
Sportbegeisterten, Kindern und alten Menschen. Das Urban Gardening, auch Gärtnern in der Stadt
Nicht zuletzt durch die Produktion von Frisch- oder Gemeinschaftsgärtnern, wird von den Sta-
und Kaltluft, kann die Funktion der Gesundheit keholdern als wichtig erachtet, steht jedoch in
auch zu den Ökosystemdienstleistungen ge- der Liste der zehn zu bewertenden Themen an
zählt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist achter Stelle. Dem Ansatz, dass Urban Gardening
die psychische Erholung für Bewohner*innen nicht übermäßig geplant werden sollte, steht die
aus verdichteten Stadtgebieten. Dieser Nutzen Forderung nach einer stärkeren Unterstützung
ist allerdings gesellschaftlich nicht mehr über- durch die öffentliche Hand gegenüber. Einigkeit
all verankert – Zitat aus dem Stakeholder Mee- herrscht bei der Bedeutung der Kleingartenkul-
17tur in Verbindung mit Urban Gardening. Diese Stakeholdern auf dem zehnten von zehn Rängen
bietet große Potentiale und ermöglicht es vie- zwischen den Kategorien wichtig und weniger
len Menschen, trotz enger Lebensverhältnisse, wichtig bewertet. Es wird erkannt, dass Grün-
allein oder in Gruppen zu Gärtnern. Insbeson- flächen, beispielsweise über stark CO2 bindende
dere junge Familien können durch das Gärtnern Gehölze, hier eine Funktion übernehmen. Jedoch
in der Stadt den Kindern Wissen zu Natur und sei das Thema der Klimawandelabschwächung
Pflanzen vermitteln und das eigene Gemüse an- eher eines für größere Maßstäbe. Die regionalen
bauen. Die Aneignung der Flächen und die so- Wälder sind Teil der CO2-Bilanz, können jedoch
ziale Interaktion wirkt für die Bürger*innen da- nur als kleine Maßnahmen im globalen Kontext
rüber hinaus auch identitätsstiftend. Menschen angesehen werden.
können sich positiv beschäftigen und soziale
Räume werden erschlossen. Übergeordnete Erkenntnisse
9 Sportangebote Neben den Einschätzungen zu den verschie-
denen Themen, lassen sich auch strukturelle
Sportangebote spielen eine Rolle bei der Entwick- Erkenntnisse aus der Arbeit in der Stakehol-
lung von Freiflächen und können über Outdoor- der-Gruppe und den Expert*inneninterviews ge-
Gyms, Spielflächen für Fußball, Basketball oder winnen. So ist ein häufig genannter Aspekt der
ähnliches dem Menschen sowohl einen Gesund- Zuwachs an Funktionen die von einer Frei-/Grün-
heits- als auch einen Unterhaltungsnutzen bieten. fläche erfüllt werden sollen. Es gibt demnach
Als problematisch wird erkannt, dass viele sport- nicht mehr nur eine definierende Funktion, viel-
liche Aktivitäten wechselnden Modetrends unter- mehr definiert sich die Fläche über die Summe
worfen sind und somit größere Investitionen in ihrer Funktionen.
Sportanlagen wohl überlegt sein müssen. Auch
die Versieglung von Flächen durch beispielswei- Eine Grünfläche soll beispielsweise nicht mehr
se Kunstrasenplätze und die nicht immer starke nur den Zweck der Erholung erfüllen, sondern
Auslastung der sportlichen Infrastruktur wird be- auch für die Versickerung von Regenwasser
mängelt. Die Bedeutung von Grünflächen für den bereitstehen oder durch Sportangebote der
städtischen Individualsport zeigt sich auch in der Gesundheit dienen. Der Funktionszuwachs be-
Feststellung, dass z.B. in Köln 70 % der Sport- zieht sich jedoch nicht bloß auf neu zu gestal-
treibenden ihren Sport nicht vereinsgebunden, tende Flächen, sondern spielt auch mit Blick auf
sondern im öffentlichen Raum durchführen. bestehende Flächen eine Rolle. Betrachtet man
die Interviews mit den Stakeholdern zeigt sich
10 Klimawandelabschwächung dieser Funktionszuwachs bereits in der grund-
sätzlich hohen Bewertung der abgefragten The-
Die Klimawandelabschwächung als Thema für men. Kaum eine Funktion kann vernachlässigt
die Entwicklung von Freiflächen wird von den werden oder erscheint weniger wichtig, woraus
18sich in der Konsequenz ein Anspruch an die 3.2 Die Maßnahmen
Freiflächen ergibt, mehrere Funktionen erfüllen
zu müssen. Die folgenden Maßnahmen wurden im Laufe des
Projekts von den Stakeholdern in Zusammenar-
Weitere grundsätzliche Erkenntnisse sind der Be- beit mit dem Projektteam konzipiert und ausge-
darf, Grünflächen im Konflikt mit anderen Nut- arbeitet. Das Wissen der Stakeholder um die loka-
zungsmöglichkeiten, wie dem Siedlungsbau oder len Bedarfe in der Grünflächenentwicklung stellt
der Landwirtschaft, besser zu positionieren und die Basis der Konzeption dar. Aus den internatio-
eine häufig genannte Kritik an der Überregulie- nalen Good Practices und den Erkenntnissen, die
rung der Flächen. Grundsätzliche Kritik wurde innerhalb des Projekts und aus den Interviews
am hier genutzten Begriff der Freifläche geübt, gewonnen werden konnten, wurden innovative
da jede Fläche bereits mit einer Funktion belegt Ansätze erarbeitet werden, die mit den lokalen
ist, also nie wirklich frei ist. Freiflächen sollten Bedarfen gekoppelt wurden. Daraus konnten die
also im Kontext dieses Projekts als gestaltbare Maßnahmen mit Umsetzungsvorhaben in der
Flächen oder Flächen, die für neue oder verän- zweiten Projektphase entwickelt werden. Bei der
derte Funktionsbelegungen nutzbar sind, ver- Auswahl der Maßnahmen wurde weiterhin Wert
standen werden. So können diese Flächen einen auf unterschiedliche Maßstäblichkeiten gelegt,
einzelnen Park darstellen oder auch eine größe- um zu zeigen, dass Eingriffe sowohl im Großen als
re, zusammenhängende Konzeption von Fläche, auch im kleinen Kontext sinnvoll und nachhaltig
wie beispielsweise der Kölner Grüngürtel. sind. Alle Maßnahmen greifen mindestens einen
der Themenbereiche auf, die in der künftigen Frei-
Neben den Bewertungen der Themen und den raumgestaltung Beachtung finden müssen:
beschriebenen Erkenntnissen ergaben sich
spannende, in die Zukunft gerichtete Beiträge. -> Klimawandelanpassung:
Mit Blick auf vorhandene Flächen und den ge- Umweltbildung, Auswahl von Baumaterialien/
stiegenen Bedarf an Funktionen ist davon aus- Gehölzen, Erkennen und Fördern der Ökosys-
zugehen, dass auch unter sozialen Aspekten und temdiensteistungen
ökologischen Anforderungen die Landschaft und
die Grünräume sich immer mehr in die Stadt ent- -> Wechseln von Perspektive und Maßstab:
wickeln (werden). Beteiligung verschiedener Akteur*innen, Wer-
tigkeit grüner Infrastruktur, Einbindung in die
Die zukünftigen Potentiale sind also nicht Planung, Betrachtung in großem Maßstab, Ver-
zwangsläufig nur in der neuen Gestaltung von bindung von Flächen schaffen
Grün- und Freiflächen zu suchen, vielmehr gilt
es einen kreativen Blick auf das Bestehende zu -> Multifunktionalität der Flächen:
werfen und Grün in den bestehenden Strukturen Reflexion der Funktionen, Funktionsergänzung mit
neu zu denken. Flächenaufwertung ohne Überbelastung der Fläche
19-> Stärkung sozialer & ökologischer Aspekte: len Engagements im Raum, gemeinsames
Beteiligung der Nutzergruppe, Stärkung sozia- Gärtnern
Die Maßnahmen des LVR im Überblick:
Maßnahmen Umsetzung Projektthemen Referenzprojekte
Workshop Landfolge Garzweiler, Klimawandel- Greenway, Umbrien
Landschaftspark Region Köln-Bonn e.V., abschwächung/Öko-
Mönchengladbach- MWIDE* systemdienstleistungen Climate for Silesia,
Wanlo MHKBG* Schlesien
Eingang zum grünen *Ministerium für Wirtschaft, Inno-
Beteiligungsverfahren
Band Garzweiler viation, Digitales und Energie NRW The Water Kingdom
*Ministerium für Heimat, Kultur,
Bauen und Gleichstellung NRW
Sportangebote Kristianstad
Kulturlandschaft The Landscape
Laboratory, Alnarp
Regionale Identität
Perspektivenwerkstatt Stiftung Schloss Dyck, Soziale Inklusion Saint Francis Wood,
Inklusiver Fuß- und Landfolge Garzweiler, Umbrien
Radweg in Klimaland- MWIDE Klimawandel-
schaft MHKBG abschwächung/Öko- Greenway, Umbien
Reallabor zwischen Stadt Jüchen systemdienstleistungen
Schloss Dyck und Climate for Silesia,
Jüchen-Süd Sportangebote Schlesien
Gesundheit
Seminar Landschaftsverband Urban Gardening Participatory photo-
Parkpflege Westfalen-Lippe (LWL) graphy workshop,
Gemeinsames Gärtnern Beteiligungsverfahren/ Umbrien
im Park Landschaftsverband Regionale Identität
Rheinland (LVR) Climate for Silesia,
Soziale Inklusion Schlesien
Kulturlandschaft The Health Garden,
Kristianstad
Gesundheit
The vegetable gardens
Ökosystemdienst- of St. Peter, Perugia
leistungen
Workshop LWL Klimawandel- The release of
Planer*innen LVR abschwächung biodiversity in Trevi,
Neue Perspektiven für Umbrien
alte Kulturlandschaften Kulturlandschaft
Integration historischer Participatory photo-
Kulturlandschaft in Ökosystemdienst- graphy workshop,
aktuelle Planungen Leistungen Umbrien
Beteiligungsverfahren The Landscape
Laboratory, Alnarp
203.2.1 Workshop Landschaftspark Projekts liegt auf dem Thema „Mensch und Bio-
Mönchengladbach-Wanlo: Eingang sphäre“. Die Stadt ist mittlerweile stolz auf das
zum Grünen Band Garzweiler Feuchtbiotop und hat daraus ein starkes Profil
entwickelt.
Der Mönchengladbacher Stadtteil Wanlo liegt
in unmittelbarer Nähe der Tagebaukante. Nach
Ende des Tagebaus und der Flutung wird der
Ort jedoch als Seeanrainer eine sehr hohe La-
gegunst haben. Zur Gestaltung des verknüp-
fenden Raumes zwischen Wanlo und dem ent-
stehenden See besteht die Idee der Konzeption
eines Landschaftsparks. Wie ein solcher Land- Der Weg zum Besucherzentrum
schaftsparks aussehen könnte, welche Funk-
tionen er wahrnehmen müsste und welche b) The Landscape Laboratory (Südschweden,
Ansprüche die anwohnenden Bürger*innen an Schweden)
den entstehenden Raum haben soll in Form Das Labor zeigt über 100 verschiedene Wald-
von zwei Workshops ausgearbeitet werden. Die und Wiesenhabitate. Es bietet somit Raum
Konzeption und Umsetzung dieser Workshops zum Lernen, Forschen, Erholen und für Frei-
durch den Zweckverband LandFolge in Zusam- luftworkshops. Die Diversität der Vegetationen
menarbeit mit der Region Köln/Bonn e.V., dem wird gezeigt, wie beispielsweise urbane Wälder,
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digita- landwirtschaftliche Natur, Parks, Gärten und
lisierung und Energie (MWIDE NRW) und dem Straßenvegetation, und kann erforscht und stu-
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und diert werden. Zudem werden Möglichkeiten der
Gleichstellung (MHKBG NRW) organisiert. aktiven Kulturlandschaftsgestaltung aufgezeigt
und darüber informiert, wie mit identischen
1. Referenzprojekte aus UL2L Mitteln (z.B. Sträuchern) Landschaftsräume
ganz unterschiedlichen Charakters (wild oder
Lernen von den Good Practices ruhig) gestaltet werden können.
a) The Water Kingdom (Kristianstad, Schweden)
Das Water Kingdom ist ein an das Stadtzent-
rum angrenzendes Naturreservat. Ein Besu-
cherzentrum bietet Bildungsmöglichkeiten und
treibt den örtlichen und regionalen Tourismus
an. Der Blick der Stadt auf das Feuchtbiotop
wurde über die Erschließung sehr positiv ver-
ändert. Der konzeptionelle Schwerpunkt des Teilbereich des Landscape Laboratory
21c) Greenway (Umbrien, Italien) Durch den planerischen Charakter des Work-
Der Greenway ist ein Netzwerk von Fuß- und shops können weitere „good practices“ aus
Radwegen zur Verbindung von Kommunen in dem Projekt UL2L oder auch außerhalb des
Umbrien. Er führt entlang einiger Flussufer, Projekts hinzugezogen werden. Die hier abge-
an denen sich wieder lokaltypische Vegetation bildeten bieten einen Überblick über das inter-
entwickelt hat. Der Grüne Weg ist ein Open- regionale Lernen mit einem Schwerpunkt auf
Air Labor, das dem Thema Nachhaltigkeit und Gärten und Parklandschaften.
Biodiversität gewidmet ist.
Erkenntnisse aus der Arbeit mit den Stake-
holdern
Die von den Stakeholdern in den Gesprächen
gesetzten Schwerpunkte sollten ebenfalls bei
der Durchführung des Workshops berücksich-
tigt werden. Hier kann beispielsweise der all-
gemeine Zuwachs an Anforderungen an einen
zu gestaltenden Raum genannt werden, aber
auch ganz konkrete Funktionen wie eine stär-
Fuß- und Radweg am Flussufer kere Anpassung der Grünfläche an die Aus-
wirkungen des Klimawandels sollten berück-
d) Climate for Silesia (Schlesien, Polen) sichtigt werden.
Der Botanische Garten Silesia bietet Expertise
bei der Revitalisierung und Bepflanzung von 2. Beschreibung der Maßnahme
postindustriellen Brachflächen an. Dazu gehö-
ren Aktivitäten wie Workshops zu Umweltbil- Workshops mit Entscheidungsträger*innen
dung, Laboruntersuchungen, Kreativität und aus Politik (Vertretenden der Kommunen) Zi-
Gärtnern, aber auch wissenschaftliche Vorle- vilgesellschaft und beteiligten Institutionen
sungen Geländeexkursionen, Bildungskampa- sowie Energiewirtschaft (RWE) sollen das
gnen und Ausstellungen. Wettbewerbsverfahren vorbereiten. Aufgrund
der besonderen Situation am Rand des Tage-
baus und der damit verbundenen laufenden
Veränderung der Landschaft besteht hier eine
besondere Herausforderung.
Die Workshops sollen mit 15 – 20 Teilnehmen-
den durchgeführt werden. Der erste Work-
shopteil (Herbst 2020) wird sich thematisch
Ausstellung am Botanischen Garten mit der Entwicklung von neuen Landschafts-
22parks sowie mit dem Kernthema „Verbindung Das MWIDE NRW ist verantwortlich für das
von Stadt und Land“ beschäftigen. Er soll be- OP EFRE NRW und hat im Rahmen der För-
wusst offen gestaltet werden. Im zweiten derung des Strukturwandels im Rheinischen
Workshop-Teil können, mit Unterstützung Revier eine koordinierende Funktion.
eines Planungsbüros und möglichen Juryteil-
nehmer*innen, standortgebundene Kriterien d) Ministerium für Heimat, Kommunales,
konkretisiert und das Wettbewerbsverfahren Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW)
vorbereitet werden. Das MHKBG NRW ist ein zentraler Akteur bei
der Erarbeitung eines förderfähigen Kon-
3. Involvierte Stakeholder zepts für das Wettbewerbsverfahren sowie
auch darüber hinaus als Fördermittelgeber
a) LandFolge Garzweiler für künftige Einzelprojekte der Kommunen.
Die LandFolge Garzweiler ist als Zweckver-
band der gemeindeübergreifende Akteur zur 4. Zeitrahmen
Entwicklung der Tagebaufolgelandschaft und
ihrer Umgebung während und nach dem Ab- Oktober 2020 – Mai 2021
bau der Braunkohle. Neben der Konzeption • Herbst 2020 – erster Workshop
des gesamten Raums befasst sich die Land- • Winter 2020/2021 – Beauftragung
Folge auch mit der Planung von Projekten in eines Planungsbüros
Teilbereichen. Das „Grüne Band“, in das der • Winter 2020/2021 – zweiter Workshop
Landschaftspark Wanlo eingebunden werden • Frühjahr/Sommer 2021 – Start des
soll, ist eine den Tagebau umgebende und die Wettbewerbsverfahrens
Umgebung vernetzende Landschaftsstruktur,
die neben Grünstrukturen landwirtschaftliche 5. Indikative Kosten
Nutzungen beinhaltet und auch städtebauliche
Entwicklungsflächen strukturiert. Für die Durchführung eines Tagesworkshops
wird eine vorläufige Kostenschätzung von ca.
b) Region Köln/Bonn e.V. 6.000 € bis 6.200 € für den Workshop mit in-
Der Region Köln Bonn e.V. erarbeitet Konzepte ternationalen Referent*innen angelegt; für
zur regionalen Entwicklung des Rheinlands und den zweiten Workshop ohne internationale
hat beispielsweise über den Agglomerations- Beteiligung werden rund 5.000 € angelegt. Da-
plan große regionale Bezüge im Blick. Die Ein- raus ergibt sich eine Gesamtsumme von rund
bettung des Landschaftsparks in größere Zu- 11.000 – 11.200 € für die Maßnahme.
sammenhänge kann hier sichergestellt werden.
Die geschätzten Kosten pro Workshop erge-
c) Ministerium für Wirtschaft, Innovation, ben sich wie folgt:
Digitalisierung und Energie (MWIDE NRW)
23Sie können auch lesen