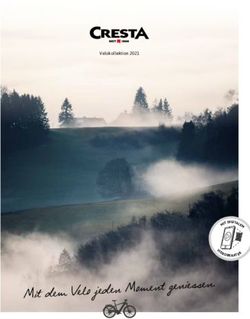Der passende Antrieb für den Fuhrpark - EIN LEITFADEN VERSION 1.0, DEZEMBER 2018 - Volkswagen Group
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der passende Antrieb für den Fuhrpark EIN LEITFADEN VERSION 1.0, DEZEMBER 2018
2
Einleitung
Dieses Whitepaper soll Ihnen als Fuhrparkmanager eine Hilfestellung bei der Entscheidung geben, welcher
Antrieb (oder Antriebsmix) für Ihre Flotte denkbar ist. Es berücksichtigt dabei den aktuellen technologischen
Stand und nutzt eine generische Darstellungsweise.
DIE SITUATION AUF DEM DEUTSCHEN FLOTTENMARKT IM HERBST 2018
Es ist noch gar nicht lange her, da galt in Fuhrparks folgende Faustregel: Mitarbeiter mit hohen jährlichen Fahr-
leistungen erhalten einen Dieselantrieb. Ist diese Betrachtungsweise heute noch aktuell? Ein Blick auf das Diesel-
barometer vom September 2018 (mit Fokus auf Flotten) der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) gibt
Aufschluss, denn 84 Prozent der Fuhrparkleiter bestellen nach wie vor Diesel-Pkw. Für Axel Schäfer, den
Geschäftsführer des Bundesverbands Fuhrparkmanagement, hat das einen einfachen Grund, wie er im Fach
magazin Firmenauto schreibt: So seien „Dienstwagenfahrer eher selten nur innerstädtisch unterwegs“ und „die
neueste Dieseltechnologie für Langstrecken die beste Antriebsart“. Dabei stellen die Total Cost of Ownership
(TCO) gewichtige Entscheidungskriterien dar. Das Dieselbarometer zeigt aber auch, dass sich in den deutschen
Fuhrparks etwas tut: Die Nutzungsprofile werden immer detaillierter und die Beschaffung der Fahrzeuge ent-
sprechend weiter gefasst, sodass vermehrt Benziner und alternative Antreibe zum Einsatz kommen.
ZAHLREICHE ANTRIEBSARTEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG
Der Fahrzeugmarkt ist in Bewegung. Um die strengen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, werden bewährte
Motorenkonzepte weiterentwickelt, aber auch alternative Antriebslösungen vorangebracht. Dabei entwickeln
die Ingenieure den Verbrennungsmotor stetig weiter, setzen aber auch auf komplett neue Konzepte. Diese Ent-
wicklungen haben zur Folge, dass Fuhrparkmanager immer mehr Einflussfaktoren berücksichtigen müssen.
WELCHE ANTRIEBSARTEN GIBT ES?
Konventionelle Alternative
Ottomotor Dieselmotor Mild-Hybrid1) Erdgasmotor Plug-in-Hybrid Elektromotor
1)
Technologie kombinierbar mit Otto- und Dieselmotoren.
FÜR DEN FLOTTENMANAGER BEDEUTET DAS?
Zweifelsohne ist die aktuelle Antriebsvielfalt attraktiv, schließlich kann der Mobilitätsverantwortliche sich
ganz nach seinen Bedürfnissen aus einem breiten Portfolio bedienen. Gleichzeitig wird dadurch aber auch
der Entscheidungsprozess komplexer. Es stellen sich Fragen wie:
> Welche Mobilitätsprofile können mit welchem Antrieb abgedeckt werden?
> Welche externen Faktoren sind zu berücksichtigen?
> Wie passt der Motor zur Car-Policy des Unternehmens?
> Was sagen die User-Chooser zum Antrieb?
> Welche Kosten müssen einkalkuliert werden?
DIE LÖSUNG: EIN „FLEET FUNNEL“.
Auf den folgenden Seiten befindet sich das Handwerkszeug, um den Entscheidungsprozess hinter der Frage „Wel-
cher Antrieb passt am besten zu meinem Mobilitätsbedarf?“ anzustoßen – und dabei die wichtigsten Parameter
zu berücksichtigen. Da es bei dieser theoretischen Vorgehensweise zu individuellen Abweichungen kommen
kann – schließlich steckt sich jedes Unternehmen andere Ziele und es herrschen unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen –, empfiehlt sich zusätzlich ein persönliches Beratungsgespräch mit einem zertifizierten Fuhrparkberater.Der passende Antrieb für den Fuhrpark 3 VERSION 1.0 12/2018
Antriebsarten
OTTOMOTOR
Hochaufgeladene Ottomotoren zeichnen sich dank start immer einige winzige Öl- und Kraftstoff-Tröpf-
Downsizing – also kleinerem Hubraum bei gleich- chen an der Zylinderwand und dem Kolben nieder.
bleibender Leistung – und Direkteinspritzung durch Dort verbrennen sie allerdings nicht vollständig und
einen niedrigen Verbrauch aus. Die modernen Moto- verlassen den Motor als extrem kleine Rußpartikel –
ren erreichen ihr maximales Drehmoment in der Re- oder anders ausgedrückt: als Feinstaub.
gel sehr früh und sorgen insgesamt für ein spritziges
Beschleunigungs
verhalten bei gleichzeitig hohem Ottopartikelfilter (OPF)
Durchzugsvermögen. Bei einem Kraftstoffkostenver- Im Ottopartikelfilter werden die Feinstaubteilchen
gleich in Deutschland zeigt sich, dass ein Liter Benzin mithilfe eines hochporösen und stark hitzebeständi-
im Schnitt 16 Prozent mehr kostet als Diesel – und gen Keramikwerksstoffs „aufgefangen“ und gleichzei-
sogar 25 Prozent mehr als ein Kilogramm Erdgas. tig durch die hohe Temperatur des Abgases verbrannt.
Diese Varianz wirkt sich unterschiedlich auf die Be- Mit einem Ottopartikelfilter kann der Partikelaus-
triebskosten aus.1) stoß um bis zu 90 Prozent verringert werden.
Ottomotor und Feinstaub
Vergleicht man die Emissionen eines Otto- mit denen DER OTTOMOTOR punktet auf kurzen bis mittellangen
eines Dieselmotors, stellt sich folgendes allgemeines Fahrstrecken oder bei geringen Jahreslaufleistungen.
Bild dar: Der Ottomotor stößt weniger Stickoxide NOX
aus, produziert aber bis zu 15 Prozent mehr Kohlen
dioxid CO₂.2) Wie alle Verbrennungsmotoren erzeu- STÄRKEN
gen auch Ottomotoren Feinstaub – a llerdings sind > Moderate Anschaffungskosten
diese Partikel extrem klein. Um deren Ausstoß ge- > Geringes Leistungsgewicht
mäß der gesetzlichen Vorgaben zu reduzieren, wer- > Weniger Stickoxid-Emissionen als der Dieselmotor
den aktuelle Ottomotoren des Volkswagen Konzerns > Agiles Fahrverhalten
mit sogenannten Ottopartikelfiltern ausgestattet.
Bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung EI NSCH RÄN KU NGEN
wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch im Zylinder unter > Ottopartikelfilter nötig für Feinstaubreduzierung
hohem Druck verbrannt. Obwohl dieser Vorgang > Hohe Kraftstoffkosten
sehr effizient ist, setzen sich insbesondere beim Kalt-
WO KOMMT FEI NSTAU B VOR? WER ERZEUGT PARTI KEL I N DEUTSCH L AN D?
Sowohl im Straßenverkehr (zum Beispiel Verbrennungspro- 23 % Schüttgutumschlag
zesse, Reifen- und Bremsabrieb) als auch beim Schüttgutum- 23 % Landwirtschaft
schlag oder in der Landwirtschaft wird Feinstaub freigesetzt. 16 % Industrie
Dessen Partikel können je nach Größe beim Menschen ver- 14 % Energiewirtschaft
schiedene gesundheitliche Wirkungen hervorrufen. 14 % Straßenverkehr
10 % Holzfeuerung
1)
Dem Vergleich liegen Durchschnittspreise für das Jahr 2017 zugrunde. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Quelle: Umweltbundesamt, 12/2016
2)
Bundesverband der Deutschen Industrie, 2018Der passende Antrieb für den Fuhrpark 4 VERSION 1.0 12/2018
DIESELMOTOR NO X-GRENZWERTE in μg/km
Unter den Verbrennungsmotoren ist der Diesel nach wie vor das Aggregat
mit dem besten Wirkungsgrad. Zudem überzeugt er mit einem konstant
500
hohen Drehmoment innerhalb eines breiten Drehzahlbereichs. Durch
technische Lösungen wie die Hochdruck-Direkteinspritzung und die 375
Turboaufladung legt der Dieselmotor heute ein agiles Fahrverhalten an Diesel
250
den Tag. Übrigens: In einem generellen Vergleich von Otto- und Dieselmo-
tor zeigt sich, dass der Diesel bis zu 15 Prozent weniger CO2 ausstößt.1) 125
Einschränkungen beim Diesel sind die hohen Emissionen von Benzin
Stickoxiden (NOX) und Feinstaub. Damit Dieselmotoren die strengen gesetz-
Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6
lichen Vorgaben erfüllen, werden sie schon seit Längerem mit Rußpartikel-
filtern zur Verminderung des Partikelausstoßes ausgerüstet – und verfügen Die Vorgaben der EU für Pkw wurde
darüber hinaus über sogenannte SCR-Katalysatoren zur NOX-Reduzierung. seit der Einführung der Euro-3-Norm
Dank dieser Abgasnachbehandlungen erfüllen moderne Dieselmotoren die im Jahr 2000 mehrmals verschärft.
strengen Stickoxid-Vorgaben der Euro-Abgasnormen (Euro 6d-TEMP und Quelle: Umweltbundesamt
Euro 6d).
SCR-Katalysator
Der SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction) wandelt die Abgas-
komponente Stickoxid (NOX) ohne Bildung von unerwünschten Nebenpro-
dukten selektiv zu Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) um. Die Umwandlung
erfolgt dabei unter Verwendung einer synthetisch hergestellten, wässri- 1,5 l AdBlue®
gen Harnstofflösung – beispielsweise AdBlue® – die in einem Zusatztank für bis zu 1.000 km
mitgeführt wird.
Der Automobilclub ADAC
hat den Verbrauch von
DER DI ESELMOTOR überzeugt vor allem auf langen Strecken dank niedrigem AdBlue® bei Diesel-
Verbrauch und einer entsprechend großen Reichweite. Fahrzeugen getestet:
Er liegt bei etwa drei bis
fünf Prozent des Kraft
STÄRKEN EI NSCH RÄN KU NGEN stoffverbrauchs.
> Hohes Drehmoment in einem breiten > Umfangreiche Abgasreinigung erhöht die
Drehzahlbereich Anschaffungskosten Das entspricht ungefähr
> Geringere CO2-Emissionen als der Otto- > Mögliche Fahrverbote für ältere Diesel 1,5 bis 3 Liter AdBlue® pro
motor unter Einhaltung der strengen Ab- generationen 1.000 Kilometer.
gasnormen Quelle: ADAC
REICHWEITEN in Kilometer am Beispiel eines typischen Flottenfahrzeugs der Kompaktklasse in Deutschland (nach NEFZ)
PRIMÄRKRAFTSTOFF SEKUNDÄRKRAFTSTOFF ENTWICKLUNG ELEKTRISCHE REICHWEITE BIS 2020
BENZINMOTOR 700
DIESELMOTOR 900
GASMOTOR (CNG)2) 690
PLUG-IN-HYBRID3) 880
ELEKTROMOTOR 300/650 4)
Stand 09/2018
1)
Bundesverband der Deutschen Industrie, 2/2018 2)
Quasi-monovalenter Erdgasmotor 3)
Plug-in-Hybrid (Benzin/Elektro) 4)
Vorschau auf die elektrische Reichweite bis 2020Der passende Antrieb für den Fuhrpark 5 VERSION 1.0 12/2018
MILD-HYBRID (MILD-HYBRID ELECTRIC VEHICLE, MHEV)
Mit der neuen Mild-Hybrid-Technologie können Verbrennungsmotoren noch effizienter werden. Aktuell elekt-
rifiziert beispielsweise die Marke Audi immer mehr ihrer Fahrzeuge. Dies funktioniert bereits mit dem beste-
henden 12‑Volt-Bordnetz: Die wichtigsten Bausteine sind eine Lithium-Ionen-Batterie sowie ein Riemen-
Starter-Generator, der zugleich als Anlasser dient.
Riemen-Starter-Generator
Dieses Bauteil macht neue Funktionen möglich: Die REKU PERATION B EIM MI LD-HYB RI D
Start-Stopp-Phase beispielsweise kann schon bei Die beim Bremsen oder im Schubbetrieb freiwerdende
etwa 15 km/h Restgeschwindigkeit beginnen. Wenn Energie wird von einem Generator in elektrische Energie
der Fahrer bei höherem Tempo vom Gas geht, segelt umgewandelt.
das Auto für kurze Zeit mit deaktiviertem Motor. Mit
maximal 5 Kilowatt ist die Rekuperationsleistung
erheblich – zusätzlich kann der Generator den Ver-
BREMS-
brennungsmotor unterstützen. Dadurch lassen sich BATTERIE
ENERGIE
Otto- als auch Dieselmotor n
äher am jeweiligen idea-
len Lastpunkt betreiben. Dementsprechend kann der
Riemen-Starter-Generator auf 12‑Volt-Basis den Kraft Quelle: Volkswagen AG
stoffverbrauch senken. Diese wird in der Batterie gespeichert und steht bei kom-
menden Beschleunigungsvorgängen zur Verfügung. Zu-
Das 48‑Volt-Bordnetz sätzlich kann die Batterie elektrische Verbraucher speisen
Mit einem neuen 48‑Volt-Teilbordnetz wird der Mild- und den Motor vom Antrieb des Generators entlasten.
Hybrid noch leistungsstärker. Die Lithium-
Ionen-
Batterie hält hier 10 Amperestunden Stromkapazität
bereit, der Riemen-Starter-Generator leistet jedoch MI LD-HYB RI D-KONZEPTE sind mit Diesel- und Otto
12 Kilowatt – was weitere Verbrauchseinsparungen motor möglich: Das Gesamtsystem senkt den Kraftstoff-
möglich macht. Mit 48 Volt lassen sich die gleichen verbrauch und die Emissionen des Verbrenners.
Mild-Hybrid-Funktionen darstellen wie mit 12 Volt,
aber in erhöhtem Umfang – die Segelphase mit aus-
geschaltetem Verbrennungsmotor kann beispiels- STÄRKEN
weise bis zu 30 Sekunden dauern. > Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zum Verbrennungsmotor
Über die Hybridisierung hinaus bietet das ohne Mild-Hybrid-Technologie
48‑Volt-Netz zahlreiche weitere Vorteile. Seine höhe- > Batterieaufladung durch Bremsenergierückgewinnung
re Spannung lässt viel geringere Leitungsquer- > Riemen-Starter-Generator unterstützt Motor
schnitte zu, was das Gewicht des Kabelsatzes ebenso > Bei Otto- und Dieselmotor einsetzbar
verringert wie die Verlustleistung. Vor allem aber
kann es viermal so viel Leistung bereitstellen wie EI NSCH RÄN KU NGEN
das 12‑Volt-Netz, damit macht es völlig neue, attrak- > Höhere Anschaffungskosten als bei konventionellen Motoren
tive Technologien für Antrieb und Fahrwerk mög- > Rein elektrischer Betrieb nicht möglich
lich.Der passende Antrieb für den Fuhrpark 6 VERSION 1.0 12/2018
ERDGASMOTOR KOSTEN 1) in Euro pro Kilogramm Erdgas oder Erdgas
Da der Kraftstoff Erdgas (Compressed Natural Gas, äquivalent in Deutschland
CNG) bereits gasförmig in den Ottomotor gelangt,
verbrennt er effektiv und sauber. Seine hohe Oktan- 2,024
zahl 130 macht effiziente Verbrennungsprozesse 1,512
Erdgas hat einen höheren
möglich. Im Vergleich zu einem Benzinmotor, der 1,080 Energiegehalt als andere
mit Superbenzin 95 betrieben wird, emittiert der Kraftstoffe, ein Kilogramm
CNG-Motor etwa 20 Prozent weniger Kohlendioxid entspricht ungefähr 1,5
(CO₂). Außerdem entstehen bei der Verbrennung Liter Benzin beziehungs-
von Erdgas deutlich weniger Feinstaub und andere CNG BENZIN DIESEL weise 1,3 Liter Diesel.
Schadstoffe als bei konventionellen Kraftstoffen. Be-
sonders interessant für städtische Umweltzonen:
CNG-Antriebe zeichnen sich durch sehr geringe Ge-
räusch- und Stickoxid-Emissionen (NOX) aus. KRAFTSTOFFKOSTEN PRO KILOMETER in Euro-Cent
Wichtig beim Betrieb von Erdgasfahrzeu- für ein typisches Flottenfahrzeug der Kompakt
gen ist die Betrachtung der Tankinfrastruktur: In klasse (DE) unter Betrachtung der durchschnitt
Deutschland stehen aktuell etwa 900 Stationen zur lichen Primärkraftstoffkosten 1)
Verfügung, im Vergleich zu Benzin und Diesel ist also
ein strategischeres Vorgehen in puncto Verfügbarkeit OTTOMOTOR 6,6
und Reichweite erforderlich. Allerdings gilt: Ist das DIESELMOTOR 5,0
Gas aufgebraucht, schaltet das Fahrzeug automatisch ERDGASMOTOR 3,9
auf Benzin um – und die Fahrt geht ohne Stopp für PLUG-IN-HYBRID 3,6
etwa 190 Kilometer weiter (siehe Reichweitenver- ELEKTROMOTOR 4,2
09/2018
gleich für ein typisches Flottenfahrzeug der Kom-
paktklasse auf Seite 4). Übrigens: Über 12 Prozent der
deutschen CNG-Tankstellen werden schon heute mit
reinem Bio-CNG aus Abfällen versorgt. DER ERDGASMOTOR bietet sich für kurze und mittellange
Strecken an.
Gas im Tank?
Um das Erdgas im Fahrzeug transportieren zu kön-
nen, wird es unter hohem Druck (200 bar) verdichtet STÄRKEN
und in spezielle Unterflur-Gastanks gepresst. Diese > Günstiger Kraftstoff
sind nach höchsten Branchenstandards konstruiert > Sparsam im Verbrauch
und für einen Maximaldruck von mindestens 450 bar > Bessere CO2-Bilanz und geringere Emissionen
ausgelegt. Im unwahrscheinlichen Fall eines Feuers als Otto- und Dieselmotor
lässt zudem ein Sicherheitsventil das Erdgas kontrol-
liert an die Außenluft ab. Übrigens: Auch das Erdgas- EI NSCH RÄN KU NGEN
tanken ist dank spezieller Sicherheitszapfhähne sehr > Hohe Anschaffungskosten
sicher – und komfortabel: Die Marken des Volkswagen > Noch lückenhafte Tankinfrastruktur
Konzerns verbauen Universal-Füllstutzen, die europa-
Der Berechnung liegen Durchschnittspreise für das Jahr 2017 zugrunde.
1)
weit genutzt werden können. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.Der passende Antrieb für den Fuhrpark 7 VERSION 1.0 12/2018
PLUG-IN-HYBRID (PLUG-IN-HYBRID ELECTRIC VEHICLE, PHEV)
In einem Plug-in-Hybrid arbeiten ein Verbrennungs- und ein Elektromotor zusammen. Der Energiespeicher
des Fahrzeugs wird während der Fahrt per Rekuperation oder beim Parken über das Stromnetz via Lade
kabel aufgeladen. Mit dieser Maßnahme kann der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
Im Stadtverkehr – speziell bei Verkehrseinschränkungen für Verbrennungsmotoren – kann der
Plug-in-Hybrid mit seinem elektrischen Antrieb emissionsfrei fahren. Auf längeren Fahrstrecken macht der
Verbrennungsmotor höhere Reichweiten möglich.
DER PLUG-I N-HYB RI D eignet sich vor allem für Pendel- und gelegentliche Langstreckenfahrten; seine Batterie
ermöglicht es lokal emissionsfrei zu fahren.
STÄRKEN EI NSCH RÄN KU NGEN
> Kraftstoffeinsparungen durch rein elektrischen Teilbetrieb > Höhere Anschaffungskosten als bei konventionellen Motoren
und Hybridfunktion > Ladeinfrastruktur nötig
> Lokal rein elektrischer Fahrbetrieb möglich > Für mehr Speicherkapazität sind größere Batterien nötig –
> Hohe Systemleistung durch zwei Teilantriebe diese führen zu einem höheren Gesamtgewicht
VERGLEICH DER KOH LEN DIOXI DEMISSION in g/km am Beispiel eines typischen Flottenfahrzeugs der Kompaktk l asse (DE)
unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Primärkraftstoffverbrauchs
BENZINMOTOR
DIESELMOTOR
ERDGASMOTOR
PLUG-IN-HYBRID
ELEKTROMOTOR
Betrachtungsweise Tank-to-Wheel. Die Balken dienen als Indikatoren für die kombinierten CO2-Emission des jeweiligen Motors in Abhängigkeit von Hubraum und Leistung. Stand 09/2018
234
Ladepunkte – die Infrastruktur in Deutschland 69
In Deutschland gibt es derzeit rund 6.060 öffentlich zu- 402
gängliche Ladepunkte für Elektroautos. Die Bundes- 38 81
534
netzagentur stellt seit dem Jahr 2017 eine Übersichts- 329
karte zur Verfügung, mit deren Hilfe Fahrer von 85
Elektro- und Plug-in-Fahrzeugen mögliche Ladepunkte 1034
in ihrer Nähe finden können: www.bundesnetzagentur. 195
498 200
de/ladesaeulenkarte
Joint-Venture: IONITY ist ein Gemein- 264
schaftsprojekt der BMW Group, der Daimler AG, der
Ford Motor Company und des Volkswagen Konzerns
9
zum Ausbau eines Netzes von Schnellladestationen 1262
826
entlang der Autobahnen mit bis zu 350 kW Leistung.
Bis zum Jahr 2020 sollen insgesamt 400 IONITY Stati-
onen in 25 Ländern zur Verfügung stehen, davon 340
allein in Europa – und wiederum 100 in Deutschland. Quelle: IONITY, Stand 10/2018 Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 10/2018Der passende Antrieb für den Fuhrpark 8 VERSION 1.0 12/2018
ELEKTROMOTOR WI RKU NGSGRADE 1) von Ver-
Elektrofahrzeuge überzeugen mit einer Vielzahl von positiven Eigenschaf- brennungs- und Elektromotoren
ten, die sie beispielsweise in umweltpolitischer Hinsicht interessant ma-
chen: Elektrisch betriebene Automobile emittieren keinerlei Schadstoffe
wie etwa NOX – und bieten sich aus diesem Grund auch für den Einsatz in Benzinmotor ca. 35 %
Städten sowie Metropolregionen an, und dort insbesondere in Umweltzo- Dieselmotor ca. 40 %
nen oder von Fahreinschränkungen betroffenen Gebieten. Um den ökologi- Erdgasmotor ca. 45 %
schen Vorteil optimal auszuspielen, ist die Verwendung von Strom aus re- Elektromotor < 90 %
generativen Quellen zu empfehlen. Dadurch lässt sich der klimatische
Fußabdruck eines E-Fahrzeugs nochmals verkleinern. Da Elektrofahrzeuge
im Gegensatz zu konventionell angetriebenen Autos weniger Raum für den
Antrieb benötigen, sehen die Konzepte des Volkswagen Konzerns im In- STROM-MIX in Deutschland
nenraum mehr Platz für den Nutzer vor. Darüber hinaus besitzen Elektro-
antriebe einen hohen Wirkungsgrad (kleiner als 90 Prozent) und zeigen
sich im Vergleich zu Verbrennern aus dem Stand heraus durchzugsstark. 22,5 % Braunkohle
Übrigens werden Elektrofahrzeuge bald für deutsche User-Chooser noch 14,1 % Kernenergie
interessanter, da die sogenannte Ein-Prozent-Regel bei der Privatnutzung 11,7 % Steinkohle
für Elektroautos und Hybridfahrzeuge ab 2019 auf ein halbes Prozent sinkt. 13,2 % Erdgas
6,0 % Sonstige 2017
Fördermaßnahmen 16,3 % Windkraft
Für Elektrofahrzeuge sind länderspezifisch unterschiedliche Fördermaß- 3,1 % Wasserkraft
nahmen möglich, beispielsweise der Umweltbonus in Deutschland: Dabei 6,1 % Photovoltaik
unterstützen die Automobilhersteller den Käufer finanziell. Dieser profi- 7,0 % Biomasse
tiert beim Neuerwerb eines Modells von bis zu 4.000 Euro Zuschuss: Plug-
Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesministeri-
in-Hybride erhalten 1.500 Euro, reine Elektrofahrzeuge sogar 2.000 Euro. um für Wirtschaft und Energie; Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft e.V.; Statistik der
Mit jeweils der gleichen Summe fördert das Bundesamt für Wirtschaft und Kohlenwirtschaft e.V.; Zentrum für Sonnenenergie-
und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Ausfuhrkontrolle die Elektromobilität – aktuell noch bis zum 30. Juni 2019 (ZSW); AG Energiebilanzen e.V.
und unter Berücksichtigung der gültigen Regularien.
DER ELEKTROMOTOR für kurze und mittellange Strecken an. Ideal für den innerstädtischen Einsatz.
STÄRKEN EI NSCH RÄN KU NGEN
> Maximales Drehmoment bereits beim Anfahren > Noch geringe Reichweite
> Geringe Betriebskosten (lange Lebensdauer, geringe Wartung) > Noch lückenhafte Ladeinfrastruktur
> Einfacher Aufbau und hoher Fahrkomfort (kein Kuppeln und Schalten) > Noch eingeschränkte Verfügbarkeit (lange Ladezeiten)
> Temporäre Befreiung von der Kfz-Steuer in Deutschland > Noch höhere Anschaffungskosten, etwa wegen Batterie
> Geringerer Steuersatz bei privater Nutzung (ab 1.1.2019) > Eventuell Kosten für eigene Ladeinfrastruktur
KFZ-STEU ER In Euro am Beispiel eines typischen Flotten-
fahrzeugs der Kompaktklasse in Deutschland L ADEN – AB ER WOMIT? 3)
Immer mehr Elektrofahrzeuge sind mit dem
Quelle: Bundesministerium für Finanzen „Combined Charging System (CCS)“ ausgestattet,
€
DIESELMOTOR 222 das verschiedene Ladeoptionen unterstützt:
€ BENZINMOTOR 72
ERDGASMOTOR 34 HAUSHALTSSTECKDOSE4) (2,3 kW) ca. 17 h
€ PLUG-IN-HYBRID 28 WALLBOX (7,2 kW)
4)
ca. 6 h
€ ELEKTROMOTOR 2) 0 CCS LADESTATION4,5) (40 kW) ca. 45 min
Der Wirkungsgrad eines Motors gibt das Verhältnis zwischen abgegebener Bewegungsenergie und aufgenommener Leistung an.
1)
Elektrofahrzeuge sind bei Erstzulassung bis zum 31.12.2020 für eine Dauer von zehn Jahren von der Steuer befreit. 3)Kalkulatorischer Wert; abhängig von Alter, Temperatur und
2)
Ladezustand der Batterie. 4)Ladezeiten für ein typisches Flottenfahrzeug der Kompaktklasse. 5) Nach 45 Minuten ist die Batterie zu 80 Prozent geladen.Der passende Antrieb für den Fuhrpark 9 VERSION 1.0 12/2018
WLTP und RDE – ein Überblick
WORLDWIDE HARMONIZED LIGHT-DUTY VEHICLES TEST PROCEDURE (WLTP)
Der Leitgedanke für das am 1. September 2017 in Europa und den Anwenderstaaten eingeführte Testverfah-
ren WLTP ist die realitätsnähere Erfassung von Verbrauchs- und Abgaswerten. Im Rahmen der Typprüfung
für neu entwickelte Pkw-Modelle und leichte Nutzfahrzeuge der Kategorie N1 Klasse I werden die Ver-
brauchs- und CO2-Werte nach WLTP mittels eines 30-minütigen Fahrzyklus repräsentativ und international
vergleichbar ermittelt.
Seit dem 1. September 2018 müssen alle neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge der Kategorie
N1 Klasse I unter WLTP typgeprüft sein. Zudem sind Hersteller leichter Nutzfahrzeuge verpflichtet, die Typ-
prüfung für neu entwickelte Fahrzeuge der Kategorien N1 Klasse II und III sowie für Fahrzeuge der Kategorie
N2 nach WLTP vorzunehmen. Ab dem 1. September 2019 müssen Hersteller leichter Nutzfahrzeuge, für alle
Fahrzeuge der Kategorie N1 Klasse II und III sowie für Fahrzeuge der Kategorie N2 die Verbrauchs- und Abgas-
werte nach WLTP ausweisen.
ANGABE VON WLTP-WERTEN
Die Typengenehmigung nach WLTP für neue Modelle ist seit September 2017 durch die Europäische Kommis
sion in den 28 europäischen Mitgliedsstaaten vorgeschrieben. Wann die WLTP-Werte im Rahmen der Ver-
brauchskennzeichnung gegenüber dem Kunden auszuweisen sind, ist Sache der Mitgliedsstaaten und noch
nicht abschließend für jedes Land festgelegt. Verpflichtend ist die Angabe der Werte zunächst im Certificate of
Conformity (CoC), welches auch als EG-Übereinstimmungsbescheinigung bezeichnet wird. Da bis Ende 2020
sowohl der NEFZ- als auch der WLTP-Wert im CoC angegeben werden, ist ein Vergleich zwischen WLTP und
NEFZ grundsätzlich möglich. Dies ist jedoch nicht zielführend, da beide Werte durch unterschiedliche Prüf-
verfahren ermittelt werden. Ähnlich verhält es sich auch mit der Besteuerung, hier obliegt die Verantwortung
in jedem EU-Mitgliedsstaat. In einigen Mitgliedsstaaten – zum Beispiel Deutschland – wurde bereits am
1. September 2018 die Besteuerung auf Basis der WLTP-CO₂-Werte umgestellt.
REAL DRIVING EMISSIONS (RDE)
Die Einführung erfolgt in zwei Stufen. RDE (I): Ab September 2019 gültig für alle neu zugelassenen Pkw-
Modelle. NOX-Emissionen dürfen maximal den 2,1-fachen Wert (Konformitätsfaktor [CF]) des unter NEFZ be
ziehungsweise WLTP ermittelten Wertes betragen. RDE (II): Ab Januar 2020 gültig für alle neu typgeprüften
Pkw-Modelle. NOX-Emissionen dürfen maximal die gleiche Höhe des NOX-Laborwerts (bei Berücksichtigung
der Messtoleranz von 0,43 = Maximalwert 1,43) betragen. Ab Januar 2021 gültig für alle neu zugelassenen
Fahrzeuge.
Hinweis: Für die Partikelanzahl gilt für alle neu zugelassenen Fahrzeuge seit September 2018 der Laborwert auch
auf der Straße (bei Berücksichtigung der Messtoleranz von 0,5 = Maximalwert 1,5).10
Entscheidungsfindung
WIE FÜHRT DER „FLEET FUNNEL“ ZUM GEEIGNETEN ANTRIEB?
Mit diesem Analyse-Tool sind fünf Themenfelder visualisiert, die während
des Entscheidungsprozesses durchlaufen werden sollten.
DABEI STELLEN SICH VERSCHIEDENE FRAGEN, BEISPIELSWEISE:
Welches
EINSATZZWECK Nutzungsprofil
besitzt das
benötigte Fahrzeug?
EXTERNE EINFLÜSSE
Welche Faktoren wirken
sich auf den Fuhrpark aus?
INTERNE ANFORDERUNGEN Welche Ziele sollen
mit der Car-Policy
UND VORGABEN erreicht werden
(z. B. CO2-Neutralität)?
TOTAL COST OF
Wie stellen sich die OWNERSHIP (TCO)
Gesamtkosten des Fahrzeugs dar?
Welche persönlichen Vorlieben hat der Nutzer
USER-CHOOSER (z. B. auch Akzeptanz der Technik)? Bewegen sich
eventuelle Kosten im persönlichen Budget
rahmen (z. B. die Besteuerung bei Privatnutzung)?
ERGEBNIS
Mit Hilfe des „Fleet Funnel“ ist die präzise Bestimmung
der passenden Antriebsarten möglich.Der passende Antrieb für den Fuhrpark 11 VERSION 1.0 12/2018
DIE FÜNF ANTRIEBSARTEN IM PRAXIS-CHECK
Welche Antriebsform die richtige ist, hängt von den Nutzergruppen und deren Mobilitätsprofilen ab: Fahren
beispielsweise Servicemitarbeiter meist kurze Strecken in der Stadt, ergeben Dieselfahrzeuge keinen Sinn. Hier
sind Benziner, Mild- oder Plug-in-Hybride geeigneter, in Anbetracht möglicher Fahreinschränkungen sogar
batterieelektrische Fahrzeuge. Ein moderner Dieselmotor sei aber weiterhin „die beste Lösung gerade für die
jenigen, die vor allem lange Überlandstrecken fahren“, sagt Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut für
Technologie (KIT). Für die Zukunft hofft Koch auf einen „vernünftigen Mix an Antrieben, in dem auch der
Diesel weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird“.
OTTOMOTOR DI ESELMOTOR ERDGASMOTOR
KURZ STRECKENLÄNGE LANG KURZ STRECKENLÄNGE LANG KURZ STRECKENLÄNGE LANG
WENIGE STARTS/STOPPS VIELE WENIGE STARTS/STOPPS VIELE WENIGE STARTS/STOPPS VIELE
NIEDRIG URBANER ANTEIL HOCH NIEDRIG URBANER ANTEIL HOCH NIEDRIG URBANER ANTEIL HOCH
NIEDRIG AUTOBAHNANTEIL HOCH NIEDRIG AUTOBAHNANTEIL HOCH NIEDRIG AUTOBAHNANTEIL HOCH
PLUG-I N-HYB RI D ELEKTROMOTOR 1) ANTRIEBSCHECK
Diese beispielhaften Darstellungen
KURZ STRECKENLÄNGE LANG KURZ STRECKENLÄNGE LANG
greifen das tägliche Mobilitätsverhalten
WENIGE STARTS/STOPPS VIELE WENIGE STARTS/STOPPS VIELE auf – und stellen verschiedene Faktoren
für Einsatzszenarien dar. Welche Strecken
NIEDRIG URBANER ANTEIL HOCH NIEDRIG URBANER ANTEIL HOCH
sind relevant? Wie wird das Fahrzeug
NIEDRIG AUTOBAHNANTEIL HOCH NIEDRIG AUTOBAHNANTEIL HOCH genutzt? Sind dabei Stadtfahrten üblich
KURZ PARKZEITEN 2)
LANG KURZ PARKZEITEN 2)
LANG – oder doch eher Überland- und Auto-
bahnrouten?
1)
Der gestrichelte Balken zeigt die perspektivische Entwicklung bis zum Jahr 2020 auf.
2)
Die Parkzeiten sind für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride wichtig, da sie während dieser Phasen geladen werden können.
EINSATZZWECK: WIE GESTALTET SICH DAS FAHRPROFIL?
Oder anders gefragt: Wofür nutzt der Mitarbeiter sein Auto? Darf er es beruflich und privat verwenden? Handelt
es sich um einen Dienstwagen oder ein Poolfahrzeug? Hier spielen klimatische und topografische Bedingungen
ebenso eine Rolle wie das Einsatzgebiet (innerorts, Autobahn …), die benötigten Reichweiten, die Gesamtlauf-
leistung oder einfach die Dauer der Standzeiten des Fahrzeugs. Aus dem Praxisalltag heraus lassen sich Fall-
beispiele mit verschiedenen Fahrprofilen skizzieren.
DER DI ENSTWAGEN B ERECHTIGTE Geschwindigkeit in km/h, im Verlauf eines durchschnittlichen Arbeitstages
GESCHWINDIGKEIT
120
80
40
0
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 hDer passende Antrieb für den Fuhrpark 12 VERSION 1.0 12/2018
Kurze Überlandfahrt zur Arbeit, kaum Fahrintervalle und lange Stand
zeiten kennzeichen am Ende des Tages das Fahrprofil. ANTRIEB, DER IN DIESES FAHRPROFIL
PASST: ELEKTROMOTOR.
Aber: Der Mitarbeiter darf das Fahrzeug auch privat nutzen. Deshalb
möchte er damit von Zeit zu Zeit in den Urlaub fahren oder die entfernt ANTRIEBE, DIE JETZT IN DIESES FAHRPROFIL
lebende Familie besuchen. Für die langen Strecken mit kurzen Stand- PASSEN: PLUG-IN-HYBRID, BENZINER ODER
zeiten steht die Option der Ersatzmobilität nicht zur Verfügung. ERDGASANTRIEB.
DER AUSSEN DI ENSTMITARB EITER Geschwindigkeit in km/h, im Verlauf eines durchschnittlichen Arbeitstages
GESCHWINDIGKEIT
120
80
40
0
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h
Wenige Kundenbesuche pro Tag, allerdings mit langen Streckenabschnit- ANTRIEB, DER IN DIESES FAHRPROFIL
ten zwischen den Terminen. Die Gespräche dauern in der Regel maximal PASST: DIESELMOTOR – AB 2020 NACH
eine Stunde. Am Abend möchte der Mitarbeiterr wieder zuhause sein. GENAUER ANALYSE DES FAHRPROFILS
Der User-Chooser nutzt das Fahrzeug zudem regelmäßig für längere AUCH DER ELEKTROMOTOR.
Urlaubsfahrten.
I H R MITARB EITER Geschwindigkeit in km/h, im Verlauf eines durchschnittlichen Arbeitstages
GESCHWINDIGKEIT
120
80
40
0
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h
Wie sieht das persönliche Fahrprofil Ihres Dienstwagenfahrers
aus? Skizzieren Sie hier beispielhaft den Arbeitsalltag Ihrer Mit- HINWEIS: BEZIEHEN SIE IHRE MITARBEI-
arbeiter und finden Sie heraus, welcher Antrieb zu ihren indivi- TER BEI DER ERSTELLUNG MIT EIN, DAS
duellen Fahrprofilen passt. Daraus werden voraussichtlich meh- SCHAFFT TRANSPARENZ UND VERSTÄNDNIS
rere Fahrprofile für Ihren Fuhrpark entstehen. FÜR IHRE ENTSCHEIDUNGEN.Der passende Antrieb für den Fuhrpark 13 VERSION 1.0 12/2018
EXTERNE EINFLÜSSE: WELCHE FAKTOREN WIRKEN SICH AUF DEN FUHRPARK AUS?
FAKTOREN, DI E EI N U NTERN EHMEN N ICHT SELBST B EEI N FLUSSEN KAN N
Beispiele auf Basis des Flottenmarkts Deutschland (hilfreiche Links dazu auf Seite 16)
WLTP
Tank-/Ladeinfrastruktur Umweltzonen Grenzwerte Normen
INTERNE VORGABEN: WAS SAGT ZUM BEISPIEL DIE CAR-POLICY?
Oder umfassender gefragt: Welche Faktoren bestehen, die ein Unternehmen selbst bestimmen und gegebenen-
falls anpassen kann? Einer der wichtigsten ist hier selbstverständlich die Car-Policy. Darin werden etwa die Aus-
wahlmöglichkeiten für Dienstwagenfahrer und User-Chooser, aber auch Verhaltensregeln festgelegt. Außerdem
steuert sie gegebenenfalls die im Unternehmen festgelegten CO2-Obergrenzen. Ein Blick genügt also, um ab-
schätzen zu können, ob ein bestimmter Antrieb überhaupt relevant ist. Hierbei können beispielsweise auch
strategische Unternehmensziele und Vorgaben hinsichtlich der Total Cost of Ownership (TCO) zum Tragen
kommen. Es gilt, die internen Faktoren zu identifizieren und zu gewichten. Zudem spielen mögliche individuel-
le kommunale und städtische Fahreinschränkungen eine Rolle, weil auch der CO2- und Feinstaubausstoß der
Fahrzeuge relevant ist.
Beispiel Deutschland: Car-Policy an WLTP anpassen
Zwar bleiben die Emissionen eines getesteten Fahrzeugs unverändert, sie werden mit dem neuen Abgasmess-
verfahren WLTP aber realitätsnäher – und damit höher – ausgewiesen. Unternehmen, deren Fuhrparks mit
Hilfe CO2-gestützter Richtlinien gesteuert werden, sollten eine Bestandsanalyse durchführen und die Nut-
zungsprofile identifizieren, die für eine nutzergruppenspezifische Car-Policy benötigt werden, um dement-
sprechend Veränderungen einfließen zu lassen. Folgende Anpassungsszenarien sind denkbar:
Die festgelegte CO₂-Höchstgrenze in der Car-Policy beibehalten.
Durch die Einführung des neuen Typprüfverfahrens sind die ausgewiesenen CO₂-Werte höher als bisher. Bei einer
definierten Obergrenze, die nicht überschritten werden darf, können so einige Modelle nicht mehr auswählbar
sein. Bei einer Durchschnittsbetrachtung gilt es, den Fahrzeugmix so zu steuern, dass die Fahrzeuge für eine Nut-
zergruppe oder das Unternehmen unterhalb der geforderten CO₂-Grenze liegen. Alternative Antriebe wie zum
Beispiel Erdgasfahrzeuge, Plug-in-Hybride und insbesondere Elektroautos können dabei positiv wirken. Bei Car-
Policies mit Bonus-Malus-Regelungen kann eine CO2-Höchstgrenze für den User-Chooser direkte Auswirkungen
auf den Nutzer haben: Da im Rahmen der WLTP-Prüfung auch Zusatzausstattungen – aufgrund von Gewicht und
Aerodynamik – den CO₂-Wert beeinflussen, kann es hilfreich sein, diese in die Car-Policy aufzunehmen.
Die CO₂-Höchstgrenze entsprechend der neuen Messergebnisse erhöhen.
Die Anpassung der CO₂-Grenze in der Car-Policy an die durchschnittlichen Veränderungen der CO₂-Emissionen
(durch Einführung von WLTP) ermöglicht das Beibehalten des bisherigen Modellangebots. Da in Deutschland
ab dem 1. September 2018 die CO₂-Werte nach WLTP zur Festsetzung der Steuer herangezogen werden, sorgen
höher ausgewiesene Emissionen für höhere Steuerausgaben.
Auf eine andere Messgröße wechseln, beispielsweise die Leistung (kW).
Die Modellvarianz kann den Nutzungsprofilen entsprechend ausgestaltet werden. Im Rahmen der Car-Policy
gibt es verschiedene Kriterien, um für eine Nutzergruppe die wählbaren Fahrzeugmodelle zu definieren. Ex-
emplarisch seien hier Hubraum und Anschaffungskosten genannt.Der passende Antrieb für den Fuhrpark 14 VERSION 1.0 12/2018
ZUSÄTZLICHE PARAMETER FÜR DIE CAR-POLICY IDENTIFIZIEREN, BEISPIELSWEISE:
CoC
Kosten Strategie Image Verhaltenskodex Motivation Recruitment
TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO): BEWEGEN SICH DIE KOSTEN IM RAHMEN?
Das A und O bei der Anschaffung eines Firmenwagens sind nach wie vor die TCO – auch beim Durchlaufen des
„Fleet Funnel“. Für die Berechnung dieser Kosten sind sowohl bei konventionellen als auch bei alternativen
Antrieben die relevanten Variablen individuell zu betrachten. Dabei lassen sich die TCO in Anschaffungskos-
ten (zum Beispiel Abschreibung, Finanzierung und Erwerbssteuer) sowie Unterhaltskosten (dazu gehören un-
ter anderem Versicherungen, Kraftstoffkosten und Service) unterteilen.
WORAUF IST BEI DER BESTIMMUNG ZU ACHTEN?
Auf den ersten Blick geben die Anschaffungskosten am schnellsten wieder, welches Fahrzeug günstig ist.
Wichtiger als die reinen Anschaffungskosten sind für den Flottenmanager allerdings die Gesamtkosten
(TCO) – denn bei deren Betrachtung wird erst deutlich, wie sich die Fahrzeugkosten über die gesamte Halte-
dauer entwickeln. Durch bestimmte Einflussfaktoren wie beispielsweise einen guten Restwert oder gerin-
gen Verbrauch kann dann ein Fahrzeug mit hohem Listenpreis schlussendlich weniger kosten als ein ver-
gleichbares Fahrzeug mit niedrigem Listenpreis.
Auf die Gesamtkosten (TCO) wirken sich zudem länderspezifische Faktoren aus, beispielsweise
Steuern, aber auch individuelle Förderungen und staatliche Subventionen; in Deutschland haben etwa Un-
ternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die elektrisch betriebene leichte Nutzfahrzeuge oder Pkw beschaf-
fen wollen, die Chance auf einen Investitionszuschuss im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“.
Das individuelle Nutzungsprofil lässt sich
zwar nur bedingt beeinflussen, trotzdem lohnt ein T C O Z U S A M M E N S E T Z U N G eines typischen Flotten-
Blick auf die Fahrbilanz der Mitarbeiter: Nach wel- fahrzeugs der Kompaktklasse (DE) bei einer Laufzeit von 36
cher Kilometerleistung muss das Fahrzeug zum Monaten und einer Laufleistung von 90.000 Kilometern
Service? Ist ein Satz Reifen über die gesamte Halte-
dauer ausreichend? Diese Fragen vermitteln einen
Eindruck der Stellschrauben, an denen der Fuhr- Abschreibung
parkleiter ebenfalls noch drehen kann. Kraftstoff
Finanzierung
Erwerbssteuer
Versicherung
DIESEL
WEITERE INFORMATIONEN ZUM THEMA Steuer
TCO FINDEN SIE IN DEM BEITRAG „ZEIT ZUM Verschleiß
UMDENKEN“ DER FACHZEITSCHRIFT FLOTTEN Service
MANAGEMENT VOM JANUAR 2018. Reifen
SIEHE DAZU SEITE 16.
Quelle: Autovista Group, 11/2018Der passende Antrieb für den Fuhrpark 15 VERSION 1.0 12/2018
USER-CHOOSER: GIBT ES PERSÖNLICHE PRÄFERENZEN?
An dieser Stelle des „Fleet Funnel“ ist die Entscheidung für einen möglichen Antrieb schon sehr weit gediehen.
Einen Parameter gilt es aber noch zu definieren: Was sagt der Mitarbeiter? Bestehen persönliche Vorlieben
oder Anforderungen an das Fahrzeug, die beachtet werden müssen oder einfließen sollen? Schließlich ist er
regelmäßig mit dem Fahrzeug unterwegs, muss gegebenenfalls seine täglichen Routinen überdenken und sein
Fahrverhalten einer neuen Infrastruktur anpassen. Ist er dazu bereit? Oder stellt er andere Anforderungen?
Wird er den gewählten Antrieb mittragen? Oder versteht er sich sogar als „First-Mover“?
Übrigens: Für Dienstwagenfahrer können alternative Antriebe auch dank steuerlicher Vorteile attraktiv sein. S o
bestimmen etwa in Großbritannien die CO₂-Emissionen den zu versteuernden Prozentsatz vom Fahrzeuglisten-
preis, in Deutschland halbiert der Gesetzgeber ab 2019 die Bemessungsgrundlage speziell für private Dienst-
wagennutzer von Elektroautos und Hybridfahrzeugen.
AKZEPTANZ VON ALTERNATIVEN ANTRI EB EN Prozentualer Anteil ALTERNATIVE ANTRI EB E Prozentualer
von Fuhrparks (EU 28), in denen Hybride, Plug-in-Hybride, Erdgas- Anteil der Neuzulassungen auf dem Flotten-
oder Elektrofahrzeuge bereits eingeführt wurden oder eingeplant sind markt am Beispiel Deutschland
30 % 6%
20 % 4%
10 % 2%
0% 0%
BEL CHE DEU ESP FRA GBR ITA LUX NLD PRT 2016 2017 2018
Quelle: CVO, Arval/CSA Research, 2017 Quelle: Dataforce (Pressemitteilung 2018)
WAS IST DEM USER-CHOOSER WICHTIG? MÖGLICHE EINFLUSSFAKTOREN:
Fahrspaß Image Geldwerter Komfort/Ausstat- Tank- und Lade- Raumangebot
Vorteil tung/Sicherheit infrastruktur16
Weiterführende Links
Förderungen Tankinfrastruktur Umweltzonen
FÖRDERUNGEN FÜR ERDGAS- TANKSTELLEN/STROM (EU) UMWELTZONEN (EU)
FAHRZEUGE www.e-tankstellen-finder.com www.urbanaccessregulations.eu
https://www.erdgas.info/erdgas-
mobil/erdgas-fahren-rechnet-sich/
foerderung-erdgas-fahrzeuge/ TANKSTELLEN/ERDGAS (DE) UMWELTZONEN (DE)
www.erdgas.info http://gis.uba.de/website/
umweltzonen/index.html
FÖRDERUNGEN FÜR E-FAHRZEUGE
(UMWELTBONUS) TANKSTELLEN/STROM (DE)
www.bafa.de/DE/Energie/ https://www.bundesnetzagentur.
Energieeffizienz/Elektromobilitaet/ de/DE/Sachgebiete/
elektromobilitaet_node.html ElektrizitaetundGas/
Unternehmen_Institutionen/
https://www.foerderinfo.bund.de/ HandelundVertrieb/
elektromobilitaet Ladesaeulenkarte/Karte/
Ladesaeulenkarte-node.html
Informationen
FÖRDERPROJEKT ZUR EINBINDUNG www.goingelectric.de/
GEWERBLICHER ELEKTROFAHR- stromtankstellen/
ZEUGE IN DER LOGISTIK-, ENERGIE- WLTP
UND MOBILITÄTSINFRASTRUKTUR www.plugsurfing.com/de/privat- www.volkswagenag.com/de/
www.digitale-technologien.de/DT/ kunden/ladestations-karte.html group/fleet-customer/WLTP.html
Navigation/DE/
Foerderprogramme/IKT-EM-3/
ikt-em-3.html FLOTTENMANAGEMENT CNG
https://www.flotte.de/files/ www.discover-cng.com
newspapers/2018/1/pdf/051-53_
FÖRDERPROGRAMM DER TCO.pdf www.gibgas.de
BUNDESREGIERUNG ZUR
ELEKTROMOBILITÄT
http://www.schaufenster- SIE BENÖTIGEN UNTERSTÜTZUNG IM ENTSCHEIDUNGSPROZESS?
elektromobilitaet.org/de/ Ihr zuständiger Großkundenberater der Volkswagen AG oder die zertifizierten
content/index.html Fuhrparkmanagementberater der Konzernmarken sind gern für Sie da.
Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch.
WEITERE INFORMATIONEN ZUM GROSSKUNDENGESCHÄFT
DER VOLKSWAGEN AG FINDEN SIE UNTER:
WWW.VOLKSWAGENAG.COM/DE/GROUP/FLEET-CUSTOMER.HTML© Volkswagen Aktiengesellschaft Volkswagen Group Fleet International, Brieffach 1324, 38436 Wolfsburg, Deutschland www.volkswagenag.com/de/group/fleet-customer.html Stand 12/2018 Änderungen vorbehalten
Sie können auch lesen