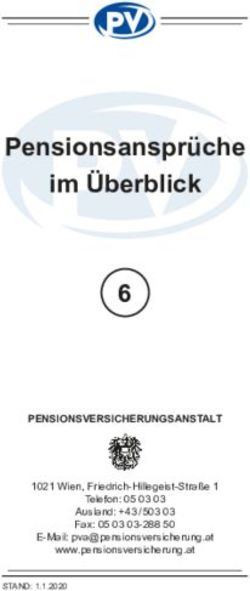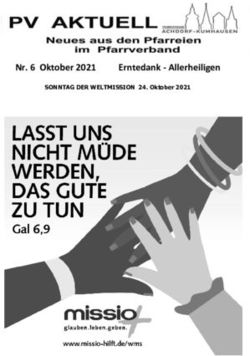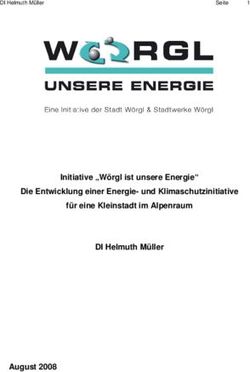Die nicht-kognitiven Aspekte der Hochbegabung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die nicht-kognitiven Aspekte der Hochbegabung
Tanja Catrin Blut Die nicht-kognitiven Aspekte der Hochbegabung Selbstkonzepte von hochbegabten Erwachsenen
Tanja Catrin Blut Abteilung Wirtschaft und Wissenschaft ARD (Deutsche Welle) Berlin, Deutschland Zgl. Dissertation an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2016/2019 ISBN 978-3-658-29986-6 ISBN 978-3-658-29987-3 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-658-29987-3 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral. Springer ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature. Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ..................................................................................... 1
2 Begriffsklärung und Stand der Forschung ................................... 9
2.1 Theoretische Vorstellungen von Hochbegabungen ............. 9
2.1.1 Definitionen ............................................................. 9
2.1.2 Fähigkeitsorientierte Modellvorstellungen ............. 23
2.1.3 Kognitive Modellvorstellungen............................... 43
2.1.4 Prozessanalytische Modellvorstellungen .............. 54
2.1.5 Psychodynamische Modellvorstellungen .............. 58
2.1.6 Pseudobegabungen .............................................. 63
2.1.7 Genie und Irrsinn ................................................... 66
2.2 Selbstkonzept: Selbst und Selbstkonzept als
psychologische Konstrukte ............................................... 75
2.3 Ausgewählte Forschungsergebnisse zur Entwicklung
von Hochbegabten ............................................................ 82
2.3.1 Ergebnisse aus Studien ........................................ 82
2.3.2 Ergebnisse der domänenspezifischen
Forschung ............................................................. 89
2.3.3 Rahmenbedingungen der Entwicklung von
Hochbegabungen ................................................ 116
2.3.4 Die Erziehung und Förderung Hochbegabter...... 163
2.4 Forschungsergebnisse zum Selbstkonzept
Hochbegabter ................................................................. 193
3 Die Fragestellung der Untersuchung ....................................... 209VI Inhaltsverzeichnis
4 Material und Methoden ............................................................ 213
4.1 Erhebungsinstrumente ..................................................... 213
4.1.1 Der Fragebogen und seine Entwicklung ............. 213
4.1.2 Das Polaritätenprofil ............................................ 222
4.2 Auswertungsmethoden .................................................... 226
4.3 Stichprobenrekrutierung und Stichprobenbeschreibung .. 230
5 Ergebnisse ............................................................................... 241
5.1 Fragebogenauswertung ................................................... 241
5.1.1 Auswertung nach Häufigkeit der Antworten ........ 244
5.1.2 Unterschiede Frauen und Männer....................... 249
5.1.3 Faktorenanalyse .................................................. 252
5.2 Das Selbstbild im Polaritätenprofil ................................... 268
5.3 Taxonomie der Hochbegabten (Clusteranalyse).............. 294
6 Diskussion ............................................................................... 309
Anhang ....................................................................................... 325
Literaturverzeichnis .................................................................... 331Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Das hierarchische Selbstkonzept nach Shavelson,
Hubner und Stanton (1976). ....................................... 194
Abb. 2: Polaritätenprofil nach Bortz und Döring (1995) .......... 223
Abb. 3: Altersverteilung der Probanden .................................. 234
Abb. 4: Höchster erreichter Bildungsabschluss ...................... 235
Abb. 5: Anzahl der älteren Geschwister ................................. 236
Abb. 6: Anzahl der jüngeren Geschwister .............................. 236
Abb. 7: Anzahl der Geschwister ............................................. 237
Abb. 8: Position des Hochbegabten in der Geschwisterfolge . 238
Abb. 9: Berufliche Position...................................................... 238
Abb. 10: Familienstand ............................................................. 239
Abb. 11: Anzahl der eigenen Kinder ......................................... 240
Abb. 12: Profilvergleiche für das Selbstbild und das Idealbild .. 274
Abb. 13: Die Polaritätsprofile für das Selbstbild und die Angst. 276
Abb. 14: Die Polaritätenprofile für Selbstbild und Begabung .... 278
Abb. 15: Faktorendiagramm im rotierten Raum für die
Gesamtstichprobe ...................................................... 281
Abb. 16: Faktorendiagramm im rotierten Raum für die
Männer (rechts oben) ................................................. 286
Abb. 17: Faktorendiagramm im rotierten Raum für die Frauen
(rechts unten) ............................................................. 287
Abb. 18: Mittlere Faktorenladungen getrennt nach Clustern .... 297Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Selbsteinschätzung der Hochbegabten...................... 242
Tab. 2: Extrahierte der Faktoren nach Rotation ..................... 254
Tab. 3: Korrelationen der Faktorenwerte mit dem
Lebensalter................................................................. 260
Tab. 4: Standardisierte kanonische Diskriminanzfunktions-
koeffizienten für das Geschlecht ................................ 264
Tab. 5 Klassifizierungsergebnisse für das Geschlecht .......... 265
Tab. 6: Standardisierte kanonische Diskriminanzfunktions-
koeffizienten für den Bildungsgrad ............................. 267
Tab. 7: Klassifizierung nach Bildungsgrad ............................. 268
Tab. 8: Signifikante Interkorrelationen der Durchschnitts-
profile (p < .05) ........................................................... 273
Tab. 9: Faktorenanalyse der Polaritätenprofile für die
Gesamtstichprobe ...................................................... 279
Tab. 10: Rotierte Faktorenmatrix für die Gesamtstichprobe..... 280
Tab. 11: Faktorenanalyse der Polaritätenprofile für die
Männer ....................................................................... 282
Tab. 12: Faktorenanalyse der Polaritätenprofile für die
Frauen ........................................................................ 283
Tab. 13: Rotierte Faktorenmatrix für die Männer...................... 284
Tab. 14: Rotierte Faktorenmatrix für die Frauen ...................... 285
Tab. 15: Standardisierte kanonische Diskriminanzfunktions-
koeffizienten für das Geschlecht ................................ 287
Tab. 16: Reklassifikation des Geschlechts anhand des
Selbstbildes ................................................................ 290X Tabellenverzeichnis
Tab. 17: Standardisierte kanonische Diskriminanzfunktions-
koeffizienten für das Geschlecht ................................ 292
Tab. 18: Reklassifikation des Geschlechts anhand der
Vorstellungen von Hochbegabung ............................. 293
Tab. 19: Fallzahlen pro Cluster ................................................ 296
Tab. 20: Eigenwerte ................................................................... 299
Tab. 21: Wilks Lambda ............................................................. 299
Tab. 22: Standardisierte kanonische Diskriminanzfunktions-
koeffizienten ............................................................... 300
Tab. 23: Funktionen bei den Gruppen-Zentroiden ................... 301
Tab. 24: Reklassifizierungsergebnisse ..................................... 303
Tab. 25: Altersunterschiede zwischen den Clustern ................ 304
Tab. 26: Anteil von Männern und Frauen pro Cluster .............. 304
Tab. 27: Anteil von „ledigen“ und „verheirateten“ Probanden
pro Cluster .................................................................. 305
Tab. 28: Probanden mit und ohne Studium .............................. 306Abstract The work presented here deals with the non-cognitive aspects of giftedness. It is based on extensive literature reviews and an em- pirical study. The focus is on the self-concepts of gifted adults and the question in particular is whether the label "gifted" is a central feature of the self-concept or whether the gifted see it only as a specific characteristic among many others who were instrumental in the development of their self-concept. After an extensive litera- ture review, a list of open issues was initially created that served as the basis for free interviews with about 30 highly talented. Based on these interviews, the list of questions was modified and extended and then converted into a pool of 55 Statements with dichotomous response options (yes / no), with which information on personal development, socialization and talent specific peculiar- ities in emotional, cognitive and performance-related areas can be captured, as well as statements concerning the gifted where they see problems within themselves, and how they cope with their situation. The complete questionaire was sent to 400 people. The response rate was 82%. After deducting incomplete returned questionnaires, the data of 333 cases were available for examina- tion. A subsample of 232 subjects had also completed all the sheets of the semantic differential (polarity profile) in full, so that the autostereotype and position of the subjective concept of talent in the semantic space could also be examined for these subjects. Since you can not form matched control groups in such issues, the analysis of the data related primarily to the internal differentiation of the examined individuals. In particular, comparisons were made between the sexes and tested whether it is possible to verify dif- ferent types of socialization with regard to the development of self-
XII Abstract
concept. Characteristic relationships were examined using statisti-
cal correlation methods and factor analyses; people typification
were examined using cluster analysis, group differences using t-
tests, analysis of variance and discriminant analyses. The litera-
ture review revealed, among other things, that giftedness is
allocated from the perspective of others with both positive and
negative connotations, the bandwidth of the heterostereotypes
varies between admiration ("Genius") and snideness ("mad pro-
fessor" or even "lunatic"). The ideas that others have on the gifted
are, however, much more thoroughly investigated than the picture,
that the highly gifted have of themselves. Therefore, there was
very little known about whether the labelling of those affected as
gifted is experienced rather than upgrading or rather as an addi-
tional burden due to high expectations. The questionnaire results
were analyzed on the level of items and factors, and a total of 19
factors with values greater than 1.0 indicate that it was possible
here to detect a very broad and heterogeneous spectrum of fea-
tures of development and socialisation of the gifted. The gifted
characterized themselves uniformly that they are open to good
arguments, know more than others, lead an independent life and
have a special kind of humor, whereas they experience little bore-
dom and consider themselves as being quite impartial.
Overall, their self-image corresponds to a large extent to their
desired image. But their self-image seems to be mainly influenced
by the personality and communication, e.g. by characteristics that
are largely independent of the talent and are seen independently.
Thus, the gifted do not primarily define their self-images about their
talent.
However, men and women seem to associate different ideas with
talent. Men associate social isolation (loneliness) with talent, wom-Abstract XIII en see talent rather as a feature that corresponds to the masculini- ty stereotype. From the perspective of highly talented women, the feminity stereotype stands in polar opposition to the giftedness, which is in their view also much more closely associated with the masculinity stereotype. For men, however, talent has no connec- tion to gender stereotypes. Their judgement here is clearly rather more differentiated than the women. Their semantic space can best be described by three dimensions, while it is rather two- dimensionally with the women. The probands clustering showed that in the sample examined there are apparently subgroups that differ in terms of their sociali- zation and identity balance. For all subjects, giftedness is a special, if not personality defining characteristic, by which they also deliberately differ from others. Part of them have come to terms with this fact fairly well and tried to cover up using appropriate behaviour or simply accept their being particular as part of their lives. Others, however, perceive significant contradictions between their social and personal identity and therefore also feel more dissatisfied with themselves. In particular, the highly talented women seem to be more prone to roll diffusion or psychosocial maladjustment. The results are discussed in detail, taking into account the litera- ture with regard to their plausibility, their similarities with already known results and their novelty value.
Zusammenfassung Die hier vorgelegte Arbeit befasst sich mit den nicht-kognitiven Aspekten der Hochbegabung. Sie stützt sich auf umfangreiche Literaturauswertungen und eine eigene empirische Untersuchung. Im Fokus stehen die Selbstkonzepte von hochbegabten Erwach- senen, wobei insbesondere der Frage nachgegangen wurde, ob das Label „hochbegabt“ zu einem zentralen Merkmal des Selbst- konzepts wird oder ob Hochbegabte darin nur ein spezifisches Merkmal unter vielen sehen, die maßgeblich für die Entwicklung ihres Selbstkonzepts waren. Nach eingehenden Literaturrecherchen wurde zunächst eine Liste von offenen Fragen erstellt, die als Grundlage für freie Interviews mit etwa 30 Hochbegabten dienten. Auf der Grundlage dieser Interviews wurde die Liste der Fragen modifiziert und erweitert und anschließend in einen Pool von 55 Statements mit dichotomen Antwortalternativen (ja/nein) umgewandelt, mit denen Angaben zur persönlichen Entwicklung, zur Sozialisation und zu begabungs- spezifischen Besonderheiten in emotionalen, kognitiven und leistungsbezogenen Bereichen erfasst werden können, sowie Aussagen darüber, im Hinblick auf welche Merkmale die Hochbe- gabten Probleme bei sich sehen und wie sie mit ihrer Situation und mit sich selbst zurechtkommen. Die vollständigen Unterlagen wurden an 400 Personen versandt. Die Rücklaufquote betrug 82 %. Nach Abzug der unvollständig zurückgesandten Bögen standen für die Auswertung die Daten von insgesamt 340 Fällen zur Verfügung. Eine Teilstichprobe von 128 Probanden hatte außerdem alle Bögen des semantischen Differentials (Polaritätenprofils) vollständig bearbeitet, so dass bei
XVI Zusammenfassung diesen Probanden auch das Autostereotyp und die Position des subjektiven Konzepts von Begabung im semantischen Raum untersucht werden konnte. Da sich bei derartigen Fragestellungen keine parallelisierten Kon- trollgruppen bilden lassen, bezogen sich die Datenanalysen vor allem auf die Binnendifferenzierung der untersuchten Gesamt- stichprobe. Dabei wurden insbesondere Vergleiche zwischen den Geschlechtern vorgenommen und geprüft, ob sich hinsichtlich der Entwicklung des Selbstkonzepts unterschiedliche Sozialisationsty- pen nachweisen lassen. Merkmalszusammenhänge wurden mit Hilfe von korrelationsstatistischen Methoden und Faktorenanaly- sen untersucht, Personentypisierungen mit Hilfe von Clusterana- lysen, Gruppenunterschiede mit Hilfe von t-Tests, Varianzanalysen und Diskriminanzanalysen. Aus der Sichtung der Literatur ergab sich unter anderem, dass Hochbegabung aus Sicht anderer so- wohl mit positiven als auch mit negativen Konnotationen besetzt ist, wobei die Bandbreite der Heterostereotype zwischen Bewun- derung („Genie“) und Abfälligkeit („verrückter Professor“ oder gar „Irrer“) variiert. Die Vorstellungen, die andere von Hochbegabten haben, sind jedoch wesentlich gründlicher untersucht als das Bild, das Hochbegabte von sich selbst haben. Daher war bisher wenig darüber bekannt, ob die Etikettierung als Hochbegabte(r) von den Betroffenen eher als Aufwertung oder eher als zusätzliche Belas- tung auf Grund hoher Erwartungen erlebt wird. Die Fragebogenergebnisse wurden auf Item- und auf Faktoren- ebene untersucht, wobei die insgesamt 19 Faktoren mit Eigenwerten von mehr als 1,0 darauf hindeuten, dass es hier gelang, ein sehr breites und heterogenes Spektrum an Besonder- heiten der Entwicklung und Sozialisation Hochbegabter zu erfassen. Die Hochbegabten charakterisieren sich einheitlich
Zusammenfassung XVII dahingehend, dass sie guten Argumenten gegenüber aufge- schlossen sind, mehr wissen als andere, ein selbstbestimmtes Leben führen und über eine besondere Art von Humor verfügen, wobei sie wenig Langeweile haben und sich für recht unvoreinge- nommen halten. Insgesamt entspricht ihr Selbstbild weitgehend ihrem Idealbild, wobei das Selbstbild vor allem durch die Persön- lichkeit und die Kommunikation geprägt zu sein scheint, also von Merkmalen, die von der Begabung weitgehend unabhängig sind und auch unabhängig gesehen werden. Hochbegabte definieren ihr Selbstbild somit nicht primär über ihre Begabung. Männer und Frauen scheinen mit Begabung jedoch unterschiedliche Vorstel- lungen zu verknüpfen. Männer assoziieren mit Begabung eher eine soziale Isolierung (Einsamkeit), Frauen sehen in der Bega- bung eher ein Merkmal, dass dem Männlichkeitsstereotyp ent- spricht. Aus Sicht der hochbegabten Frauen steht das Weiblichkeitsstereo- typ im polaren Gegensatz zur Hochbegabung, die aus ihrer Sicht auch wesentlich enger mit dem Männlichkeitsstereotyp assoziiert wird. Für Männer weist Begabung hingegen keinen Zusammen- hang zu den Geschlechterstereotypen auf. Sie urteilen hier anscheinend auch etwas differenzierter als die Frauen. Ihr seman- tischer Raum lässt sich am besten durch drei Dimension beschreiben, während er bei den Frauen eher zweidimensional ist. Wie das Personen-Clustering zeigte, gibt es in der hier untersuch- ten Stichprobe anscheinend Subgruppen, die sich im Hinblick auf ihre Sozialisation und Identitätsbalance unterscheiden. Für alle Probanden ist die Hochbegabung ein besonderes, wenn auch nicht persönlichkeitsbestimmendes Merkmal, durch das sie sich auch bewusst von anderen unterscheiden. Ein Teil von ihnen hat sich mit dieser Besonderheit recht gut arrangiert und versucht, sie durch angepasstes Verhalten zu überspielen oder akzeptiert sie
XVIII Zusammenfassung einfach als Bestandteil ihres Lebens. Andere nehmen hingegen deutliche Widersprüche zwischen ihrer sozialen und persönlichen Identität wahr und fühlen sich deswegen auch unzufriedener mit sich selbst. Insbesondere die hochbegabten Frauen scheinen eher anfällig für Rollendiffusionen oder psychosoziale Fehlanpassungen zu sein. Die Ergebnisse werden ausführlich unter Berücksichtigung der Literatur im Hinblick auf ihre Plausibilität, ihre Übereinstimmungen mit schon bekannten Befunden und ihren Neuigkeitswert diskutiert.
Sie können auch lesen