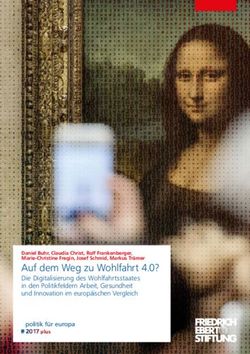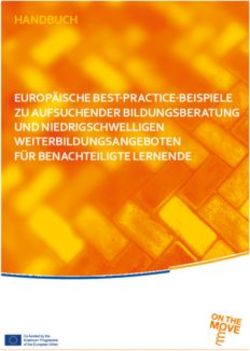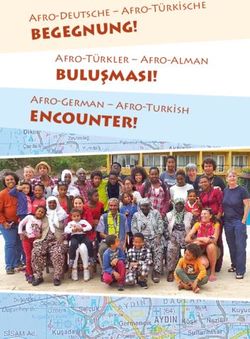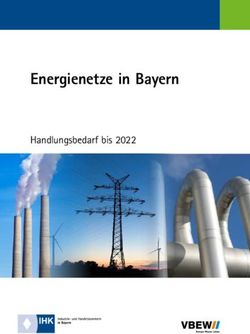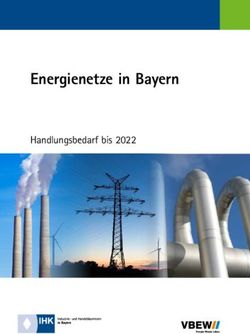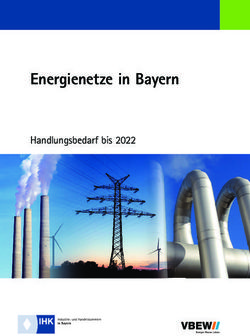Diskurs Öffentlich-Private Partnerschaften - Ein Konzept für die zukünftige Gestaltung öffentlicher Aufgaben? - Bibliothek der Friedrich ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Dezember 2011
Expertisen und Dokumentationen
zur Wirtschafts- und Sozialpolitik Diskurs
Öffentlich-Private
Partnerschaften
Ein Konzept für die zukünftige
Gestaltung öffentlicher Aufgaben?
IExpertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung Öffentlich-Private Partnerschaften Ein Konzept für die zukünftige Gestaltung öffentlicher Aufgaben? Wolfgang Gerstlberger Michael Siegl
WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 4
Vorbemerkung 5
Das Wesentliche auf einen Blick 6
1. Einleitung 8
1.1 Anliegen und Ziel der Expertise 9
1.2 Methodik 9
1.3 Aufbau 10
2. Definition für Öffentlich-Private Partnerschaften 11
3. Rahmenbedingungen für ÖPP in Deutschland und in der EU 16
3.1 Schwierige Haushalts- und Finanzsituation der deutschen Kommunen 16
3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für ÖPP in Deutschland und der EU 17
3.3 ÖPP aus der Perspektive der Rechnungshöfe 19
3.4 Praktische Bedeutung von ÖPP: ein kommunales Stimmungsbild 20
4. Bisherige praktische Erfahrungen mit ÖPP in der Bundesrepublik 26
4.1 Vertragliche ÖPP-Infrastrukturprojekte: Schulprojekte als Beispiel 26
4.1.1 Fallbeispiel Schulsanierung Landkreis Offenbach 27
4.1.2 Weitere Erfahrungen mit ÖPP-Projekten im Schulbereich 27
4.2 Institutionelle ÖPP 28
4.2.1 Fallbeispiele Neue Mitte Oberhausen und Wiederaufbau
der Unterneustadt in Kassel 30
4.2.2 Fallbeispiel Informations- und Datentechnik (ID) Bremen 32
4.3 Großveranstaltungen als ÖPP 33
4.4 Nahversorgungs-ÖPP im ländlichen Raum 35
4.5 ÖPP im Ausland: Ein Blick über die Grenzen 37
Diese Expertise wird von der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-
Ebert-Stiftung veröffentlicht. Die Ausführungen und Schlussfolgerungen sind von den
Autoren in eigener Verantwortung vorgenommen worden.
Impressum: © Friedrich-Ebert-Stiftung | Herausgeber: Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der
Friedrich-Ebert-Stiftung | Godesberger Allee 149 | 53175 Bonn | Fax 0228 883 9202 | www.fes.de/wiso |
Gestaltung: pellens.de | Titelfoto: dpa Picture Alliance | bub Bonner Universitäts-Buchdruckerei |
ISBN: 978 - 3 - 86872 - 887-3 |Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
5. Implikationen und Schlussfolgerungen für zukünftige politische Entscheidungen
über ÖPP in Bund, Ländern und Kommunen 38
5.1 Vertragscontrolling und Berücksichtigung von Transaktionskosten 38
5.2 Verbesserte öffentliche Transparenz bei ÖPP 38
5.3 Unzureichende wissenschaftliche Analyse 39
5.4 Notwendige Professionalisierung der öffentlichen Entscheider 39
5.5 Grundsätzliche Ablehnung von Gewerkschaften
und Personalräten gegenüber ÖPP 39
5.6 Zusammenfassung grundsätzlicher Kritikpunkte an der ÖPP-Praxis
in deutschen Gebietskörperschaften 40
6. Zusammenfassung und Ausblick: Empfehlungen für den zukünftigen
politischen Umgang mit ÖPP in der Bundesrepublik 42
7. Literaturverzeichnis 44
Anhang 49
a) Themenschwerpunkte der Expertengespräche 49
b) Projektbeispiele, die im Rahmen des 2. Expertengesprächs vorgestellt wurden 50
Beispiel 1: ÖPP bei kommunalen Schulprojekten
Projekt Schulsanierung Landkreis Kassel 50
Beispiel 2: ÖPP bei kommunalen Freizeit- und Gesundheitsprojekten
Projekt Vital Resort Winterberg 51
Ein in Zusammenhang mit Beispiel 2 angesprochenes Bäder-Projekt 52
c) Differenziertes Kriterienraster für die Bewertung von ÖPP-Projektideen
im Vorfeld konkreter Planungen 52
Die Autoren 55
3WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Typisierung von ÖPP 12
Abbildung 2: Entwicklung des Finanzierungssaldos deutscher Kommunen
2006 - 2014 in Mrd. Euro 17
Abbildung 3: Bisherige kommunale Erfahrungen mit ÖPP-Projekten nach Bundesländern 20
Abbildung 4: Anteil der Städte und Gemeinden mit realisierten ÖPP-Projekten 21
Abbildung 5: Bewertung des Sanierungsbedarfs bei kommunalen Infrastruktureinrichtungen 22
Abbildung 6: Verfügbarkeit notwendiger Managementressourcen
für Abwicklung von ÖPP-Projekten 22
Abbildung 7: Erwartete Entwicklung der kommunalen Finanzsituation in den nächsten Jahren 23
Abbildung 8: Einschätzung des Beitrags des Konjunkturpakets II zum Abbau
des kommunalen Investitionsstaus 24
Abbildung 9: Bewertung von Maßnahmen für die Verbesserung
der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen 24
Abbildung 10: Einschätzung einer möglichen Konkurrenz zwischen
dem Konjunkturpaket II und ÖPP 25
Tabelle 1: ÖPP-Projekt Schulen im Landkreis Offenbach (Los Ost) 27
Tabelle 2: ÖPP-Projekt Schulen im Landkreis Offenbach (Los West) 28
Tabelle 3: ÖPP-Gesellschaft Neue Mitte Oberhausen 31
Tabelle 4: ÖPP-Gesellschaft Kassel-Unterneustadt 32
Tabelle 5: ÖPP-Gesellschaft ID Bremen 33
Tabelle 6: ÖPP-Gesellschaft Expo 2000 GmbH Hannover 34
Tabelle 7: ÖPP-Gesellschaft documenta GmbH Kassel 35
Tabelle 8: Multifunktionale Serviceläden 36
4Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
Vorbemerkung
Lange Zeit galten Öffentlich-Private Partnerschaf- Neben konzeptionellen Überlegungen ba-
ten (ÖPP) als ein vielversprechender und in vie- siert diese Bestandsaufnahme vor allem auf der
len Ländern bereits erprobter Weg, um öffentli- Auswertung empirischer Studien und praktischer
che Leistungen schneller, früher und kostengüns- Projekterfahrungen aus der Bundesrepublik. Da-
tiger bereit zu stellen. Auch in Deutschland gibt rüber hinaus werden auch bisherige Erfahrungen
es mittlerweile eine Vielzahl praktischer Erfah- mit ÖPP aus anderen EU-Ländern beleuchtet.
rungen mit ÖPP-Projekten. Der bisherige Erfolg Hier werden wichtige Unterschiede zur vorherr-
dieser Projekte wird kontrovers diskutiert. Einige schenden deutschen ÖPP-Praxis deutlich. In
Landesrechnungshöfe (Bayern, Baden-Württem- skandinavischen Ländern beispielsweise sind die
berg) warnen gar vor „versteckter öffentlicher Finanzierung von ÖPP-Projekten und die politi-
Verschuldung“ und überschätzten Effizienzgewin- sche Entscheidung darüber deutlich transparen-
nen Öffentlich-Privater Partnerschaften. Daneben ter als hierzulande.
befürchten Gewerkschaften und öffentlich Be- Anders als in vielen bereits vorliegenden
schäftigte die weitere Aufweichung von Flächen- Leitfäden und Einführungen zum Thema ÖPP
tarifverträgen und einen fortschreitenden Arbeits- berücksichtigt die vorliegende Expertise explizit
platzabbau als Konsequenz von ÖPP. Bürgerini- auch die Perspektiven von öffentlich Beschäftig-
tiativen und Experten warnen zudem vor einer ten, ihren Personalvertretungen und zuständigen
weiteren Verschlechterung von Qualität und Zu- Gewerkschaften sowie Rechnungshöfen des Bun-
gänglichkeit öffentlicher Dienstleistungen. des und der Länder. Es wird demzufolge auch eine
Mit Blick auf aktuelle Diskussionen über die ganze Reihe grundsätzlicher Kritikpunkte an ÖPP
zukünftige Gestaltung des deutschen Dienstleis- zusammengefasst und diskutiert.
tungssektors hat die Friedrich-Ebert-Stiftung im Mit der vorliegenden Publikation leisten die
Jahr 2010 ein Projekt zum Thema „Öffentlich- Autoren einen wichtigen Beitrag, in Politik und
Private Partnerschaften“ (ÖPP) durchgeführt, das Verwaltung, und hier insbesondere in den Kom-
Grundlage der vorliegenden Expertise ist. munen, für die langfristigen, komplexen und
Der Titel, Öffentlich-Private Partnerschaften: häufig kritisch zu betrachtenden politischen, so-
Ein Konzept für die zukünftige Gestaltung öffentlicher zialen und wirtschaftlichen Implikationen von
Aufgaben? Diskussion unterschiedlicher Anforderun- ÖPP zu sensibilisieren.
gen aus Politik, Verwaltung, Gewerkschaften, Bürger- Wir danken den Autoren und allen an dem
initiativen und Wirtschaft, greift das Spannungs- Projekt beteiligten Expertinnen und Experten für
feld auf, das bei ÖPP im Regelfall besteht. Private ihr Engagement und hoffen, dass die Studie als
Gewinnorientierung einerseits und öffentliche politisch-strategische und praxisorientierte Hand-
Gemeinwohlorientierung andererseits sollen un- reichung für Entscheidungsträger in Politik, Ver-
ter den Hut eines gemeinsamen Projekts (z. B. Bau waltung, Gewerkschaften und Verbänden Ein-
und Betrieb einer kommunalen Einrichtung) ge- gang findet.
bracht werden. Die Expertise unterzieht unter-
schiedliche institutionelle und vertragsbasierte Helmut Weber
Modelle, die dies ermöglichen sollen, einer kri- Friedrich-Ebert-Stiftung
tischen Bestandsaufnahme. Wirtschafts- und Sozialpolitik
5WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
Das Wesentliche auf einen Blick
Eine Reihe von politischen Auseinandersetzun- Problemen Öffentlich-Privater Partnerschaften
gen in deutschen Kommunen hängt eng mit dem gewarnt. Angesichts vermehrter kritischer Berich-
Thema Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) te über negative Auswirkungen von ÖPP-Projek-
zusammen. Dies gilt sowohl für Schulprojekte ten auf öffentliche Haushalte, auf die Qualität
(Neubau oder Sanierung) als auch für Projekte in öffentlicher Dienstleistungen sowie auf Beschäf-
den Bereichen Kultur, Freizeit und Tourismus. tigungsbedingungen im öffentlichen Sektor sind
Durch die Einbeziehung privatwirtschaftlicher bei lokalen Entscheidungen über zukünftige ÖPP-
Unternehmen bei der Realisierung kommunaler Vorhaben Verfahrenstransparenz sowie eine um-
ÖPP-Projekte werden häufig ohnehin vorhande- fassende und rechtzeitige Beteiligung/Informati-
ne inhaltliche Kontroversen verschärft. Dies lässt on der betroffenen Bürger, politischen Entschei-
sich auch darauf zurückführen, dass partizipative dungsgremien und Beschäftigten notwendig.
und dialogische Planungsprozesse die kurzfris- Ausgehend von der zunehmenden Verbrei-
tigen Kosten derartiger Projekte erhöhen und tung von ÖPP in der Bundesrepublik einerseits
deshalb bisher selten eingesetzt werden. Parti- und der wachsenden gesellschaftlichen und poli-
zipative Planungsprozesse sind mit der eher tischen Kritik andererseits hat die Friedrich-Ebert-
kurzfristigen Shareholder-Orientierung vieler Stiftung im Jahr 2010 das Projekt „Öffentlich-
potenzieller privater ÖPP-Partner in der Regel Private Partnerschaften (ÖPP) in der Bundesrepu-
nicht vereinbar. Damit ist bereits das Hauptpro- blik Deutschland: Zwischen Anfangserfolgen, zu-
blem von ÖPP benannt: Öffentliche und private nehmender Kritik und Rekommunalisierung“
Partner verfolgen aufgrund ihrer jeweiligen Ziele durchgeführt. Ziel des Projektes war es, eine kriti-
grundsätzlich unterschiedliche Interessen: Ge- sche Bestandsaufnahme eines umstrittenen Politik-
winnorientierung einerseits versus Gemeinwohl- feldes vorzunehmen, bei der neben betriebswirt-
orientierung andererseits. Ob diese konträren In- schaftlichen und volkswirtschaftlichen auch poli-
teressen im Rahmen eines gemeinsamen Projek- tische und soziale Aspekte berücksichtigt wer-
tes verwirklicht werden können, sehen nicht nur den.
Gewerkschaften und Personalräte, sondern auch Die vorgelegte Expertise basiert auf drei un-
viele Bürgerinitiativen, Politiker, Wissenschaftler terschiedlichen methodischen Bausteinen: einer um-
und Publizisten sehr kritisch. Strittig ist zudem fangreichen Literaturanalyse, zwei aufeinander
in der aktuellen deutschen ÖPP-Diskussion, wie aufbauenden Befragungen kommunaler Entschei-
Rahmenbedingungen solcher Ausnahmefälle ggf. dungsträgerinnen und Entscheidungsträger und
aussehen können. zwei ÖPP-Expertengesprächen. Während eine
Darüber hinaus bewerten auch viele Verantwor- thematisch sehr breite Literaturanalyse vorge-
tungsträger innerhalb der öffentlichen Verwaltung nommen wurde, die auch Randbereiche von ÖPP
und die zuständigen Aufsichtsbehörden ÖPP seit län- berücksichtigt, konzentrierten sich die Befragun-
gerem grundsätzlich kritisch. Vor allem die Landes- gen und Expertengespräche auf sogenannte ÖPP-
rechnungshöfe (z. B. Bayern, Baden-Württemberg, Betreibermodelle. Dieser ÖPP-Typ dominiert die
Bremen und Hamburg) haben in den letzten Jah- aktuelle Diskussion über Öffentlich-Private Part-
ren wiederholt vor versteckter öffentlicher Verschul- nerschaften in der Bundesrepublik.
dung und langfristigen betriebswirtschaftlichen
6Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
Aus der Expertise ergeben sich folgende zen- – Entwicklung von Regelungen, um die öffent-
trale Schlussfolgerungen, die kurzfristig bei politi- lich Beschäftigten bzw. deren Personalvertre-
schen Initiativen des Bundes und der Länder tungen und zuständigen Gewerkschaften for-
Berücksichtigung finden sollten: mal stärker als bisher an politischen Entschei-
– Entwicklung und Einführung flächendecken- dungsprozessen über ÖPP zu beteiligen.
der und verbindlicher Standards für die Ge- Schließlich ist ein weiteres wichtiges Ergebnis
währleistung größtmöglicher finanzieller Trans- dieser Expertise, dass in öffentlichen Verwaltun-
parenz von ÖPP-Projekten; gen eine systematische, kriteriengeleitete Heran-
– flächendeckende Aufnahme von ÖPP in Infor- gehensweise an ÖPP-Ideen derzeit noch nicht die
mationsgesetze auf Länderebene; Regel ist. Eine derartige Herangehensweise müss-
– Vermeidung von Fehlanreizen für (potenzielle) te beispielsweise die frühzeitige Einbeziehung
private ÖPP-Partner, z. B. durch Entkopplung aller beteiligten und (potenziell) betroffenen Sta-
von Finanzierung und Projektdurchführung keholder anhand klarer Kriterien und die Berück-
oder Reduzierung der Möglichkeiten für Nach- sichtigung möglicher Alternativmodelle zu ÖPP
verhandlungen nach Projektbeginn; (z. B. interkommunale Zusammenarbeit) umfas-
– Notwendigkeit einer systematischen Evaluie- sen. Im Anhang befindet sich ein Kriterienkata-
rung von ÖPP; log als Unterstützung für Mitglieder politischer
– kurzfristige Aufstockung der Personalressour- Selbstverwaltungsgremien, öffentliche Entschei-
cen und Weiterbildungsbudgets der Rech- dungsträger, Personalvertretungen und Bürgerini-
nungshöfe und der Kommunalaufsichtsbe- tiativen bzw. Vereine bei Entscheidungen über
hörden; ÖPP-Ideen.
7WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
1. Einleitung
Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) sind ein noch nicht) realisiert werden können, ist derzeit
zunehmend kontrovers diskutiertes Instrument äußerst umstritten. Neben Bürgerinitiativen, Ge-
für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. werkschaften und Personalvertretungen haben sich
Verglichen mit konventionellen, rein öffentli- in den letzten Jahren auch die Rechnungshöfe
chen Formen für die Planung, Organisation und sowie Vertreter aus der Wissenschaft grundsätzlich
Finanzierung staatlicher und kommunaler Auf- kritisch darüber geäußert, ob und ggf. inwieweit
gaben sind ÖPP sowohl in der EU als auch in die o.g. Erwartungen bei einzelnen ÖPP-Projek-
Deutschland jedoch gegenwärtig nach wie vor ten bisher erreicht werden konnten (vgl. Kapitel
eher ein Nischenthema. Dieses „Nischenthema“ 3 und 4 mit ausführlichen Literaturhinweisen
hat allerdings in den letzten Jahren für die EU- und Informationen zum Stand der ÖPP-Evaluie-
Kommission, die Bundesregierung sowie einen rung in Deutschland).
Teil der deutschen Bundesländer und Kommunen Quantitativ gesehen haben ÖPP-Projekte auf
eine steigende politische Bedeutung erlangt. Als allen Politik- und Verwaltungsebenen in der zwei-
positive Argumente für den (verstärkten) Einsatz ten Hälfte des letzten Jahrzehnts eine wachsende
von ÖPP werden von Befürwortern in den ver- Verbreitung erfahren (Grabow et al. 2005: 4 f.;
gangenen Jahren im Kern die folgenden Erwar- vgl. Kapitel 4). – Der Begriff Public-Private-Part-
tungen angeführt (z. B. Littwin/Schöne 2006; We- nership (PPP) – als Synonym für ÖPP – wurde be-
ber et al. 2006): reits in den USA der 1950er Jahre geprägt (Budä-
– Durch die organisatorische Bündelung von us/Grüning 1997). Damals waren in einigen US-
Leistungen in den Bereichen Planung, Bau/Er- amerikanischen Großstädten, die stark von der
richtung, Betrieb, Wartung/Instandhaltung und Krise der Kohle- und Stahlindustrie nach Ende
ggf. Finanzierung („Lebenszyklus-Prinzip“) so- des Zweiten Weltkriegs betroffen waren, Verein-
wie die Nutzung von speziellem Know-how barungen zwischen Stadtregierungen und lokalen
aus der Privatwirtschaft sollen sogenannte Wirt- Unternehmen getroffen worden, um Innenstädte
schaftlichkeitsvorteile gegenüber einer kon- gemeinsam vor dem drohenden Verfall zu be-
ventionellen Projektrealisierung erreicht wer- wahren. Die beteiligten Unternehmer verpflich-
den. teten sich, konzentriert in bestimmte Innen-
– Aufgrund dieser organisatorischen Bündelung stadtareale zu investieren bzw. ihre dort gelegenen
unterschiedlicher Leistungen und der (ver- Unternehmen oder Geschäfte nicht aufzugeben
stärkten) Nutzung von Know-how aus der Pri- oder zu verlagern. Im Gegenzug verpflichteten
vatwirtschaft soll die Bau- bzw. Errichtungs- sich Bürgermeister und Stadtverwaltungen spe-
phase bei ÖPP-Projekten rascher als im Fall ziell für diese Innenstadt-Unternehmen kommu-
konventioneller Projektrealisierung abgeschlos- nale Steuern und Abgaben erheblich zu reduzie-
sen werden. ren und die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bei diesen beiden Argumenten handelt es sich je- in bestimmten Innenstadtbereichen zu gewähr-
doch, wie bereits erwähnt, um Erwartungen bzw. leisten bzw. wiederherzustellen.
Annahmen. Ob und ggf. inwieweit diese Erwar- Vor allem die so genannte „Pittsburgh Align-
tungen bei einzelnen laufenden ÖPP-Projekten ment Partnership“ (Budäus/Grüning 1997) hat
(wirklich abgeschlossene deutsche ÖPP-Projekte als Beispiel für diese frühe Form von ÖPP in Groß-
gibt es aufgrund der langen Projektlaufzeiten städten auch über die Grenzen der USA hinaus
8Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
Bekanntheit erlangt. In den 1980er und 1990er zu gehören beispielsweise die frühzeitige Einbe-
Jahren wurde auch in europäischen und deut- ziehung aller beteiligten und (potenziell) betrof-
schen Städten, wie in Sheffield, Manchester, Rot- fenen Stakeholder anhand klarer Kriterien und
terdam, Bologna, Barcelona oder in Oberhausen, die Berücksichtigung möglicher Alternativmodel-
mit ähnlich angelegten öffentlich-privaten Ver- le zu ÖPP (z.B. interkommunale Zusammenar-
einbarungen versucht, bestimmte städtebauliche beit; vgl. dazu den allgemeinen Kriterienkatalog
Fehlentwicklungen abzumildern bzw. zu besei- im Anhang als Unterstützung für Mitglieder poli-
tigen. Die Erfolgseinschätzungen hinsichtlich die- tischer Selbstverwaltungsgremien, öffentliche
ser öffentlich-privaten Stadtsanierungsprojekte Entscheidungsträger, Personalräte etc.)
unterscheiden sich je nach Einzelprojekt und 15 bis 30 Jahre nach Abschluss der genann-
Perspektive des Evaluierenden naturgemäß sehr ten Stadtumbau-PPP-Projekte muss die Frage
stark (Heinz 1993). Weitgehende Einigkeit be- einer möglichen „Routinisierung“ von PPP bzw.
steht in der Literatur darüber, dass durch diese ÖPP im Rahmen der Erstellung öffentlicher
frühen europäischen und deutschen Stadtumbau- Dienstleistungen in der Bundesrepublik unter
projekte in öffentlich-privater Trägerschaft zusätz- veränderten Vorzeichen diskutiert werden. Hier-
liche Ressourcen für die Stadtsanierung und -mo- bei sind auch die zwischenzeitlichen Praxiser-
dernisierung in Form von Kapital, Fördermitteln fahrungen hinsichtlich dieser „Routinisierung“
sowie Know-how mobilisiert werden konnten. in unterschiedlichen Aufgabenfeldern aus dem
Einigkeit besteht in der Literatur weitgehend Blickwinkel der beteiligten gesellschaftlichen
auch darüber, dass mit den untersuchten ÖPP- Akteure zu berücksichtigen. Die praxisnahe Auf-
Projekten in begrenzten Zeiträumen stadtentwick- bereitung und Strukturierung dieser Diskussion
lungspolitische Sonderaufgaben insgesamt erfolg- für Entscheiderinnen und Entscheider sowie Be-
reich bewältigt worden waren. Eine Ausweitung troffene und Interessierte aus Bürgerschaft, Poli-
von PPP auf Routineprojekte und -aufgaben öf- tik, Verwaltungen, Personalvertretungen, Ge-
fentlicher Gebietskörperschaften wurden in die- werkschaften, Verbänden sowie Medien ist der
ser frühen europäischen und deutschen PPP-Lite- Auftrag der vorliegenden Expertise.
ratur entweder überhaupt nicht diskutiert (Heinz
1993) oder aber als nicht realistisch bzw. erfolg-
versprechend eingeschätzt (Gerstlberger 1999: 11). 1.2 Methodik
Diese Expertise basiert auf unterschiedlichen qua-
1.1 Anliegen und Ziel der Expertise litativen und quantitativen Materialien, die ein-
ander gegenübergestellt sowie im Gesamtzu-
Anliegen und Ziel dieser Expertise ist es nicht, sammenhang dargestellt und diskutiert werden.
noch ein weiteres Gutachten über spezielle ÖPP- Einen Teil der verarbeiteten Materialien bilden
Aspekte oder einen weiteren Leitfaden für die die Ergebnisse von zwei Expertengesprächen, die
praktische Umsetzung von ÖPP-Projekten in im Juli und September 2010 in der Friedrich-
Kommunen oder anderen öffentlichen Gebiets- Ebert-Stiftung in Berlin durchgeführt wurden.
körperschaften vorzulegen. Vielmehr sollen die Das erste der beiden durchgeführten Expertenge-
Leserin und der Leser in kompakter Form für spräche war den politischen und konzeptionellen
wichtige strategische bzw. langfristige Implikatio- Grundlagen von ÖPP im weiteren Sinne gewid-
nen von ÖPP sensibilisiert werden, die in vorlie- met. Im zweiten Expertengespräch wurden ausge-
genden Gutachten und Leitfäden weitgehend wählte ÖPP-Praxisbeispiele von beteiligten Ak-
„vergessen“ oder lediglich unzureichend darge- teuren präsentiert und im Anschluss daran kri-
stellt und diskutiert werden (vgl. Arnold/Kehl tisch diskutiert (vgl. Kurzdarstellung der beiden
2010 als konzeptionellem Problemaufriss). Hier- ausgewählten Beispiele im Anhang).
9WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
1.3 Aufbau deutschlandweiten Erhebungen unter kommu-
nalen Entscheidungsträgerinnen und -entschei-
Die vorliegende Expertise ist wie folgt gegliedert: dungsträgern ergänzt. Kapitel 4 und 5 umfassen
In Kapitel 2 wird eine Definition für Öffentlich- die Zusammenfassung bisheriger praktischer
Private Partnerschaften eingeführt. Darauf folgt Erfahrungen mit ÖPP in der Bundesrepublik
das dritte Kapitel, welches den aktuellen Rah- Deutschland sowie daraus resultierende Implika-
menbedingungen für ÖPP in Deutschland und in tionen und Schlussfolgerungen für zukünftige
der EU gewidmet ist. Hier werden auch mögliche politische Entscheidungen über ÖPP in Bund,
Auswirkungen der globalen Finanzmarktkrise der Ländern und Kommunen. Das sechste Kapitel
zurückliegenden beiden Jahre auf ÖPP reflektiert. schließlich lautet: Zusammenfassung und Aus-
Diese Ausführungen werden zum Abschluss des blick: Empfehlungen für den zukünftigen politi-
Kapitels um die empirischen Befunde von zwei schen Umgang mit ÖPP in der Bundesrepublik.
10Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
2. Definition für Öffentlich-Private Partnerschaften
Trotz der berechtigten Kritik an zu stark generali- lich-privater Zusammenarbeit (Grabow et al. 2005;
sierenden oder vereinfachenden ÖPP-Definitio- Budäus 2006a, b; Weber et al. 2006). Institutio-
nen (Budäus 2006 a; b) liegt dieser Expertise eine nelle ÖPP sind auf Dauer angelegt und basieren
allgemeine Definition der Autoren zugrunde, die auf den Rechtsformen GmbH, AG und gelegent-
sich wie folgt zusammenfassen lässt: lich der von eingetragenen Vereinen (e. V.).
In Abgrenzung zu materiellen und formalen Pri- Institutionelle ÖPP sind in den Aufgaben-
vatisierungen bezeichnen ÖPP spezifische rechtliche bereichen kommunale Ver- und Entsorgung, IT
und organisatorische Formen der Teilprivatisierung und Datenverarbeitung (z. B. kommunaler Re-
öffentlicher Dienstleistungen, bei welchen der öffent- chenzentren) sowie Wirtschafts- und Tourismus-
liche Partner üblicherweise die politische Federführung förderung weit verbreitet (Gerstlberger 1999;
und die Gewährleistungsverantwortung beibehält. Napp 2004). ÖPP auf Basis eingetragener Vereine
Die ÖPP zugrunde liegende Aufgabenteilung haben im Rahmen kommunaler Sport- und Kul-
basiert idealtypisch auf dem Prinzip, dass jeder turaktivitäten eine zunehmende Bedeutung (Bun-
Partner die Aufgabe übernimmt, die er am effek- desministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
tivsten und effizientesten umsetzen kann. Dabei wicklung 2010). Besonders auf Bundes- und Lan-
können Aufgaben und Verantwortung auch un- desebene sowie in Großstädten werden ÖPP-Pro-
terschiedlich verteilt sein. Grundsätzlich geht es jektgesellschaften gegründet, um international
jedoch darum, das Ziel zu verfolgen, eine mög- bedeutsame Großprojekte durchzuführen (z. B. für
lichst effektive „Win-Win-Situation“ für beide die Expo 2000 in Hannover oder die Internationale
Partner herbeizuführen, bei der zugleich eine Bauausstellung Emscherpark/IBA im Ruhrgebiet).
höchstmögliche Qualität des Angebotes für den Die strategischen Ziele und wichtigsten vertragli-
Bürger bzw. Nutzer bei möglichst niedrigen Kos- chen Vereinbarungen, auf welchen institutionel-
ten erreicht wird. Diese und weitere idealtypische le ÖPP basieren, werden i.d.R. in einem Gesell-
Charakteristika von ÖPP lassen sich wie folgt in schaftervertrag festgelegt.
allgemeiner Form zusammenfassen (Gerstlberger/ Nach einem Urteil des Europäischen Ge-
Schneider 2008: 19): richtshofs (EuGH) vom 11. Januar 2005 unter-
– Langfristig angelegte Zusammenarbeit mit In- liegen ÖPP immer dann dem Vergaberecht der
terdependenz (gegenseitiger Abhängigkeit) Europäischen Union, wenn der öffentliche Anteil
beider Partner; den privaten Anteil an der Partnerschaft über-
– gemeinsame Projektstrategie und -ziele; steigt (AZ C-26/03; EuGH 2005, Ronellenfitsch
– vertraglich festgelegte Aufteilung der während 2005). Dies ist in aller Regel von öffentlicher Seite
der Projektplanung identifizierten Risiken ge- gewollt, um die eigene unternehmerische und
mäß den jeweiligen Kompetenzen und finanzi- politische Federführung in einer ÖPP zu gewähr-
ellen Möglichkeiten der Projektpartner; leisten. Nach der genannten Entscheidung des
– eine Zusammenarbeit, die über eine reine Auf- EuGH sind in der Bundesrepublik nur noch in
traggeber-Auftragnehmer-Beziehung hinaus- Einzelfällen neue ÖPP-Gesellschaften gegründet
geht. worden, beispielsweise in Bereichen wie Wirt-
Die deutsche ÖPP-Literatur unterscheidet zwi- schafts- und Tourismusförderung, in welchen
schen zwei Grundformen formalisierter öffent- von den ÖPP-Gesellschaften keine Leistungen für
11WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
Abbildung 1:
Typisierung von ÖPP
Aufgaben-
Organisations-/ IT-Projekte: Öffentlich-private Gesellschaften
bündelung
Aufbau Bürgeramt, Abfall, EVU, (Ab-)Wasser,
Personalentwicklung etc. Wirtschaftsförderung, Tourismus etc.
thematische
Breite
Groß-Veranstaltungen: Betreiberprojekte:
Einzel- Expo, IBA, documenta etc. Schulen, Straßen,
projekt Energieversorgung etc. etc.
kurz- & mittelfristig langfristig
Laufzeit
Quelle: Übersicht ÖPP-Typen (eigene Darstellung).
die eigene Kommune getätigt werden (Sack 2007; Die dritte aufgeführte vertragsbasierte ÖPP-
Gerstlberger/Schneider 2008: 8). Form, das Betreibermodell, stellt einen Sammel-
Vertragliche ÖPP sind durch langfristige Ver- begriff für unterschiedliche Spielarten von Ver-
tragsbeziehungen zwischen öffentlichen und pri- trags-ÖPP dar. Der private Betreiber übernimmt
vaten Organisationen gekennzeichnet. Die wich- in diesem Kontext mindestens die organisatori-
tigsten Formen von Vertrags-ÖPP in deutschen sche Verantwortung für die Errichtung und den
Gebietskörperschaften sind (1) Bereitstellungs-, Betrieb einer öffentlichen Infrastruktur-Einrich-
(2) Konzessions-, (3) Betreiber- und (4) Contrac- tung. Nach einem bestimmten vertraglich verein-
ting-Modelle (Gerstlberger et al. 2006; Sack 2007). barten Zeitraum übergibt der private Partner der
Bei der erstgenannten vertraglichen ÖPP-Form öffentlichen Gebietskörperschaft die jeweilige
garantiert der öffentliche Partner (z.B. ein kom- Infrastruktur-Einrichtung zur etwaigen Weiter-
munales Krankenhaus oder eine Universitätskli- nutzung. Der Private kann darüber hinaus auch
nik) dem privaten Partner langfristig die Provi- Planungs-, Finanzierungs- und zusätzliche War-
sion für die Bereitstellung komplexer Behand- tungsleistungen anbieten. Im Fall des vierten
lungs-, Wartungs- und Schulungsleistungen. Der ÖPP-Vertragsmodells vereinbaren der öffentliche
private Partner bringt dafür eigene Großgeräte in und der private Partner im Rahmen eines lang-
die Partnerschaft ein, die er in einigen Fällen fristigen Vertrags, dass der Private für den Öffent-
während der Vertragslaufzeit technisch weiter- lichen eine bestimmte Leistung (z. B. die Energie-
entwickelt. Für das zweite vertragsbasierte ÖPP- versorgung für einen Gebäudekomplex) mindes-
Modell ist charakteristisch, dass ein privater Kon- tens zu denselben Kosten erbringt, als dieser das
zessionär von einer öffentlichen Gebietskörper- in einem bestimmten Zeitraum vor Vertragsab-
schaft beauftragt wird, bestimmte gebührenbezo- schluss selbst tut. Unterschreitet der Private den
gene Dienstleistungen für private Nutzerinnen vertraglich festgelegten Kostenrahmen aufgrund
und Nutzer zu erbringen. Die Nutzungsgebühren eigener Innovation oder durch Prozessoptimie-
(z. B. Maut) werden entweder durch den privaten rung, werden die eingesparten Kosten nach
Konzessionär oder die öffentliche Gebietskörper- einem bestimmten Schlüssel zwischen beiden
schaft selbst erhoben und eingesammelt. Partnern aufgeteilt. Überschreitet der Private den
12Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
gemeinsam festgelegten Kostenrahmen, muss er tisch mit ÖPP auseinander setzen (Rügemer 2004;
nicht nur die entstehende Differenz aus eigenen 2008; ver.di 2005). So bieten große und langfris-
Mitteln finanzieren, sondern hat darüber hinaus tig angelegte Infrastruktur-ÖPP neben Chancen
auch eine Strafzahlung an die Gebietskörper- für den privaten Partner auch in besonderem
schaft zu entrichten. Maße Stoff, um Risiken und Probleme bereits lau-
Abbildung 1 zeigt, dass die vielfältigen Spiel- fender und gegenwärtig geplanter Vorhaben öf-
arten Öffentlich-Privater Partnerschaften, die ak- fentlich zu diskutieren. Dies zeigt sich derzeit ein-
tuell in den Gebietskörperschaften der Bundes- drucksvoll am Beispiel der Auseinandersetzung
republik vorkommen, nicht nur anhand der um das Bahnhofs-Neubauprojekt „Stuttgart 21“.
rechtlich-organisatorischen Achse „institutionelle Bevor in Kapitel 4 näher auf bisherige prak-
versus vertragliche ÖPP“ näher charakterisiert tische Erfahrungen mit großen ÖPP-Infrastruk-
werden können. So lassen sich aktuelle ÖPP-Pro- turprojekten in Deutschland eingegangen wird,
jekte darüber hinaus auch mit Hilfe von Kriterien soll an dieser Stelle noch auf die anderen drei
wie Quadranten in Abbildung 1 eingegangen werden.
– Investitionsvolumen, Folgt man den in der Einleitung angesprochenen
– Art der einbezogenen Aufgaben (neu versus zukünftigen Anforderungen an Öffentlich-Private
etabliert), Partnerschaften, können die in diesen Quadran-
– Grad der Aufgabenbündelung (Einzelaufgaben ten genannten Aufgaben bzw. Projekte oftmals
versus breite Aufgabenpalette), angemessener durch ÖPP bearbeitet werden als
– Zeithorizont (mittel-, kurz- oder langfristig) große Infrastrukturprojekte.
oder Bei den Projekten des linken unteren Qua-
– Offenheit für die Mitarbeit zusätzlicher Akteu- dranten handelt es sich aus Sicht der involvierten
re (Bürger-, Nutzer- oder Beschäftigtenbeteili- Kommune um einmalige oder zumindest seltene
gung) nationale oder internationale Großveranstaltun-
abgrenzen. Legt man derartige zusätzliche Defi- gen, wie Sport- und Kulturveranstaltungen sowie
nitionskriterien an, fällt auf, dass viele neuere große Ausstellungen. Hier liegt es nahe, Möglich-
deutsche Publikationen, Gutachten und Leitfä- keiten einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit
den zum Thema ÖPP sich vollständig oder weit- zu prüfen und ggf. zu nutzen, da kaum eine Kom-
gehend auf ÖPP-Spielarten beschränken, die im mune für sich alleine über die notwendigen Res-
rechten unteren Quadranten von Abbildung 1 sourcen und Kompetenzen verfügt, internatio-
anzutreffen sind. Diese langfristigen öffentlich- nale Großveranstaltungen professionell und effi-
privaten Infrastrukturprojekte für den Neubau zient durchzuführen (Häußermann/Siebel 1993).
oder die Modernisierung von Schulen, Hochschu- Bei der Durchführung solcher Einzelaufgaben be-
len, Verwaltungsgebäuden, Straßen, Flughäfen, steht daher eine plausible Chance, dass eine ÖPP
Krankenhäusern etc. sind hinsichtlich des Inves- mit einem spezialisierten Partner im Rahmen
titionsvolumens, der Laufzeit sowie der daraus einer engen Kooperation auf Zeit zu signifikanten
ableitbaren Ertragschancen aus der Sicht vieler Synergieeffekten führt.
potenzieller privater Partner ein besonders in- Der linke obere Quadrant fasst ÖPP-Ansätze
teressanter und attraktiver ÖPP-Typ. zusammen, mit deren Hilfe die Bündelung „klein-
„ÖPP-affine“ Veröffentlichungen und Hand- teiliger“ öffentlicher und privater Dienstleistun-
reichungen, wie sie jüngst von öffentlichen ÖPP- gen angestrebt wird. Dabei kann es sich in beiden
Kompetenzzentren oder großen Unternehmens- Fällen sowohl um kommerzielle als auch nicht-
beratungen herausgegeben worden sind (Bundes- kommerzielle Dienstleistungen handeln. Ein Bei-
ministerium für Verkehr, Bau und Wohnungs- spiel für diesen ÖPP-Typ, der besonders in länd-
wesen 2003; Littwin/Schöne 2006; Weber et al. lichen Regionen in den letzten Jahren erheblich
2006; Janetschek 2007) konzentrieren sich daher an Bedeutung gewonnen hat, sind „multi-funk-
auf diesen ÖPP-Typus. Dies gilt im Gegenzug tionale Serviceläden“. Mit diesem Begriff werden
auch für viele neuere Publikationen, die sich kri- Anlaufstellen („One-Stop-Shops“; Lenk 1997) be-
13WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
zeichnet, die beispielsweise gleichzeitig Lebens- die jeweiligen nationalen ÖPP-Diskussionen an-
mittel, Schreibwaren, Postdienstleistungen, Fahr- geht (Thierstein 2007; Favry/Hiess 2008).
karten für den ÖPNV sowie Eintrittskarten für Neue Perspektiven in Bezug auf die Siche-
kommunale Sportveranstaltungen vertreiben. rung und Entwicklung von Infrastruktur und
Darüber hinaus werden einfache amtliche For- Wertschöpfung im ländlichen Raum bieten ne-
mulare (für Sperrmüllabholung oder An-/Ummel- ben den dargestellten öffentlich-privaten Nah-
dung eines Stromanschlusses) ausgegeben und versorgungsprojekten auch Konzepte der dezen-
ausgefüllt entgegengenommen. tralen Energieversorgung. In diesem Kontext kann
Seit Ende der 1990er Jahre bieten derartige die Nutzung von lokalen, regenerativen Energie-
One-Stop-Shops verstärkt auch verschiedene On- ressourcen (wie der Winderzeugung in kommu-
line-Dienstleistungen an. Das Spektrum reicht nalen Windparks oder in lokalen Bioenergieanla-
hier von herunterladbaren Formularen bis hin zu gen) nicht nur einen Beitrag zum Erreichen einer
komplexeren Bestell- und Buchungsvorgängen gewissen Energieautarkie leisten, sondern auch
über das Internet sowie Auskünften per E-Mail. In für entsprechende Wertschöpfungs- und Beschäf-
den meisten Fällen teilen sich Gemeinden und tigungsimpulse in strukturschwachen Räumen
private Einzelhändler die unternehmerische so- sorgen. Die Zusammenarbeit zwischen der kom-
wie organisatorische Verantwortung für solche munalen Verwaltung, die die konzeptionellen
One-Stop-Shops in ländlichen Räumen. Häufig und rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einlei-
werden gemeindeeigene Räumlichkeiten genutzt, tung der örtlichen Energiewende gewährleistet,
die von lokalen Einzelhändlern bzw. deren Ange- und den kleinen und mittelständischen Unter-
stellten bewirtschaftet und betreut werden. Teil- nehmen vor Ort, die für die technische Umset-
weise werden diese öffentlich-privaten Anlauf- zung der konzipierten Maßnahmen sorgen, bietet
stellen darüber hinaus von lokalen Vereinen oder eine Option für die Umsetzung von zukünftigen
Bürgerinitiativen als Geschäftsstellen und Ver- ÖPP im ländlichen Raum (Energiebüro Amt Burg –
sammlungsorte genutzt. Der ÖPP-Ansatz der St. Michaelisdonn 2009; Sozialdemokratische Ge-
One-Stop-Shops wurde ursprünglich bereits in meinschaft für Kommunalpolitik in der Bundes-
den 1980er Jahren in Österreich entwickelt und republik Deutschland e.V. 2010).
unter der Überschrift „Sicherung der Nahversor- Blickt man auf den rechten oberen Bereich
gung in kleinen Landgemeinden“ popularisiert der Abbildung 1, hat sich seit dem Jahr 2005 auf-
(Favry/Hiess 2008; Regionalmanagement Ober- grund der o.g. EuGH-Entscheidung eine Bedeu-
österreich 2010). In den vergangenen Jahren ha- tungsverschiebung in Richtung von Dienstleis-
ben etliche deutsche Gemeinden in Bayern und tungen ergeben, die nicht von Gebietskörper-
Baden-Württemberg das österreichische Konzept schaften selbst, sondern von einzelnen Bürgern,
der Nahversorgung übernommen und entspre- Unternehmen oder Vereinen genutzt werden.
chend der jeweiligen Bedingungen vor Ort modi- Mittlerweile verfügen viele deutsche Kommunen
fiziert. Derartigen öffentlich-privaten Ansätzen, über spezialisierte öffentlich-private Gesellschaf-
welche die alltägliche Nahversorgung der Bevöl- ten für Wirtschaftsförderung, Tourismus oder
kerung insbesondere in dünn besiedelten, länd- Kulturmanagement (Trapp 2006: 97). Die Tätig-
lich geprägten und strukturschwachen Räumen keit von öffentlich-privaten GmbHs – oder zu-
verbessern, kommt in der deutschen ÖPP-Diskus- nehmend auch Vereinen – in den genannten Auf-
sion bisher keine nennenswerte Bedeutung zu. In gabenbereichen wird i.d.R. politisch weniger
Österreich, der Schweiz sowie in den skandinavi- kontrovers diskutiert als institutionelle ÖPP bei
schen Ländern hingegen spielen der von einer Stadtwerken (Gerstlberger 2009 b) oder kommu-
zunehmenden Entvölkerung der wirtschaftlich nalen Abwasserunternehmen (Tegner/Rehberg
aktiven Bevölkerung betroffene ländliche Raum 2006). Die wichtigsten Gründe für diese unter-
und innovative Nahversorgungskonzepte in den schiedliche Einschätzung liegen darin, dass
letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle, was GmbHs und Vereine im Bereich der kommunalen
14Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
Standortentwicklung und Kulturförderung in al- Partnerschaften mit Vereinen, Verbänden, Kir-
ler Regel nur über vergleichsweise kleine Haus- chen oder anderen Kommunen in der Region zu
halte und eine geringe Anzahl von Beschäftigten schaffen. Kommunale Bündnisse für Arbeit oder
verfügen. Darüber hinaus erbringen sie ihre großstädtisches Quartiersmanagement bedienen
Dienstleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer sich bereits heute in etlichen Städten und Ge-
unentgeltlich oder in Form geringer Bearbei- meinden des Instrumentes öffentlich-privater
tungsgebühren. Ein Anschluss- und Benutzungs- Gesellschaften als Organisationsmodell. Um die-
zwang für die Bürgerinnen und Bürger, wie er für sen institutionellen Kern herum können sich in-
die kommunale Abwasserbeseitigung in der Bun- formelle Aktivitäten und Netzwerke – im Sinne
desrepublik gilt, spielt hier keine Rolle (Tegner/ von „Handschlag-ÖPP“ – anlagern (Gerstlberger
Rehberg 2006). Neben der praktischen Bedeutung 1999: 160; Schneider 2002).
für die jeweilige Bürgerschaft und lokale Unter- In Kapitel 4 werden wichtige praktische Er-
nehmen können kleine kommunale Gesellschaf- fahrungen zusammengefasst, die von deutschen
ten mit Servicecharakter auch ein wichtiges stra- Gebietskörperschaften in den letzten beiden Jahr-
tegisches Instrument der langfristigen Stadtent- zehnten mit den vier in Abbildung 1 unterschie-
wicklung darstellen. Dies gilt sowohl im kom- denen ÖPP-Typen gesammelt wurden. Dieses
munalen Binnen- als auch Außenverhältnis. empirische Kapitel erhebt keinen Anspruch auf
Innerhalb der Kommune können sich Stadtwerke Vollständigkeit. Es geht hier vielmehr darum, an-
und Sparkassen gemeinsam an kommunalen Ge- hand verschiedenartiger Zugänge (quantitative
sellschaften für Wirtschafts- oder Technologie- Befragungen, qualitative Fallbeispiele und zwei
förderungen beteiligen. Dadurch kann eine ins- ÖPP-Expertengespräche) wichtige und differen-
titutionelle Plattform für gemeinsame Projekte zierte Kriterien für zukünftige Diskussionen bei
geschaffen werden. Dabei kann es sich beispiels- anstehenden Entscheidungen in öffentlichen
weise um E-Government-Projekte oder kommu- Gebietskörperschaften über Öffentlich-Private
nale Energieagenturen handeln (Gerstlberger/ Partnerschaften zusammenzustellen.
Sack 2003; Deutsche Energie Agentur 2008). Was Zuvor werden wichtige Rahmenbedingun-
das Außenverhältnis von Kommunen betrifft, gen für ÖPP in Deutschland und in der EU darge-
bieten kleinere kommunale Gesellschaften die stellt.
Möglichkeit, eine institutionelle Plattform für
15WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
3. Rahmenbedingungen für ÖPP in Deutschland und in der EU
Aufgrund der Folgen der internationalen Finanz- Diese derzeit nur vorläufig einschätzbaren Aus-
marktkrise für private Investoren und die öffent- wirkungen der internationalen Finanzmarktkrise
lichen Haushalte sind die Rahmenbedingungen haben in den letzten Monaten bei den kommu-
für ÖPP in der Bundesrepublik gegenüber dem nalen Entscheidern zusätzlich zu einer eher skep-
Zeitraum der Studie von Grabow et al. (2005) tischen Haltung gegenüber ÖPP beigetragen. Es
mittlerweile deutlich verändert. Die komplexen gibt darüber hinaus weitere Gründe für diese ten-
und bisher nur ansatzweise absehbaren Effekte denziell skeptische Haltung, die in Kapitel 3.4 auf
der globalen Finanzmarktkrise auf ÖPP betref- der Basis „kommunaler Stimmungsbilder“ aus
fen insbesondere die Finanzierungskomponente den Jahren 2009 und 2010 zusammengefasst wer-
(Partnerschaften Deutschland 2010; ÖPP-Initia- den. Zuvor werden jedoch noch einige weitere
tive NRW et al. 2010, Grossmann 2010: Deut- wichtige Rahmenbedingungen für ÖPP in der
licher Rückgang KfW-geförderter ÖPP-Projekte Bundesrepublik dargestellt.
seit 2008). In kompakter Form lassen sich die
Auswirkungen wie folgt zusammenfassen:
– Es ist seit Beginn der Krise für private Partner 3.1 Schwierige Haushalts- und Finanz-
schwerer geworden, mit Kreditinstituten lang- situation der deutschen Kommunen
fristige ÖPP-Finanzierungsmodelle zu verein-
baren, da die Anforderungen an Eigenkapital, Nicht erst durch die globale Weltfinanzmarktkri-
Solvenz und Liquidität erhöht wurden. se der Jahre 2008 und 2009 sind vielen deutschen
– Durch diese Entwicklung ist es auch für öffent- Kommunen wichtige Anteile der eigenen Finan-
liche Partner komplizierter geworden, geeigne- zierung weggebrochen. Der ohnehin bereits seit
te private Partner für ÖPP-Projekte zu finden. längerem vorhandene „Sanierungsstau“ ist in
– Darüber hinaus ist es auch für die meisten öf- vielen Städten, Gemeinden und Landkreisen auf-
fentlichen Gebietskörperschaften selbst schwe- grund der Krise weiter angewachsen. Die deut-
rer geworden, langfristige „kreditähnliche Ge- schen Kommunen werden auf Grundlage einer
schäfte“ (wozu ÖPP zählen) einzugehen, da aktuellen Analyse des Deutschen Landkreistages
sich aufgrund der Krise zusätzliche und finan- (2010) für das Jahr 2010 insgesamt ein Defizit
zielle Belastungen ergeben haben. von 14,8 Milliarden Euro zu verzeichnen haben.
– Es wird zunehmend diskutiert, die Finanzie- In den Prognosen des DLT für die kommenden
rungskomponente komplett oder teilweise aus Jahre wird mit weiteren jährlichen Defiziten in
ÖPP-Projekten herauszulösen und direkt dem ähnlicher Höhe gerechnet (vgl. Abbildung 2). Die
öffentlichen Partner zu übertragen. In diesem bereits vor der Krise vorhandenen geringen Spiel-
Fall stellt sich allerdings die Frage, warum die räume, eigene kommunale Investitionsvorhaben
Gebietskörperschaft überhaupt noch ÖPP nut- umzusetzen, werden in den nächsten Jahren
zen soll. Wenn es bei ÖPP nur noch um die durch die weiter sinkenden Einnahmen zusätz-
Nutzung der Fachkompetenzen und Erfahrun- lich reduziert (ergänzend Deutscher Städtetag
gen privater Partner gehen soll, können diese 2010). An dieser Entwicklung haben auch die
oftmals auch durch konventionelle Auftrags- Fördermaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II
vergaben genutzt werden (z. B. ÖPP-Initiative und vergleichbaren kurzfristigen staatlichen Un-
NRW et al. 2010: 5). terstützungsprogrammen bisher grundsätzlich
16Wirtschafts- und Sozialpolitik
WISO
Diskurs
Abbildung 2:
Entwicklung des Finanzierungssaldos deutscher Kommunen 2006 bis 2014 in Mrd. €
2006 2,96
2007 8,61
2008 7,61
-7,2 2009
-14,8 2010
-16,4 2011
-14,6 2012
-13,2 2013
-11,8 2014
-20 -15 -10 -5 0 5 10
Quelle: Deutscher Landkreistag 2010.
nur wenig ändern können. Es konnten mit diesen durch langfristige Zahlungsverpflichtungen, die
Fördergeldern zwar punktuell einige dringend aus ÖPP-Projekten resultieren (vgl. Kapitel 3.2).
notwendige Sanierungsmaßnahmen bei kommu-
nalen Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen
umgesetzt werden. Die strukturellen Haushalts- 3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
probleme vieler Kommunen wurden davon je- für ÖPP in Deutschland und der EU
doch nicht berührt (vgl. Kapitel 3.4).
So werden die Haushalte der deutschen Kom- In der Bundesrepublik ist ÖPP bisher überwie-
munen bis Ende des Jahres 2014, nach den in gend ein kommunales Thema (vgl. Kapitel 4.1
Abbildung 2 zusammengefassten Berechnungen, und 4.2). Aufgrund von Art. 28 Abs. 2 Grundge-
ein Gesamtdefizit von insgesamt ca. 60 Milliar- setz wird den Städten, Gemeinden und Landkrei-
den Euro erreichen. Angesichts dieser gravieren- sen in Deutschland – im Unterschied zu vielen
den strukturellen Haushaltsprobleme fordern die anderen Ländern (Heinz 1993; Wegener 2002;
kommunalen Spitzenverbände verstärkt eine Sack 2007) – kommunale Selbstverwaltung garan-
grundlegende Veränderung der Rahmenbedingun- tiert. Das Prinzip der kommunalen Selbstverwal-
gen für die Finanzierung kommunaler Haushalte tung stellt dabei sowohl eine rechtliche Basis als
(z. B. Deutscher Städtetag 2010). Eine vermehrte auch eine Beschränkung für ÖPP dar. Kommunen
Anwendung von ÖPP kann nach bisherigen Er- können sich in dem Rahmen, der durch die
fahrungen keinen nennenswerten Beitrag zur Re- Rechts- bzw. Kommunalaufsicht festgelegt wird,
duzierung der strukturellen Verschuldung der eigenständig für oder gegen Öffentlich-Private
Kommunen leisten, vielmehr besteht die Gefahr Partnerschaften entscheiden.1 In vielen anderen
einer zunehmenden „versteckten“ Verschuldung Staaten dagegen ist häufig die nationale Regie-
1 Vor allem Infrastruktur-ÖPP-Projekte basieren im Regelfall auf genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften (Konferenz der Präsidentin-
nen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder 2006).
17WISO
Diskurs Friedrich-Ebert-Stiftung
rung Träger von ÖPP-Projekten und realisiert die- Refinanzierung aufgrund einer privaten Ent-
se direkt mit Hilfe eigener ÖPP-Agenturen in be- geltregelung.
stimmten Kommunen. Dies ist vor allem in den In den Bundesländern wurden darüber hinaus in
„klassischen“ ÖPP-Ländern, den USA und Groß- den vergangenen Jahren ergänzende Gesetze und
britannien sowie in den skandinavischen Län- Rechtsverordnungen in Kraft gesetzt, um den
dern, der Fall (National Council for PPP 2007; jeweiligen landesspezifischen Rahmen für ÖPP
Gerstlberger 1999: 148). weiter auszugestalten. Als neuere Beispiele von
In der Bundesrepublik wurde durch das „ÖPP- vielen seien hier nur zwei Erlasse aus NRW und
Beschleunigungsgesetz“ (Deutscher Bundestag Sachsen genannt. In NRW müssen die Kommu-
2005; BMF 2005) aus dem Jahr 2005 die Etablie- nen seit 2006 bei der Anzeige eines neuen ÖPP-
rung Infrastruktur-Projekt-ÖPP in den deutschen Projekts eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Gebietskörperschaften deutlich erleichtert. Der vorlegen und dabei einen „konventionellen Ver-
Deutsche Bundestag beschloss im Wesentlichen gleichswert“ einbeziehen, der einer kommunalen
folgende Änderungen im Gebühren-, Vergabe-, Eigenerstellung entspricht (Ministerium für In-
Steuer-, Wettbewerbs- und Haushaltsrecht sowie bei neres und Kommunales des Landes Nordrhein-
den Finanzierungsbedingungen für öffentliche In- Westfalen 2006). Demgegenüber muss nach ei-
frastrukturvorhaben: nem Erlass des sächsischen Finanzministeriums
– Die Änderung der Bundeshaushaltsordnung er- derzeit bei kommunalen ÖPP-Projekten „dop-
möglicht die Veräußerung von unbeweglichen pelt“ ausgeschrieben werden: einmal konventio-
Vermögensgegenständen („Immobilien“), die nell und einmal ÖPP-spezifisch (Sächsisches
zur Erfüllung von Aufgaben des Bundes weiter- Staatsministerium des Innern 2008). Während
hin benötigt werden, wenn auf diese Weise die der o. g. Erlass aus NRW kommunale ÖPP insge-
Aufgaben des Bundes nachweislich wirtschaft- samt eher begünstigt hat, hat der sächsische Er-
licher erfüllt werden können. lass – nach bisherigen Erfahrungen – eher die ge-
– Die Änderung des Grunderwerbssteuergesetzes genteilige Wirkung entfaltet (vgl. Kapitel 3.4).
sieht die Befreiung von der Grunderwerbssteuer Diese unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbe-
bei der Übertragung von Grundstücken an dingungen auf Länderebene zeigen, dass vertrags-
ÖPP-Projektgesellschaften vor, solange sie für basierte Infrastruktur-ÖPP aktuell nicht nur mit
hoheitliche Zwecke genutzt werden – unter der kritischen Stimmen aus Gewerkschaften, Perso-
Voraussetzung einer Rückübertragung am Ende nalvertretungen und Rechnungshöfen (vgl. Kapi-
des Vertragszeitraums. tel 3.3) konfrontiert sind. Auch bei Expertinnen
– Die Änderung des Grundsteuergesetzes ermög- und Experten in zuständigen Landesministerien,
licht, dass der Grundbesitz einer ÖPP-Projekt- vor allem in den Innen-, Wirtschafts- und Finanz-
gesellschaft von der Grundsteuer befreit ist. ministerien, wird dieses Instrument derzeit kon-
Bedeutunglos ist dabei, ob der private Auftrag- trovers diskutiert (ergänzend Ostdeutscher Spar-
nehmer den ÖPP-Grundbesitz von der öffent- kassenverband 2007).
lichen Hand erhalten oder auf dem Immobi- Neben neueren Versuchen auf der deutschen
lienmarkt erworben hat. Bundes- und Landesebene, die rechtlichen Rah-
– Die Änderung von Finanzierungsbedingungen menbedingungen für vertragliche Infrastruktur-
für öffentliche Infrastrukturvorhaben eröffnet ÖPP weiter zu konkretisieren, sind in den letzten
privatwirtschaftlichen offenen Immobilienfonds Jahren auch aufgrund gerichtlicher und adminis-
die Möglichkeit, im Rahmen der Betreiberpha- trativer Entscheidungen auf EU-Ebene bestimmte
se Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften Beschränkungen für ÖPP in Deutschland for-
zu übernehmen. muliert worden. Neben der bereits in Kapitel 2
– Die Änderung des Fernstraßenbaufinanzierungs- genannten EuGH-Entscheidung zum Vergabe-
gesetzes ermöglicht privaten Betreibern beim recht bei „Inhouse-Leistungen“ einer institutio-
Ausbau von Bundesfernstraßen eine direkte nellen ÖPP-Gesellschaft ist hier die so genannte
18Sie können auch lesen