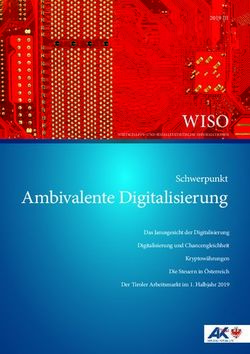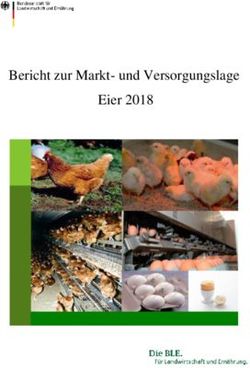Einsatz von Multiblend JET A-1 in der Praxis - Kurzstudie zu Möglichkeiten und Grenzen der thermo-chemischen Nutzung von Abfall zur ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
DEMO-SPK wird finanziert durch Forschungs- und Demonstrationsvorhaben zum Einsatz von erneuerbarem Kerosin am Flughafen Leipzig / Halle (DEMO-SPK) www.mks-dialog.de Einsatz von Multiblend JET A-1 in der Praxis Kurzstudie zu Möglichkeiten und Grenzen der thermo-chemischen Nutzung von Abfall zur Kerosinherstellung Autoren Anat Schanung (TUHH), Nils Bullerdiek (TUHH), Ulf Neuling (TUHH), Martin Kaltschmitt (TUHH), Florian Keller (TUBAF), Alexander Laugwitz (TUBAF), Bernd Meyer (TUBAF), Ludwig Georg Seidl (TUBAF), Patricio Edmundo Mamani Soliz (TUBAF), Franziska Müller-Langer (DBFZ)
Projektpartner und Kontaktmöglichkeiten DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum Dr.-Ing. Franziska Müller-Langer gemeinnützige GmbH +49 341 24 34-423 Torgauer Straße 116 franziska.mueller-langer@dbfz.de 04347 Leipzig Technische Universität Prof. Dr.-Ing. Bernd Meyer Bergakademie Freiberg +49 3731 39-4511 Institut für Energieverfahrenstechnik bernd.meyer@iec.tu-freiberg.de und Chemieingenieurwesen Fuchsmühlenweg 9, Haus 1 09599 Freiberg Technische Universität Hamburg Dr.-Ing. Ulf Neuling Institut für Umwelttechnik und +49 40 42 878-4391 Energiewirtschaft ulf.neuling@tuhh.de Eißendorfer Straße 40 (N) 21073 Hamburg Auftraggeber Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Zitation Schanung A., Bullerdiek N., Neuling U., Kaltschmitt M., Keller F., Laugwitz A., Meyer B., Seidl G.L., Soliz P.E.M., Müller-Langer F. (2020): Einsatz von Multiblend-JET-A-1 in der Praxis. Kurzstudie zu Möglichkeiten und Gren- zen der thermo-chemischen Nutzung von Abfall zur Kerosinherstellung. DBFZ Deutsches Biomasseforschungs- zentrum gemeinnützige GmbH, Leipzig. Stand: 06 / 2020
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Kurzzusammenfassung _____________________________________________________________________________ 1 1 Hintergrund und Motivation _____________________________________________________________________ 4 2 Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung _______________________________________ 5 Abfallfraktionen als verwertbarer Stoffstrom __________________________________________________ 5 Definition der Abfallfaktionen im deutschen Entsorgungssystem __________________________ 5 Bisherige und absehbare Entwicklung des Anfalls von Abfallfraktionen _____________________ 7 Bisherige und absehbare Entwicklung der Entsorgung und Abfallverwertung _______________ 10 Analyse sich möglicherweise ändernden Abfallverwertungswege und daraus resultierender Substitutionseffekte_____________________________________________________________ 12 Eigenschaften und Potenziale ausgewählter Abfallfraktionen/-Stoffströme für die Kerosinherstellung ___ 14 3 Erforderliche Rahmenbedingungen für abfallbasiertes Kerosin _________________________________________ 18 Vermarktbarkeit und Einsatzfähigkeit von Kraftstoffen aus Abfall _________________________________ 18 Anrechnung von Kraftstoffen aus Abfall im Kontext des Emissionshandels __________________________ 19 Derzeitigen Erfassung von Klimagasen aus der Abfallverwertung _________________________ 19 Anrechnung erneuerbarer Flugkraftstoffe im EU ETS __________________________________ 20 Einordnung Abfallbasierter Kraftstoffe im Rahmen RED II _______________________________ 21 Exkurs | SAF-Anrechnung CORSIA __________________________________________________ 22 Ableitung von Handlungsbedarfen zum Einsatz von Kerosin aus Abfall _____________________________ 24 4 Technische Machbarkeit für abfallbasiertes Kerosin__________________________________________________ 25 Kurzdarstellung Stand der Technik __________________________________________________________ 25 Systemperspektive – Kohlenstoffkreisläufe __________________________________________ 25 Prozessperspektive – Waste-to-X-Prozesse __________________________________________ 25 Thermo-chemische Wandlung ____________________________________________________ 26 Stand Synthesegaserzeugung _____________________________________________________ 28 Gasreinigung/-Konditionierung ____________________________________________________ 33 Synthesen _____________________________________________________________________ 34 Synergien durch Sektorkopplung __________________________________________________ 37 Vorschlag geeigneter Gesamtketten und Analyse der technischen Effizienz _________________________ 38 Referenztechnologien und Prozesskettenmodellierung des WynFuels-Konzepts ____________ 38 Ergebnisse der Prozesskettenmodellierung des WynFuels-Konzepts ______________________ 40 Vergleich mit Referenzkonzepten __________________________________________________ 45 Bewertung der technischen Machbarkeit ____________________________________________________ 45 5 Abschätzung erwarteter THG-Minderungen und Kerosingestehungskosten _______________________________ 47 Abschätzung erwarteter THG-Minderungspotenziale ___________________________________________ 47 Abschätzung Gestehungskosten für Kerosin aus Abfall __________________________________________ 51 Gesamteinschätzung THG und Kosten _______________________________________________________ 56 Exkurs | Theoretisches CO2-Reduktionspotenzial im Verkehr ____________________________________ 57 6 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen ___________________________________________________ 59 7 Referenzverzeichnis ___________________________________________________________________________ 62 IV
Abbildungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abb. 1 Bisherige Entwicklung der Abfallfraktionen [Umweltbundesamt, 2018; Umweltbundesamt, 2019a] _____ 8 Abb. 2 Entwicklung der Importe und Exporte für Restmüll und Altholz (* grenzüberschreitende Verbringung von zustimmungspflichtigen Abfällen , keine Unterteilung in Haus- / Gewerbe- / Industrieabfälle, nach Grundlage der europäischen Verordnung (EG) 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen) [Umweltbundesamt, 2020] ________________________________________________________________ 9 Abb. 3 Abfallaufkommen für 2015 und prognostizierte Entwicklung bis 2030 in Mio. Mg (*Werte für 2014) [Umweltbundesamt, 2018] _______________________________________________________________ 10 Abb.4 Bisherige Verwertungsquote verschiedener Abfallfraktionen [Umweltbundesamt, 2019a] ____________ 11 Abb.5 Jahresgang des häuslichen Restmüllaufkommens [Stadtreinigung Hamburg] _______________________ 16 Abb. 6 Beispielhafte Erfassung der Emissionen entlang des Lebenszyklus eines Abfallstoffs (Darstellung TUHH) ________________________________________________________________________________ 20 Abb. 7 Kohlenstoffkreisläufe (Tillmann 2018) ______________________________________________________ 25 Abb. 8 Systematik Stoffwandlung (eigene Darstellung TUBAF) ________________________________________ 26 Abb. 9 Übersicht Kraftstoff-Syntheserouten (Darstellung von IEC-TUBAF) _______________________________ 34 Abb. 10 Vereinfachtes Fließbildeiner beispielhaften abfallbasierten Kerosinsynthese über die Methanolroute (TUBAF) ______________________________________________________________________________ 39 Abb. 11 Übersicht potenzieller THG-Emissionen unterschiedlicher abfallbasierter Kraftstoffe (Alkohole = Butanol, Ethanol und Methanol; Kohlenwasserstoffe = Benzin, Diesel, Kerosin oder ähnliche; DME = Dimethylether; MSW = Municipal Solid Waste; nach [Stichnothe & Azapagic, 2009; Zhang et al., 2010; Schmitt et al., 2012; Ebner et al., 2014; Aracil et al., 2017; Guerrero & Muñoz, 2018; Suresh et al., 2018; Meng et al., 2019; Meng & McKechnie, 2019; Papadaskalopoulou et al., 2019; Keller et al., 2020]) ________________________________________________________________________________ 47 Abb. 12 Darstellung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen der untersuchten Prozesse in gCO2eq/MJKerosin für die Szenarien Netz (grauer Wasserstoff + Netzstrom) sowie Grün (grüner Wasserstoff + Windstrom) ___________________________________________________________________________ 50 Abb. 13 THG-Emissionen unterschiedlicher erneuerbarer Flugkraftstoffe im Vergleich zu Referenzwert fossiler Kraftstoffe der RED sowie der Mindestreduktion für nicht-biogenen Ursprungs (SAF: Sustainable Aviation Fuel, HEFA: Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, PtL: Power-to-Liquids, Bio-GtL: Biogas- to-Liquids, BtL: Biomass-to-Liquids, AtJ:Alcohol-to-Jet , DSHC: Direct Sugars to Hydrocarbons, nach: [Schmidt et al; Jovanović, 2012; Staples et al., 2014; Jong et al., 2015; Dietrich et al., 2017; Jong et al., 2017; Bullerdiek et al., 2019; Neuling, U., Kaltschmitt, M., 2019; Pavlenko et al., 2019; Winther Mortensen et al., 2019]) _________________________________________________________________ 51 Abb. 14 Übersicht potenzieller Herstellungskosten unterschiedlicher abfallbasierter Kraftstoffe normalisiert auf das Jahr 2019 (Alkohole = Butanol, Ethanol und Methanol; Kohlenwasserstoffe = Benzin, Diesel, Kerosin oder ähnliche; DME = Dimethylether; MSW = Municipal Solid Waste; nach [Zhang et al., 2010; Iaquaniello et al., 2017; Safarian & Unnthorsson, 2018; Suresh et al., 2018, 2018; Pavlenko et al., 2019; Sens, L., Neuling, U., Kaltschmitt, M., 2019; Ashani et al., 2020; Brown et al., 2020; Intan Shafinas Muhammad & Rosentrater, 2020]) _________________________________________________ 52 Abb. 15 Aufteilung der Herstellungskosten in die einzelnen Kostenbestandteile Investitionsausgaben (CAPEX), Betriebskosten (OPEX) und Einnahmen für unterschiedliche Herstellungspfade (FTS: Fischer-Tropsch Synthese, AtJ: Alcohol-to-Jet, MeOH: Methanol-Synthese; nach a: [Suresh, 2016], b: [Brown et al., 2020], c: [Chiarasumran], d: [Fivga & Dimitriou, 2018]) ________________________________________ 53 V
Abbildungsverzeichnis Abb. 16 Herstellungskosten der flüssigen Kraftstoffe für die drei untersuchten Einsatzstoffe für die Prozessvariante mit Hydrocracker in €/L inkl. der spezifischen Anteile der Investitionsausgaben (CAPEX), Betriebsausgaben (OPEX) sowie Entsorgungserlöse ____________________________________ 55 Abb. 18 Herstellungskosten unterschiedlicher erneuerbarer Flugkraftstoffe normalisiert auf das Jahr 2019 sowie die durchschnittliche Preisspanne für fossiles Jet A-1 (SAF: Sustainable Aviation Fuel, HEFA: Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, PtL: Power-to-Liquids, Bio-GtL: Biogas-to-Liquids, BtL: Biomass-to-Liquids, AtJ:Alcohol-to-Jet , DSHC: Direct Sugars to Hydrocarbons, nach: : [Jovanović, 2012; Jong et al., 2015; Sustainable Aviation Fuels Guide, Montréal (2017), 2017; Dietrich et al., 2017; Brynolf et al., 2018; Deutsch & Mayer, 2018; Hobohm et al., 2018; Bullerdiek et al., 2019; Neuling, U., Kaltschmitt, M., 2019; Pavlenko et al., 2019; Winther Mortensen et al., 2019]) _____________________ 56 VI
Tabellenverzeichnis Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Definition der unterschiedlichen Abfallfraktionen nach [Altholzverordnung – AltholzV; Europages; Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH: Abfallkatalog für das landwirtschaftliche Gewerbe; HRG Heisterner Holz Recycling GmbH; Schmid, H.-G.: Holzrecycling & Biomasse Schmid GmbH; Stadt Hamburg; Stadt Hamburg; Stadtreinigung Hamburg; Umweltbundesamt; Umweltbundesamt; Verbraucherzentrale; Stratmann, 2018] ____________________ 5 Tabelle 2 Mengenpotenziale der drei analysierten Abfallfraktionen sowie den daraus theoretisch herstellbaren Kerosins im Vergleich zum Kerosinabsatz in Deutschland (DE Domestic: nur Inlandsflüge, DE Full Scope: Gesamtabsatz) ___________________________________________________________________ 15 Tabelle 3 Gegenüberstellung der Brennstofftechnischen Eigenschaften für Altholz, Ersatzbrennstoff (EBS) aus Restmüll sowie der Sortierreste von Leichtverpackungen (wf = wasserfrei) ________________________ 17 Tabelle 4 Qualitativer Vergleich thermo-chemischer Wandlungsprozesse (eigene Bewertung TUBAF) ___________ 27 Tabelle 5 Verfahrensübersicht Vergasungstechnologien zur Synthesegaserzeugung [GBB Gersham, Brickner & Bratton, Inc; Hrbek; Quicker et al; Whitty et al; Williams & Zhan; Bain, 2011; Bush, 2016; Waldheim, 2018] ________________________________________________________________________________ 30 Tabelle 6 Verfahrensübersicht der Oligomerisierung von Olefinen [Lavrenov et al., 2016] ____________________ 35 Tabelle 7 Kurzübersicht laufende und frühere kommerzielle Vorhaben zur Vergasung von Abfällen mit Kraftstoffsynthese [Hrbek;Hrbek;Hrbek]. ____________________________________________________ 37 Tabelle 8 Referenztechnologien und Einordnung [Mawhood et al; Neuling & Kaltschmitt, 2018] _______________ 38 Tabelle 9 Ergebnisse der Prozesskettenmodellierung – OHNE Hydrocracking _______________________________ 41 Tabelle 10 Ergebnisse der Prozesskettenmodellierung – MIT Hydrocracking ________________________________ 42 Tabelle 11 Technologievergleich Kerosinherstellung ____________________________________________________ 43 Tabelle 12 Treibhausgas-Inventar der absoluten Emissionen der in Kapitel 4.2 untersuchten Prozesse in g CO2eq/h (umfasst nur die Kraftstoffsynthese, d. h. die Konversion) ______________________________________ 49 Tabelle 13 Spezifische Treibhausgas-Emissionen der untersuchten Prozesse mit Hydrocracker in gCO2eq/MJKerosin ___ 49 Tabelle 14 Rahmenannahmen zur Abschätzung der Herstellungskosten der untersuchten Prozessvarianten und Rohstoffe _____________________________________________________________________________ 54 VII
Kurzzusammenfassung Kurzzusammenfassung Das Forschungs- und Demonstrationsvorhaben zum Einsatz von erneuerbarem Kerosin am Flughafen Leipzig / Halle (kurz DEMO-SPK) wurde als Modellvorhaben der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) ini- tiiert und durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) finanziert. Ungeachtet der erfolgreichen Untersuchungen im Vorhaben DEMO-SPK bleibt die Tatsache, dass es für eine breite Marktimplementierung von erneuerbaren Kerosinen des massiven Ausbaus an Produktionskapazitäten sowie der Erweiterung von infrastrukturellen Gegebenheiten (z. B. zur Herstellung von Multiblend JET A-1) bedarf. Nur dann wird es möglich sein, die identifizierten und am Beispiel DEMO-SPK verifizierten positiven Effekte in Bezug auf Minderungspotenziale von Schadstoffemissionen und Treibhausgasen zu ermöglichen. Im Kontext des notwendigen Ausbaus an Produktionskapazitäten für Kerosin wird zunehmend auch die Ver- wertung von Abfall als Ausgangsstoff für die Produktion von Kraftstoffen diskutiert und ist seit vielen Jahren Gegenstand der Forschung, Entwicklung und Demonstration. Bislang sind keine Produktionsanlagen im kom- merziellen Maßstab verfügbar. Grund dafür sind nicht nur technische Herausforderungen, sondern auch viel- fältige weitere Randbedingungen, die bisher eine Produktion zu wettbewerbsfähigen Kosten bzw. Treibhaus- gasminderungskosten verhindern. Die hier durchgeführte Kurzstudie zu den Möglichkeiten und Grenzen der thermo-chemischen Nutzung von Abfall zur Herstellung von Kerosin für die Luftfahrt mit zunächst indikativem Charakter kommt zu folgenden Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen. Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung: Bisher wird ein Großteil des in Deutschland anfallenden Abfalls stofflich oder energetisch verwertet und steht somit nicht oder nur bedingt für eine Kraftstoffproduktion zur Verfügung. Allerdings schließt dies nur die bisher gesammelten und statisch erfassten Abfallmengen ein, darüber hinaus gibt es noch wei- tere, bisher nicht mobilisierte Abfallmengen, die in Zukunft potenziell zur Verfügung stehen könnten. Mit der Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Energien verändern sich auch die Rahmenbe- dingungen für die Abfallverwertung und letztendlich auch die Zusammensetzung der künftig anfallenden und zu behandelnden Abfälle. Zusätzlich ist zu erwarten, dass auf Grund der steigenden stofflichen Nut- zung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft langfristig nur noch stofflich nicht verwertbare Abfallfraktionen für eine energetische Nutzung verbleiben. Dies wird aller Voraussicht nach ebenfalls Veränderungen der Abfallverwertungswege mit sich bringen. Für die Kraftstoffherstellung erscheinen insbesondere die Abfallfraktionen Altholz, Ersatzbrennstoffe (EBS) und die Sortierreste der Leichtverpackung vielversprechend. Würde theoretisch das gesamte Ab- fallaufkommen dieser Fraktionen zur Kerosinherstellung genutzt und entsprechend der geltenden ASTM- Norm bis zu 50% (v/v) mit fossilem JET A-1 gemischt, könnten je nach Abfallfraktion ca. 7 bis 20% des Bedarfs des gesamten derzeitigen deutschen Flugverkehrs substituiert werden. Für alle drei Abfallfrakti- onen ergibt sich ein kumuliertes Substitutionspotenzial von ca. 44%, das jedoch nur verfügbar ist, wenn die gesamte Abfallmenge zur Kerosinproduktion eingesetzt werden würde. Analog zu den anderen er- neuerbaren Kerosinoptionen bedarf es auch für die abfallbasierten Routen eines entsprechenden Anrei- zes, diese Abfallfraktionen zur Kraftstoffherstellung einzusetzen, da dies aller Voraussicht nach nicht durch rein wirtschaftliche oder markt-basierte Prozesse erfolgen wird. 1
Kurzzusammenfassung Erforderliche Rahmenbedingungen für abfallbasiertes Kerosin: Damit abfallbasiertes Kerosin anrechenbar ist, muss es – wie andere erneuerbare Kraftstoffe auch – per Zertifikat nachzuweisenden Nachhaltigkeitskriterien genügen. Durch die noch zu konkretisierende An- rechnungsmethodik für abfallbasierte Kraftstoffe (recycled carbon fuels, RCF) in der RED II besteht der- zeit eine große Unsicherheit für eine sachgerechte Bewertung. Hier bedarf es einer Definition von RCF und die dazugehörigen Nachhaltigkeitsanforderungen (z. B. hinsichtlich der einsetzbaren Abfallfraktio- nen) sowie Berechnungsvorschriften (z. B. Anrechnung fossiler Anteile in Mischfraktionen); selbige sollen seitens der EC bis 01/2021 vorliegen. Außerdem müssen die daraus resultierenden Anforderungen sowie die neuen Anforderungen der RED II in nationale Regelungen überführt werden, wobei auch besondere Anreize für den Einsatz abfallbasierter Kraftstoffe implementiert werden können (z. B. Anrechenbarkeit RCFs auf nationale Quotenerfüllung). Um die Nutzung abfallbasierter Flugkraftstoffe und SAF insgesamt zu fördern bzw. sicherzustellen, sollte eine verbindliche SAF-Quote für den Luftverkehr etabliert werden. Hierbei ist eine gesamteuropäische Lösung zu bevorzugen. Alternativ dazu könnte eine derartige Quote, dem Beispiel anderer europäischer Länder folgend (z. B. 0,5% Beimischung in Norwegen ab 2020, Erhöhung auf 30% bis 2030), zunächst auf nationaler Ebene (für alle Flüge oder nur nationale Flüge) umgesetzt werden. Technische Machbarkeit für abfallbasiertes Kerosin: Die technische Machbarkeit für Verfahren, die die thermo-chemische Vergasung und Synthese zur Her- stellung von Kerosin beinhalten, wird als hoch eingeschätzt mit Verweis auf die Kraftstoffherstellung aus fossilen Einsatzstoffen (insbes. Erdgas und Kohle). Für den Einsatz von Abfall gibt es bisher keine in der Gesamtheit pilotierten bzw. im kommerziellen Umfang demonstrierten Vorhaben. Bisher sind lediglich die Teilschritte (Abfallaufbereitung, Abfallvergasung, Rohgasreinigung, Methanolsynthese, Kraftstoffsyn- these) im Demonstrations- oder kommerziellen Maßstab verfügbar. Vertiefte Untersuchungen geeigneter Gesamtketten für die Herstellung von abfallbasiertem Kerosin wur- den beispielhaft für das WynFuels-Konzept der TUBAF durchgeführt. Unterstellt wurde eine Anlagen- größe von 600 000 t/a Altholz, Ersatzbrennstoffe und Sortierreste, die jeweils über die bislang nicht ASTM-zertifizierte Methanolroute zu Kerosin (ca. 160 000 t/a aus Sortierresten, ca. 130 000 t/a aus Alt- holz und ca. 100 000 t/a aus Ersatzbrennstoffen) verarbeitet werden. Herstellungsrouten (synthesegasbasierte Kraftstofferzeugung) mit hoher erwartbarer Gesamtverfügbar- keit sind zu bevorzugen, da die Verfügbarkeit einen großen Einfluss auf die Produktgestehungskosten hat. Methanolbasierte Routen bieten durch die Entkopplung der robusten Methanolsynthese von der sensiblen Kraftstoffsynthese über das speicherbare Zwischenprodukt Methanol einen Vorteil gegenüber nicht-entkoppelten Routen, z.B. Fischer-Tropsch-Routen. Neben der Entkopplung bietet das CO2-redu- zierte Zwischenprodukt „grünes“ Methanol als Plattformchemikalie auch die Möglichkeit, flexibel auf die steigenden Marktanforderungen in anderen Bereichen der „grünen“ Chemie zu reagieren und unabhän- gig von der Kraftstoffproduktion Wertschöpfung zu generieren. Ungeachtet der konkreten technischen Konzepte bedarf es je nach jeweiligem technischen Entwicklungs- stand im nächsten Schritt des erfolgreichen Nachweises der Verschaltung, Integration und das Zusam- menwirken der gesamten Prozesskette im Demonstrationsmaßstab. Empfohlen wird dies als Technolo- gieplattformen für weiterführende Technologieentwicklungen und -optimierungen der Industrie auszurichten. 2
Kurzzusammenfassung Abschätzung erwarteter Treibhausgas-(THG)-Minderungen und Kerosingestehungskosten: In der kursorischen Betrachtung der erwarteten THG-Minderungspotenziale für den Part der Konversion zeigt sich der große Einfluss der Anrechnung des fossilen Kohlenstoffanteils der betrachteten Abfallfrak- tionen. Wird entsprechend der RED-Methodik der fossile Anteil des Kohlenstoffes mitberücksichtigt, er- reichen lediglich die altholzbasierten Prozessvarianten eine potenzielle THG-Einsparung von über 70% gegenüber der fossilen Referenz. Beim Einsatz von EBS und den Sortierresten der Leichtverpackung kann hier im besten Fall eine Minderung von 45 % erzielt werden, wobei sich diese noch weiter reduzieren könnte, wenn der fossile Anteil auch bei der Berechnung der Emissionen für die Rohstoffbereitstellung beachtet werden müssen. Eine tatsächliche Überprüfung der Einhaltung der RED-Grenzwerte für eine potenzielle Anrechnung dieser Kraftstoffe kann allerdings erst erfolgen, sobald ein entsprechender De- legierter Rechtsakt erlassen wurde und eine Anrechnungsmethodik mit entsprechenden Nachhaltig- keitskriterien definiert wurde. Allen alternativen Kraftstoffoptionen gemein sind die vergleichsweise deutlich höheren Gestehungskos- ten gegenüber den fossilen Pedants (hier JET A-1). Unter den getroffenen Annahmen und den unterstell- ten Entsorgungserlösen für die Abnahme der Abfallstoffe ergeben sich in Relation zu anderen Herstel- lungsrouten für nachhaltige Flugkraftstoffe vergleichsweise geringe Kerosingestehungskosten, wobei sich diese zu ähnlichen Anteilen aus den Investitionsausgaben und den Betriebskosten zusammensetzen. Hierbei haben die unterstellten Entsorgungserlöse nur einen geringen Anteil an den Gesamtkosten, soll- ten diese jedoch wegfallen und evtl. sogar Kosten für die Bereitstellung anfallen, würden sich die Geste- hungskosten deutlich erhöhen. Allerdings liegen die Herstellungskosten von 1,20 bis 1,30 €/L bereits mit diesen Annahmen beim zwei bis dreifachen des Preises von herkömmlichem JET A-1 (durchschnittlicher Marktpreis ca. 0,50 €/L). Wird das gesamte Abfallpotenzial für die Kerosinherstellung genutzt, ergibt sich ein theoretisches CO2- Reduktionspotenzail von ca. 7 Mio. tCO2/a; dies stellt eine theoretische Obergrenze dar, deren Erschlie- ßung unter den bereits genannten und absehbaren Randbedingungen sehr unwahrscheinlich ist. Für die ab 2021 geltenden THG-Mindesteinsparungen der RED II von 70 % und einer nach derzeitiger Anrech- nung des Strombezuges realistischen Kraftstoffproduktion unter Nutzung von Netzstrom ergäbe sich ein CO2-Reduktionspotenzial von ca. 3,7 Mio. tCO2/a, da in diesem Fall lediglich Kerosin aus Altholz und ein geringer zusätzlicher Anteil Kerosin aus EBS eingesetzt werden könnten. 3
Hintergrund und Motivation 1 Hintergrund und Motivation Ungeachtet der erfolgreichen Untersuchungen im MKS-Modellvorhaben DEMO-SPK bleibt die Tatsache, dass es neben den u. a. im Endbericht formulierten Empfehlungen für eine breite Marktimplementierung von er- neuerbaren Kerosinen des massiven Ausbaus an Produktionskapazitäten sowie der Erweiterung von infra- strukturellen Gegebenheiten (z. B. zur Herstellung von Multiblend JET A-1) bedarf. Nur dann wird es möglich sein, die identifizierten und am Beispiel DEMO-SPK verifizierten positiven Effekte in Bezug auf Minderungs- potenziale von Schadstoffemissionen und Treibhausgasen zu ermöglichen. Im Kontext des notwendigen Ausbaus an Produktionskapazitäten für Kerosin wird zunehmend auch die Ver- wertung von Abfall als Ausgangsstoff für die Produktion von Kraftstoffen diskutiert und ist seit vielen Jahren Gegenstand der Forschung, Entwicklung und Demonstration. Dennoch sind bislang keine Produktionsanlagen im kommerziellen Maßstab verfügbar. Grund dafür sind nicht nur technische Herausforderungen, sondern auch vielfältige weitere Randbedingungen, die bisher eine Produktion zu wettbewerbsfähigen Kosten bzw. Treibhausgasminderungskosten verhindern. Das MKS-Modellvorhaben DEMO-SPK bietet die Möglichkeit eine Kurzstudie zu den Möglichkeiten und Gren- zen der thermo-chemischen Nutzung von Abfall zur Herstellung von Kerosin für die Luftfahrt durchzuführen, die zunächst indikativen Charakter hat. Untersuchungsgegenstand sind vier Teilpakete, deren Ergebnisse nachfolgend dargestellt werden. Dabei ob- liegt die federführende Bearbeitung der Kapitel 2, 3 und 5 der TUHH und des Kapitels 4 der TUBAF. DBFZ hat die Kurzstudie als Projektkoordinator des Gesamtvorhabens DEMO-SPK koordiniert sowie in diesem Zusam- menhang die Erstellung der Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen begleitet. 4
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung 2 Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung Abfallfraktionen als verwertbarer Stoffstrom Im folgenden Abschnitt erfolgt die Definition und Klassifizierung der Abfallfraktionen in Deutschland sowie die Analyse des derzeitigen Abfallaufkommens und der daraus resultierenden Abfallbehandlung. Aufbauend auf dieser Analyse erfolgt eine kurze Abschätzung zur potenziellen Entwicklung des Abfallaufkommens und der damit einhergehenden Änderung der Abfallverwertungswege. Definition der Abfallfaktionen im deutschen Entsorgungssystem Die Klassifizierung der Abfallfraktionen orientiert sich an den Abfallströmen, die derzeit im deutschen Ab- fallentsorgungssystem erfasst werden. Sie beinhaltet die Fraktionen, die für Siedlungsabfälle sowie für Ge- werbe- und Industrieabfälle (nach [Umweltbundesamt, 2019a]) sowie für verschiedene Altholzstoffströme (nach [Umweltbundesamt, 2018]) erfasst werden. In Tabelle 1 ist die sich daraus ergebende Klassifizierung der Abfallfraktionen (Spalte Fraktionen) sowie die Definition der entsprechenden Fraktionen dargestellt. Hierzu sind für jede Abfallfraktion die üblichen Sam- melorte sowie die Zusammensetzung / die unterschiedlichen Bestandteile der einzelnen Fraktionen aufgelis- tet. Dabei handelt es sich um eine fachliche Definition; d. h. es ist ein Idealzustand darstellt. Somit spiegelt die Tabelle insbesondere die (hauptsächliche) Zusammensetzung die Abfälle wieder, die theoretisch auf die- sem Weg entsorgt werden sollen; dies inkludiert keine sogenannten Fehlwürfe (d. h. eine Entsorgung des Abfalls in eine nicht dafür bestimmte Abfallsammlung). Damit spiegelt dies nicht zwingend die tatsächliche (reale) Zusammensetzung der Fraktionen wider. Gerade im Hausmüll treten häufig Fehlwürfe auf (d.h. auch andere Abfallfraktionen landen zu einem bestimm- ten Anteil im Hausmüll); dies gilt insbesondere für Papier / Pappe / Kartonage (21,5% in 2011), Organik (18,9% in 2011), Kunststoff (15,6% in 2011) und Gartenabfälle / Grünschnitt (12% in 2011) [Umweltbundesamt, 2019b]. Tabelle 1 Definition der unterschiedlichen Abfallfraktionen nach [Altholzverordnung – AltholzV; Europages; Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH: Abfallkatalog für das landwirtschaftliche Gewerbe; HRG Heis- terner Holz Recycling GmbH; Schmid, H.-G.: Holzrecycling & Biomasse Schmid GmbH; Stadt Hamburg; Stadt Ham- burg; Stadtreinigung Hamburg; Umweltbundesamt; Umweltbundesamt; Verbraucherzentrale; Stratmann, 2018] Fraktionen Übliche Sammelorte (hauptsächliche) Zusammenset- zung Hausmüll (hier: Restmüll), haus- Restmülltonne z. B. Asche, Tierkot- und streu, ver- müllähnliche Gewerbeabfälle schmutze / imprägnierte / be- gemeinsam schichtete Papiere, Thermopa- piere, Hygieneartikel und Windeln, Staubsauerbeutel, defekte Glüh- birnen, angetrocknete Filzstifte, Zi- garettenkippen, alte Fotos, zerbro- chene Porzellane oder Glas Glas Glascontainer Einwegglasflaschen oder –gläser (wird getrennt gesammelt: Grün-, Braun-, Weißglas) Papier, Pappe, Kartonage Papiertonne z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Schreibpapier, Verpackungen aus Pappe, Geschenkpapier Leichtverpackungen, Kunst- Leichtverpackungen im gelben Sack / in Gelber Sack / gelbe Tonne*: Verpa- stoffe der gelben Tonne ckungen aus Kunststoff, Weiß- Leichtverpackungen / Kunststoffe in der blech, Aluminium, Verbundverpa- Wertstofftonne ckungen (Getränkekartons), 5
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung Fraktionen Übliche Sammelorte (hauptsächliche) Zusammenset- zung Pfandsystem Serviceverpackungen (Brötchentü- ten, Coffee to-go Becher, Styropor- box von take-away Essen) Wertstofftonne: siehe gelber Sack / gelbe Tonne, ferner stoffgleiche Nichtverpackungen (z. B. alte Zahnbürsten, Rührschüsseln aus Plastik, Kochtöpfe), je nach Stadt noch Altholz, Elektrogeräte Pfandsystem: Einweggetränkever- packungen zum Recyceln, Mehr- weggetränkeverpackungen zur Wiederverwendung, bis sie vom Abfüller aussortiert werden Elektrische und elektronische Bei kommunalen Sammelstellen oder beim Elektro(-nik) Altgeräte (z. B. Mobil- Geräte Händler** telefone, defekte Toaster, Bügelei- sen, Laptops), LED- und Leuchtstof- flampen Sonstiges (Verbunde, Metalle, u.a. Sondermüll: Produkte mit schädli- Textilien…) - Sondermüll, kommunale Sammelstellen, chen Inhaltsstoffen (Renovierungs- Handel abfälle, Reinigungsmittel, volle - Altkleidersammelstellen Spraydosen, Gartenchemikalien, - Korksammelstellen alles mit Gefahrensymbolen und - CD und DVD Quecksilber), im Handel alte Batte- rien, Akkus, Altöl Altkleidersammelstellen: alte Klei- dungsstücke Korksammelstellen: Weinhändler und Wertstoffhöfe sammeln z. B. alte Korken um sie zu recyceln, es werden z. B. biologische Dämm- stoffe und Bodenbeläge daraus ge- macht Abfälle aus der Biotonne Biotonne / Kompost Alle zur Kompostierung geeigneten organischen Abfälle (z. B. Pflanzen- reste, Gartenabfälle, Obst- und Ge- müseabfälle, Kaffee- / Teefilter), teilweise unterscheiden sich die Bedingungen je nach Stadt; z. B. dürfen in manchen Städten Fleisch- , Fischreste und Frittierfett mit dazu, in anderen nicht Altholz - Forstwirtschaft - Holzentsorgungsindustrie (bietet um- z. B. Knickholz, Forst fangreiche Dienstleistungen zur Sammlung / Erfassung / Weiterverarbeitung von Alt- holz) - Altholzbehandlungsanlagen Altholz – Holzverarbeitungsin- - Holzentsorgungsindustrie (bietet um- z. B. Verschnitt, Abschnitte, Späne dustrie fangreiche Dienstleistungen zur Sammlung von naturbelassenem und un- / Erfassung / Weiterverarbeitung von Alt- schädlichem Vollholz (AI, AII) holz) - Altholzbehandlungsanlagen - Wertstoffhof Altholz – Verpackungsabfälle - Holzentsorgungsindustrie (bietet um- z. B. Paletten aus Vollholz (AI), fangreiche Dienstleistungen zur Sammlung Holzwerkstoffen (AII), mit Ver- / Erfassung / Weiterverarbeitung von Alt- bundmaterialien (AIII), Transport- holz) kisten (z. B. Obst-, Gemüsekisten) - Altholzbehandlungsanlagen und Verschläge aus Vollholz und - Wertstoffhof Holzwerkstoffen (AI, AII), Muniti- onskisten (AIV) 6
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung Fraktionen Übliche Sammelorte (hauptsächliche) Zusammenset- zung Altholz – Bau- und Abbruchab- - Holzentsorgungsindustrie (bietet um- - Fraktionen von Bau- und Ab- fälle fangreiche Dienstleistungen zur Sammlung bruchabfällen: u. a. Glas, Kunst- / Erfassung / Weiterverarbeitung von Alt- stoff, Metalle, einschließlich Legie- holz) rungen, Holz, Dämmmaterial, - Altholzbehandlungsanlagen Baustoffe auf Gipsbasis, Beton, Zie- - Wertstoffhof gel, Fliesen und Keramik, PPK [e] - Bezogen auf Holz: Baustellensor- timente (AI, AII), Altholz aus dem Abbruch und Rückbau (z. B. Dielen, Bretterschalungen, Türblätter von Innentüren, Deckenpaneele, Zier- balken, Bauspanplatten (AII), Kon- struktionshölzer für tragende Teile, Holzfachwerk und Dachsparren, Fenster, Außentüren, imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich (AIV), Dämm- und Schallschutzplat- ten, die mit Mitteln behandelt wur- den, die polychlorierte Biphenyle enthalten (Beseitigung) Altholz – getrennt erfasstes Holz aus Siedlungsabfällen Altholz - Sperrmüll Gesonderte Abholung / Entsorgung, z. B. z. B. sperrige Abfälle, Möbelstücke, auf Recyclinghöfen Matratzen, Kühlschränke, große Elektrogeräte, Hausrat, der in keine Müllgefäße passt, Teppiche Altholz - Holz in gemischten Siedlungsabfällen Grünabschnitt – Garten- und - auf Recyclinghöfen für Recyclinghöfe / den Laubsack: Parkabfälle biologisch abbaubar - zu Hause im Laubsack Gartenabfälle, die nicht mehr in die Biotonne passen, Laubsäcke wer- den z. B. von der Stadtreinigung abgeholt oder werden ebenfalls zu Recyclinghöfen gebracht Gewerbe- und Industrieabfälle – - getrennt vom Hausmüll in Wechselbehäl- siehe Abfallfraktionen für private Hausmüllähnliche Gewerbeab- tern Haushalte fälle getrennt vom Hausmüll an- geliefert oder eingesammelt Gewerbe und Industrieabfälle – - Entsorgungsindustrie bietet Möglichkei- Biologische abbaubare Küchen- ten der Sammlung, Abholung und Weiter- und Kantinenabfälle verarbeitung (z. B. braune Tonnen als Sam- melbehälter) Bisherige und absehbare Entwicklung des Anfalls von Abfallfraktionen Für die Analyse der bisherigen und absehbaren Entwicklung des Abfallaufkommens werden die einzelnen Ab- fallfraktionen an Hand der in Abschnitt 2.1.1 eingeführten Oberkategorien der einzelnen Abfallfraktionen dis- kutiert. In Abb. 1 ist die bisherige Entwicklung der Abfallfraktionen Hausmüll, Abfälle aus der Biotonne, Alt- holz, Garten- und Parkabfälle, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle und biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenanfälle von 2000 bis 2017 dargestellt.1 1Altholz ausschließlich 2007, 2010 und 2017; Garten- und Parkabfälle ab 2002; biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenanfälle ab 2006 7
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung 20.000 18.000 16.000 Abfallmenge in Tausend Mg 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hausmüll (hier: Restmüll), hausmüllähnliche Gewerbeabfälle gemeinsam Abfälle aus der Biotonne Altholz (Industrie- und Gebrauchtholz) Garten- und Parkabfälle biologisch abbaubar Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle getrennt vom Hausmüll angeliefert oder eingesammelt Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Abb. 1 Bisherige Entwicklung der Abfallfraktionen [Umweltbundesamt, 2018; Umweltbundesamt, 2019a] Demnach hat sich die angefallene Menge Hausmüll nach einem Rückgang von ca. 18 Mio. Mg im Jahr 2000 auf ungefähr 14 Mio. Mg im Jahr 2008 in den vergangenen Jahren nur noch wenig verändert. Diese Reduktion lässt sich auf eine bessere Abfalltrennung zurückführen, da in dem selben Zeitraum das Aufkommen der ge- trennt gesammelten Fraktionen – u. a. Glas, Papier, gemischte Verpackungen – von 13,5 Mio. Mg auf 19,0 Mio. Mg pro Jahr anstieg. Auch bei den Garten- und Parkabfällen ist auf Grund einer verstärkten Samm- lung dieser Fraktion von 2002 bis ca. 2014 ein leichter Anstieg von ca. 4 Mio. Mg auf 6 Mio. Mg zu verzeich- nen. Dahingegen sind bei den anderen Abfallfraktionen ab 2002 nur noch geringer Veränderungen im Aufkommen zu erkennen. So wird bei den Abfällen aus der Biotonne ein leichter Anstieg von ca. 3,8 Mio. Mg im Jahr 2000 auf ca. 4,5 Mio. Mg in 2017 deutlich, der auf eine Erweiterung der getrennten Bioabfallsortierung zurückge- führt werden kann. Dieser Anstieg dürfe in der Anschlussfähigkeit der Bioabfalltonne begründet liegen, der mittlerweile jedoch nahezu vollständig umgesetzt ist; deshalb ist hier perspektivisch nur ein geringes zusätz- liches Wachstumspotenzial zu erwarten. Auch bei den biologisch abbaubaren Küchen- und Kantinenabfällen ist eine leichte Zunahme zu erkennen, die an einer Steigerung des Trends zum Essen außer Haus liegen kann. Allerdings ist das tatsächliche Potenzial im Vergleich zu den in den Abfallstatistiken erfassten Mengen ver- mutlich deutlich größer, da diese Abfallmengen häufig von privatwirtschaftlichen Dienstleistern eingesam- melt und weiterverarbeitet werden und diese somit nicht in die Statistik eingehen. Neben diesen Entwicklungen kann auch für Altholz ein leichter Anstieg von ca. 10,0 Mio. Mg in 2007 auf ca. 11,2 Mio. Mg in 2015 verzeichnet werden. Allerdings kommt es hierbei zu nicht unerheblichen Doppelzählun- gen durch Altholzmengen, die gehandelt und anschließend wieder der Abfallverwertung zugeführt werden. Wird also eine Menge Altholz, die bereits in der Statistik erfasst ist, gehandelt und anschließend wieder einer 8
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung Verwertung (z. B. Recycling als Sperrholz) zugeführt, fließt diese Menge doppelt ein. Das tatsächlich verfüg- bare Altholzaufkommen dürfte somit deutlich geringer sein. Die in Abb. 1 dargestellten Abfallströme werden anschließend in unterschiedlichen Behandlungskaskaden weiterverarbeitet. Eine wichtige Ressource, die durch die weitere Abfallbehandlung zur Verfügung gestellt wird, ist der Sortierrest aus dem gelben Sack (sogenannte Sortierreste von Leichtverpackungen). Im Jahr 2015 fielen an derartigen Sortierresten ca. 4,5 Mio. Mg an. Dieser Sortierrest sowie andere Stoffe aus der Sortier- anlage werden als Ersatzbrennstoff (EBS) u. a. zur Energieversorgung verbrannt. Im Jahr 2015 stand insgesamt eine Menge von 7,9 Mio. Mg an Ersatzbrennstoff zur Verfügung. Zudem werden auch weitere Abfälle aus der Abfallbehandlung eingesetzt, die nicht als Ersatzbrennstoff klassifiziert werden (z. B. Klärschlamm, Schredder- leichtfraktion und tierische Nebenprodukte, jährliches Gesamtaufkommen ca. 2,2 Mio. Mg). [Umweltbundes- amt, 2018] Neben dem reinen Abfallaufkommen und dessen Behandlung in Deutschland erfolgt in einem gewissen Um- fang auch Im- bzw. Export von Abfallströmen, wobei sich dieser im Wesentlichen auf die Nachbarstaaten und hier auch i. Allg. auf die grenznahen Räume begrenzt. Die in den vergangenen Jahren grenzüberschreitend transportierten Mengen an Restmüll (2009 bis 2018) und Altholz (2007, 2010, 2015) sind in Abb. 2 gegenüber- gestellt. Die importierten Mengen Restmüll nahmen hierbei in den letzten Jahren (mit Ausnahme von 2017) kontinuierlich zu, wobei die gleichzeitig exportierten Mengen im Mittel auf einem ähnlichen Niveau verblie- ben. Da die deutschen Müllverwertungsanlagen (und hier primär die Müllverbrennungsanlagen) nicht voll ausgelastet sind, erhöht der importierte Restmüll die Anlagenauslastung. Altholz wird in deutlich größeren Mengen importiert; allerdings ist auf Grund der schlechten Datenlage kein tatsächlicher Trend über Zu- oder Abnahme der Gesamtmengen zu erkennen. Dahingegen wird nur ein vergleichsweise geringer Anteil Altholz exportiert. 1000 900 800 Abfallmenge in Tausend Mg 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Import Restmüll* Export Restmüll* Import Altholz Export Altholz Abb. 2 Entwicklung der Importe und Exporte für Restmüll und Altholz (* grenzüberschreitende Verbringung von zustim- mungspflichtigen Abfällen , keine Unterteilung in Haus- / Gewerbe- / Industrieabfälle, nach Grundlage der europäi- schen Verordnung (EG) 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen) [Umweltbundesamt, 2020] Die potenzielle Entwicklung des Abfallaufkommens für einen Teil der betrachteten Fraktionen zeigt Abb. 3. Nach derzeitigen Prognosen wird das Gesamtabfallaufkommen (d. h. Abfälle, die in thermischen und biologi- schen Verfahren energetisch verwertet werden) von ca. 48 Mio. Mg im Jahr 2015 auf etwa 57,7 Mio. Mg bis 9
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung 2030 steigen. Hierbei wird für Hausmüll aufgrund einer erweiterten Bioabfallsammlung ein Rückgang um 1,7 Mio. Mg auf ca. 12,6 Mio. Mg bis 2030 erwartet. Bei den Hausmüll-ähnlichen Gewerbeabfällen wird eine Steigerung von 15 %, in Anlehnung an das wachsende Bruttoinlandsprodukt (BIP), erwartet. Für die Abfälle aus der Biotonne ist entsprechend der Reduktion des allgemeinen Hausmülls ein zusätzliches Potenzial von 1,7 Mio. Mg/a wahrscheinlich. Die Verpackungsabfälle aus privaten Haushalten werden gleichlaufend zum BIP um voraussichtlich 5 % bis 2030 ansteigen. Bei Holzabfällen wird unter Berücksichtigung des BIP und von Effizienzsteigerungen von einer Zunahme der Abfallmenge von 20 % und bei Küchen- und Kantinenabfällen von einer Mengensteigerung von 15 % ausgegangen. Küchen-/Kantinenabfälle Aufkommen 2015 Aufkommen 2030 Sonstige Kunststoffabfälle Verpackungsabfälle gewerblich Holzabfälle Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle Straßenkehricht, Park- und Gartenabfälle Verpackungsabfälle* Abfälle aus der Biotonne Gemischte Siedlungsabfälle 0 4 8 12 16 Abfallaufkommen in Mg Abb. 3 Abfallaufkommen für 2015 und prognostizierte Entwicklung bis 2030 in Mio. Mg (*Werte für 2014) [Umweltbundes- amt, 2018] Bisherige und absehbare Entwicklung der Entsorgung und Abfallverwertung Im Rahmen des deutschen Abfallentsorgungssystems erfolgt die Verwertung der einzelnen Abfallfraktionen über unterschiedliche Prozesse bzw. Verwertungswege. Eine Zuordnung der Abfallfraktionen zu den entspre- chenden Verwertungsverfahren ist nur bedingt möglich, da die Abfallfraktionen unterschiedliche Behand- lungskaskaden durchlaufen, in denen die Abfallfraktionen wiederum getrennt bzw. weiterverarbeitet werden und somit andere Stoffströme erzeugt werden. Für die Abfallverwertung der einzelnen Abfallfraktionen wer- den im Folgenden unterschiedliche Quellen / Bezugssysteme zu Grunde gelegt. Die Abfallfraktionen der un- 10
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung terschiedlichen Quellen / Bezugssysteme sind hierbei (meist) nicht vergleichbar, da diese unterschiedlich klas- sifiziert werden. Die daraus resultierenden Entsorgungs- und Verwertungsmöglichkeiten sind somit nicht als eine vollständige Stoffstromanalyse zu verstehen. Vielmehr soll hiermit ein Überblick über die Entsorgungs- und Verwertungspfade sowie deren potenzielle zukünftige Entwicklung gegeben werden. Allgemein wird die Abfallbehandlung im Wesentlichen in Ablagerung / Deponierung, thermische Beseitigung, Behandlung zur Beseitigung, energetische Verwertung sowie die stoffliche Verwertung unterteilt. Dabei un- terscheidet sich der Verwertungsweg für die unterschiedlichen Abfallfraktionen. Daraus lässt sich die in Abb.4 dargestellte Verwertungsquote (Anteil der energetischen und stofflichen Verwertung bezogen auf die Ge- samtabfallmenge) unterschiedlicher Abfallfraktionen (Hausmüll, Glas, Papier / Pappe, Kunststoff, elektrischer und elektronischer Geräte, sonstige getrennt erfasste Siedlungsabfälle, Bioabfall aus der Biotonne, biologi- sche Garten- und Parkabfälle, Hausmüll aus Gewerbe und Industrie, biologische Küchen- und Kantinenabfälle) für die Jahre 2000 bis 2015 ableiten. 120 100 Verwertungsquote in % 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hausmüll - Verwertungsquote Bioabfall - Verwertungsquote Garten- und Parkabfälle - Verwertungsquote Hausmüll aus Gewerbe und Industrie - Verwertungsquote Kantinenabfälle - Verwertungsquote Sonstige - Recyclingquote Abb.4 Bisherige Verwertungsquote verschiedener Abfallfraktionen [Umweltbundesamt, 2019a] Für Hausmüll, Leichtverpackungen / Kunststoffe / Hausmüll-ähnliche Gewerbeabfälle ist in den vergangenen Jahren ein Trend weg von der thermischen Beseitigung und hin zu energetischer Verwertung zu beobachten. Der wesentliche Grund dafür liegt darin, dass immer mehr Abfallverbrennungsanlagen das R1-Kriterium für die energetische Verwertung von Abfällen in Siedlungsabfallverbrennungsanlagen gemäß der EU-Abfallrah- menrichtlinie2 erfüllen und somit Verwertungsstatus erlangt haben [Briese & Gatena, 2019]. Für Hausmüll ist in den letzten Jahren zusätzlich ein Anstieg der Recyclingquote zu verzeichnen; dies ist sowohl auf eine ver- besserte Sortiertechnik als auch auf entsprechende Gesetzgebungen im Rahmen des KrWG zurückzuführen [Umweltbundesamt, 2018]. 2 Nach der EU-Abfallrahmenrichtlinie werden Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle ab dem Erreichen einer bestimmten Energie- effizienz (kurz R1-Kennzahl) als Verwertungsanlagen eingestuft. Diese Kennzahl wird mit Hilfe einer Formel zur Berechnung der Ener- gieeffizienz bzw. kurz R1-Formel berechnet. Mittlerweile haben alle Anlagen zur energetischen Abfallentsorgung dies R1-Kriterium erlangt und werden somit als Verwertungsanlagen eingestuft. 11
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung Für Verpackung / Kunststoffabfälle ergibt sich für 2015 eine Gesamtverwertungsquote von 99 %; die verblei- bende Menge geht in die Beseitigung / Deponierung. Von den Abfällen, die einer Verwertung zugeführt wer- den, werden 53 % energetisch und 46 % stofflich verwertet. Hiervon werden 34,5 % der Kunststoffabfälle in Müllverbrennungsanlagen (MVA) und 18,5 % als EBS / Sonstiges eingesetzt; bei der stofflichen Verwertung werden ca. 45 % werkstofflich und 1 % rohstofflich verwertet [Umweltbundesamt, 2018].3 Für Altholz liegt die Verwertungsquote bei nahezu 100 %. Die energetische Verwertung von Altholz (jeweils für die Jahre 2007, 2010 und 20154) erfolgt über die thermische Behandlung in MVA (11 %, 11 % bzw. 12 %), in Großfeuerungsanlagen und Mitverbrennungsanlagen (74 %, 69 % bzw. 73 %), in kleinen und mittleren Feu- erungsanlagen (15 %, 8 % bzw. 6 %) sowie über eine stoffliche Verwertung (9 %, 11 % bzw. 10 %). Insgesamt ist bei einem leichten Anstieg des Gesamtaltholzaufkommens in den vergangenen Jahren eine Gleichvertei- lung auf die thermische und die stoffliche Nutzung zu erkennen [Umweltbundesamt, 2018]. EBS und andere Abfälle zur Abfallbehandlung werden (Bezugsjahr 2015) zu 43 % in Müllverbrennungsanlagen, zu 38 % in Ersatzbrennstoff-Kraftwerken (EBS-KW), zu 13 % in Zementwerken (ZW) und zu 6 % in Kohlekraft- werken (KKW) eingesetzt [Umweltbundesamt, 2018]. Die zukünftige Entwicklung der einzelnen Verwertungswege hängt von verschiedenen Einflussfaktoren, wie der Entwicklung der Bevölkerungszahl, der Weiterentwicklung wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedin- gungen sowie des BIP ab. Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung der Abfallmenge sowie dieser wesentlichen Einflussfaktoren ist für 2030 von einer erhöhten Recyclingquote und einem Rückgang des ener- getisch verwertbaren Abfallanteils auszugehen. Da sich parallel aber auch die Abfallmenge erhöht, bleibt die Abfallmenge der energetischen Verwertung absolut in etwa gleich groß. [Umweltbundesamt, 2018] Analyse sich möglicherweise ändernden Abfallverwertungswege und daraus resultierender Substitu- tionseffekte Mit der Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Energien verändern sich auch die Rahmenbedingun- gen für die Abfallverwertung und letztendlich auch die Zusammensetzung der künftig anfallenden und zu be- handelnden Abfälle. Dies wird aller Voraussicht nach ebenfalls Veränderungen der Abfallverwertungswege mit sich bringen. Einige in diesem Zusammenhang zu erwartende Effekte werden im Folgenden kurz disku- tiert. Da der gesamte Themenkomplex der zukünftigen Entwicklung des Energiesystems sowie die daraus re- sultierenden Effekte auf andere Sektoren sehr komplex ist und zum derzeitigen Zeitpunkt nur bedingt vorher- gesagt werden kann, kann hier nur ein kurzer Ausblick gegeben werden. Bis zum Jahr 2016 verfügten von den insgesamt in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerken 25 über eine Ge- nehmigung zur Mitverbrennung von Abfällen (d. h. 10 Braunkohlekraftwerke und 15 Steinkohlekraftwerke). Von diesen haben 16 auch tatsächlich Abfälle in einer Größenordnung von rund 1,5 Mio. Mg mitverbrannt. Hier eingesetzte Sekundärbrennstoffe waren u. a. Papier- und Faserschlämme, Klärschlamm, Kunststoffe so- wie organische Abfälle [Birnstengel et al., 2018]. Aufgrund der Energiewende sowie dem geplanten Kohleaus- stieg werden diese Kohlekraftwerke jedoch sukzessive außer Betrieb gesetzt. Damit wird in absehbarer Zeit auch die Mitverbrennung von Abfällen (als EBS) in diesen Anlagen nicht mehr möglich sein. Alternativer kann dieser Brennstoff aufgrund seiner guten Qualität in Zementwerken eingesetzt werden, wo ein Teil des EBS bereits heute zugefeuert wird. Auf Grund der steigenden stofflichen Nutzung im Sinne einer Kreislaufwirt- schaft verbleiben langfristig nur noch stofflich nicht verwertbare Abfallfraktionen für eine energetische Nut- 3 Dies widerspricht den Angaben aus [18], allerdings werden hier ähnliche Verhältnisse angegeben. 4 Prognose basierend auf den bisherigen Entwicklungen 12
Verfügbarkeit von geeigneten Abfällen für die Kerosinherstellung zung. Dies und die Verringerung der fossilen Kunststoffanteile in den verbleibenden Fraktionen werden ins- gesamt zu einer Reduzierung des Heizwerts führen. Diese qualitativen Veränderungen könnten den Einsatz in hochkalorischen EBS in Zementwerken einschränken. Alternativ könnten freiwerdende Mengen an Ersatzbrennstoff zukünftig verstärkt zur Wärme- und Prozess- energieversorgung genutzt werden, da sie für die Stromversorgung nicht die nötige Flexibilität mitbringen. Dies könnte außerdem dazu führen, dass die Vergärung von biogenen Abfallfraktionen mit anschließender Biogasaufbereitung für eine flexible Stromerzeugung an Bedeutung gewinnen könnte. Im Zuge der Dekarbo- nisierung sollten mittelfristig auch fossile Bestandteile den Abfallströmen zur thermischen und energetischen Verwertung entzogen werden. Dies kann zum einen durch ein verstärktes Recycling einzelner Abfallfraktionen oder durch die generelle Reduktion von fossilen Rohstoffen in der Produktion erreicht werden. Somit ist lang- fristig von einem Rückgang von Materialien fossilen Ursprungs im Wirtschaftskreislauf und damit auch in den künftigen Abfällen auszugehen. Für die derzeitige thermische Nutzung von Altholz könnte sich in den nächsten Jahren eine potenziell gegen- läufige Entwicklung ergeben. Ein Großteil des thermisch Verwerteten Altholzes wird in EEG geförderten Feu- erungsanlagen energetisch zur Strom- und Wärmeproduktion eingesetzt (ca. 70 %) [Baur et al., 2018]. Die Förderung von Altholzfeuerungsanlagen startete im Jahr 2000, so dass die ersten Anlagen bereits im Jahr 2020 aus der Förderung fallen, die letzten bis Ende 2026. Durch diese Entwicklung könnten potenziell 5,2 Mio. Mg/a Altholz für andere Nutzungspfade zur Verfügung stehen. Ob und wieviel diese Mengen tatsächlich für andere Nutzungspfade, wie z. B. der Kerosinherstellung zur Verfügung stehen, hängt auch mit den Rahmenbedingun- gen für den Weiterbetrieb der Altholzverbrennungsanlagen zusammen. Da viele der Post-EEG-Anlagen aus technischer Sicht weiterbetrieben werden könnten hängt der ökonomische Weiterbetrieb an zukünftigen Ge- schäftsmodellen und politischen Rahmenbedingungen [Thiel et al., 2020]. Es ist unklar, ob die Abfallbehandlung aus Gründen des Umweltschutzes in Zukunft nach wie vor ein wichtiger Pfeiler sein wird, da mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energie an der deutschen Energieversorgung die energetische Abfallverwertung potenziell mit höheren THG-Emissionen verbunden ist und somit mit einer Verschlechterung der Klimabilanz der Energieversorgung einhergehen würde. Darüber hinaus lässt sich ein möglicher Einfluss des Klimawandels auf die Abfallverwertung sowie die energe- tische Abfallnutzung erkennen. So waren z. B. im Sommer 2018 aufgrund der hohen Trockenheit auch die Abfälle sehr trocken und die Heizwerte entsprechend hoch. Dies hat wiederum zu Engpässen in der Entsor- gung geführt. Ebenfalls durch die hohen Gesamttemperaturen bedingt konnten Anlagen ihre Kühlwässer teil- weise nur eingeschränkt in die jeweiligen Flüsse leiten, um die an sich schon (zu) hohe Wassertemperatur nicht weiter zu erhöhen. Dadurch wurden im Sommer 2018 die Verwertungskapazitäten einiger Anlagen ein- geschränkt. Diese Entwicklungen könnten sich durch den globalen Klimawandel und die zu erwartenden Tem- peratursteigerungen noch verstärken [Birnstengel et al., 2018]. 13
Sie können auch lesen