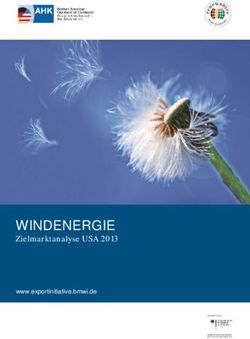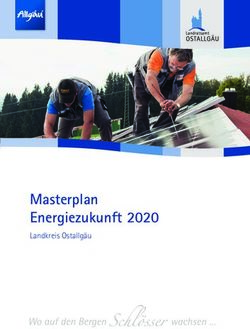WALDZUSTANDS-BERICHT 2020 - Saarland.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Impressum
Herausgeber Durchführung, Auswertung und Gestaltung
Ministerium für Umwelt und Zentralstelle der Forstverwaltung
Verbraucherschutz Saarland Forschungsanstalt für Waldökologie und
Keplerstr. 18 Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz
66117 Saarbrücken Hauptstr. 16
67705 Trippstadt
Ansprechpartner: Telefon: 06306 911-0, Fax: 06306 911-200
MR Thomas Steinmetz zdf.fawf@wald-rlp.de
Telefon: 0681 501-4271 www.fawf.wald-rlp.de
Mitwirkung
Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz SaarForst Landesbetrieb
Don-Bosco-Str. 1 Von der Heydt 12
66119 Saarbrücken 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681 8500-0, Fax: 0681 8500-1384 Telefon: 0681 9712-01, Fax: 0681 9712-150
lua@lua.saarland.de poststelle@sfl.saarland.de
www.saarforst-saarland.de
Universität Trier
FB VI, Geobotanik
54286 Trier
Telefon: 0651 201-0
www.uni-trier.de
Saarbrücken, November 2020
als Download
www.saarland.de/waldzustandsbericht.htm
Titelbild:
Trockenschäden und Borkenkäferbefall bei Steinbach-Lebach Foto: Th. Wehner
2WALDZUSTANDS-
BERICHT 2020
Seite
Vorwort 4
Waldzustand 2020 - Ein Überblick 6
Waldzustandserhebung (WZE) 10
Einflüsse auf den Waldzustand Waldschutz 28
Einflüsse auf den Waldzustand Luftverunreinigungen 38
Wiederholungskalkung von Waldbeständen zur nachhaltigen
Sicherung der Bodenvitaltiät 48
Anhänge
Zeitreihentabellen der Anteile der Schadstufen 54
Probebaumkollektiv 2020 60
Zusammensetzung des Probebaumkollektives nach Altersklassen 61
Statistische Signifikanz der Veränderungen der mittleren Kronenverlichtung 62
Ausmaß und Ursachen des Ausscheidens von Probebäumen 63
Abkommen und gesetzliche Regelungen zur Luftreinhaltung 65
Masterplan für den saarländischen Wald 67
3VORWORT
Liebe Saarländerinnen und Saarländer,
der Klimaforscher Ed Hawkins entwickelte die Im Detail stellt sich die Lage im Saarland 2020 wie
Grafik mit den farbigen Jahresstreifen und der folgt dar:
Deutsche Wetterdienst füllte diese Grafik dann
Die Buche hat mit 23 Prozent den größten Flä-
mit den Durchschnittstemperaturen von 1881 bis
chenanteil. Damit ist sie Leitbaumart der natür-
2019. Im Ergebnis sehen wir auf eindrucksvolle
lich vorkommenden Waldgesellschaften. Das
Weise den Trend der Erwärmung in Deutschland,
Schadniveau ist gegenüber dem Vorjahr erheblich
insbesondere die beispiellose Häufung von Tem-
angestiegen. Der Anteil der Buchen mit deutlichen
peraturrekorden seit Anfang der 1990-er Jahre.
Schäden liegt bei 58 Prozent. Das sind 32 Prozent-
Es war in den vergangenen 20 Jahren zunehmend punkte mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Buchen
zu heiß und zu trocken, und das bleibt für unse- ohne sichtbare Schadmerkmale liegt bei zwölf
ren Wald nicht ohne Folgen. Die Schäden haben Prozent, also um acht Prozentpunkte höher als
massiv zugenommen. Die Ergebnisse der Wald- 2019. Vergleichbare Spitzenwerte gab es zuletzt
zustandserhebung 2020 für das Saarland machen 2016 und 2006.
deutlich, dass von Entspannung keine Rede sein
Die Eiche als unsere zweite wichtige Laubbaumart
kann. Unser Wald befindet sich im Klimastress,
hat einen Flächenanteil von 21 Prozent. der Anteil
auch wenn wir im bundesweiten Vergleich auf-
der Bäume mit deutlichen Schäden beträgt 35
grund unseres überdurchschnittlich großen Laub-
Prozent, 2019 zeigten noch 51 Prozent der Eichen
waldanteils noch immer einigermaßen gut daste-
deutliche Schäden. Der Anteil der Bäume ohne
hen: Von 11.000.000 Hektar Wald in Deutschland
sichtbare Schäden liegt bei 19 Prozent also vier
sind mittlerweile rund 2,6 Prozent Schadfläche.
Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Dieses
In absoluten Zahlen entspricht das rund 285.000
Bild passt zu den relativ ausgeprägten Schwan-
Hektar vernichteter Wald – vornehmlich Fichten-
kungen der vergangenen 15 Jahre bei insgesamt
Bestände. Die Schadfläche für Fichte im Staats-
vergleichsweise hohem Schadniveau.
wald des Saarlandes liegt dagegen bei etwa 1,22
Prozent, umgerechnet etwa 420 Hektar. Das ist
ganz und gar kein Grund zur Entwarnung aber
doch ein kleiner Lichtblick.
cc BY 4.0 Ed Hawkins (University of Reading) Quelle: www.climate-lab-book.ac.uk Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
4Die Fichte kommt bei uns nur noch auf 15 Prozent Hier finden Sie ausführliche Informationen zu un-
Anteil der Waldzusammensetzung. Der Anteil der serer Suche nach Klima stabileren Baumarten, um
deutlichen Schäden liegt 2020 bei 55 Prozent und unsere Wälder fit für die Zukunft zu machen.
ist gegenüber dem Vorjahr um elf Prozentpunk-
Liebe Leserinnen und Leser, infolge der klima-
te angestiegen. Wie in den Vorjahren, bestimmte
tischen Entwicklung kommt es zurzeit in den
auch 2020 der Borkenkäferbefall die Schadsitua-
saarländischen Wäldern zu großen Schäden. Ein
tion. Das Schadniveau hat einen neuen Höchst-
behutsamer und bedachter Umgang mit den Wäl-
stand seit Beginn der Zeitreihe 1984 erreicht.
dern sowie die Wiederbestockung mit angepass-
Die Kiefer hat im Vergleich der vier Hauptbaumar- ten Baumarten muss in dieser Ausnahmesituation
ten mit knapp sechs Prozent den geringsten Flä- das Handeln bestimmen. Für den Staatsforst ha-
chenanteil. Der Kronenzustand hat sich 2020 ge- ben wir uns mit dem Masterplan für den saarländi-
genüber dem Vorjahr tendenziell verbessert. Die schen Wald (vgl. Anhang) dazu entschlossen, dass
deutlichen Schäden liegen bei 13 Prozent, sie sind aus Vorsorgegesichtspunkten, nur halb so viel der
um sechs Prozentpunkte gegenüber 2019 zurück- dickeren Bäumen geerntet werden, als dies mög-
gegangen. Der Anteil ohne sichtbare Schäden liegt lich wäre. So soll das Waldinnenklima stabilisiert
unverändert bei 36 Prozent. Damit stabilisieren sich werden. Zusätzlich will die Landesregierung im
die Kieferbestände erfreulicherweise auf dem nied- Haushalt Vorsorge dafür treffen, dass die Erlös-
rigen Schadniveau der vergangenen sechs Jahre. einbußen und der Mehraufwand für Schadensbe-
Die Sonstigen 23 erfassten Baumarten sind das seitigung und Wiederbewaldung im Staatswald
erfreuliche Ergebnis von drei Jahrzehnten naturna- nicht mit Mehreinschlägen oder Personalabbau
her Waldwirtschaft im Saarland. Ihnen verdanken beim Saarforst Landesbetrieb kompensiert wer-
wir den bundesweiten Spitzenwert beim Anteil an den müssen. Hierfür sollen seitens des Landes
Laubbäumen von mehr als 70 Prozent und der da- in den nächsten beiden Jahren zusätzlich jeweils
mit einhergehenden breiten Palette an weiteren 5,5 Mio € für das unverschuldete Defizit des Saar-
Baumarten. Sie dienen erheblich zur Risikostreu- Forst bereitgestellt werden
ung und könnten in Zukunft noch mehr an Bedeu- Sie werden bei der Lektüre dieses Berichtes fest-
tung gewinnen. Der Anteil der deutlichen Schäden stellen, dass wir uns den Herausforderungen stel-
von 36 Prozent wirkte abmildernd auf das Ge- len und an tragfähigen Lösungen arbeiten. Es gibt
samtergebnis der Waldzustandserhebung. viel zu tun und wir werden Sie über unsere Arbeit
Neben den reinen Zahlen der Erhebung wird Sie auch in Zukunft regelmäßig informieren.
der Waldzustandsbericht auch wieder über ein
breites Spektrum forstlicher Aktivitäten informie- Ihr Reinhold Jost
ren. Besonders wichtig sind mir dabei diesmal der
Bericht zur Versauerung von Waldböden und der
damit einhergehenden Notwendigkeit von Kom- Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
pensationskalkungen. Daneben sind das die Bau- Saarland
martensteckbriefe und Klimahüllen.
5EIN ÜBERBLICK
Lange trockene Perioden in den Vegetationszeiten Nicht vergessen werden darf, dass unsere Wald-
2018 bis 2020, weit überdurchschnittliche Tempe- ökosysteme nach wie vor erheblich durch Luft-
raturen über den gesamten Zeitraum, eine bis heu- schadstoffe belastet werden. Die Säurebelastung
te nie erreichte Borkenkäfermassenvermehrung an übersteigt trotz Erfolgen bei der Luftreinhaltung
Fichten sowie weitere, durch Temperaturerhöhung weiterhin das Pufferpotential vieler Waldbestände.
und Wassermangel verursachte Baumschäden Vor allem die Stickstoffeinträge liegen nach wie
führten zu einem hohen Schadniveau in der Zeitrei- vor über dem Schwellenwert der Ökosystemver-
he seit Beginn der Waldzustandserhebung im Jahre träglichkeit. Auch Ozon wirkt weiterhin waldschä-
1984. digend, die Verträglichkeitsgrenzen für Waldbäume
werden an allen Messstandorten überschritten.
Der Anteil deutlicher Schäden ist auf 41 % weiter
angestiegen. Auch der Anteil der Bäume mit star-
ken Kronenschäden und abgestorbener Bäume,
das mittlere Verlustprozent und die Ausscheidera-
te sind weiter angestiegen. Der Anteil an Bäumen
ohne sichtbare Schadmerkmale ist mit 18 % dage-
gen sehr niedrig. Alle Kennwerte der Waldzustands-
erhebung weisen das dritte Jahr in Folge einen un-
günstigeren Zustand aus.
Bei der Fichte ist die Trockenheit mit einer Borken-
käferkalamität verbunden, die für die extrem hohe
Absterbe- und Ausscheiderate ursächlich ist. Für
die Buche scheint mittlerweile starker Fruchtbe-
hang im zweijährigen Rhythmus normal. Durch die
Trockenheit bleibt der Buche wenig Gelegenheit,
genügend Reservestoffe zu bilden, um die Krone in
den Zwischenjahren wieder hinreichend zu regene-
rieren. Das Schadniveau der Douglasie und Esche
prägen weiterhin die Pilzerkrankungen, die zu ho-
hen Nadelverlusten bzw. absterbenden Trieben und
Ästen führen. Nur wenige Baumarten weichen in
ihrer Entwicklung von dem allgemeinen Trend ab.
So hat sich der Zustand der Eiche gegenüber dem
Vorjahr erfreulich verbessert, auch die Kiefer und
einige seltene Laubbaumarten zeigen Verbesserun-
gen oder zumindest keine Veränderungen.
Saarschleife bei Orscholz Foto: Th. Wehner
7Anteil der Baumarten
an der Stichprobe
Fichte
Sonstige 15 %
23 % Kiefer
100% 11 %
Eiche Buche
28 % 23 %
80%
Schadstufenanteile in [ % ]
60%
40%
20%
0%
1984 -- 2020
1984 2020 1984 -- 2020
1984 2020 1984 -- 2020
1984 2020 1984 - 2
Fichte
Fichte Kiefer
Kiefer Buche
Buche Eiche
8Entwicklung der Waldschäden von 1984 bis 2020 im Saarland
schwach geschädigt (Stufe 1)
mittelstark geschädigt (Stufe 2)
stark geschädigt und abgestorben (Stufe 3+4)
1984 - 2020 1984 -- 2020
1984 2020 1984 -- 2020
1984 2020 1984 -- 2020
1984 2020
Buche Eiche
Eiche Sonstige
Sonstige Baumarten alleBaumarten
Baumarten alle Baumarten
9Die jährliche Waldzustandserhebung stützt sich auf den Kronenzustand als Indikator für die
Vitalität der Waldbäume. Veränderungen des Kronenzustands sind eine Reaktion auf Belas-
tungen durch natürliche und durch menschenverursachte Stresseinflüsse. Die Gewichtung der
einzelnen Einflüsse im Schadkomplex variiert zwischen den einzelnen Baumarten und von Jahr
zu Jahr.
Im Jahr 2020 hat sich der Kronenzustand gegenüber dem Vorjahr über alle Baumarten weiter
verschlechtert. Ein Anstieg des Schadniveaus ist vor allem bei Buche und Fichte aber auch bei
Douglasie, Birke, Lärche und Ahorn zu verzeichnen. Die Schadsituation bei Kiefer und Esche
hat sich wenig verändert. Die Eiche präsentiert sich in ihrem Kronenzustand dagegen merklich
besser.
Durchführung
Die Waldzustandserhebung erfolgt seit 1984 auf Die Stichprobe erlaubt statistisch abgesicherte
einem systematischen, landesweiten Stichpro- Aussagen zur Schadensentwicklung auf Landes-
benraster. Bis 1988 wurde die Erhebung in einem ebene für den Wald allgemein und die häufigsten
4x4 km-Raster mit den Daten des Waldschadens- Baumarten Buche, Eiche, Fichte und Kiefer. Für die
katasters ergänzt. Im Jahr 1989 wurde das 4x4 km- weniger häufigen Baumarten Birke, Esche, Lärche,
Raster zu einem 2x4 km-Gitternetz verdichtet, auf Douglasie und Ahorn sind ebenfalls Aussagen mög-
dem seitdem die jährliche Erhebung durchgeführt lich, jedoch bei geringerer statistischer Sicherheit.
wird. Nur in 1990 musste die Waldzustandser- Eine Übersicht über die Zusammensetzung des Kol-
hebung infolge der Schäden der Frühjahrsstürme lektivs der Probebäume nach den verschiedenen
Vivian und Wiebke ausfallen. 2020 umfasst das Baumarten und ihre Verteilung nach Altersklassen
Aufnahmeraster 98 Aufnahmepunkte, wobei an findet sich im Anhang des Berichtes.
vier Punkten zurzeit kein geeigneter Waldbestand In Vorbereitung der WZE 2021 wird überprüft, ob
stockt, um Probebäume auszuwählen. An diesen an potenziellen Schnittpunkten des Rasters Wald
Punkten kann erst wieder eine Aufnahme erfolgen, neu entstanden ist und Probebäume ausgewählt
sobald der nachfolgende Jungbestand etabliert ist. werden können. Damit würden ggf. Aufnahme-
An einem weiteren Aufnahmepunkt konnte die Er- punkte neu angelegt.
hebung nicht durchgeführt werden, da wegen Be-
falls mit Eichen-Prozessionsspinner ein zu hohes
Gesundheitsrisiko für das Aufnahmepersonal be-
5 Aufnahmepunkte sind zugleich Teil des euro-
stand. Insgesamt wurden an 93 Aufnahmepunkten
paweiten Level I-Monitoringnetzes zum Wald-
2232 Stichprobenbäume begutachtet.
zustand. Die auf diesen Punkten erhobenen
Die Außenaufnahmen erfolgten einschließlich Ab-
Daten gehen in die bundesdeutsche und euro-
stimmungsübung und Kontrollaufnahmen in der
päische Waldzustandserhebung ein.
Zeit vom 06. bis 24. Juli 2020.
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter
http://www.thuenen.de/de/wo/projekte/bo-
WZE-Aufnahmepunkt 122 bei Eitzweiler denschutz-und-waldzustand/projekte-waldzu-
Foto: Th. Wehner standserhebung/bundesweite-waldzustandser-
hebung/
und www.futmon.org und www.icp-forests.org
11Kombinierte Schadstufe aufgrund von Nadel-/Blattverlusten und Vergilbung
Kronenverlichtung Vergilbung der vorhandenen Nadeln/Blätter
Nadel-/Blattverluste 0 1 2 3 Vergilbungsstufe
Verluststufe Verlustprozent 0 - 10 % 11 - 25 % 26 - 60 % 61 - 100 % Vergilbungsprozent
0 0 - 10 % 0 0 1 2
1 11 - 25 % 1 1 2 2 Kombinations-
2 26 - 60 % 2 2 3 3 schadstufe
3 61 - 99 % 3 3 3 3
4 100 % 4 (abgestorben)
Bezeichnung der Stufen: 0 ohne sichtbare Schadmerkmale; 1 schwach geschädigt; 2 mittelstark geschädigt;
3 stark geschädigt; 4 abgestorben; die Stufen 2-4 werden als „deutlich geschädigt“ zusammengefasst
Waldzustand allgemein
Für die gesamte Waldfläche des Saarlandes über Verschlechtert hat sich der Kronenzustand bei Bu-
alle Baumarten und Altersstufen hat sich der Zu- che und Fichte, aber auch Douglasie, Birke, Lärche
stand des Waldes gegenüber dem Vorjahr nicht und Ahorn. Kiefer und Esche präsentieren sich weit-
entspannt. Der Anteil an Probebäumen mit deutli- gehend unverändert im Schadniveau. Die Eichen
chen Schäden ist um 2 Prozentpunkte angestiegen, sowie einige seltene Laubbaumarten wie Hainbu-
der Anteil ohne sichtbare Schadmerkmale um 2 che, Kirsche und Erle konnten sich in ihrem Kronen-
Prozentpunkt zurückgegangen. Die mittlere Kro- zustand etwas verbessern. Durch die Gegenüber-
nenverlichtung liegt um 1,3 Prozentpunkte über stellung der sowohl 2019 als auch 2020 erhobenen
dem Wert des Vorjahres, diese Veränderung ist sta- Probebaumindividuen (idente Probebäume) lässt
tistisch signifikant. sich die beobachtete Entwicklung genauer analy-
Entwicklung der Schadstufenverteilung über alle Baumarten
100%
90%
80%
70%
60%
Anteile
50%
40%
30%
20%
10%
0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1984 bis 2020
ohne sichtbare Schadmerkmale mittelstark geschädigt abgestorben
schwach geschädigt (Warnstufe) stark geschädigt
12sieren und statistisch absichern. Hierauf wird bei dem Vorjahreswert; diese Veränderung ist signifi-
den betreffenden Baumarten eingegangen. Eine kant. Stark geschädigt, mit Blattverlusten ab 65 %
Beschreibung und eine Tabelle mit den Ergebnissen waren 2,9 % der Probebäume. Die Stichprobe traf
zur Signifikanz der Veränderung der mittleren Kro- zum Erhebungszeitpunkt keine seit dem Vorjahr ab-
nenverlichtung gegenüber dem Vorjahr finden sich gestorbenen Buchen. Auch die Ausscheiderate aus
im Anhang des Berichtes. dem Probebaumkollektiv des Vorjahres ist mit 1 %
unauffällig gering. An zwei Probebäumen (0,4 %)
Der Witterungsverlauf des Jahres 2020 war zum wurde Schleimfluss an der Rinde beobachtet, der
dritten Mal in Folge ungünstig für den Wald. Ledig- auf Borkenkäfer- oder Pilzbefall hindeuten kann.
lich der Februar brachte genügend Niederschläge,
um den Boden zu durchfeuchten, sodass der Aus- Das Schadniveau erreicht damit wieder einen Spit-
trieb und Fruchtansatz weitgehend ungehindert zenwert und bleibt nur knapp unter den Werten
erfolgen konnten. Die Bäume litten dann aber je der Jahre 2016 und 2006. Seit Beginn der Zeitreihe
nach Standort und örtlichen Besonderheiten in der WZE 1984 stieg die Kronenverlichtung bei der
unterschiedlichem Maße unter Spätfrost, som- Buche an. Im Jahr 1995 wurde ein erstes Maximum
merlichem Trockenstress und lokal unter Gewitter erreicht, in den Folgejahren zeigte sich bis 2003
mit Sturmböen, Starkregen oder Hagel. Bei vielen ein Erholungstrend. In der Folge des Trockensom-
Baumarten kam eine starke Fruchtbildung als Be- mers 2003 verschlechterte sich der Kronenzustand
lastung hinzu. Im Spätsommer war der Dürrezu- jedoch wieder und erreichte 2006 ein neuerliches
stand der Böden im Saarland noch ungünstiger als Maximum. In den Folgejahren konnte die Buche
im Vorjahr. Auf die anhaltende Trockenheit reagier- ihren Kronenzustand unter günstigen Bedingungen
ten einige Baumarten mit einem Notprogramm zur dann wieder verbessern, unter schlechten Bedin-
Verringerung der Blattverdunstung durch Grün- gungen stieg die Kronenverlichtung entsprechend
blattabwurf und vorzeitige Herbstverfärbung. Ab wieder an.
Anfang August war besonders bei Buche und Birke,
beginnend von der Oberkrone her, weiterer Blatt- Im letzten Jahrzehnt trugen die Buchen nahezu
fall aber auch schnelle Braunfärbung zu beobach- jedes zweite Jahr Bucheckern. Nach der Pause im
ten. Da die Außenarbeiten der Waldzustandser- Vorjahr (23 %) gab es in 2020 mit 87 % wieder
hebung Ende Juli abgeschlossen waren, hat diese reichlichen Fruchtbehang, von den über 60 Jahre
Entwicklung die Ergebnisse nicht mehr beeinflusst. alten Buchen tragen 95 % der Probebäume Früch-
Hier wird sich erst im kommenden Frühjahr zeigen, te. Bei den nur wenigen Buchen ohne Fruchtbehang
ob die Knospenbildung noch abgeschlossen wurde zeigt sich ein tendenzieller, nicht signifikanter An-
und die Bäume normal austreiben können oder ob stieg der Kronenverlichtung. Die deutlich fruktifi-
auch ganze Zweigpartien abgestorben sind. zierenden Buchen weisen einen höheren Anstieg
der Kronenverlichtung auf als die nur schwach fruk-
tifizierenden.
Buche
Die Buche ist im Saarland mit 23 % Flächenanteil Loch- und Minierfraß durch den Buchenspringrüss-
die wichtigste Baumart und zugleich Leitbaumart ler (Rhynchaenus fagi) war an rund 7 % der Buchen-
der natürlich vorkommenden Waldgesellschaften. Probebäume (Vorjahr 3 %) mit meist geringer In-
Auch in der Stichprobe der WZE ist sie mit einem tensität aufgetreten und blieb ohne Einfluss auf
Anteil von 23 % vertreten. den Kronenzustand. Ebenso der Befall durch Blatt-
pilze, wie der Blattbräune (Apiognomonia errabun-
Das Schadniveau bei Buche ist gegenüber dem Vor- da), der nur in unbedeutendem Ausmaß beobach-
jahr erheblich angestiegen. Der Anteil der deutli- tet wurde. Blattvergilbungen sind nur an einzelnen
chen Schäden ist um 32 Prozentpunkte höher, der Probebäumen zu beobachten, an fünfen (1 %) war
Anteil an Probebäumen ohne sichtbare Schadmerk- Vergilbung in nennenswertem Ausmaß festgestellt
male ist um 8 Prozentpunkte geringer. Die mittlere worden.
Kronenverlichtung liegt um 8,3 Prozentpunkte über
13Buche
Entwicklung der Schadstufenverteilung
100%
90%
80%
70%
60%
Anteile
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bis
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2020
Buche
Entwicklung der mittleren Kronenverlichtung
50
45
40
Mittlere Kronenverlichtung in %
35
30
25
20
15
10
5
0 1 2 3 4 5 6
1991
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
bis
1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2020
36 37
14Veränderung der mittleren Kronenverlichtung der über 60-jährigen Buchen in Prozentpunkten von
2019 auf 2020 bei unterschiedlicher Intensität des Fruchtbehanges
deutlich
N = 264
schwach
1
N = 110
ohne
N = 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
=> Verschlechterung
des Kronenzustandes
Dürres Feinreisig und abgestorbene Äste im Licht- Stark geschädigt, mit Blattverlusten ab 65 %, wa-
kronenbereich werden schon seit Beginn der Er- ren 0,7 % der Probebäume, frisch abgestorben
hebung 1984 bei der Bewertung der Kronenver- waren 3 Probebäume (0,5 %). Die Ausscheiderate
lichtung berücksichtigt und gehen anteilsmäßig in ist mit 3,7 % vergleichsweise hoch, wobei diese
die Beurteilung des Blattverlustes mit ein. In 2020 Probebäume jedoch alle noch stehend vorhanden
wurde an 27 % der Buchen-Probebäume (Vorjahr sind, allerdings nicht bonitiert werden konnten.
11 %) Dürrreisig beobachtet. Da bei der Buche das Die Eiche verharrt damit auf dem vergleichsweise
feine, dürre Reisig in der Regel im Laufe eines Jahres hohen Schadniveau der letzten 15 Jahre mit relativ
herausbricht, bedeutet das, dass das beobachtete ausgeprägten Schwankungen zwischen den einzel-
dürre Feinreisig überwiegend seit der letzten Erhe- nen Jahren.
bung neu abgestorben ist.
Die Eichen erleiden regelmäßig mehr oder min-
der starke Schäden durch blattfressende Insekten.
Eiche Häufig wird der Wiederaustrieb durch den Eichen-
Die Eiche hat im Saarland einen Flächenanteil von mehltau (Microsphaera alphitoides), ein Anfang des
21 %, im Kollektiv der WZE ist sie mit knapp 28 % vorigen Jahrhunderts nach Europa eingeschleppter
häufiger vertreten. Blattpilz, befallen. In 2020 wurden an 21 % der
Probebäume Fraßschäden beobachtet und damit
Der Kronenzustand der Eichen hat sich in 2020 in etwas geringerem Umfang als im Vorjahr (29 %).
verbessert. Der Anteil deutlich geschädigter Pro- Befall durch den Mehltaupilz wurde an drei Probe-
bebäume ist um 16 Prozentpunkte gegenüber dem bäumen (0,5 %) festgestellt, der damit wesentlich
Vorjahr zurückgegangen. Der Anteil ohne sichtba- weniger bedeutend ist als im Vorjahr (18 %). Der
re Schadmerkmale liegt um 4 Prozentpunkte über Insektenfraß ist überwiegend gering (um 5 % der
dem Vorjahreswert. Die mittlere Kronenverlichtung Blattmasse), an etwa 3 % der Probebäume war ein
liegt um 4,2 Prozentpunkte unter dem Wert des stärkeres Ausmaß festzustellen. Insektenfraß und
Vorjahres; diese Veränderung ist signifikant.
15Eiche
Entwicklung der Schadstufenverteilung
100%
90%
80%
70%
60%
Anteile
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
bis
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2020
37
Eiche
Entwicklung der mittleren Kronenverlichtung
50
45
40
Mittlere Kronenverlichtung in %
35
30
25
20
15
10
5
0 1 2 3 4 5 6 7
1991
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
bis
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2020
36 37
16Mehltaubefall haben sich wiederholt als bedeutsa- nicht bekannt, es könnte sich um Virenbefall oder
me Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Kro- Pilzinfektionen handeln. Merkliche Blattvergilbun-
nenzustandes bei Eiche erwiesen. Der Schadanstieg gen wurden 2020 nur an einem Probebaum beob-
des Vorjahres war vornehmlich durch die Mehl- achtet.
tau- und Fraßschäden ausgelöst worden. Ohne
diese Belastung konnten sich die Eichen merklich
erholen, die wenigen stärker befressenen Probe- Fichte
bäume dagegen nicht. Ausmaß und Intensität der Die Fichte hat im Saarland einen Flächenanteil von
Schäden durch Insekten der klassische Eichenfraß- 15 %; im Aufnahmekollektiv der WZE macht sie ei-
gesellschaft waren in den letzten Jahren entgegen nen Anteil von 16 % aus.
den Erwartungen vergleichsweise unbedeutend, Die Fichte hat sich in ihrem Kronenzustand ge-
höchstens moderat. An Bedeutung gewonnen hat genüber dem Vorjahr merklich verschlechtert.
dagegen der Eichen-Prozessionsspinner (EPS). Aus- Der Anteil der deutlich geschädigten Probebäume
maß und Intensität der Fraßschäden an den Eichen ist um 11 Prozentpunkte angestiegen. Die mittle-
sind meist gering, sodass sie nur bei genauer Be- re Kronenverlichtung liegt um 4,6 Prozentpunkte
obachtung festgestellt werden. Durch die allergene höher als im Vorjahr. Diese Veränderung ist sig-
Wirkung der Raupenhaare hat der EPS jedoch eine nifikant. Das Schadniveau hat damit einen neuen
hohe hygienische Bedeutung. Die Aufnahmeteams Höchstwert erreicht. Der Verlauf der Zeitreihe ab
der WZE sind daher gehalten, sorgfältig auf das 1984 zeigt ein erstes ausgeprägtes Maximum im
Vorkommen des EPS zu achten und abzuwägen, Jahr 2006. In den Folgejahren verbesserte sich der
ob die Erhebung gefahrlos durchgeführt werden Kronenzustand dann wieder. Das Schadniveau blieb
kann. Wurde im Vorjahr sein Vorkommen an zwei jedoch merklich höher als in den Jahren zu Beginn
Aufnahmepunkten gemeldet, so wurde er 2020 an der Zeitreihe und stieg ab 2019 wieder stark an.
neun Aufnahmepunkten festgestellt. Erstmals auch
an einem der Punkte in einem Ausmaß, welches Wie schon im Vorjahr wird auch in 2020 die Schad-
eine gefahrlose Durchführung der Erhebung nicht situation der Fichte durch den Borkenkäferbefall
zuließ. Obgleich die Probebäume stehend am Auf- bestimmt. An 8,6 % der Probebäume wurde Bor-
nahmepunkt vorhanden sind, müssen sie aus der kenkäferbefall festgestellt, 18 Probebäume (5,3 %)
Erhebung ausscheiden, bis ein gefahrloses Arbeiten waren in 2020 frisch abgestorben. Mit insgesamt
in dem betroffenen Waldbereich wieder möglich 27 toten Probebäumen (8,0 %) ist der Anteil abge-
ist. storbener Bäume bei Fichte außerordentlich hoch,
23 dieser Probebäume konzentrieren sich jedoch
In 2020 fruktifiziert die Eiche wieder recht ausge- an einem Aufnahmepunkt, an dem die Käferbäu-
prägt, an 43 % aller Probebäume wurde Fruchtbe- me nicht geräumt wurden. Darüber hinaus ist auch
hang beobachtet. Die Früchte der Eiche sind zum die Ausscheiderate mit 12 % sehr hoch, auch hier
Zeitpunkt der WZE jedoch häufig noch zu klein, um war fast ausschließlich Borkenkäferbefall die Ursa-
den Fruchtbehang sicher abschätzen zu können. Ob che für die Fällung der Probebäume. Mit dabei ist
die Fruchtbildung der Eiche einen Einfluss auf die ein Aufnahmepunkt, an dem alle 24 Probebäume
Entwicklung der Kronenverlichtung hat, konnte da- entnommen wurden. Nicht alle mit Borkenkäfer
her aus den Daten bisher nicht abgeleitet werden. befallenen Fichten waren zum Zeitpunkt der WZE
In 2020 sind zwischen den Gruppen unterschied- jedoch bereits abgestorben, sechs Probebäume
lich starken Fruchtbehangs keine Unterschiede in zeigten noch grüne Nadeln und erst moderate Na-
der Entwicklung des Kronenzustandes erkennbar. delverluste. Alle weisen jedoch so starken Borken-
käferbefall auf, dass von ihrem Absterben auszuge-
An einigen Eichen werden immer wieder ins Gelb- hen ist.
liche gehende Verfärbungen der Blätter oder hell- Im Jahr 2020 hat die Fichte wieder reichlich Zap-
grüne bis gelbliche Partien zwischen den Blattrip- fen gebildet, an 76 % der Probebäume (Vorjahr
pen beobachtet. Die genaue Ursache hierfür ist 0,5 %) wurde frischer Zapfenbehang festgestellt.
17Fichte
Entwicklung der Schadstufenverteilung
100%
90%
80%
70%
60%
Anteile
50%
40%
30%
20%
10%
0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1984 bis 2020
Fichte
Entwicklung der mittleren Kronenverlichtung
50
45
40
Mittlere Kronenverlichtung in %
35
30
25
20
15
10
5
0 1 2 3 4 5 6 7
1991
8 9 10 11 12 13 14 15 16
bis18
17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2020
36 37
18Die Fruchtbildung bedeutet eine zusätzliche Belas- ohne sichtbare Schadmerkmale ist unverändert.
tung für die Fichten, ein Einfluss der Fruktifikation Die mittlere Kronenverlichtung liegt um 1 Prozent-
auf die Entwicklung der Kronenverlichtung ist aus punkt niedriger. Diese Veränderung ist aber nicht
den Daten aber nicht abzuleiten. signifikant. Stark geschädigt, mit Nadelverlusten ab
65 % waren 0,8 % der Probebäume. Abgestorben
Nadelvergilbungen in nennenswertem Umfang wa- waren fünf Probebäume (2,1 %), davon drei frisch
ren in 2020 an fünf Fichten zu beobachten. Bis in und zwei bereits in den Vorjahren. Wie schon im
die 1980er Jahre war Vergilbung besonders in den Vorjahr waren landesweit immer wieder abgestor-
Höhenlagen der Mittelgebirge ein weit verbreitetes bene Kiefern zu beobachten, meist nur einzelne
Phänomen bei Fichte, seit Mitte der 1990er Jahre Bäume oder Gruppen. Von 2019 auf 2020 sind keine
ist sie jedoch stark zurückgegangen. Kiefern aus dem Probebaumkollektiv ausgeschie-
den. Im Verlauf der Zeitreihe ab 1984 zeigt sich ein
ausgeprägtes Maximum des Schadniveaus im Jahr
Kiefer 2006. In den Folgejahren verbesserte sich der Kro-
Die Kiefer hat im Saarland einen Flächenanteil von nenzustand wieder. Trotz des Anstieges im Vorjahr
knapp 6 %. In der Stichprobe der WZE beträgt ihr liegt das Schadniveau noch in vergleichbarer Höhe
Anteil 11 %, wobei Waldkiefer und Schwarzkiefer wie zu Beginn der Zeitreihe. Mit nur drei Nadeljahr-
als eine Baumartengruppe gemeinsam ausgewer- gängen reagiert die Kiefer auch vergleichsweise fle-
tet werden. xibel mit variierender Benadelungsdichte.
Bei der Kiefer hat sich der Kronenzustand gegen-
über dem Vorjahr tendenziell verbessert. Der An- Im Berichtsjahr war an rund 24 % der Kiefern und
teil an Probebäumen mit deutlichen Schäden ist damit merklich häufiger als im Vorjahr (4 %), Rei-
um 6 Prozentpunkte zurückgegangen, der Anteil fefraß durch Waldgärtner (Tomicus piniperda und
Kiefer
Entwicklung der Schadstufenverteilung
100%
90%
80%
70%
60%
Anteile
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
bis
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2020
35
36 37
19Kiefer
Entwicklung der mittleren Kronenverlichtung
50
45
40
Mittlere Kronenverlichtung in %
35
30
25
20
15
10
5
0 1 2 3 4 5 6 7
1991
8 9 10 11 12 13 14 15
bis17
16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2020
3536 37
T. minor) zu beobachten. Durch den Reifefraß die- Andere Baumarten
ser auf Kiefern spezialisierten Borkenkäfer sterben In unseren Wäldern findet sich neben den bereits
einjährige Triebe ab. Bei wiederholtem Befall kann genannten noch eine Vielzahl anderer Baumarten,
es dadurch zu Störungen in der Verzweigung kom- die insgesamt einen Flächenanteil von 34 % aus-
men, die dann zu einem schlechteren Kronenzu- machen. Die WZE erfasst mit ihrem Kollektiv insge-
stand führen. Pilzbefall der Nadeln (Kiefernschütte) samt 21 weitere Baumarten, die zusammen einen
wurde in 2020 an den Probebäumen nicht festge- Anteil von 23 % an dem Probebaumkollektiv ha-
stellt (Vorjahr 11 %). ben. Einige werden nur mit einzelnen Exemplaren,
andere aber auch mit mehr als 50 Probebäumen
Die Kiefer erleidet immer wieder Schäden durch erfasst, sodass eine baumartenspezifische Aus-
Kronenbrüche oder Abrisse stärkerer Äste, meist sage zum Kronenzustand möglich ist. Wegen des
durch Nassschnee. Bei starker Windbewegung kön- geringeren Stichprobenumfangs sind die Aussagen
nen die Zweigspitzen benachbarter Baumkronen hier jedoch mit höheren Unsicherheiten behaftet
aneinander schlagen und so Nadeln verlieren. Die- und die Veränderungen statistisch meist nicht zu
se rein mechanischen Schäden werden an Kiefern sichern. Auch können in den Schadstufenanteilen
regelmäßig beobachtet und soweit wie möglich bei oder bei der mittleren Kronenverlichtung von Jahr
der Begutachtung des Nadelverlustes ausgeklam- zu Jahr größere Sprünge auftreten, da sich starke
mert. Die Ansprache der Kronenverlichtung ist da- Veränderungen auch nur einzelner Probebäume
durch aber erschwert, da insbesondere ältere Kie- durchprägen und Veränderungen von gleich meh-
fern einmal entstandene Lücken nicht mehr durch reren Prozentpunkten in der Statistik entsprechen
Ersatztriebe ausfüllen. können. Veränderungen zwischen den Jahren sind
Die Kiefern haben in 2020 stark geblüht und zeigen daher nur im längeren Verlauf der Zeitreihe sinnvoll
auch sonst regelmäßigen und reichlichen Fruchtbe- zu bewerten.
hang. Dieser hat jedoch keinen erkennbaren Einfluss
auf den Kronenzustand. Vergilbung war in 2020 an
einem Kiefernprobebaum beobachtet worden.
20Andere Baumarten
Entwicklung der Schadstufenverteilung
Baumart Jahr Anzahl an Anteile der Schadstufen (in %) mittlere
(bzw. Gattung) Probebäumen 0 1 2-4 Kronenverlichtung
Birke 2020 87 21 48 31 22,5
2019 87 33 38 29 20,2
2018 91 14 53 33 26,5
2011 89 45 52 3 13,4
2001 65 60 40 0 10,9
1991 67 57 34 9 11,2
Esche 2020 87 8 28 64 45,6
2019 90 11 26 63 46,0
2018 90 7 32 61 42,9
2011 100 46 40 14 14,9
2001 99 82 17 1 6,5
1991 98 80 15 5 5,9
Lärche 2020 82 7 51 42 29,8
2019 89 17 39 44 27,0
2018 89 21 50 29 23,3
2011 90 20 61 19 19,8
2001 84 21 75 4 17,4
1991 89 83 14 3 9,3
Ahorn 2020 63 62 32 6 13,6
2019 60 65 23 12 13,9
2018 60 35 43 22 20,5
2011 41 64 34 2 11,0
2001 38 95 5 0 4,3
1991 39 79 18 3 4,7
Douglasie 2020 60 7 30 63 35,6
2019 59 5 32 63 29,8
2018 58 7 65 28 23,6
2011 43 37 37 26 19,3
2001 40 28 40 33 25,1
1991 39 95 5 0 3,2
weitere andere 2020 141 25 54 21 22,0
Baumarten 2019 142 27 34 39 25,5
2018 141 31 41 28 18,0
2011 116 62 29 9 12,3
2001 164 87 11 2 6,5
1991 155 84 13 3 6,4
21In 2020 ist die Entwicklung der Kronenverlich- auf einem hohen Niveau halten. Ursächlich dafür
tung bei den Nebenbaumarten insgesamt günstig ist das zunehmend massive Auftreten des Eschen-
verlaufen. Artspezifisch sind das Schadniveau und triebsterbens, das durch eine Pilzinfektion mit dem
auch die Veränderungen der Kronenverlichtung „Falschen Weißen Stängelbecherchen“ (Hymenos-
sehr unterschiedlich. cyphus fraxineus) verursacht wird. Das Eschentrieb-
sterben tritt landesweit in bestandsbedrohendem
Ausmaß auf. Bei der WZE gehen die infolge der
Esche Erkrankung abgestorbenen Triebe oder Blätter in
Bei der Esche ist das Schadniveau in 2020 unverän- die Bewertung der Kronenverlichtung mit ein. Bei
dert, der Anteil deutlich geschädigter Probebäume der aktuellen Erhebung wurden bei 72 % (im Vor-
liegt um 1 Prozentpunkt über dem Vorjahreswert, jahr 62 %) aller begutachteten Eschen Infektions-
die mittlere Kronenverlichtung um 0,4 Prozent- merkmale festgestellt. Zwei der Eschen-Probebäu-
punkte darunter. Eschen ohne sichtbare Schad- me waren in 2020 frisch abgestorben. An den 14
merkmale sind nur selten im Kollektiv der Probe- Probepunkten mit Eschenvorkommen sind in fünf
bäume zu finden. Der Anteil stark geschädigter und Fällen tote, absterbende oder infolge des Eschen-
abgestorbener Probebäume (Schadstufen 3 und 4) triebsterbens vorzeitig ausgeschiedene Eschen zu
bleibt unverändert mit 29 % extrem hoch. finden. In 2020 schieden vier Eschen, darunter zwei
Bis in das Jahr 2011 hielt sich die Esche auf einem bereits abgestorbene, aus dem Probebaumkol-
konstant niedrigen Schadniveau und galt auf ge- lektiv aus, als Ersatzbäume wurde nur eine Esche
eigneten Standorten als stabile, zukunftsträchtige ausgewählt. Seit 2015 ist die Anzahl der Eschen-
Baumart. Ab 2011 kam es dann zu einem rasan- Probebäume von 100 auf 87 zurückgegangen, was
ten Anstieg der Kronenschäden, die sich seit 2013 bedeutet, dass ausgeschiedene Eschen vornehm-
Esche
Entwicklung der Schadstufenverteilung
100%
90%
80%
70%
60%
Anteile
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bis
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2020
29 30
22lich durch Probebäume anderer Arten ersetzt wer- Bedeutung. Fruchtbehang war an 28 % der Probe-
den. Es bedeutet aber auch, dass die Esche an den bäume zu beobachten.
Aufnahmepunkten in Mischbeständen wächst und
durch den Ausfall die Eschen zwar immer weniger
werden, das Waldgefüge als solches aber erhalten Douglasie
bleibt. Im Laufe der letzten drei Jahre wurden an Die Douglasie hat im Saarland einen Flächenan-
allen Aufnahmepunkten mit Eschen-Probebäumen teil von 4,2 % (BWI 2). In der Stichprobe der WZE
Symptome des Eschentriebsterbens festgestellt. ist sie mit einem Anteil von 2,7 % weniger häufig
Es ist daher davon auszugehen, dass der Erreger in vertreten. Die Douglasie zeigte in 2020 eine Ver-
allen Eschenbeständen gegenwärtig ist. Die Symp- schlechterung des Kronenzustandes. Der Anteil
tome sind unterschiedlich stark, von Jahr zu Jahr deutlich geschädigter Probebäume ist gegenüber
wechselnd ausgeprägt und nicht immer offensicht- dem Vorjahr unverändert, die mittlere Kronen-
lich. verlichtung liegt um 5,8 Prozentpunkte über dem
In 2020 wurden bei 57 von insgesamt 87 Probe- Vorjahreswert, die Veränderung ist signifikant. Der
bäumen dürre Äste notiert (Vorjahr 32). Die frisch Anteil stark geschädigter Probebäume ist auf 8 %
abgestorbenen, feinen Dürräste sind ein wichtiges, angestiegen, abgestorben ist jedoch keiner der Pro-
leicht erkennbares (und daher auch namensge- bebäume.
bendes) Symptom des Eschentriebsterbens. Das Das Schadniveau liegt damit weiter in dem Bereich
Erscheinungsbild und Schadniveau der Esche wird der Periode ab 2012. Allerdings beruhen diese Er-
von dem Eschentriebsterben geprägt. Insektenfraß, gebnisse auf einer relativ geringen Stichprobe von
6 Probebäume mit leichtem Lochfraß und Blatt- nur 60 Probebäumen, verteilt auf neun Aufnahme-
vergilbung (0 Probebäume) waren in 2020 ohne punkte.
Douglasie
Entwicklung der Schadstufenverteilung
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
Anteile
Anteile
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0% 1 2
0%
1984 3 4 5 6 7 8 9
bis
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
23Generell bewegt sich die Douglasie seit Ende der Eine eingehende Beschreibung der Methodik
1990er Jahre auf einem relativ hohen Schadniveau, finden Sie auf der Webseite
mit einem Maximum in 2013. Eine Ursache ist der https://saarland.de/waldzustandsbericht.html
Befall durch die Rußige Douglasienschütte (Pha-
eocryptopus gaeumannii), die im ganzen Land ver-
breitet ist. Im Verlauf der letzten Jahre wurden an
allen bis auf einem Aufnahmepunkt mit Douglasi- zentpunkte zurückgegangen, die mittlere Kronen-
en-Probebäumen Schüttesymptome beobachtet. verlichtung dagegen um 2,7 Prozentpunkte ange-
Je nach Witterungsverlauf und Befallsintensität stiegen. Die Veränderung ist aber nicht signifikant.
können befallene Nadeln mehrere Jahre am Baum Der Anstieg der mittleren Kronenverlichtung ist
verbleiben. Die Nadelschütte selbst erfolgt meist in einzig auf das Absterben von fünf Probebäumen
Kombination mit kalter Winterwitterung. In 2020 zurückzuführen, die Ursache dafür blieb unbekannt.
waren an 42 % der Douglasien-Probebäume Schüt- Bei der Lärche zeigen sich starke Veränderungen
tesymptome notiert worden (Vorjahr 61 %). An zwischen den Jahren mit einem Maximum in 2007,
Douglasien können noch weitere Pilzinfektionen es ist aber kein gerichteter Trend in der Entwicklung
auftreten, die diesjährige Triebe infizieren und sie der gesamten Zeitreihe erkennbar. In 2020 wurde
gänzlich zum Absterben bringen können. Solche als an 85 % der Lärchen (Vorjahr 23 %) Zapfenbehang
„Triebsterben“ bezeichneten Infektionen wurden festgestellt. An einem Probebaum war Insektenbe-
2020 jedoch nicht beobachtet, auch Befall durch fall der Nadeln (Lärchenminiermotte) zu beobach-
die Douglasiengallmücke konnte nicht beobachtet ten, Pilzbefall oder Nadelvergilbung trat nicht auf.
werden. Fruchtbehang war 2020 an 37 % der Pro-
bebäume zu sehen. Ahorn
Die Ahorne (Berg-, Spitz- und Feldahorn) zeigen
Birke gegenüber dem Vorjahr eine tendenzielle Verbesse-
Bei der Birke hat sich der Kronenzustand in 2020 rung im Kronenzustand. Der Anteil deutlich geschä-
leicht verschlechtert, der Anteil deutlich geschä- digter Probebäume ist um 6 Prozentpunkte und die
digter Probebäume ist um zwei Prozentpunkte mittlere Kronenverlichtung um 0,3 Prozentpunkte
angestiegen, die mittlere Kronenverlichtung um zurückgegangen; diese Veränderung ist aber nicht
2,3 Prozentpunkte; diese Veränderung ist signifi- signifikant, sie beruht auch auf dem Ausscheiden
kant. Stark geschädigt ist nur ein Probebaum, ab- eines stark geschädigten und eines abgestorbenen
gestorben keiner. Schäden durch Insektenfraß oder Probebaumes. In 2020 wurde an 87 % der Probe-
Pilzbefall wurden während der WZE an keinem der bäume Fruchtbehang festgestellt (Vorjahr 52 %).
Probebäume festgestellt. Sehr häufig, an 88 % der Besondere Belastungen wie Insektenfraß wurde
Probebäume, war Fruchtbehang zu beobachten. an einem, Pilzbefall an keinem der Probebäume
Die Birke reagiert auf anhaltende Bodentrocken- beobachtet, auch Vergilbung trat nicht auf. Das
heit mit vorzeitiger Blattfärbung und Laubfall, dies Schadniveau ist im Laufe der gesamten Zeitreihe
war jedoch verstärkt erst ab Anfang August nach vergleichsweise niedrig, ohne ausgeprägte Maxima.
Abschluss der Außenarbeiten der WZE zu beobach-
ten. Das Schadniveau der Birke zeigt seit Beginn der
WZE insgesamt einen leicht ansteigenden Trend; Einfluss ausgeschiedener und ersetzter Probe-
im Jahr 2015 wurde ein erstes, in 2018 ein zweites bäume
Maximum erreicht. Insgesamt bleibt die Birke in der Von den markierten Stichprobebäumen scheiden
Zeitreihe aber auf einem moderaten Schadniveau. jedes Jahr einige aus dem Beobachtungskollektiv
aus. Die Waldteile, in denen die Aufnahmepunk-
Lärche te der Waldzustandserhebung angelegt und die
Die Lärche zeigt in 2020 einen tendenziellen An- Probebäume markiert sind, werden meist regulär
stieg der Kronenverlichtung. Der Anteil deutlich forstlich bewirtschaftet. Maßgeblich sind dabei die
geschädigter Probebäume ist zwar um drei Pro- Ziele und Wünsche der jeweiligen Waldbesitzen-
24den. Einzelne Probebäume werden daher im Zuge Regionale Verteilung
von Durchforstungen gefällt. Zudem werden durch Der Anteil deutlich geschädigter Probebäume va-
Sturmwurf, Schneebruch oder Insektenbefall be- riiert an den einzelnen Aufnahmepunkten erheb-
troffene Bäume entnommen. Probebäume schei- lich. Punkte, die keine oder nur wenige deutlich
den aber auch, ohne dass sie entnommen wurden, geschädigte Probebäume aufweisen, liegen in di-
nach Sturmwurf, einem Kronenbruch oder wenn rekter Nachbarschaft von solchen, an denen über
sie von Nachbarbäumen überwachsen wurden, aus die Hälfte der Probebäume deutlich geschädigt
dem Stichprobenkollektiv aus. Ein Ersatz ausge- ist. Wegen der starken Unterschiede der Kronen-
schiedener Probebäume ist notwendig, damit die schäden bei den verschiedenen Baumarten und Al-
WZE den aktuellen Zustand des Waldes widerspie- tersstufen wird das Niveau der Kronenschäden am
gelt. einzelnen Aufnahmepunkt in erster Linie durch die
Verteilung der Baumarten und das Alter der Pro-
Im Jahr 2020 sind insgesamt 98 Probebäume aus- bebäume am Aufnahmepunkt beeinflusst. Werden
geschieden, von denen 50 ersetzt werden konn- verschiedene Regionen miteinander verglichen,
ten. Die Ausscheiderate beträgt damit 4,3 % des sind daher die Baumarten- und Alterszusammen-
Kollektivs der Stichprobe und liegt merklich über setzung zu beachten. Weitere Bestimmungsgrößen,
dem Mittel von 2,7 % der letzten 29 Jahre. Im Jahr wie standörtliche Parameter, Witterung oder Im-
2020 sind zwei Aufnahmepunkte komplett ausge- missions- und Depositionssituation, variieren we-
schieden. Von den ausgeschiedenen Probebäumen niger stark und überprägen den Einfluss von Baum-
wurden rund 57 % zwangsweise vorzeitig wegen art und Alter im Regelfall nicht. Der am einzelnen
Insektenschäden oder Sturmschäden geerntet oder Aufnahmepunkt festgestellte Grad der Schädigung
sind vom Sturm geworfen im Wald noch liegend sagt unmittelbar nur etwas über die Probebäume
vorhanden. selbst und allenfalls über den in Artenzusammen-
Der überwiegende Teil (55 %) der ausgeschiedenen setzung und Alter entsprechenden umgebenden
Probebäume wurde für die Holznutzung aufgear- Waldbestand aus. Erst die Zusammenfassung einer
beitet. Der andere Teil ist zwar noch am Aufnah- gewissen Anzahl an Aufnahmepunkten erlaubt eine
mepunkt vorhanden, die Bäume können aber nicht repräsentative Aussage für das jeweilige Bezugsge-
in ihrem Kronenzustand bewertet werden, da sie biet. Je höher dabei die Zahl der Stichprobebäume
nicht mehr am Kronendach des Waldbestandes be- ist, umso zuverlässiger ist die gewonnene Aussage.
teiligt sind oder der Zugang zu den Probebäumen
nicht möglich ist. Stehende abgestorbene Probe-
bäume verbleiben mit 100 % Nadel-/Blattverlust
als bewertbare Probebäume im Aufnahmekollektiv,
bis das feine Reisig aus der Krone herausgebrochen
ist oder sie von den Nachbarbäumen überwachsen
wurden. Danach werden sie aus dem Probebaum-
kollektiv entfernt, auch wenn sie weiterhin als ste-
hendes Totholz im Wald verbleiben. In 2020 wur-
den zwei Probebäume aus diesem Grund ersetzt.
Insgesamt wurden 49 abgestorbene Probebäume
im Kollektiv vermerkt, von denen 17 bereits beim
letzten Erhebungstermin 2019 tot waren. Die Rate
der frisch abgestorbenen Probebäume liegt damit
bei 1,4 % (Vorjahr 0,9 %). Eine Übersicht über die
Ursachen des Ausscheidens von Probebäumen und
eine Gegenüberstellung der Schadstufenverteilung
der ausgeschiedenen Probebäume mit der ihrer Er-
satzbäume findet sich im Anhang 5.
25Anteil der deutlich geschädigten Probebäume an den einzelnen Aufnahmepunkten 2020 26
Eichenprozessionsspinnerbefall bei Stennweiler
Foto: Th. Wehner
27EINFLÜSSE AUF DEN
WALDZUSTAND
WALDSCHUTZ
28Trockenheit und Hitze führten bereits 2018 und 2019 zu einer Vitalitätsschwächung der
Bäume. Dies hat sich 2020 fortgesetzt. Geschwächte Bäume werden anfälliger für Antago-
nisten (Gegenspieler/Schaderreger), zudem beschleunigen langandauernde höhere Tempera-
turen die Entwicklung zahlreicher Insektenarten. Die Kombination dieser Entwicklung führt zu
Waldschäden in einem bisher in Saarland nicht gekannten Ausmaß.
Fichte
Je drei Borkenkäfergenerationen in den Jahren aufnahme. In beiden Fällen, oder gar in Kombi-
2018, 2019 und 2020 führten zu einem Ausmaß nation beider Fälle, wird der Harzfluss im Baum,
an Schäden in historisch bisher nicht erreich- d. h. die Abwehrmöglichkeit gegenüber sich ein-
tem Ausmaß. Die Käferpopulation erreichte zum bohrenden Käfern, reduziert. Erfolgreiche Brutan-
Start 2020 einen erneuten Höchststand, was lagen der Käfer unterbinden den Saftfluss im Baum
dazu führte, dass selbst vitale Fichten Opfer des und führen zu dessen Absterben.
Buchdruckers wurden. Ausgangspunkt von Buch- Im Frühjahr 2020 war der Befallsdruck infolge einer
druckermassenvermehrungen ist geeignetes Brut- hohen Ausgangspopulation enorm hoch. Danach
material, zum Beispiel von geschwächten Fichten. wurden schon die durch die Stürme Lolita, Yulia
Dies kann durch Sturmwurf, durch Trockenheit und Sabine geworfenen und gebrochenen Fich-
oder die Kombination beider Einflussfaktoren ge- ten, die dem Buchdrucker einen idealen Brutraum
schehen. Beim Sturmwurf umgefallene Fichten boten, in einer außergewöhnlich hohen Besiede-
mit eingeschränktem Wurzelkontakt können nur lungsdichte befallen. Die hohe Käferzahl führte
begrenzt Wasser aufnehmen. Bei Trockenheit führt auch zum Befall von zu diesem Zeitpunkt noch vi-
Wassermangel direkt zu einer reduzierten Wasser- talen und sehr gut mit Wasser versorgten Fichten.
Buchdruckerbefall an einer vom Wind geworfenen sowie an einer benachbarten stehenden Fichte an der mittlerweile
aufgegebenen Versuchsfläche im Forstamt Neuhäusel Fotos: H.W. Schröck
Bestandesmessstelle Deposition Fichte-Arzbach 1984 - 2019 Fotos: F. Schmidt
29Durchschnittliche Fangzahlen Buchdrucker je Region
Es gab so viele Käfer, dass auch vitale Fichten und Jahr (12 Fallen je Region)
den Befall nicht mehr abwehren konnten. Dies ist
30000
ein zu diesem Zeitpunkt der Massenvermehrung
durchaus „normaler“ Verlauf. Trotz großer An- Pfälzerwald Hunsrück
25000
strengungen seitens SaarForst und vieler Waldbe-
sitzenden war es nicht zu vermeiden, dass ein Teil
20000
der brutbesetzten Fichten nicht rechtzeitig aufge-
arbeitet und entrindet bzw. abtransportiert werden 15000
konnte.
10000
Monitoring Buchdrucker
Der Buchdrucker wird an jeweils drei Stand- 5000
orten im Pfälzerwald und im Hunsrück über-
wacht. Auf Grundlage dieser Daten werden 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
fortlaufend Empfehlungen zur effektiven Kon-
trolle der Fichtenwälder auf Stehendbefall für
die Waldbesitzenden abgeleitet und wöchentlich
veröffentlicht (https://fawf.wald-rlp.de). Die Ent-
wicklung der Käferfangzahlen pro Falle verdeut-
licht den Anstieg der Käferpopulation im aktuellen
Jahr.
Schadenskataster und Wiederbewaldungspla-
nung
Im Saarland wird das 2019 aufgestellte Schadens- Pflanzungen sind zunächst auf den Flächen vor-
kataster zur regionalen Erfassung von Schadflä- gesehen, die keine oder nur wenig Naturverjün-
chen auch 2020 weitergeführt. (s. WZE-Bericht gung aufweisen und auf denen keine wesentlichen
2019, Seite 32 und 36ff https://www.saarland.de/ Hemmnisse durch verdämmende Begleitvegeta-
muv/DE/portale/waldundforstwirtschaft/service/ tion wie Brombeere oder Adlerfarn zu erwarten
publikationen/pub_waldzustandsbericht_muv. sind.
pdf?__blob=publicationFile&v=1) Die Pflanzungen erfolgen nach diesem Konzept
Bis August 2020 hat sich allein im Staatswald die nicht vollflächig sondern kleinflächig im sogenann-
im Zuge des Borkenkäferbefalls entstandene Frei- ten Klumpen-Verfahren. Der Klumpen-Pflanzbe-
fläche auf 450 ha erhöht. Auf diesen Kalamitäts- reich hat einen Durchmesser von 5 m bis 7 m und
flächen, aber auch auf weiteren Schadflächen von die Pflanzen im Klumpen werden im Abstand von
Buche, Douglasie (Schütte) oder Esche (Eschen- 1,0 m x 1,0 m bepflanzt. In den Zwischenbereichen,
triebsterben) wurden seit letztem Jahr systema- den sogenannten Zwischenfeldern, wird die Fläche
tische Wiederbewaldungsplanungen erstellt, die der natürlichen Sukzession überlassen. Hier finden
Flächen örtlich nach Schadensumfang und wald- keine weiteren Maßnahmen statt. Durch die ge-
baulicher Priorität beurteilt. Wo immer möglich, ringe Pflanzenanzahl werden Kosten für die Pflan-
hat in den naturnah bewirtschafteten Wäldern zung und spätere Pflege gespart und gleichzeitig
natürliche Sukzession/Naturverjüngung Vorrang. soll der Wald mehr dem natürlichen Gefüge über-
Nur wenn nötig werden Ergänzungspflanzungen in lassen werden.
Form von Klumpen mit standortsheimischen oder –
gerechten Baumarten auf der Fläche eingebracht.
30Auszug aus dem Schadenskataster Revier Homburg und Karlsberg nach Baumarten und
Schadstufen
In die Bepflanzungsplanungen werden vornehm- empfindlicher Baumarten wie gerade der Eiche
lich einheimische Baumarten aufgenommen, die durch Wildverbiss häufig stark eingeschränkt. In
nach jetziger Einschätzung im Klimawandel Be- vielen Verjüngungen gehen initial höhere Anteile
stand haben können, zuvorderst Eiche, aber je nach von Mischbaumarten durch wiederholten Verbiss
Standort auch Tanne, Bergahorn und Edelkastanie, durch Schalenwild drastisch zurück (Entmischung).
dazu dienende Mischbaumarten wie Linde, Hain- In der Regel müssen die Verjüngungsflächen vor
buche, Hasel oder andere beschattende Arten der dem Verbiss durch Schalenwild geschützt werden.
natürlichen Pflanzengesellschaft
Das Verbissmonitoring der letzten Jahre auf reprä- Während nach den Stürmen der 1990er Jahre viele
sentativen Waldflächen sowie die Verjüngungsent- Flächen mit Zäunen geschützt wurden, sollen jetzt
wicklung im Vergleich ungezäunter und gezäunter zum Schutz der aufkommenden Naturverjüngung
Verjüngungsflächen zeigt eindeutig: Auch bei in- oder der Pflanzung Hordengatter aus Fichtenkäfer-
tensiverer Bejagung ist das Aufwachsen verbiss- holz zum Schutz der Pflanzen aufgestellt werden.
31Weitergehende Daten und Auswertungen:
Weisergatter zur Kontrolle von Wildverbiss in
Eichen-Verjüngungsflächen, in
https://www.saarland.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/muv/waldundforstwirtschaft/
dl_waldzustandsbericht2017_muv.pdf?__
blob=publicationFile&v=2
Wald-Wild-Konflikt im Spannungsfeld des Kli-
mawandels
https://www.saarland.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/muv/waldundforstwirtschaft/
dl_waldzustandsbericht2019_muv.pdf?__
blob=publicationFile&v=3
Hordengatter in Kombination mit Einzelschutzmaßnahmen
auf einer Kahlfläche Foto: Alexandra Steinmetz
Wildverbiss - Kontrolle der Verbissbelastung der
Waldverjüngung auf Indikatorflächen
https://www.saarland.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/muv/waldundforstwirtschaft/
Buche dl_waldzustandsbericht2014_muv.pdf?__
2020 hat die Buche wieder sehr stark fruktifi- blob=publicationFile&v=3
ziert. Auch wenn Blühen und Fruchten normale
Vorgänge im Lebenszyklus eines Baumes und für
die Verjüngung von Wäldern von entscheidender tieren von geschwächten Buchen und den warmen
Bedeutung sind, führt dies zu einer starken Belas- Temperaturen, können sich gut vermehren und
tung der Bäume. Der Nährstoffbedarf zur Anlage verursachen weitere Schäden.
von Blüten und Früchten ist erheblich und wird 2020 führten die in weiten Bereichen des Landes
entweder durch angelegte Reserven oder durch zu trockenen Monate April, Juli und August zu
Verlagerung von Wachstumsvorgängen gedeckt. einem Rückgang der Wasservorräte im Wurzel-
Auf den Buchen-Dauerbeobachtungsflächen geht raum der Bäume. Ende Juli/Anfang August gerieten
die seit 1990 und verstärkt seit 2002 auftretende insbesondere die stark fruktifizierenden Buchen
Fruktifikation mit einem signifikanten Anstieg der unter zunehmenden Wasserstress. Dies äußerte
Kronenverlichtung und einem signifikanten Rück- sich in gelb und braun werdenden Buchenblättern
gang des Zuwachses einher (https://fawf.wald-rlp. und häufig in nicht vollständig entwickelten Buch-
de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=71199&tok eckern. Deutlich sichtbar wurde dies durch flächig
en=3ce70d4e0685edce7be475a4f4a28ae5a31b braunwerdende Buchenwälder, z. B. auf südlich ex-
bba2). ponierten Standorten des Hunsrücks.
Während vor 2018 tote Buchen lediglich in Verbin-
dung mit der sogenannten Buchenkomplexkrank- Die Kombination von Trockenheit und starker Fruk-
heit auftraten, führten die Jahre 2018 bis 2020 zu tifikation führt zu einer Schwächung der Bäume.
einem deutlichen Anstieg trockenheitsbedingter Auch wenn im August die Buchen ihre Knospen
Absterbevorgänge. für das nächste Jahr bereits ausgebildet hatten
Die Bäume sind geschwächt und werden anfällig und diese in der Regel auch grün und vital waren,
gegenüber anderen Schaderregern. Durch Son- werden die Auswirkungen dieser Schwächung erst
nenbrand verursachte Rindennekrosen führen zu nächstes Jahr sichtbar werden. Zu erwarten ist je-
einem Auftreten von Rindenpilzen. Dem folgt die doch eine weitere, deutliche Zunahme der Schä-
Besiedelung durch Holzfäulepilze oder Hallimasch. den.
Buchenborkenkäfer und Buchenprachtkäfer profi-
32Sie können auch lesen