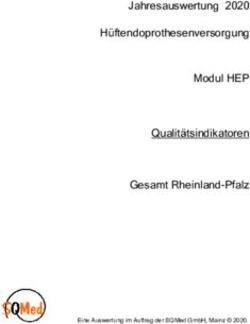Faktencheck Gesundheit - Regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung - Bertelsmann Stiftung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
3 Faktencheck Gesundheit Regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung Autoren Hans-Dieter Nolting (IGES Institut Berlin), Karsten Zich (IGES Institut Berlin), Dr. med. Bernd Deckenbach (IGES Institut Berlin), Dr. med. Antje Gottberg (IGES Institut Berlin), Kathrin Lottmann (IGES Institut Berlin), Prof. Dr. med. David Klemperer (Hochschule Regensburg), Marion Grote Westrick (Bertelsmann Stiftung), Uwe Schwenk (Bertelsmann Stiftung) Gutachter Prof. Dr. med. David Klemperer (Hochschule Regensburg), Prof. Dr. med. Thomas Mansky (Technische Universität Berlin), Professor Dr. med. Bernt-Peter Robra (Universität Magdeburg), Dr. Ingrid Schubert (Universität Köln)
4 Inhalt
Inhalt
1. Das Projekt „Faktencheck Gesundheit“ 6
2. Unerwünschte regionale Unterschiede –
Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt 8
2.1 Unerwünschte Variationen – Wie und wo treten sie auf? 8
2.2 Faktencheck Gesundheit „Regionale Variationen“ – Hintergrund 11
2.3 Faktencheck Gesundheit „Regionale Variationen“ – Ergebnisse und Erklärungsansätze 12
2.4 Faktencheck Gesundheit „Regionale Variationen“ – Welche Variationen sind
unerwünscht? 15
2.5 Unerwünschte Variationen – Wie können sie verringert und die
Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung verbessert werden? 16
3. Vorgehen und Methodik 19
3.1 Ausgangspunkt des Faktencheck „Regionale Unterschiede“ 19
3.2 Auswahl der Indikatoren für den Faktencheck „Regionale Unterschiede“ 20
3.3 Referenzen und Vorbilder des Faktencheck „Regionale Unterschiede“ 21
3.4 Berechnung der Indikatoren 21
3.5 Möglichkeiten und Grenzen des Faktenchecks „Regionale Unterschiede“ 25
4. Ausgewählte Indikatoren 26
4.1 Perinatalsterblichkeit 26
4.2 Anteil Kaiserschnitte an allen Geburten 28
4.3 Entfernung der Gaumenmandeln 30
4.4 Entfernung des Blinddarms 32
4.5 Fachärzte für Kinder-/Jugendpsychiatrie u. -psychotherapie
sowie Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten 34
4.6 Entfernung der Gebärmutter 36
4.7 Entfernung der Prostata 38
4.8 Entfernung der Gallenblase 40
4.9 Koronare Bypass-Operationen 42
4.10 Implantation eines Defibrillators 44
4.11 Kniegelenk-Erstimplantationen 46
4.12 Vorrangig ambulant durchzuführende, aber stationär erbrachte Hernien-Operationen 48
4.13 Krankenhausbehandlungen bei Diabetes 50
4.14 Krankenhausbehandlungen bei Depression 52
4.15 Anteil Stundenfälle an KH-Fällen 54
4.16 Anteil der im Krankenhaus Verstorbenen über 75-Jährigen 56Inhalt 5
5. Datenherkunft und -verwendung 58
5.1 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Statistiken 58
5.2 Mögliche Limitierungen 64
5.3 Die Indikatoren – Methodik der Berechnung und Hinweise 66
6. Literaturquellen 78
6.1 Allgemeine Literaturquellen 78
6.2 Indikatorenspezifische Literaturquellen 80
7. Vorstellung der Autoren 86
8. Vorstellung der Gutachter 86
Impressum 876 1. Das Projekt „Faktencheck Gesundheit“
1. Das Projekt „Faktencheck Gesundheit“
Uwe Schwenk (Bertelsmann Stiftung)
Über-, Unter- und Fehlversorgung im deutschen Gesundheitswesen werden in Fachkreisen schon seit
Jahren diskutiert. Der Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
zeigte die Problemlage bereits 2001 deutlich auf: In unserem Gesundheitssystem werden nicht nur wert-
volle Ressourcen unnötig und unangemessen verbraucht. Auch der regionale Einsatz von Gesundheits-
leistungen und das Angebot an Versorgungsstrukturen entsprechen häufig nicht dem Bedarf der Bevöl-
kerung.
Obwohl diese Probleme bekannt sind, sind sie nur schwer zu lösen. Komplexe Zusammenhänge, die
unklare Datenlage und unterschiedliche Interessen verzögern notwendige Verbesserungen. Mit der „Ini-
tiative für gute Gesundheitsversorgung“ will die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit Partnern neue
Wege gehen, um Veränderungsdruck zu erzeugen. Wir wollen Über-, Unter- und Fehlversorgung konkret
und nachvollziehbar aufzeigen – im „Faktencheck Gesundheit“. Dabei stehen vor allem zwei Aspekte im
Mittelpunkt. Statt unsere Bemühungen nur auf die gesundheitspolitischen Fachkreise auszurichten, set-
zen wir auf eine starke Bürgerorientierung. Und wir wollen, dass sich möglichst viele Akteure und Insti-
tutionen im Gesundheitswesen an diesem Projekt beteiligen. Denn nur gemeinsam können wir das Ziel
einer besseren Gesundheitsversorgung für alle Menschen erreichen.
Ziele
Die Initiative für gute Gesundheitsversorgung will dazu beitragen, dass...
• Gesundheitsleistungen stärker am tatsächlichen Bedarf der Patienten ausgerichtet und die begrenz-
ten Ressourcen sachgerechter eingesetzt werden
• sich die Menschen aktiv damit auseinandersetzen, welche Leistungen ihrem Bedarf entsprechen und
wie die Versorgung besser gestaltet werden kann
• die Bürger sich stärker mit der Versorgung in ihrer Region auseinandersetzen, das Gesundheitssys-
tem sowie notwendige Reformen besser verstehen und ihr Vertrauen in das System steigt.
Vorgehen
Im „Faktencheck Gesundheit“ werden wir regelmäßig Beispiele für unangemessene regionale Unter-
schiede auf einer fundierten Datengrundlage analysieren, interpretieren und veröffentlichen. Dazu gehö-
ren auch Ursachenforschung und Lösungsvorschläge für die jeweiligen Themen. Wir wollen Antworten
auf folgende Fragen finden:
• Gibt es unerwünschte regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung?
• Wo werden Leistungen erbracht, für die kein Bedarf besteht? Wo gibt es Bedarf, der unzureichend
gedeckt ist? Wo weicht der Einsatz von Ressourcen von Leitlinien und Erwartungen ab?
• Was sind die Ursachen für unerwünschte regionale Abweichungen?
• Welche Lösungen können eine bedarfsgerechte Versorgung fördern?
• Wie können die Bürger besser informiert und beteiligt werden?
Pro Jahr werden zwei bis drei Ausgaben des „Faktencheck Gesundheit“ veröffentlicht. Die ausgewähl-
ten Themen stehen beispielhaft für strukturelle Defizite im deutschen Gesundheitswesen, wie Planungs-
und Koordinationsmängel, fehlende Verantwortlichkeiten, Fehlanreize und mangelhafte Einbindung der
Patienten.
Die Auswahl der Themen treffen die Partner der Initiative für gute Gesundheitsversorgung anhand von
festgelegten Kriterien: Die Themen sollen vor allem eine hohe Relevanz für die Bevölkerung haben,
bedeutsame Defizite im System aufzeigen und konkrete Handlungs- und Verbesserungsansätze ermög-
lichen. Akteure im Gesundheitswesen und auch Bürger können sich mit Themenvorschlägen beteiligen.1. Das Projekt „Faktencheck Gesundheit“ 7 Die Bearbeitung der Themen und Interpretation der Ergebnisse erfolgt durch Themenpaten aus der Wis- senschaft und ein strukturiertes Themen-Review. Der „Faktencheck Gesundheit“ soll nicht nur die Ver- sorgungsrealität beschreiben, sondern Interpretationen und Analysen liefern, Ursachenforschung betrei- ben und nicht zuletzt Empfehlungen abgeben, wie die identifizierten Defizite behoben werden können. Kartografische Darstellungen bilden die regionale Versorgungsrealität ab und wecken das Interesse der Menschen, sich mit den dargestellten Problemen in ihrer Region aktiv auseinanderzusetzen. Kommunikation und Beteiligung Inhalt und Ergebnisse des „Faktencheck Gesundheit“ verbreitet die Initiative für gute Gesundheitsversor- gung durch vielfältige Kommunikationsmaßnahmen. Kommunikation und Diskussion sollen nicht nur in Fachkreisen stattfinden. Die Initiative will vielmehr die allgemeine Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam machen, um Veränderungsdruck zu erzeu- gen. Dabei ist es sinnvoll, Multiplikatoren anzusprechen – Journalisten und Medienexperten, aber auch alle diejenigen, die den direkten Kontakt zu den Menschen haben wie Verbraucher- und Patientenbera- tungen, Krankenkassen, Ärzte, Selbsthilfegruppen, Sozial- und Seniorenverbände. Kommunikation für die allgemeine Öffentlichkeit ist im Bereich der Gesundheitspolitik allerdings mit Herausforderungen verbunden, da die Zusammenhänge oft komplex und Laien nur schwer zu vermitteln sind. Oft weicht der subjektive Eindruck eines Patienten von der Versorgungsrealität und Expertenaus- sagen ab – zum Beispiel, wenn trotz objektiver Überversorgung ein subjektiver Mangel wahrgenommen wird. Die teilweise emotional geführte und häufig interessengeleitete öffentliche Diskussion erfordert eine sensible Form der Kommunikation. Gesundheitspolitik aus Bürgerperspektive Für die Initiative für gute Gesundheitsversorgung gilt der Grundsatz der Bürgerperspektive. Das heißt: In allen Stadien der Erstellung unserer Faktenchecks werden die Erwartungen und Wünsche der Bürger berücksichtigt. Dies kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen: Durch das Heranziehen von reprä- sentativen Befragungsergebnissen und das Bereitstellen von verständlichen, hilfreichen Informationen, durch die Beteiligung von Verbraucherorganisationen und Sozialverbänden oder durch die Unterstüt- zung regionaler Initiativen, die das Ziel verfolgen, die Versorgung vor Ort bürgerorientierter zu gestalten. Plattform für partnerschaftliche Zusammenarbeit In der Initiative für gute Gesundheitsversorgung möchte die Bertelsmann Stiftung mit Partnern und Experten aus dem Gesundheitsbereich zusammenarbeiten, die Idee und Ziele dieses Projekts mittragen. Alle Partner können die Initiative in vielfacher Weise unterstützen und bereichern, zum Beispiel durch: • Themenvorschläge • Auswertungen eigener Datenbestände • Einbringen bereits vorhandener Studien • Kooperation bei Kommunikationsmaßnahmen Wenn Sie Interesse an einer solchen Zusammenarbeit haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf gemeinsame Aktivitäten.
8 2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt
2. Unerwünschte regionale Unterschiede –
Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt
Marion Grote Westrick (Bertelsmann Stiftung) und Prof. Dr. med. David Klemperer (Hochschule Regensburg)
Regionale Unterschiede in der Versorgung finden sich bei den meisten Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den – und viele Unterschiede sind gerechtfertigt. Zum Beispiel dann, wenn in einer Region eine bestimmte Erkran-
kung häufiger oder stärker auftritt als in einer anderen und dort deshalb mehr Untersuchungen und Behand-
lungen erfolgen. Viele regionale Unterschiede ergeben sich jedoch nicht nur aus Gründen der Medizin oder
individueller Patientenpräferenzen. Solche ungerechtfertigten Unterschiede gilt es zu identifizieren und zu verrin-
gern, nicht nur, um die Qualität, Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit unseres Gesundheitssystems zu erhö-
hen, sondern vor allem, um unnötige Belastungen und Gefährdungen von Patienten zu vermeiden.
2.1. Unerwünschte Variationen – Wie und wo treten sie auf?
Die wegweisende Studie von Wennberg und Gittelsohn (1973) über kleinräumige Unterschiede in der
Gesundheitsversorgung hat die Versorgungsforschung vor eine Reihe grundlegender Fragen gestellt,
so z.B.: Wie sind regionale Unterschiede in der Angebotsdichte, in der Inanspruchnahme von Leistun-
gen oder in der Ausgabenhöhe zu bewerten? Wie lassen sich erwünschte Unterschiede von unerwünsch-
ten auseinander halten? Was sind die Ursachen für ungerechtfertigte Unterschiede, und wie lassen sich
diese, und nur diese, verringern?
Wennberg definiert ungerechtfertigte Variationen als „variation that cannot be explained on the basis of
illness, medical evidence, or patient preference“ (Wennberg J 2010, S. 4). Demnach sind Versorgungsun-
terschiede dann als unerwünscht bzw. ungerechtfertigt zu bewerten, wenn erwünschte Unterschiede auf-
grund von „illness“, „medical evidence“ und „patient preference“ ausgeschlossen sind:
• Illness: Regionale Unterschiede in der Krankheitshäufigkeit und -schwere können eine Ursache für
berechtige Unterschiede in der Inanspruchnahme sein. So wird eine Grippeepidemie, die in einer
Region sehr viel stärker ausgeprägt ist als in einer Vergleichsregion, zu Unterschieden in der Zahl
ambulant und stationär behandelter Patienten führen.
• Medical Evidence: Versorgungsunterschiede treten zudem auf, wenn der Mangel an Evidenz über
die Versorgungsergebnisse breite Entscheidungsspielräume erlaubt.1 Daraus folgende Unterschiede
können dann weder als berechtigt noch als ungerechtfertigt bewertet werden. Sie sollten allerdings
Anlass geben, Studien durchzuführen, die mehr Klarheit schaffen und eine optimale Versorgung defi-
nieren. Ungerechtfertigt sind Versorgungsunterschiede dann, wenn sie ohne sachgerechte Begrün-
dung von evidenzbasierten Leitlinien mit Standards, Normwerten und Toleranzgrenzen abweichen.2
• Patient Preference: Berechtigte Versorgungsunterschiede liegen außerdem vor, wenn es für ein medi-
zinisches Problem mehrere Optionen gibt und sich informierte Patienten nach Klärung ihrer Präferen-
zen in einer Region häufiger als in einer anderen bewusst für die eine oder die andere oder für keine
von beiden Behandlungsmöglichkeiten entscheiden. Voraussetzung für solch eine Entscheidung ist die
wertfreie, nicht-direktive Kommunikation über die möglichen Optionen und deren jeweilige Vorteile,
Nachteile, Chancen und Risiken.
Unerwünschte Variationen stellen Qualitätsdefizite in der Gesundheitsversorgung dar. Qualität der Ver-
sorgung wird dabei nach Gray (2008, S. 43) als „doing the right thing right“ verstanden, wobei sich „das
Richtige“ auf die Indikationsstellung, und „richtig machen“ auf die Durchführung bezieht. Eine Präzisie-
rung dessen, was „das Richtige“ ist, bietet die Qualitätsdefinition des Institute of Medicine (IOM 1990):
„Quality of care is the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood
of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge.“ Basierend auf dieser
Qualitätsdefinition hat eine Arbeitsgruppe des IOM die drei weithin bekannten Typen von Qualitätsdefi-
ziten – Überversorgung, Unterversorgung und Fehlversorgung – entwickelt (Chassin et al 1998):
1 So weiß bis heute – wegen der erstaunlich dürftigen Evidenzlage – niemand, wie viele Tage Bettruhe nach einem akuten unkomplizierten Herzinfarkt
zu den besten Ergebnissen führen, ob z.B. zwölf Tage besser als zwei sind oder ob 24 Stunden ggf. auch schon ausreichen (Herkner et al. 2007).
2 Allerdings ist es zuweilen schwer zu beurteilen, bis wann Abweichungen vom Normwert als sachgerecht und ab welchen Abweichungen die Unter-
schiede als ungerechtfertigt zu bewerten sind.2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt 9 Unterversorgung besteht in der Nichterbringung einer Leistung, die bei dem Patienten zu einem günsti- gen Outcome geführt hätte. Überversorgung entsteht bei einer Gesundheitsleistung, deren Schadenspoten- zial den möglichen Nutzen übersteigt. Fehlversorgung liegt vor, wenn eine an sich angemessene Leistung zwar erbracht wird, aber eine vermeidbare Komplikation auftritt und der Patient nicht den bestmöglichen Nutzen aus der Leistung erhalten kann. Wennberg hat in seinen Analysen zu unerwünschten Variationen festgestellt, dass bestimmte Leistungen eher mit Überversorgung und / oder Fehlversorgung und andere eher mit Unterversorgung einhergehen. Er unterteilt Versorgungsleistungen in effektive Versorgung (effective care), präferenzsensitive Versor- gung (preference-sensitive care) und angebotssensitive Versorgung (supply-sensitive care) (Wennberg 2005). Effektive Versorgung Effektive Versorgung bezeichnet Leistungen, deren Nutzen den Schaden so deutlich überwiegt, dass sie praktisch allen Patienten mit dem entsprechenden Problem zukommen sollten – vorausgesetzt, es liegen keine Kontraindikationen vor. Bei Interventionen, die zur effektiven Versorgung zählen, ist häufig eine Unterversorgung festzustellen. In der Studie „The Quality of Health Care Delivered to Adults in the United States“ fanden McGlynn et al. (2003) für dreißig akute und chronische Erkrankungen ein hohes Maß an Unterversorgung für effek- tive Leistungen. Nur etwas mehr als die Hälfte der als effektiv definierten Leistungen wurden erbracht (54,9 Prozent). Der Dartmouth Atlas hat für eine Reihe von effektiven Interventionen ebenfalls Unterver- sorgung in den USA festgestellt, die regional unterschiedlich ausgeprägt sind (Wennberg et al 2008). In einer aktuellen Studie wurde bei der stabilen koronaren Herzkrankheit Unterversorgung bezüglich der medikamentösen Therapie bei gleichzeitiger Überversorgung mit invasiven Maßnahmen festgestellt (Bor- den et al 2011). Für Deutschland dokumentierte das Gutachten des SVR Gesundheit Defizite in der Versorgung mit effek- tiven Leistungen für ischämische Herzkrankheiten, Schlaganfall und chronische, obstruktive Lungener- krankungen (SVR Gesundheit 2000). Auch eine aktuelle deutsche Studie zeigt Unterversorgung bei der medikamentösen Therapie von Patienten nach Herzinfarkt auf (Mangiapane et al 2011). Bei diesen Analysen wurde allerdings nicht berücksichtigt, wie Patienten die erforderliche Therapie bezüglich ihrem eigenen Gesundheitszustand, ihrer Multimorbidität und Lebensqualität bewerten. Mit anderen Worten: Eine 100%ige Umsetzung effektiver Leistungen ist nicht zu erwarten und auch nicht erstrebenswert, wenn sich einige Patienten wohlinformiert und bewusst gegen diese Leistungen ent- scheiden. Präferenzsensitive Versorgung Bei der präferenzsensitiven Versorgung hat ein Patient die Wahl zwischen zwei und mehr Behandlungs- optionen. Er kann zwischen den Optionen mit ihren jeweiligen erwünschten und unerwünschten Effek- ten, ihrem Nutzen und Schaden abwägen. Bei dieser Abwägung ist zu berücksichtigen, dass medizinische Resultate nicht sicher vorhergesagt, sondern nur mit einer Wahrscheinlichkeit erwartet werden können. Häufig fehlt sogar Evidenz zur Frage, welche Vorgehensweise bei zwei oder mehr als zwei Optionen zu besseren Ergebnissen führt. Bei präferenzsensitiven Eingriffen geht es meist um die Verbesserung der Lebensqualität, und bei solchen Fragen bewerten Patienten die Aussicht auf Symptomlinderung einer- seits und die möglichen, teilweise schwerwiegenden Nebenwirkungen eines Eingriffs andererseits, ganz unterschiedlich. Variationen, die die tatsächlichen Präferenzen der Patienten widerspiegeln, sind positiv zu bewerten. Werden die Präferenzen der Patienten allerdings nicht ausreichend berücksichtigt, besteht die Gefahr von Überversorgung, denn Patienten entscheiden sich bei präferenzsensitiven Leistungen häu- figer gegen einen Eingriff als ihr Arzt.
10 2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt
Beispiele für präferenzsensitive Leistungen sind die Prostataentfernung bei gutartiger Prostatavergröße-
rung versus aufmerksames Beobachten, die brusterhaltende Chirurgie versus Brustamputation bei Brust-
krebs im Frühstadium oder die koronare Bypassoperation versus das Einsetzen eines Stent bei stabiler
symptomatischer koronarer Herzkrankheit.
Präferenzsensitive Entscheidungen dürften den Regelfall in der Gesundheitsversorgung darstellen, weil
insbesondere bei chronischen Krankheiten nur wenige Behandlungen zwingend notwendig sind und das
Aufschieben oder Nicht-Durchführen der Behandlung häufig eine vernünftige Option sein kann. Patien-
ten sollten daher stets Informationen erhalten, die sich explizit auf die für sie bedeutsamen Therapieziele,
also auf die Beschwerdelinderung und Lebensqualität, beziehen, einschließlich der Wahrscheinlichkeit,
diese Ziele zu erreichen. Der Patient kann dann auf dieser Grundlage entscheiden, ob er eine Behand-
lung wünscht, aufschiebt oder ablehnt.
Angebotssensitive Versorgung
Wenn Ärzte die Indikationsstellung an die jeweils vorhandenen Kapazitäten anpassen, handelt es sich um
angebotssensitive Versorgung. Die gegebene sachliche und personale Infrastruktur in Form von Kranken-
hausbetten, Intensivbetten, Fachärzten und technischen Geräten determiniert die Nachfrage.
Wennberg kommt – gestützt auf Interviews – zum Ergebnis, dass die vom Angebot abhängigen ärztlichen
Entscheidungen unbewusst erfolgen. Sind wenige Intensivbetten vorhanden, stellt der Arzt die Indikation
für die Behandlung auf der Intensivstation streng. Steht eine größere Zahl von Intensivbetten zur Verfü-
gung, sinkt die Schwelle für die Indikation, ohne dass dies dem Arzt bewusst wird. Dem Angebot folgen
ebenfalls die Zahl der Arztkontakte, die Nachfrage nach Krankenhausbehandlung, die Überweisungen
zu Fachärzten und die Anwendung von bildgebender und anderer Diagnostik.3 Das Phänomen ist in ers-
ter Linie bei der Versorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten (z.B. Diabetes, koronare Herz-
krankheit, chronisch obstruktive Lungenerkrankung) festzustellen. Angebotssensitive Versorgung macht
nach Wennberg (2010, S. 10) etwa 60 Prozent der Medicare-Ausgaben aus und erklärt den Großteil der
geographischen Variationen.
Bei der angebotssensitiven Versorgung stellt sich die Frage, ob mehr Versorgung zu besseren Ergebnis-
sen führt. Studien des Dartmouth-Atlas kommen zum Ergebnis, dass mehr Behandlung sogar zu schlech-
teren Ergebnissen führen kann: In Regionen mit höheren Ausgaben war die Versorgung von Medicare-
Patienten in den letzten sechs Monaten schlechter bezüglich der Versorgungsqualität, des Zugangs zur
Versorgung und der Patientenzufriedenheit als in den Regionen mit niedrigeren Ausgaben (Fisher et al.
2003). Das Problem ist nicht etwa eine Unterversorgung in den Regionen mit niedrigen Ausgaben, son-
dern die Überversorgung in den Regionen mit hohen Ausgaben.
Die Aufteilung Wennbergs in effektive, präferenzsensitive und angebotssensitive Versorgung hat sich als
ein geeignetes Konzept zur Erklärung von Über-, Unter- und Fehlversorgung erwiesen. Allerdings sind die
drei Versorgungskategorien nicht ganz überschneidungsfrei – insbesondere bei der Frage, ob eine Leis-
tung als effektive oder als präferenzsensitive Versorgung bewertet werden sollte. Denn auch für Leistun-
gen aus der Kategorie der effektiven Versorgung gibt es für den Patienten grundsätzlich die Alternative
des Nicht-Eingreifens und Abwartens. Zudem dürfte es bei der Auswertung von Sekundärdaten teilweise
schwierig sein zu erkennen, ob es für eine an sich präferenzsensitive Leistung im konkreten Behand-
lungsfall tatsächlich mehrere Behandlungsoptionen gegeben hätte. Dies gilt es bei der Beurteilung von
regionalen Versorgungsunterschieden zu beachten.
3 Wennberg spricht in diesem Zusammenhang, in Anlehnung an Adam Smith’s „invisible hand of the market“, von der „invisible hand of capacity“
(Wennberg 2010, S. 128).2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt 11
2.2 Faktencheck Gesundheit „Regionale Variationen“ –
Hintergrund
Die internationale Forschung über regionale Variationen in der Gesundheitsversorgung hat in den anglo-
amerikanischen Ländern eine lange Tradition. In den vergangenen zehn Jahren hat sie auch in Deutsch-
land an Aufmerksamkeit und Dynamik gewonnen. Bereits 1938, also vor mehr als 70 Jahren, veröffent-
lichte J. Alison Glover Ergebnisse zu regionalen Versorgungsunterschieden in der Grafschaft Kent in
England: In seiner Studie zeigte er, dass ein in Margate wohnendes Schulkind mit einer achtfach höhe-
ren Wahrscheinlichkeit eine Tonsillektomie erhielt als ein Schulkind aus dem benachbarten Ramsgate.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der einem Kind seine Gaumenmandeln entfernt wurden, hing von der per-
sönlichen Meinung des behandelnden Arztes ab und nicht von der Ausprägung der Erkrankung beim
Kind (Glover AJ 1938).
In Deutschland wurden die internationalen Forschungsergebnisse zu geographischen Variationen und
der damit verbundenen Über-, Unter- und Fehlversorgung bis Ende der 1990er Jahre kaum zur Kennt-
nis genommen. Eine Ausnahme bildet die Arbeit von Lichtner und Pflanz (1971) über die operative Ent-
fernung des Blinddarms (Appendektomie) in Deutschland, in der auf die hohen Appendektomieraten in
Deutschland im internationalen Vergleich, die unterschiedlichen Raten bei Arbeitern und Angestellten
sowie die jahreszeitlichen Schwankungen (z.B. weniger Appendektomien in Urlaubszeiten) hingewiesen
wurde. In seinem Gutachten von 1988 analysierte der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion
im Gesundheitswesen die Entwicklung von Angebot und Inanspruchnahme von Leistungen des Kranken-
hauses im zeitlichen Verlauf, stellte eine „beträchtliche Varianz zwischen den Bundesländern“ fest, ohne
dies jedoch im Zusammenhang mit internationalen Forschungsergebnissen zu vertiefen (SVR Gesundheit
1988, Ziffer 167). Im Jahr 2000 erschien eine vom Bundesministerium für Gesundheit veranlasste Studie
zu Operationshäufigkeiten in Deutschland, die sich explizit auf die internationalen Ergebnisse bezieht.
Darin wird belegt, dass es eindeutige Hinweise auf regionale Unterschiede in der Häufigkeit von Opera-
tionen gibt (Bundesministerium für Gesundheit 2000, Weitkunat et al 2000).
Eine breite Diskussion über die Problematik von Über-, Unter- und Fehlversorgung in Deutschland regte
der Sachverständigenrat Gesundheit mit seinem Gutachten „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“
(2000/2001) an. In dem Band III des Gutachtens zeigte der Sachverständigenrat auf, dass Über-, Unter-
und Fehlversorgung auch in Deutschland auftreten, insbesondere bei den großen Volkskrankheiten isch-
ämische Herzerkrankungen, zerebrovaskuläre Erkrankungen, chronische, obstruktive Lungenerkrankun-
gen, Rückenleiden, Krebserkrankungen und depressive Störungen.
Seither sind auch in Deutschland zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zur Thematik der regionalen Vari-
ationen sowie der Über-, Unter- und Fehlversorgung erschienen. Betrachtungsgegenstand sind beispiels-
weise die Ärztedichte (Klose J, Rehbein I 2011), der Arzneimittelverbrauch (Häussler B et al 2007) und
spezielle Arzneimitteltherapien (Heier M et al 2009, Müller-Nordhorn J et al 2005), Krebserkrankungen
(Katalinic A 2010), Todesursachen und Lebenserwartung (Gaber E 2011, Latzitis N et al 2011), vermeid-
bare Sterbefälle (Sundmacher L et al 2011) und regionale Variationen in der Gesundheitsversorgung in
einzelnen Bundesländern (Swart E et al 2000, Swart E et al 2008).
Für diesen ersten „Faktencheck Gesundheit“ hat die Bertelsmann Stiftung das IGES Institut beauftragt,
einen Überblick über regionale Variationen in verschiedenen Bereichen der Gesundheitsversorgung in
Deutschland anhand von öffentlich verfügbaren Daten zu erstellen, das Ausmaß der Variationen und ggf.
regionale Muster zu bestimmen sowie erste Erklärungsätze und mögliche Handlungsoptionen zu skizzie-
ren (vgl. dazu ausführlich Kap. 3 „Vorgehen und Methodik“).
Die 16 Versorgungsaspekte, deren regionale Variationen in diesem Faktencheck vorgestellt und erläu-
tert werden, betreffen mehr als zwei Millionen Menschen jährlich. Selbst wenn aufgrund des Mangels an
öffentlich zugänglichen, regionalisierten Daten zur Gesundheitsversorgung die 16 hier betrachteten The-
men (Indikatoren) fast alle einen Bezug zur stationären Versorgung haben, decken sie ganz unterschied-
liche Versorgungsaspekte ab.12 2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt
• Operationshäufigkeiten: Der größte Teil der Indikatoren bezieht sich auf Operationen. Die hier ana-
lysierten zehn Eingriffe machen etwa zwölf Prozent aller Operationen in Deutschland aus.4 Einige der
hier betrachteten Operationen – Kaiserschnitte, die Entfernung des Blinddarms, der Gaumenmandeln,
der Gebärmutter und der Prostata sowie koronare Bypass-Operationen und die Implantation von Defi-
brillatoren – werden in anderen Ländern aufgrund ihrer starken regionalen Variabilität bereits seit
Jahren erforscht. Gemeinsame Problematik bei zumindest einigen dieser Indikatoren ist die starke
Mengenentwicklung, die zu geringe Einbeziehung von Patientenpräferenzen und die unzureichende
Qualität der Indikationsstellung.
• Zugang zu und Interaktion zwischen Versorgungssektoren: Bei sechs Indikatoren – Dichte der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und der Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
vorrangig ambulant durchzuführende, aber stationär erbrachte Hernien-Operationen, Krankenhaus-
behandlungen bei Diabetes, Krankenhausbehandlungen bei Depressionen, Anteil der Stundenfälle an
den Krankenhausfällen, Anteil der im Krankenhaus Verstorbenen über 75-Jährigen – geht es um den
Zugang zum Versorgungssystem und um die Interaktion zwischen verschiedenen Versorgungssekto-
ren. Gemeinsame Problematik dieser Indikatoren ist die regional teils ineffiziente Allokation der ambu-
lanten Versorgungsangebote und die damit einhergehenden insuffizienten Substitutionsmechanismen
zwischen ambulantem und stationärem Sektor.
• Perinatalsterblichkeit: Der Indikator „Perinatalsterblichkeit“ aus dem Themenkomplex der ver-
meidbaren Todesfälle fällt bei den hier betrachteten Indikatoren aus der Reihe, weil er der einzige
Outcome-Parameter ist – ein Ergebnisindikator nicht ausschließlich im klinischen, sondern auch im
sozialmedizinischen Sinne. Die Problematik, auf die dieser Indikator hinweist, ist die teilweise wenig
bedarfsgerechte Versorgung innerhalb des Sozial- und Gesundheitssystems sowie an den Schnittstel-
len von sozialer und medizinischer Betreuung.
2.3 Faktencheck Gesundheit „Regionale Variationen“ –
Ergebnisse und Erklärungsansätze
Operationshäufigkeiten: Regionale Unterschiede, deren Ausmaß und mögliche Gründe
Bei fast allen betrachteten Indikatoren zu Operationshäufigkeiten zeigen sich erhebliche regionale Unter-
schiede in der Gesundheitsversorgung. Die größten Unterschiede treten bei der vollständigen Entfernung
der Gaumenmandeln bei Kindern und Jugendlichen auf: So ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem Kind
die Gaumenmandeln entfernt werden, in dem Landkreis mit dem höchsten Operationsindex über acht
Mal so hoch wie in dem Landkreis mit dem niedrigsten Operationsindex (sog. Extremalquotient). Selbst
wenn die 20 Landkreise mit dem höchsten bzw. niedrigsten Operationsindex aus der Betrachtung aus-
geschlossen werden (Extremalquotient 95./5. Perzentile), ergibt sich ein Unterschied vom Faktor 2,9.
Auch bei den übrigen Operationsindikatoren gibt es ein großes Ausmaß an regionalen Unterschieden: So
liegt der Unterschied (Extremalquotient) zwischen dem Landkreis mit dem höchsten und dem niedrigs-
ten Indexwert fast durchgängig über 2. Einen Überblick über das Ausmaß der regionalen Variationen für
die einzelnen Operationsarten gibt Abbildung 15.
Wie Abbildung 1 verdeutlicht, gibt es erhebliche regionale Variationen bei den Operationshäufigkeiten.
Wennberg’s prägnante Aussage „In health care, geography is destiny“ (Wennberg J 2010, S. 3) scheint
also auch auf Deutschland zuzutreffen.
Viele Erklärungsansätze über die Ursachen von regionalen Variationen treffen auf die hier betrachteten
Indikatoren zu. In Kapitel 4 werden zu jedem Indikator themenspezifische Erklärungsansätze gegeben.
Nachfolgend soll der Versuch unternommen werden, indikator- bzw. themenübergreifende Erklärungen
für die regionalen Variationen der betrachteten operativen Eingriffe zu finden.
4 Eigene Berechnungen auf Basis des Statistischen Bundesamtes (DRG_OPSend).
5 Auf eine Berechnung und Interpretation weiterer Kennziffern der regionalen Verteilung und einen genaueren Vergleich der Kennziffern unterein-
ander wird im Rahmen dieses überblicksartigen Faktenchecks verzichtet.2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt 13
Abbildung 1: Ausmaß der regionalen Unterschiede
Extremalquotienten der Indikatoren zu Operationshäufigkeiten
8,3
Entfernung der Gaumenmandeln 2,9
8,3
Koronare Bypass-Operation 2,9
7,5
Implantation eines Defibrilators 3,1
5,9
Entfernung der Prostata 2,4
5,7
Entfernung des Blinddarms 2,5
3,9
Entfernung der Gebärmutter 2,1
3,5
Kniegelenk-Erstimplatation 1,9
2,5 Extremalquotient
Kaiserschnittentbindung 1,7 Extremalquotient ohne die 20 oberen
und die 20 unteren Ausreisser
2,0
Entfernung der Gallenblase 1,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quelle: Bertelsmann Stiftung, IGES, Statistisches Bundesamt
Die hier betrachteten Operationen lassen sich nach der Systematik Wennbergs häufig, wenn auch nicht
immer der Kategorie der präferenzsensitiven Versorgung zuordnen.6 Insofern muss der Patient nach
Abwägung des möglichen Nutzens und Schadens je Option und deren Auswirkungen auf seine zukünf-
tige Lebensqualität entscheiden, welche Behandlungsalternative für ihn persönlich am besten passt.
Häufig genug allerdings delegiert der Patient die Entscheidung, welche Behandlungsoption ausgewählt
werden soll, an den Arzt. Nun trifft der Arzt die Entscheidung, und dabei folgt er laut Wennberg seinem
eigenen „Practice Style“ (siehe Abbildung 2). Unterschiede im Praxisstil weniger Ärzte können beim
Vergleich kleiner Regionen große Versorgungsunterschiede verursachen.
Hat der Patient die Entscheidung an den Arzt delegiert, so beeinflussen vier Faktoren die Wahl des Arz-
tes für eine bestimmte Behandlungsoption, und zwar in unterschiedlicher Intensität (Wennberg 2010,
S. 38ff.):
1. Die persönliche Meinung des Arztes: An die Entscheidung für oder gegen eine Operation gehen
behandelnde Ärzte ganz unterschiedlich heran: So gibt es Ärzte, die dem Leitgedanken „Operation
als Prävention“ folgen. Um dem Patienten ein eventuelles Voranschreiten der Erkrankung mit dann
anstehenden Komplikationen – oder allein die Angst davor – zu ersparen, plädiert der Arzt dafür,
die Operation quasi präventiv durchzuführen. Andere Ärzte hingegen schließen sich eher dem Leit-
gedanken des „primum non nocere“ („zuerst einmal nicht schaden“) an und ziehen eher konserva-
tive, medikamentöse oder abwartende Strategien einer Operation vor (Wennberg 2010, S. 46). Wel-
chem Ansatz ein Arzt eher zugeneigt ist, dürfte unter anderem von seiner Sozialisierung während
der Ausbildung, seinem kollegialen Umfeld und seiner persönlichen Erfahrung abhängen.7 Dieser
Erklärungsansatz könnte bei den hier betrachteten Indikatoren auf die Entfernung der Gaumenman-
deln, der Prostata, des Blinddarms und der Gebärmutter, auf die Erstimplantation eines Kniegelenks,
Kaiserschnittentbindungen und die Entfernung der Gallenblase zutreffen.
6 So dürfte die Kaiserschnittentbindung in der Mehrzahl der Fälle medizinisch ebenso geboten sein wie die operative Entfernung der Gebärmutter.
In manchen Situationen, z.B. bei Prostatakrebs, kann abwartendes Beobachten eine vernünftige Alternative zur Operation sein.
7 Zum Einfluss von soziologischen Rahmenbedingungen auf das Verhalten von Ärzten vgl. de Jong JD (2007) und Westert G, Groenewegen P (1999).14 2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt
Abbildung 2: Was beeinflusst die Inanspruchnahme präferenzsensitiver Leistungen?
Modell der präferenzsensitiven Versorgung, wenn der Patient die Entscheidung
an den Arzt delegiert.
Meinung des Medizinische Verfügbarkeit Verfügbarkeit
behandelnden Arztes Evidenz von Ressourcen von Ressourcen
(Starker Einfluss) (Variabler Einfluss) (Variabler Einfluss) (Schwacher Einfluss)
„Practice Style“
(Art und Weise zu praktizieren)
Inanspruchnahme von
präferenzsensitiver Versorgung
Quelle: Wennberg J (2010), S. 10.
2. Die medizinische Evidenz: In zahlreichen Analysen, die sich entweder auf einzelne US-Bundes-
staaten, die gesamte USA oder auf mehrere Länder bezogen, zeigte sich ein statistischer Zusammen-
hang zwischen medizinischer Evidenz und dem Ausmaß der regionalen Variationen: Je unklarer die
Evidenzlage zum Nutzen einer Operation im Vergleich zu anderen Behandlungsmaßnahmen ist (ein-
schließlich abwartendem Beobachten), desto größer ist der Ermessensspielraum für die Entscheidung
(Wennberg 2010, S. 48ff). Bei den hier betrachteten Indikatoren könnte dieser Erklärungsansatz auf
die Entfernung der Prostata, des Blinddarms und der Gebärmutter, auf Kaiserschnittentbindungen
und – im Sinne einer relativ klaren Evidenzlage – die Entfernung der Gallenblase zutreffen.8
3. Die Verfügbarkeit von Ressourcen: Die Verfügbarkeit der für die jeweilige Operation benötigten
personellen und sachlichen Ressourcen beeinflusst ebenfalls die regionale Variabilität von Leistun-
gen: Je mehr Ressourcen in Form von Personal, Krankenhausbetten und Medizingeräten verfügbar
sind, um so eher wird die betreffende Operation vorgenommen. Dieser Erklärungsansatz könnte auf
die koronaren Bypass-Operationen, die Implantation eines Defibrillators und auf Kaiserschnittent-
bindungen zutreffen.
4. Die Präferenzen des Patienten: Hat der Patient die anstehende – und zuallererst ihn persönlich
betreffende – Entscheidung erst einmal dem Arzt überlassen, so haben seine Präferenzen nur noch
einen geringen Einfluss darauf, welche Behandlungsoption der Arzt auswählt. Als schwerwiegende
Folge werden laut Wennberg häufig „die falschen Patienten“ operiert, also die, die sich gegen diese
Option entschieden hätten, wären sie vollständig informiert gewesen. Genau an diesem Punkt muss
laut Wennberg eine fundamentale Reform ansetzen, die die Medizinkultur nachhaltig verändert wird:
Eine „Demokratisierung“ des Arzt-Patienten-Verhältnisses, bei dem die Präferenzen des Patienten
mehr Gewicht erhalten (Wennberg 2010, S. 9f).
Ein weiterer wichtiger Grund für das Auftreten regionaler Unterschiede bei den betrachteten Opera-
tionshäufigkeiten in Deutschland dürften zudem finanzielle Anreize sein. Deutsche Krankenhäuser
erhalten ein prospektives Budget, das auf einem aus der Vergangenheit abgeleiteten, zu erwartenden
Leistungsvolumen (z.B. Anzahl an Koronarangiographien, Prostataentfernungen usw.) beruht. Somit
besteht ein Anreiz zur Erbringung von Leistungen zumindest bis zur Ausschöpfung des Budgets. Ver-
8 Bei einem internationalen Vergleich könnte sich auch herausstellen, dass höhere Operationsraten in einem Land mit einer insgesamt größeren
Verfügbarkeit von personellen und technischen Ressourcen zur Durchführung dieser Operation erklärt werden können.2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt 15
gütet wird also das Durchführen einer Operation und nicht das Unterlassen, z.B. in Form von beobach-
tendem Zuwarten. Es ist anzunehmen, dass deutsche Krankenhausärzte einem unterschiedlich starken
betriebswirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind, auch Leistungen zu erbringen, deren Indikationsstel-
lung nicht eindeutig gegeben ist. Ob dieser betriebswirtschaftliche Druck allerdings regionale Muster
aufweist, müsste geklärt werden.
Strukturabhängige Leistungen: Regionale Unterschiede, deren Ausmaß und mögliche
Gründe
In diesem Faktencheck Gesundheit „Regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung“ werden nicht
nur regional unterschiedliche Häufigkeiten verschiedener Operationen vorgestellt, sondern auch regio-
nale Unterschiede bei Leistungen aufgezeigt, deren Inanspruchnahme versorgungsstrukturabhängig sind
und die die Interaktion zwischen den Versorgungsstrukturen abbilden.9 Wie oben bereits erläutert, wei-
sen diese Indikatoren die gemeinsame Problematik einer regional unterschiedlichen und ggf. ineffizien-
ten Allokation der ambulanten und stationären Versorgungsangebote und damit einhergehende Kompen-
sationsleistungen des stationären für den insuffizient ausgestatteten ambulanten Sektor auf.
Nach der Systematik von Wennberg handelt es sich bei diesen Indikatoren tendenziell um angebotssensi-
tive Versorgungsleistungen, deren Inanspruchnahme von der regionalen Verfügbarkeit – oder eben auch
von dem regionalen Mangel – an Angebotsstrukturen abhängt.
Eine direkte Gegenüberstellung der Extremalquotienten ergibt bei diesen Indikatoren allerdings wenig
Sinn, zum einen, weil sie thematisch zu unterschiedlich sind, d.h. weil ihre Einflussfaktoren eher themen-
spezifisch als themenübergreifend sind (siehe dazu die einzelnen Erklärungen in Kapitel 5), zum zwei-
ten, weil bei der eingeschränkten Datenverfügbarkeit umfassende regionale Versorgungsprofile nicht mit-
einander verglichen werden können.
Einige gemeinsame Gründe für die regionalen Variationen lassen sich allerdings vermuten: So scheint die
ambulante Bedarfsplanung einerseits und die Krankenhausplanung andererseits bei vielen Indikatoren
Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen der Leistungsinanspruchnahme von ambulanten und statio-
nären Versorgungsstrukturen zu haben. Ein weiterer Grund für regionale Unterschiede bei diesen ange-
botssensitiven Versorgungsleistungen liegt vermutlich in regional unterschiedlichen Vertrags-, Abrech-
nungs- und Kontrollmodalitäten zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen.
2.4 Faktencheck Gesundheit „Regionale Variationen“ –
Welche Variationen sind unerwünscht?
Wie sind die Ergebnisse des Faktencheck Gesundheit „Regionale Variationen“ zu bewerten? Deutet das
errechnete Ausmaß an regionalen Unterschieden bei einigen Indikatoren auf unerwünschte Variationen
hin? Liegt bei einigen der betrachteten Indikatoren Über-, Unter- oder Fehlversorgung vor?
Generelle und für alle Indikatoren zusammenfassende Antworten können auf diese Fragen nicht gege-
ben werden. Es gilt zu beachten, dass in diesem Faktencheck für jeden Indikator der bundesdeutsche
Durchschnitt (Indexwert = 1) als Richtgröße zur Berechnung der regionalen Unterschiede bzw. der
Abweichungen gewählt wurde. Auf einen medizinischen Wert je Indikator (z.B. 80 Eingriffe pro 100 Tsd.
Einwohner) als normative Richtgröße für die Abweichungen wurde aus drei Gründen bewusst verzich-
tet: Die „richtige Rate“ für die Durchführung von Behandlungen ist den Autoren und Gutachtern nicht
bekannt – anerkannte Normwerte für die hier betrachteten Indikatoren liegen nicht vor. Einen solchen
Normwert festzulegen, erfordert zum zweiten ein aufwändiges Verfahren, das den Rahmen dieses über-
blicksartigen Faktenchecks gesprengt hätte. Das Festlegen des Bundesdurchschnitts als Richtgröße hat
zum dritten den Vorteil, dass sich die Interpretation der Ergebnisse vor allem auf das Ausmaß der regi-
onalen Abweichungen konzentriert und nicht darauf, ob der gewählte Normwert tatsächlich der „rich-
tige“ ist.
Der Nachteil, den Bundesdurchschnitt als Richtgröße festzulegen, besteht darin, dass Aussagen zu einer
möglichen Über- oder Unterversorgung schwerer zu treffen sind. Anhand eines Normwertes oder -korri-
9 Der Indikator „Dichte der Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten“ beispielsweise ist ein
reiner Strukturindikator, weil durch ihn nicht die Leistungsinanspruchnahme, sondern die Angebotsdichte abgebildet wird.16 2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt
dors ließe sich konkret feststellen, dass bei einer Abweichung nach oben eine Überversorgung vorliegt
bzw. bei einer Abweichung nach unten eine Unterversorgung. Ob der bundesdeutsche Durchschnitt hin-
gegen dem der „richtigen Rate“ bzw. dem medizinischen Normwert entspricht, ist fraglich. Es ist durch-
aus möglich, dass das Versorgungsniveau in Deutschland bei einem Indikator im internationalen Ver-
gleich insgesamt eher hoch oder eher niedrig ist, und dass selbst große Abweichungen vom Durchschnitt
vor diesem insgesamt hohen oder niedrigen Niveau zu interpretieren wären.
Nichtsdestoweniger ist das Ausmaß der regionalen Versorgungsunterschiede für manche Indikatoren
sehr hoch, medizinisch nicht nachvollziehbar und erklärungsbedürftig, und es ist durchaus zu vermuten,
dass auch unerwünschte regionale Variationen vorliegen. Die Annahme liegt nahe, dass es in Deutsch-
land Überversorgung gibt für die Entfernung der Gaumenmandeln, des Blinddarms, der Prostata und der
Gebärmutter, für die koronaren Bypass-Operationen, die vorrangig ambulant durchzuführenden, aber
stationär erbrachten Hernien-Operationen und den Anteil der Stundenfälle an allen Krankenhausfällen.
Bei der Dichte an Psychiatern und Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche sowie der Behandlung
von Patienten mit Depressionen liegt die Vermutung von regionalen Situationen der Unterversorgung
nahe. Bei den Indikatoren, die sich auf die Interaktion zwischen ambulanten und stationären Angebots-
strukturen beziehen, ist zu vermuten, dass tendenziell eine Unterversorgung im Sinne einer zu geringen
Verfügbarkeit an ambulanten Versorgungsstrukturen und eine Überversorgung im Sinne von leichter
verfügbaren, und damit häufig den ambulanten Bereich kompensierenden stationären Versorgungs-
strukturen vorliegt. Probleme der Unter- und Fehlversorgung gibt es schließlich im Bereich der Ver-
sorgung von werdenden Müttern mit Risikoschwangerschaften und deren zu früh geborenen Kindern.
Ob diese Vermutungen in Richtung Überversorgung oder Unterversorgung, bzw. dem gleichzeitigen Vor-
liegen von Überversorgung und Unterversorgung in den kreisfreien Städten und Landkreisen tatsächlich
zutreffen, lässt sich nur durch weitere quantitative und qualitative Nachforschungen zu den einzelnen
Indikatoren herausfinden. Bei vielen Themen wäre es interessant, die bereits herangezogenen Indika-
toren um weitere Indikatoren zu ergänzen. So wäre es beispielsweise sehr aufschlussreich, die regio-
nale Operationshäufigkeit von Blinddarmentfernungen einer regionalen Perforationsrate bei Appendi-
zitis (also den Blinddarmdurchbrüchen) gegenüberzustellen, die regionale Häufigkeit von koronaren
Bypass-Operationen mit regionalen Mustern von Katheterbehandlungen zu vergleichen oder die Kran-
kenhausbehandlungen bei Diabetes mit der ambulanten Diabetiker-Versorgung abzugleichen. Solche
zweifelsohne erkenntnisbringenden, gleichwohl umfangreichen Recherchen lagen allerdings außerhalb
der Zielsetzung dieses Faktenchecks, der in einem ersten Überblick regionale Variationen und deren
Ausmaß über verschiedene Themen hinweg darstellen und erste Erklärungsansätze für die regionalen
Unterschiede aufzeigen sollte.
2.5 Unerwünschte Variationen – Wie können sie verringert und
die Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung verbessert werden?
Medizinisches und gesundheitspolitisches Ziel muss es sein, unerwünschte Versorgungsunterschiede,
und nur die unerwünschten, zu verringern. Dies gilt nicht nur, um den ineffizienten Einsatz von Res-
sourcen bei ungerechtfertigten regionalen Unterschieden abzubauen, sei es, weil bei Überversorgung
Ressourcen verschwendet oder bei Unterversorgung Leistungen vorenthalten werden. Es ist vor allem
eine ethische Pflicht, Patienten präferenz- und bedarfsgerecht zu versorgen und unnötige Belastungen
und Gefährdungen von ihnen fernzuhalten. Die große Herausforderung besteht darin, unerwünschte
Variationen so in Angriff zu nehmen, dass die berechtigten Variationen, die mit einer patientenorien-
tierten Versorgung einhergehen, erhalten bleiben (Mulley A 2010). Das Identifizieren der unerwünsch-
ten Variationen ist dabei ein erster wichtiger, gleichwohl methodisch und medizinisch anspruchsvoller
Schritt. In einem zweiten Schritt sind dann die Ursachen zu ergründen und gezielt anzugehen. Auch
dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil häufig mehrere Faktoren für unerwünschte Versorgungsun-
terschiede verantwortlich sind.
Generell können eine sektorenübergreifende, bedarfsorientierte Versorgungsplanung, integrierte Anbie-
terstrukturen und finanzielle Anreize, die die sprechende Medizin und ein abwartendes Beobachten
stärker honorieren, auf der Makroebene des Systems zu einer Verringerung von unerwünschten Unter-
schieden und damit zu einer bedarfsgerechteren Gesundheitsversorgung beitragen. Auf der Mikroe-2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt 17
bene können vor allem die Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien und Entscheidungshilfen,
unterstützende IT-Systeme und die größere Bereitschaft von Ärzten, sich auf eine partnerschaftliche
Entscheidungsfindung mit ihrem Patienten einzulassen, eine bedarfs- und präferenzorientierte Versor-
gung begünstigen.
Unerwünschte Variationen in der Versorgung zu verringern oder gar ganz zu vermeiden, ist ein wichti-
ges Ziel. Die oben beschriebene, eher analytische Strategie, bei der erst die unerwünschten Variationen
und ihre Ursachen identifiziert und dann gezielt angegangen werden, ist komplex und aufwändig. Eine
alternative Strategie setzt hingegen nicht zuerst an den unerwünschten Ergebnissen versorgungspoliti-
scher und medizinischer Entscheidungen an, sondern am Prozess der Entscheidungsfindung selbst. Für
den britischen King’s Fund entspricht dieser Ansatz dem Konzept der Prozessgerechtigkeit: Solange die
getroffenen medizinischen Entscheidungen durch einen vereinbarten fairen Prozess zustande kommen,
werden und können die Ergebnisse voneinander abweichen (Appleby et al 2011).
Diese prozessorientierte Strategie stellt auf die partizipative Entscheidungsfindung von Arzt und Patient
(Shared Decision Making) ab. Shared Decision Making bezeichnet die partnerschaftliche Entscheidungs-
findung, in der Arzt und Patient alle relevanten Informationen austauschen und sich auf die am besten
passende Behandlungsoption einigen (siehe Textbox). Konzeptgetreu angewandt, führt es zu mehr prä-
ferenzgerechten Entscheidungen.
Shared Decision Making (SDM):
• Was ist SDM? Im gegenseitigen Vertrauen tauschen Ärzte und Patienten alle wichtigen Informationen
aus, der Arzt als unabhängiger medizinischer Experte für die Diagnose und die möglichen Behandlungs-
optionen mit deren jeweiligen Chancen und Risiken, der Patient als Experte für seine eigenen Wünsche,
Ängste und Lebensumstände. Sie einigen sich auf die für den Patienten beste Option, übernehmen beide
Verantwortung für ihre gemeinsame Entscheidung und halten diese schriftlich fest.
• Was bewirkt SDM? Nach einem SDM-Prozess verfügen Patienten über ein besseres Wissen und Ver-
ständnis über ihre Erkrankung. Sie können die Risiken verschiedener Optionen besser einordnen, fühlen
sich mit ihrer Entscheidung wohler – und tatsächlich entscheiden sich weniger Patienten für größere
Eingriffe – und entfalten mehr Therapietreue und Eigenkompetenz im Umgang mit ihrer Erkrankung.
• Wie gelingt SDM? Zu einer erfolgreichen gemeinsamen Entscheidungsfindung gehören genügend Zeit
und Ruhe, unabhängige Entscheidungshilfen für Patienten (Decision Aids) als unterstützende Unterlagen,
und nicht zuletzt die Bereitschaft von Arzt und Patient, gemeinsam zu entscheiden zu wollen.
• Wollen Patienten und Ärzte SDM? Umfragen (auch aus Deutschland), zeigen immer wieder, dass
die Mehrzahl der Patienten in Entscheidungen über ihre eigene Person stärker mit einbezogen werden
und (mit-) entscheiden möchte. Selbst Patienten aus vulnerablen Gruppen, die die Verantwortung und
Entscheidung häufiger an den Arzt delegieren, lassen sich zu einer gemeinsam Entscheidungsfindung
ermuntern. Sie profitieren auch am meisten davon. Auch viele Ärzte sind dem gemeinsamen Entschei-
dungsprozess grundsätzlich offen gegenüber eingestellt. Sie nennen häufig aber ganz ähnliche Gründe
und Vorbehalte, warum das gemeinsame Entscheiden noch nicht erfolgt.
• Wie können Decision Aids unterstützen? Entscheidungshilfen enthalten alle relevanten medizi-
nischen Informationen für den Patienten in verständlicher Sprache. Sie beschreiben die Erkrankung und
ihre Symptome, stellen – ohne einseitige Empfehlungen – die möglichen Behandlungsoptionen (inklusive
Nicht-Eingreifen und Abwarten) vor, beschreiben deren erhoffte Wirkungen und Nebenwirkungen sowie die
Wahrscheinlichkeiten, mit der bestimmte Wirkungen und Nebenwirkungen zu erwarten sind. Zudem wird
in Entscheidungshilfen, auch anhand von konkreten Beispielen, dargelegt, welche Erfahrungen Patienten
mit jeweils unterschiedlichen Behandlungsoptionen gemacht haben. In ihrer umfassenden, unabhängigen,
wissenschaftlich fundierten, aber laienverständlichen Form bieten sie im wahrsten Sinne des Wortes eine
Entscheidungshilfe für den Patienten, vor, während oder auch nach dem Gespräch mit dem Arzt.
Quelle: Coulter und Collins (2011), Klemperer und Rosenwirth (2005).Sie können auch lesen