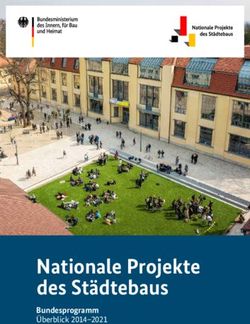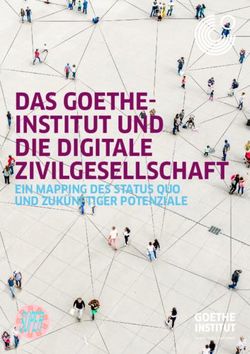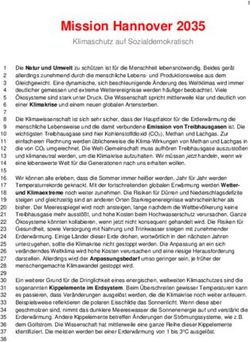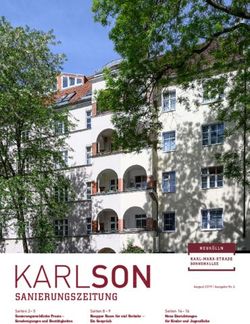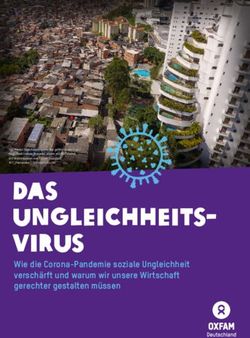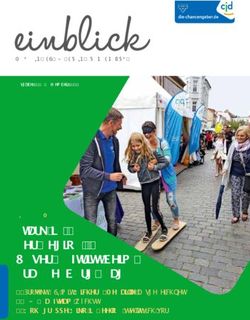"Gemeinsam das Kindeswohl schützen" - Stadt Landshut
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kinder brauchen Schutz und Sicherheit Körperliches Wohlergehen Bindung und Beziehung Liebe und Wertschätzung Anregung und Förderung „Gemeinsam das Kindeswohl schützen“ Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Koordinierenden Kinderschutzstelle Stadt Landshut
Impressum
Herausgeber
Stadt Landshut
Stadtjugendamt
Luitpoldstr. 29b
84034 Landshut
Tel.: 0871 / 88 - 2300
www.landshut.de
Redaktion
KoKi - Netzwerk Frühe Kindheit
Stadt Landshut
Stilla Waltl Christina Meister
Tel.: 0871 / 88-2346 Tel.: 0871 / 88-2348
Stilla.Waltl@landshut.de Christina.Meister@landshut.de
Sandra Heyer
Tel.: 0871 / 88-2347
Sandra.Heyer@landshut.de
Stand
2. überarbeitete Auflage, August 2021
Die Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKis) werden aus Mitteln des Bayerischen
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Informationen zum Kin-
derschutz in Bayern finden Sie unter https://www.stmas.bayern.de/kinderschutz/in-
dex.php
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 2Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption
der Koordinierenden Kinderschutzstelle Stadt Landshut
1 Einleitung ......................................................................................... 5
2 Historie der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) in Bayern ... 5
2.1 Fachliche Ebene ..................................................................................................................... 5
2.2 Politische Ebene .................................................................................................................... 6
3 Grundlagen der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) ............ 7
3.1 Aufgaben ............................................................................................................................... 7
3.2 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen................................................................ 8
3.3 Zielgruppen und Ziele ............................................................................................................ 8
3.4 Methodische Umsetzung der Ziele........................................................................................ 9
3.5 Netzwerkarbeit ...................................................................................................................... 9
3.6 Familienbezogene Arbeit ..................................................................................................... 10
4 KoKi in der Stadt Landshut ..............................................................11
4.1 Ausgangslage ....................................................................................................................... 11
4.2 Rahmenbedingungen .......................................................................................................... 12
4.3 Datenschutz ......................................................................................................................... 13
5 Netzwerkarbeit ................................................................................15
6 Familienbezogene Arbeit .................................................................18
6.1 Einsatz von Fachkräften im Rahmen der Frühen Hilfen ...................................................... 18
6.2 Kooperation mit Netzwerkpartner*innen im Einzelfall ....................................................... 19
6.3 Beratung nach §§ 8b SGB VIII, 4 KKG................................................................................... 20
6.4 Schnittstellenmanagement ................................................................................................. 20
6.4.1 Schnittstellenmanagement zwischen KoKi und ASD ............................................................ 20
6.4.2 Schnittstellenmanagement zu anderen Fachbereichen des Jugendamtes .......................... 22
6.4.3 Schnittstellenmanagement zu sonstigen Netzwerkpartner*innen...................................... 23
7 Angebotslandschaft „Frühe Hilfen“ in der Stadt Landshut ................24
7.1 Angebote in Kooperation mit Netzwerkpartner*innen ...................................................... 25
7.2 Angebote weiterer Netzwerkpartner*innen ...................................................................... 27
7.3 Nicht gedeckter Bedarf ........................................................................................................ 29
8 Öffentlichkeitsarbeit ........................................................................30
8.1 Veranstaltung und Werbung ............................................................................................... 30
8.2 Berichterstattung durch regionale Medien ......................................................................... 31
8.3 Internetauftritt .................................................................................................................... 31
9 Qualitätssicherung und Fortschreibung der Netzwerkbezogenen
Kinderschutzkonzeption ...................................................................32
9.1 Qualitätssicherung............................................................................................................... 32
9.2 Fortschreibung..................................................................................................................... 32
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 310 Ausblick ...........................................................................................33 11 Literaturverzeichnis .........................................................................34 12 Begriffsbestimmungen .....................................................................35 13 Anhang ............................................................................................37 Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 4
1 Einleitung
Säuglinge und Kleinkinder sind körperlich und psychisch in besonderem Maße von der Fürsor-
gequalität ihrer unmittelbaren Umwelt abhängig.1 Daraus ergibt sich eine besondere Schutz-
würdigkeit speziell in den ersten drei Lebensjahren. In jungen Eltern-Kind-Beziehungen kann
es schnell zu Krisen kommen. Deshalb ist es in dieser Zeit besonders wichtig, Eltern während
der höchst sensiblen Phase der frühen Kindheit in ihrer Elternkompetenz zu fördern und zu
unterstützen.
Über die typischen Krisen der frühen Kindheit hinaus kann es bei zusätzlichen Belastungen wie
z.B. Armut, psychischer Erkrankung der Eltern, jugendlichem Alter der Eltern, fehlender fami-
liäre Unterstützung etc. auch zu Gewalt und Vernachlässigung oder schweren Störungen der
Eltern-Kind-Beziehung kommen, die die kindliche Entwicklung ernsthaft und nachhaltig ge-
fährden.2
So wie die Übergänge von einer krisenhaften Entwicklung zu einer Gefährdungssituation flie-
ßend sind, können auch die Übergänge von der Freiwilligkeit einer Beratung bis hin zur Siche-
rung des Kindeswohls durch gesetzliche Maßnahmen fließend sein.
Das Konzept der Koordinierenden Kinderschutzstellen basiert deshalb in erster Linie auf dem
Gedanken „Prävention vor Intervention“. Es ist Aufgabe der Koordinierenden Kinderschutzstel-
len, auf der örtlichen Ebene frühzeitig und präventiv Risiken und Gefährdungen im Aufwach-
sen von Kindern in Familien zu erkennen und rechtzeitig notwendigen Unterstützungsbedarf
zu gewährleisten. Je höher das psychosoziale Risiko von Familien mit kleinen Kindern ist, desto
früher, spezifischer und gezielter müssen präventive Angebote zur Verfügung stehen.
Im Fokus steht die gelingende Bewältigung der Entwicklungsaufgaben von Kindern und die Si-
cherstellung ihrer wichtigsten Grundbedürfnisse nach Schutz und Sicherheit, körperlichem
Wohlergehen, Bindung und Beziehung, Liebe und Wertschätzung, Anregung und Förderung
insbesondere in den ersten sensiblen Lebensjahren.
Um diese Aufgabe bewältigen zu können, bedarf es der Zusammenarbeit mit allen vorhande-
nen Unterstützungssystemen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Gesundheitshilfe
und allen weiteren Professionen und Institutionen, die mit werdenden Eltern und jungen Fa-
milien befasst sind.
Nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und starke Netzwerke vor Ort bilden, ist eine
optimale Förderung von Kindern sowie die Sicherstellung eines effektiven Kinderschutzes
möglich.
2 Historie der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) in Bayern
2.1 Fachliche Ebene
Mehrere Entwicklungsstränge haben zum gegenwärtigen Konzept der Koordinierenden Kin-
derschutzstellen geführt:
1 Vgl. Ziegenhain und Fegert 2009, S. 12
2
Vgl. Hammer 2010, S. 13
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 5 Dramatische und schockierende Kinderschutzfälle (Stichwort „Kevin“) mit großer media-
ler Aufmerksamkeit haben intensive fachliche Diskussionen darüber ausgelöst haben, wie
Kinderschutz optimiert werden kann.3
Die Novellierung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
im Herbst 2005, insbesondere mit den Neuregellungen in § 8a SGB VIII zum Schutzauf-
trag.
Die Erkenntnisse des länderübergreifenden Modellprojekts „Guter Start ins Kinderle-
ben“,4 (Teilnehmer: Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen) mit
dem Ziel der Intensivierung der Zusammenarbeit von Gesundheitsbereich mit der Kinder-
und Jugendhilfe, die gezeigt haben, dass die frühe Förderung und Stärkung der Erzie-
hungskompetenzen von Eltern eine nachhaltigere Wirkung erzielt als lediglich reaktive,
repressive Strategien des Kinderschutzes.
2.2 Politische Ebene
Die Verbesserung des Kinderschutzes an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Gesund-
heitswesen war Gegenstand der gemeinsam mit der Bundeskanzlerin gefassten Beschlüsse der
Regierungschefs der Länder im Dezember 2007 und Juni 2008.
Der Bayerische Ministerrat hat am 12. Februar 2008 die Einführung eines Förderprogramms
zur Unterstützung der kommunalen Gebietskörperschaften als örtliche Träger der Kinder-
und Jugendhilfe bei der Etablierung sozialer Frühwarn- und Fördersysteme als Regelförder-
programm beschlossen.5
Auf der Fachebene wurden 2008/2009 in mehreren Arbeitsgruppen zwischen Kommunen, Re-
gierungen, dem Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt sowie
dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen gemein-
sam programmatische und konzeptionelle Eckpunkte erarbeitet, sodass nach Verabschiedung
des Haushalts im Bayerischen Landtag das staatliche Regelförderprogramm zur Unterstützung
der Koordinierenden Kinderschutzstellen im Verantwortungsbereich der Jugendämter ab Juli
2009 anlaufen konnte.6
Mit der Umsetzung und Durchführung dieses staatlichen Förderprogramms sind die jeweiligen
Bezirksregierungen beauftragt. Die fachliche Begleitung und die Durchführung von Qualifizie-
rungsveranstaltungen wird durch das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) – Bayeri-
sches Landesjugendamt – gewährleistet.
Durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 wurde unter anderem
die Notwendigkeit der Koordinierenden Kinderschutzstellen, insbesondere mit der Aufgabe
zur Netzwerkkoordination, gesetzlich manifestiert.
Ab 2018 ist das Förderprogramm in die Bundesinitiative/Bundesstiftung übergegangen.
Seit 2020 gelten nur noch die Verwaltungsvereinbarungen und Leistungsleitlinien Fonds Frühe
Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen.
3 vgl. hierzu z.B. Rätz et al. 2014, S.44
4
Informationen zum Pilotprojekt „Guter Start ins Kinderleben“ im Internet unter: http://www.uniklinik-
ulm.de/struktur/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatriepsychotherapie/home/Forschung/guter-start-ins-kinder-
leben.html
5 https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/downabt6/13_Bayerisches_Landesjugendamt_KoKi.pdf
6
Vgl. StMAS o.J.
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 63 Grundlagen der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) Die Arbeit der Koordinierenden Kinderschutzstellen basiert auf den Eckpunkten des Staatsmi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (STMAS), die die Fördervoraus- setzungen und konzeptionelle Rahmenbedingungen beinhalten. Grundsätzliches Ziel der Koordinierenden Kinderschutzstellen ist die Vorbeugung und Vermei- dung von Vernachlässigung und Gewalt gegenüber Kindern, insbesondere im Altersbereich von 0 – 3 Jahren. In den ersten drei Lebensjahren wird der Grundstein für die gesamte weitere kindliche Entwicklung gelegt. Deshalb ist es besonders wichtig, so früh wie möglich Belastun- gen in familiären Systemen zu erkennen, um die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe bei Bedarf mit den passenden Hilfen zu unterstützen. Die Fachkräfte der Koordinierenden Kinderschutz- stellen kennen die Angebote und Strukturen vor Ort, veröffentlichen die Angebote in geeigne- ter Form und übernehmen eine Navigationsfunktion bei der Suche nach der passenden Hilfe sowohl für die Familien als auch für die Netzwerkpartner*innen ein. Im Fokus steht die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen der Ge- sundheits- und Jugendhilfe, um eine enge verbindliche Kooperation zu erreichen mit dem Ziel, riskante Entwicklungsverläufe frühzeitig wahrzunehmen bzw. ihre Entstehung zu verhindern. Die Koordinierenden Kinderschutzstellen übernehmen hierbei eine koordinierende und steu- ernde Funktion. 3.1 Aufgaben Die Aufgaben Koordinierender Kinderschutzstellen sind im Wesentlichen in drei große Berei- che gegliedert. Diese umfassen neben Netzwerkkoordination und Öffentlichkeitsarbeit auch das Angebot und die Umsetzung familienbezogener Hilfen. Im Rahmen der Netzwerkkoordination werden ortsansässige Träger, Angebote und Einrichtun- gen vernetzt, um regionale Bedarfe zu ermitteln und zu decken, einheitliche Standards zu er- arbeiten und Informationen transparent zu machen. Durch sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit werden diese Anstrengungen sowohl verschiedenen Pro- fessionen als auch interessierten Bürger*innen zugänglich gemacht. Aktuelle Entwicklungen und Neuerungen in rechtlichen, psychologischen oder sozialen Themengebieten können eben- falls durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit einer breiten Masse vermittelt werden. Im Rahmen der familienbezogenen Hilfen können Eltern frühzeitig beraten und informiert wer- den und auf spezifische Angebote aus dem regionalen Netzwerk hingewiesen werden. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 7
3.2 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen
Auf der Basis folgender rechtlichen Grundlagen erfolgt die Arbeit der Koordinierenden Kin-
derschutzstellen:
SGB VIII BKiSchG
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII: § 3 KKG
Aufgaben der Jugendhilfe Rahmenbedingungen für verbindliche
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz
§ 16 SGB VIII:
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Fa-
milie
§80 SGB VIII:
Jugendhilfeplanung
§81 SGB VIII:
Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stel-
len und öffentlichen Einrichtungen
§86 SGB VIII:
Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Eltern
3.3 Zielgruppen und Ziele
Durch die Koordinierenden Kinderschutzstellen sollen grundsätzlich alle werdenden Eltern und
Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren erreicht werden, die für sich einen Unterstützungsbe-
darf sehen (primäre Prävention).
Der besondere Fokus liegt jedoch auf Familien, deren „soziale und ökonomische Lebensver-
hältnisse auf hohe Benachteiligungen und Belastungen hinweisen“7 und deshalb gezielter und
qualifizierter Unterstützung bedürfen (selektive/sekundäre Prävention). Faktoren wie Migrati-
onshintergrund, problematische Partnerschaft, psychische Erkrankungen oder die Tatsache,
dass ein Elternteil ein oder mehrere Kinder allein groß zieht, können hierfür Anhaltspunkte
geben. Auch Suchterkrankungen der Eltern, die Erfahrung von Misshandlung und Vernachläs-
sigung durch die Herkunftsfamilie oder ein sehr junges Alter der Mütter und Väter können ein
Hinweis auf einen erhöhten Unterstützungsbedarf sein. Die Indikatoren für Benachteiligungen
und Belastungen der Zielgruppe sind vielfältig und können alle Lebensbereiche junger Familien
betreffen. Aus diesem Grund erheben die oben genannten Aspekte keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.
Ziel der Koordinierenden Kinderschutzstellen ist es, auf örtlicher Ebene „förderliche Entwick-
lungsbedingungen für Säuglinge und Kleinkinder zu schaffen und zu stärken, um ihnen von
Anfang an ein möglichst gesundes und gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen“8.
7 STMAS 2017, S. 2
8 NZFH 2016, S.6
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 8Um dies zu gewährleisten, steht zum einen die Stärkung der Erziehungsverantwortung von El- tern mit Kindern von 0-3 Jahren im Fokus. Zum anderen sollen Hemmschwellen gegenüber dem Jugendamt und dessen vielfältigen Aufgabenbereichen abgebaut werden, um die oben genannten Zielgruppen frühzeitiger bzw. schneller zu erreichen und somit Kindeswohlgefähr- dung und Vernachlässigung im frühen Lebensalter zu vermeiden. Ein weiteres Ziel ist die Etablierung eines örtlichen sozialen Frühwarn- und Fördersystems, das von interdisziplinären Kooperationsformen und Netzwerkstrukturen lebt und sowohl der Ver- meidung von Kindeswohlgefährdungen als auch der Information und Unterstützung von Eltern und Interessierten dient. 3.4 Methodische Umsetzung der Ziele Die Arbeit der Koordinierenden Kinderschutzstellen setzt auf zwei Ebenen an. So sollen zum einen Eltern und Familien gestärkt und zum anderen eine regionale Infrastruktur notwendiger Unterstützungssysteme aufgebaut werden. Dies bedeutet konkret, dass Eltern Hilfestellung und Begleitung beim Übergang in die Eltern- schaft und auch bei der Versorgung und Pflege von Säuglingen und Kleinkindern sowie dem Aufbau einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind erhalten. Hierzu werden geeignete Fachkräfte oder Maßnahmen an betroffene Mütter und Väter vermittelt. Ein besonderes Augenmerk in der Arbeit mit Familien liegt auf der Aktivierung und Nutzung der vorhandenen Ressourcen sowie der Selbstbefähigung der beteiligten Klient*innen, ihren eigenen Weg zu finden. Eine zweite Ebene auf der Koordinierende Kinderschutzstellen aktiv werden, bezieht sich auf den Ausbau der regionalen sozialen Infrastruktur. Dieser erfolgt durch regelmäßige Bestands- aufnahme und Aktualisierung aller vorhandenen Angebote, Einrichtungen und Dienste. Hinzu kommt die Ermittlung und regelmäßige Überprüfung des aktuellen Bedarfs an unterstützen- den Maßnahmen für Familien und interprofessioneller Vernetzung. Instrumente des Ausbaus sozialer Infrastruktur sind Runde Tische, Fachtage, Fachkräftetreffen, Treffen mit der Amt- bzw. Sachgebietsleitung sowie die Verzahnung mit der Jugendhilfepla- nung. 3.5 Netzwerkarbeit Netzwerkarbeit umfasst den Aufbau, die Erweiterung, Pflege und Wei- terentwicklung verbindlicher regionaler Netzwerke zur frühzeitigen Un- terstützung von Familien. Durch Bündelung vorhandener Kompetenzen vor Ort und verbindliche sowie nachhaltige interdisziplinäre Zusammen- arbeit soll eine optimale Unterstützung der Zielgruppe ermöglicht wer- den. Die Netzwerkarbeit bedingt die Einbindung möglichst aller Professionen, die sich wesent- lich mit der unter Punkt 3.3 genannten Zielgruppen befassen. Wichtige Netzwerkpartner*in- nen sind daher unter anderem Geburtskliniken, Hebammen und Entbindungspfleger, Gesund- heitsämter, Ärzt*innen, Psychiatrien, Kliniken, Schwangerenberatungsstellen, Erziehungsbera- tungsstellen, Kindertagesstätten, weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Frühför- derstellen, Träger der Grundsicherung, Sucht- und Drogenberatungsstellen, Frauenschutzein- richtungen, Schuldnerberatungsstellen, Polizei und ehrenamtliche Akteur*innen. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 9
Neben der Koordination von geeigneten Hilfeangeboten umfasst die Netzwerkarbeit auch die Schaffung von systematischen Zugängen zur Zielgruppe durch eine verbindliche Zusammenar- beit mit dem Gesundheitswesen. Insbesondere mit Geburtskliniken sollen gemeinsame Instru- mente erarbeitet werden, die eine Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren ermöglichen. Zusätzlich sollen verbindliche Absprachen über das weitere Vorgehen getroffen werden. Um eine bestmögliche Vernetzung zu gewährleisten, ist eine Analyse der Kooperations- partner*innen, ihrer Aufgaben und Angebote, fachlicher Ressourcen und Grenzen sowie der Zielgruppe vor Ort notwendig. Die Analyse umfasst auch die Prüfung der Angebote auf Akzep- tanz und Erreichbarkeit. Insbesondere aufsuchende Hilfeangebote sollen in das Netzwerk ein- gebunden werden. Ziele der Netzwerkarbeit sind unter anderem die Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis und Akzeptanz der einzelnen Netzwerkpartner*innen, gemeinsame Sprachregelungen, trans- parente Übergaberegelungen und verbindliche Standards im präventiven Kinderschutz. Geeignete Mittel, um die Ziele der Netzwerkarbeit zu erreichen, sind etwa die Einrichtung Run- der Tische, Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII oder vergleichbarer (auch virtueller) Kommunikationsplattformen zum fachlichen Austausch aller Berufsgruppen und Institutionen, die Frühe Hilfen anbieten. 3.6 Familienbezogene Arbeit Die Fachkräfte der Koordinierenden Kinderschutzstelle bieten (werdenden) Eltern gemäß § 16 SBG VIII Beratung und Unterstützung im Rahmen eines individuellen Beratungsprozesses. Die Beratung ist ausgerichtet auf die Lebenswelt der Klient*innen und verfolgt sowohl lösungs- als auch ressourcenorientierte Ansätze. Gemeinsam mit den Eltern wird der Unterstützungs- bedarf geklärt und bei Bedarf schnell und unbürokratisch niedrigschwellige, für die Familien kostenfreie Hilfen vermittelt. Sollte dies nicht ausreichen, werden die Eltern motiviert, auch Hilfen nach § 27 ff SGB VIII über den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes (z.B. eine Sozialpädagogische Familienhilfe) anzunehmen. Die Zusammenarbeit der Koordinierenden Kinderschutzstelle mit der Familie erfolgt grund- sätzlich auf freiwilliger Basis, auf Wunsch auch anonym. Die Leistungen der Koordinierenden Kinderschutzstelle sind kostenfrei. Die KoKi-Fachkräfte unterliegen der Schweigepflicht gegen- über anderen Diensten. Diese kann durch eine schriftliche Schweigepflichtentbindung aufge- hoben werden oder endet, sobald Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung bekannt werden. Die Kontaktaufnahme zur Familie kann aufsuchend, in Form eines Hausbesuchs, in den Räum- lichkeiten der Koordinierenden Kinderschutzstelle oder auch in den Räumen von Netzwerk- partner*innen stattfinden. Hauptziel der familienbezogenen Arbeit ist die Stärkung der elterlichen Kompetenz und die nachhaltige Aktivierung von familialen Ressourcen, um Kindern bestmögliche Bedingungen für deren Aufwachsen zu schaffen. Nicht zu den Aufgaben der Koordinierenden Kinderschutzstelle gehört die Bearbeitung von Fällen bei Kindeswohlgefährdung, da sie unterhalb der Eingriffsschwelle des § 8a SGB VIII agiert. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 10
4 KoKi in der Stadt Landshut
Vor diesem Hintergrund beschloss der Jugendhilfeausschuss der Stadt Landshut in seiner Sit-
zung vom 18.07.2009 die Einrichtung einer Koordinierenden Kinderschutzstelle.
Auf der Grundlage folgender regionaler Ausgangsbedingungen wird das KoKi-Konzept in der
Stadt Landshut umgesetzt.
4.1 Ausgangslage
Die kreisfreie Stadt Landshut umfasst eine Fläche von 6.581,25 ha und hat insgesamt 73.297
Einwohner, die in den 10 Stadtteilen leben (Stand 31.12.2019).
Der Abbildung lässt sich entnehmen, dass die Einwohnerzahl der Stadt Landshut kontinuierlich
ansteigt. Sie ist von 2010 bis 2019 um 10.039 Personen gewachsen. Dies ist unter anderem auf
die steigende Anzahl von Zuzügen zurückzuführen. Während die Zahlen der Zuzüge hier bei
deutschen Personen schwanken, steigt die Anzahl der ausländischen Personen stetig. Auch die
Zahl der Neugeborenen ist 2018 im Vergleich zum Jahr 2014 um 81 Kinder gestiegen.
Altersverteilung der
Bevölkerung
3,50%
12,70%
43,70%
20,10%
20,00%
0-3J. 4-18J. 18 - 39 J.
40 - 59 J. 60 J. und älter
(Quelle: Stadt Landshut (2019),Statistischer Jahresbericht 2018, S.31)
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 11Betrachtet man die Altersverteilung der Bevölkerung, liegt der Anteil der 0-3 Jährigen bei 3,5
% und entspricht ca. 2500 Kindern.
Die Anzahl der begleiteten Familien durch die Koordinierende Kinderschutzstelle steigt stetig
an. So hat das Angebot 2014 63 Familien erreicht und im Jahr 2018 bereits 108 Familien. Pa-
rallel dazu stieg auch der Einsatz von Familienkinderkrankenschwestern von 13 (2014) auf 46
(2018).
Fallzahlen KoKi GFB Einsätze
108
106
98
83
63
46
44
30
19
13
2014 2015 2016 2017 2018
4.2 Rahmenbedingungen
Organisatorische Eingliederung im Stadtjugendamt Landshut
Die Koordinierende Kinderschutzstelle ist ein präventiver Fachdienst im Sachgebiet Soziale
Dienste des Stadtjugendamtes Landshut. Die fachliche Leitung der Koordinierenden Kinder-
schutzstelle obliegt der Sachgebietsleitung des Sozialen Dienstes. Die Gesamtleitung liegt bei
der Jugendamtsleitung bzw. der Stellvertretung. Eine enge Zusammenarbeit mit allen Abtei-
lungen des Stadtjugendamtes ist Voraussetzung zur Erfüllung der Aufgaben der Koordinieren-
den Kinderschutzstelle.
Personelle und räumliche Ausstattung
2009 gestartet mit einer 75%-Stelle, ist die KoKi seit 2018 mittlerweile mit drei Fachkräften
(insg. 2,0 Stellen) besetzt. Das Büro der Koordinierenden Kinderschutzstelle befindet sich
räumlich abgegrenzt vom Sozialdienst des Jugendamtes im städtischen Behördengebäude,
Rathaus II. Den Fachkräften steht ein zeitgemäß ausgestatteter Arbeitsplatz zur Verfügung. Des
Weiteren können die vorhandenen Ressourcen innerhalb des Amtes genutzt werden.
Qualifikation der Fachkräfte
Die Fachkräfte verfügen über die notwendigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten auf sozialpä-
dagogischem und psychologischem Gebiet sowie über einschlägige Rechtskenntnisse. Neben
einer langjährigen Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit bringen
zwei der Fachkräfte eine therapeutische Zusatzausbildung mit.
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 12Erreichbarkeit Die Fachkräfte der Koordinierenden Kinderschutzstelle sind während der allgemeinen Dienst- zeiten des Stadtjugendamtes persönlich oder per Telefon, Fax, Postweg oder E-Mail zu errei- chen. Ein Beratungskontakt ist grundsätzlich ohne Voranmeldung möglich, eine Terminverein- barung erleichtert jedoch eine bessere Planung. Da die Arbeit mit den Familien schwerpunkt- mäßig aufsuchend stattfindet, ist das Büro der Koordinierenden Kinderschutzstelle nicht im- mer besetzt. Die Erreichbarkeit ist jedoch durch den Anrufbeantworter und eine Verwaltungs- fachkraft des Sachgebiets Soziale Dienste sichergestellt. Bei erwünschter Kontaktaufnahme er- folgt i.d.R. ein Rückruf spätestens am nächsten Arbeitstag. Im Falle des Urlaubs befindet sich auf dem Anrufbeantworter ein entsprechender Text mit Abwesenheitszeiten und Rufnummer der Vertretung. Die Fachkräfte der Koordinierenden Kinderschutzstelle vertreten sich gegenseitig, so dass auch in Urlaubszeiten immer eine Fachkraft für die Familien und die Netzwerkpartner*innen er- reichbar ist. Um eine möglichst rasche Übermittlung von Beratungs- und/oder Unterstützungsbedarfen von Familien an die KoKi zu gewährleisten, wurde ein Formular „Beratungsanfrage“ (siehe An- hang Seite 44) entwickelt und den Einrichtungen vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Netzwerkpartner*innen füllen das Formular zusammen mit den Eltern aus und faxen es an die KoKi weiter. Auf diesem Wege ist es den Fachkräften der KoKi möglich, aktiv Kontakt mit den Eltern aufzunehmen. Die Fachkräfte der Koordinierenden Kinderschutzstelle sind wie folgt zu erreichen: Stilla Waltl Tel.: 0871/88 – 2336 Email: Stilla.Waltl@landshut.de Christina Meister Tel: 0871 / 88 – 2348 Email: Christina.Meister@landshut.de Sandra Heyer Tel: 0871 / 88 – 2347 Email: Sandra.Heyer@landshut.de 4.3 Datenschutz In allen professionellen Kontexten der Arbeit im sozialen Bereich und im Gesundheitswesen ist der vertrauliche Umgang mit den personenbezogenen Daten die wichtigste Basis der Zu- sammenarbeit zwischen Klient*in und professionelle*m Helfer*in. Mit der Vernetzung in den Frühen Hilfen entstehen neue Schnittstellen. Damit steigt auch der Bedarf nach Informationen und Austausch der im Netzwerk Tätigen. Dabei ist für alle Professi- onen zu beachten, dass es spezifische Voraussetzungen für die Erhebung und die Weitergabe personenbezogener Daten gibt. Diese Voraussetzungen sind für die Koordinierende Kinder- schutzstelle und den mit der KoKi vernetzten Berufsgruppen und Institutionen teilweise unter- schiedlich und können deshalb in der Kooperation zu unterschiedlichen Herangehens- und Sichtweisen führen. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 13
Für mehr Qualität, Transparenz und Sicherheit hat der Gesetzgeber die neue Europäische Da-
tenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) eingeführt. Diese trat am 25.05.2018 in Kraft und
hat unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit in der Jugend- und in der Gesundheitshilfe. Die
Regelungen zum Sozialdatenschutz wurden vom Gesetzgeber bereits angepasst. Die Grund-
prinzipien haben sich dabei jedoch nicht geändert.
Im Einzelfall muss die Datenerhebung und Datenverarbeitung für die Erfüllung der jeweiligen
Aufgabe geeignet, erforderlich und angemessen sein (Zweckbindungsprinzip). Es gilt der
Grundsatz „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“ (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz). Im Sinne
einer guten Zusammenarbeit zwischen Klient*in und Helfer*in sollte außerdem mit größtmög-
licher Transparenz gearbeitet werden. Dies bedeutet, dass der*die Klient*in genau darüber
informiert werden soll, wozu die Daten erhoben werden. Die Beziehung zwischen Helfer*in
und Klient*in genießt besonderen Vertrauensschutz und basiert auf einer Öffnung durch
den*die Klient*in in einem besonders sensiblen Bereich.
Im Folgenden werden die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen der Datenerhebung für die ver-
schiedenen Professionen aufgeführt:
Für alle Professionen gilt die EU-DSGVO.
Für die Jugendämter sind das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und das SGB X (So-
zialdatenschutz) entscheidend. Relevant sind die §§ 61-65 und § 68 SGB VIII sowie die §§
67, 67a, 67b, 67c, 67d und 69 SBG X.
In der Gesundheitshilfe, z.B. bei Ärzt*innen, Hebammen oder Frühförderstellen sowie in
der Schwangeren(konflikt)beratung werden Behandlungs- oder Hilfeverträge geschlossen.
Diese müssen aber nicht explizit in schriftlicher Form sein.
Gesundheitsämter arbeiten mit den Gesetzen über den öffentlichen Gesundheitsdienst.
Sollte zum Schutz des Kindes eine Informationsweitergabe, z.B. an den ASD, nötig sein und die
Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, dem zuzustimmen, bietet das Gesetz Fachkräften
trotzdem die Möglichkeit, Daten weiterzugeben. Diese Einschätzung kann mit einer sogenann-
ten „insoweit erfahrenen Fachkraft“ getroffen werden. Auch hier gilt - sofern der wirksame
Schutz eines Kindes dem nicht entgegensteht - das Transparenzgebot gegenüber dem* der
Klient*in.
Deshalb sollte nach dem Motto „vielleicht gegen den Willen, aber nicht ohne Wissen“ des Be-
troffenen gehandelt werden. Die Glaubwürdigkeit der Arbeits- und Vertrauensbeziehung wird
dadurch gewahrt.
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen der Datenweitergabe für die verschiedenen Profes-
sionen:
Zunächst gilt professionsübergreifend die EU-DSGVO.
Die Koordinierende Kinderschutzstelle unterliegt zudem als Dienst des Jugendamtes dem
§ 64 SGB VIII und § 65 SGB VIII sowie dem § 8a SBG VIII.
Für viele Professionen im Netzwerk regelt seit Januar 2012 das Bundeskinderschutzgesetz
insbesondere der Art. 1 Gesetz zur Kooperation und Kommunikation im Kinderschutz (KKG)
und dem § 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei
Kindeswohlgefährdung, die Datenweitergabe in kritischen Fällen.
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 14 Für die im BKiSchG nicht genannten Professionen, z.B. Erzieher*innen gelten die oben ge-
nannten Regelungen des SGB VIII, wenn ein Vertrag als Zuwendungsempfänger von Gel-
dern der öffentlichen Jugendhilfe, z.B. im Rahmen von Kindergartenbeiträgen oder ähnli-
ches besteht.
Für alle Professionen gilt nach wie vor im Zweifelsfall § 34 StGB Rechtfertigender Notstand.
5 Netzwerkarbeit
In Landshut konnte die Koordinierende Kinderschutzstelle bereits auf
gute Netzwerkstrukturen im Bereich des Kinderschutzes sowie der Frü-
hen Hilfen durch die Arbeitsgemeinschaft (AG) Kindeswohl zurückgreifen
und darauf aufbauen. Mit der Zielsetzung „Ein Kind braucht ein ganzes
Dorf zum Wachsen“ (afrikanisches Sprichwort) gründete sich im Mai 2007
die AG Kindeswohl unter der Leitung von Herrn Dr. Fels und Frau Manjgo (Chefarzt bzw. Ober-
ärztin der Kinderchirurgie des Kinderkrankenhauses St. Marien in Landshut). Viele Fachkräfte
der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe, der Gesundhilfe und weiterer Einrichtungen /Institutio-
nen sind in dieser Runde vertreten, die seitdem an der Verbesserung des regionalen Kinder-
schutzes arbeiten sowie die Vernetzung im Bereich der Frühen Hilfen weiter entwickeln. Seit
2019 leitet eine Fachkraft der Koordinierenden Kinderschutzstelle die AG Kindeswohl.
Der Schwerpunkt der Koordinierenden Kinderschutzstelle Stadt Landshut im Bereich der Ver-
netzung lag deshalb von Beginn an bei der Pflege bzw. Weiterentwicklung der vorhandenen
Netzwerkstrukturen sowie in der bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Unterstützungsan-
geboten für Familien gemeinsam mit Netzwerkpartner*innen.
Folgende interdisziplinäre Netzwerkstrukturen haben sich in den letzten Jahren entwickelt:
Interdisziplinäre Netzwerke unter der Leitung der KoKi:
Runder Tisch „Frühe Hilfen“
Seit 2015 findet regelmäßig zweimal jährlich der Runde Tisch „Frühe Hil-
fen“ statt. Es ist ein Zusammenschluss von Fachkräften öffentlicher und
privater Träger, die mit (werdenden) Eltern rund um die Geburt und in den
ersten drei Lebensjahren des Kindes arbeiten. Im Mittelpunkt des Runden Tisches stehen der
Austausch von Informationen, das Vorstellen von regionalen Angeboten, die Bearbeitung von
themenbezogenen Fragestellungen, Fallbesprechungen sowie die Weiterentwicklung der regi-
onalen Angebotslandschaft.
Ziel ist die Entwicklung einer intensiven Vernetzung der einzelnen Beteiligten zum optimierten
Handeln für Familien und deren Kinder.
Netzwerk Postpartale Depression
Initiiert von der KoKi wurde im Januar 2012 das Netzwerk PPD gegründet. Vertreter*innen
verschiedener Fachdisziplinen aus Landshut (Bezirkskrankenhaus, Klinikum, niedergelassene
Gynäkolog*innen und Kinderärzt*innen, Hebammen, Kinderkrankenhaus, Sozialpädiatrisches
Zentrum, Schwangerenberatungsstellen, Erziehungsberatungsstelle, Familienbildungsträger
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 15etc.) treffen sich vierteljährlich zum fachlichen Austausch. Die Arbeit im Netzwerk soll dazu dienen, dass betroffene Mütter/Familien schnell und gezielt Hilfe in ihrer Situation finden, pro- fessionelle Fachkräfte auf themenspezifische Information/Fortbildung zurückgreifen können und die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert wird. AK Kinder und Jugendliche Der AK ist Teil des Regionalen Steuerungsverbundes (RSV). Der RSV ist ein Gremium, in dem alle in der psychosozialen Versorgung beteiligten Personen und Institutionen aus Stadt und Landkreis Landshut vertreten sind. Aufgabe des RSV ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Belange psychisch kranker und behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener so- wie die Verbesserung der Versorgungslandschaft dieser Zielgruppe. AK Kinder psychisch erkrankter Eltern Der interdisziplinäre Arbeitskreis setzt sich seit 2013 für die Situation von Kindern psychisch kranker Eltern ein. Die Auseinandersetzung mit dem besonderen Hilfebedarf von Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil ist ein gemeinsames Anliegen der teilnehmenden Fachkräfte aus Gesundheitshilfe und Jugendhilfe. Der AK trifft sich vierteljährlich. Interdisziplinäre Netzwerke unter der Teilnahme der KoKi: Die Mitarbeiterinnen der Koordinierenden Kinderschutzstelle sind regelmäßig im Rahmen der Vernetzungsarbeit in folgenden interdisziplinären Arbeitskreisen vertreten: Runder Tisch LOG = Runder Tisch Landshuter Offensive gegen häusliche Gewalt Die Landshuter Offensive gegen häusliche Gewalt – LOG ist ein Zusammenschluss von Fach- gremien, die Betroffene von häuslicher Gewalt unterstützen und begleiten. Eine strukturierte Vernetzung von Intervention, Hilfe und Prävention sind ein wesentlicher Bestandteil der Be- kämpfung von häuslicher Gewalt, von der Kinder und Jugendliche in erheblicher Weise mit entsprechenden Folgen für ihre Entwicklung betroffen sind. AK Industrieviertel Im AK Industrieviertel sind professionelle Vertreter*innen aus mehreren Landshuter Stadttei- len anwesend, mit dem Ziel gemeinsame Bedarfe herauszuarbeiten und dafür stadtteilüber- greifende Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen. AK Stadtteilarbeit In diesem Arbeitskreis sind alle Einrichtungen aus einem sozialen Brennpunktgebiet in Lands- hut vertreten mit dem Ziel, die Lebenssituation der dortigen Familien zu verbessern. Armutskonferenz Dieser interdisziplinäre Arbeitskreis setzt sich aus Mitarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen aus Beratungsdiensten der regionalen Wohlfahrtsverbände zusammen. Er verfolgt das Ziel, so- zial benachteilige Menschen in Stadt und Landkreis Landshut bei der Verbesserung ihrer Le- bensbedingungen zu unterstützen. Themen sind dabei beispielsweise die Lage am sozialen Wohnungsmarkt in und um Landshut, gesellschaftliche Teilhabe für einkommensschwache Menschen oder Armut bei Familien. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 16
AG „gesund aufwachsen“
Diese Arbeitsgemeinschaft wird von der Vertreterin der Gesundheitsregion Plus für Stadt und
Landkreis Landshut initiiert. Ziel ist es im Bereich der Gesundheit von Kindern- und Jugendli-
chen neue Netzwerke zu schaffen bzw. bestehende weiter zu verbessern und bedarfsgerechte
Angebote für diese Zielgruppe zu entwickeln.
Veranstaltungen/Vorträge/Workshops im und mit dem Netzwerk
Seit Implementierung der KoKi wurden folgende Veranstaltungen von der Koordinierenden
Kinderschutzstelle initiiert bzw. in Kooperation mit/ohne Netzwerkpartner*innen durchge-
führt:
2011 Fortbildung zum Thema Postpartale Depression für Hebammen in Stadt und Land-
kreis Landshut
2012 Vortrag „Regionales Netzwerk für Kinder psychisch erkrankter Eltern“ beim
Hebammenfachtag
2013 Fortbildung „Belastungen in Familien wahrnehmen und vorbeugen“ für Mitarbei-
ter*innen von Kindertageseinrichtungen
2013 Fortbildung „Lebensraum Schule - Schule ohne Mobbing“ für Lehrer*innen an
Grundschulen
2013 Fortbildung zum Thema Kinder psychisch kranker Eltern: „Psychisch erkrankte El-
tern und ihre Kinder - ein Thema in Jugendhilfe und Psychiatrie“
2014 Fachtagung zum Thema Borderline-Erkrankung: „Borderline und Elternsein“
2015 Vortrag „Was ist bloß los mit meinem Kind?“ im Rahmen der Jubiläums 40 Jahre
Psychiatrie-Enquete
2015 Vortrag „Postpartale Depression“ für Mitarbeiter*innen der Geburtsstation
2015 Vortrag über das Konzept der Koordinierenden Kinderschutzstellen in Bayern beim
Jahrestreffen der Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz in der Medizin
2016 Fortbildung „Präventiver Kinderschutz“ für angehende Krankenschwestern/-Pfle-
ger an der Krankenpflegeschule Landshut
2016 Gastvorlesungen zum Thema „Präventiver Kinderschutz“ im Studiengang Soziale
2017 Arbeit an der Hochschule Landshut
2018
2019
2016 Fachtagung zum Thema Sucht: „Hauptsache es dreht sich – Familien und ihre Helfer
im
Suchtkarussell“
2017 Vortrag zum Thema Postpartale Depression für EKP-Leiterinnen in Stadt und Land-
kreis Landshut
2018 Fortbildung „Kinder psychisch kranker Eltern – Fallstricke in der Kommunikation“
für Lehrer*innen an Grundschulen
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 172019 Vortrag im Rahmen des Borderline Trialogs (Diakonie Landshut) zum Thema „Psy-
chische Erkrankung und Elternschaft“
6 Familienbezogene Arbeit
Familien oder Alleinerziehende mit Kindern von 0 - 3 Jahren können auf unterschiedlichen
Wegen in Kontakt mit der Koordinierenden Kinderschutzstelle treten. Die Vermittlung erfolgt
entweder über andere Einrichtungen und Dienste, die einen Unterstützungsbedarf bei den El-
tern sehen oder die Familien wenden sich selbst direkt an die Koordinierende Kinderschutz-
stelle mit dem Wunsch nach Beratung und Unterstützung.
Die Fachkräfte der Koordinierenden Kinderschutzstelle haben in der Zusammenarbeit mit Fa-
milien verschiedene Aufgaben. Zum einen benötigen Klient*innen zuverlässige Informationen,
die je nach Lebenssituation gesundheitliche, pflegerische, rechtliche, psychosoziale oder ent-
wicklungspsychologische Fragestellungen betreffen. Zum anderen wird im Rahmen der Bera-
tung ein Clearing mit den Familien durchgeführt, das den Fokus nicht nur auf Bereiche legt,
in denen Hilfestellung benötigt wird, sondern das Ressourcen aus allen Lebensfeldern auf-
deckt und berücksichtigt.
Die Beratung erfolgt auf freiwilliger Basis und findet - je nach Bedarf und Wunsch - im Büro
der Koordinierenden Kinderschutzstelle, in einer anderen Beratungsstelle/Einrichtung oder zu-
hause beim Klienten statt. Die Dauer der Beratung orientiert sich an der individuellen Situation
der Klient*innen. Entweder kann die Koordinierende Kinderschutzstelle den Bedarf der Familie
mit ihrem eigenen Unterstützungsangebot decken oder es werden geeignete Netzwerk-
partner*innen aus dem Netzwerk der Stadt Landshut miteinbezogen bzw. es wird an diese
weitervermittelt.
6.1 Einsatz von Fachkräften im Rahmen der Frühen Hilfen
Gemäß § 16 SGB VIII (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) werden Gesund-
heitsorientierte Familienbegleiterinnen (GFB) eingesetzt, wenn sich Eltern in ihrer neuen Rolle
verunsichert und überfordert fühlen oder in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Bei
Bedarf kann der Einsatz auch schon während der Schwangerschaft erfolgen.
Der Umfang und die Dauer der Maßnahme sind abhängig vom Förderbedarf der Familie und
werden prozessorientiert festgelegt. Die Zielsetzungen der Hilfeform werden mit den Eltern
gemeinsam festgelegt. Für den Einsatz der Maßnahme wird eine schriftliche Vereinbarung mit
den Eltern geschlossen. Die Fallsteuerung liegt bei der Koordinierenden Kinderschutzstelle.
Das Angebot wird von erfahrenen Fachkräften aus dem Gesundheitssystem mit Zusatzqualifi-
kation zur Familienkinderschwester in einem aufsuchenden Setting durchgeführt und ist für
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 18die Eltern kostenfrei. Neben der Förderung der Gesundheit von Mutter und Kind wird auch die familiäre Situation in die Beratung miteinbezogen. Die Familienkinderkrankenschwestern begleiten die Mutter / die Eltern in ihrem Familienalltag und unterstützen bei folgenden Themen wie z.B. Stillen, Säuglingspflege, Schrei-, Schlaf- und Fütterproblemen, motorischer-, sprachlicher- und psychischer Entwicklung, lernen, die „Spra- che“ des Babys zu verstehen. Ziel der Fachkräfte ist es, Gesundheits- und Entwicklungsrisiken beim Kind frühzeitig zu erken- nen, die Mutter-Kind-Bindung zu fördern, die elterliche Kompetenz zu stärken - als Basis für ein gesundes Aufwachsen des Kindes - sowie konstruktiv mit Fachkräften anderer Einrichtun- gen im Sinne der Familie zu kooperieren. Gestartet wurde in der Stadt Landshut im September 2012 mit einer Fachkraft. Mittlerweile gibt es ein Team von fünf Familienkinderkrankenschwestern. In regelmäßigen Abständen fin- den Teamtreffen mit den KoKi-Fachkräften statt, die der Information, dem Austausch sowie der Klärung organisatorischer Themen dienen. Zur Reflexion ihrer Arbeit nehmen die Famili- enkinderkrankenschwestern an regelmäßig stattfindenden Supervisionssitzungen teil. 6.2 Kooperation mit Netzwerkpartner*innen im Einzelfall Je nach Ausgangslage und Ergebnis des Clearingverfahrens nimmt die einzelfallbezogene Ko- operation einen großen Stellenwert in der Arbeit mit Familien, Alleinerziehenden und Schwangeren ein. Die Fachkräfte der KoKi unterliegen grundsätzlich der Schweigepflicht nach § 203 StGB und sind somit verpflichtet, die ihr anvertrauten Daten und Informationen vertraulich zu behan- deln. Zur Kooperation und Datenweitergabe im Einzelfall wird eine Schweigepflichtentbin- dung, die von den Klient*innen unterzeichnet werden muss, benötigt. Hier werden alle an der Zusammenarbeit beteiligten Einrichtungen, Dienste und Einzelpersonen aufgelistet. Die KoKi ist zwar ein Teil des Jugendamtes, unterliegt aber dennoch gegenüber anderen Diens- ten des Jugendamtes der Schweigepflicht. Auch hier wird das Einverständnis der Klient*innen benötigt, sollte eine Zusammenarbeit vorgesehen sein. Nur im Falle der Einschätzung einer bestehenden oder drohenden Kindeswohlgefährdung durch die Fachkraft der KoKi kann auf die Entbindung der Schweigepflicht bei Weitergabe der notwendigen Informationen und Da- ten verzichtet werden (§ 34 StGB: Rechtfertigender Notstand). In diesem Fall gilt dennoch im- mer der Grundsatz, dass Eltern und Betroffene, wenn sinnvoll und möglich, über diesen Schritt und die hierfür vorliegenden Gründe informiert werden sollen. Das Hinzuziehen des ASD er- folgt in Fällen des § 8a SGB VIII also gegebenenfalls gegen den Willen der Eltern, aber in der Regel nie ohne deren Wissen. Die einzelfallbezogene Kooperation erfolgt mit allen für die Problemlösung notwendigen und geeigneten Stellen aus dem bestehenden Netzwerk der Stadt Landshut. Hierzu gehören bei- spielsweise Ärzt*innen und Beratungsstellen, aber auch Kindertagesstätten und Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter. Weitere Informationen und Voraussetzungen zur Zusammenarbeit mit anderen Verantwor- tungsbereichen aus dem Jugendamt sind unter 6.4 Schnittstellenmanagement im Jugendamt zu finden. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 19
6.3 Beratung nach §§ 8b SGB VIII, 4 KKG
Seit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes haben neben Fachkräften, die in der Kinder-
und Jugendhilfe tätig sind, auch Fachkräfte aus weiteren Berufsgruppen einen Anspruch auf
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft bei einem Verdacht auf eine vorliegende
Kindeswohlgefährdung. Hierzu gehören insbesondere Schulen sowie Berufsgruppen des So-
zial- und Gesundheitswesens.
In der Stadt Landshut übernehmen diese Tätigkeit sowohl die Fachkräfte des Allgemeinen
Dienstes und für die 0 – 3 Jährigen die Fachkräfte der KoKi.
Die Aufgabe der insoweit erfahrenen Fachkraft ist in ein dreistufiges Verfahren eingebettet,
das die Befugnis der bereits genannten Berufsgruppen zur Datenweitergabe an das Jugend-
amt regelt:
Verpflichtung zur Erörterung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung mit Eltern, Kindern/Jugendlichen (§ 4 Abs. 1
KKG)
Anspruch auf Beratung zur Gefährdungseinschätzung durch eine in-
soweit erfahrene Fachkraft (IseF, § 4 Abs. 2 KKG)
Befugnis zur Datenweitergabe an das Jugendamt, wenn ein Tätigwer-
den für dringend erforderlich erachtet wird und eine Gefährdung auf
andere Weise nicht abgewendet werden kann (§ 4 Abs. 3 KKG)
6.4 Schnittstellenmanagement
Neben der Netzwerkarbeit als allgemeine, strukturelle Zusammenarbeit hat die KoKi Eltern
entsprechend ihrem individuellen Bedarf innerhalb des Jugendamtes oder an geeignete Netz-
werkpartner*innen im Sinne einer Navigationsfunktion zu vermitteln. Auf Wunsch unterstüt-
zen und begleiten die KoKi-Fachkräfte auch den Übergang an der Schnittstelle zwischen zwei
Netzwerkpartner*innen. Bei der Zusammenarbeit im Einzelfall sind insbesondere die Regelun-
gen des Sozialdatenschutzes zu beachten.
Im Folgenden werden die verschiedenen Schnittstellen der Zusammenarbeit zwischen der
KoKi und weiteren Fachdiensten im Stadtjugendamt erläutert.
6.4.1 Schnittstellenmanagement zwischen Koordinierender Kinderschutzstelle (KoKi) und
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
Auch wenn die KoKi im Jugendamt angesiedelt ist, gibt es zwischen dem Aufgabengebiet des
ASD und den Arbeitsweisen der KoKi eine klare Abgrenzung.
Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 20Die Fachkräfte beider Aufgabengebiete haben im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestim- mungen keine Möglichkeit, gegenseitig die Akten bzw. Daten von Familien einzusehen oder abzugleichen. Die Arbeit der KoKi mit den Familien unterliegt der Schweigepflicht, d.h. personenbezogene Daten dürfen nur mit Einverständnis der Familie übermittelt werden. Eine Ausnahme stellt le- diglich der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung oder eine akute Kindeswohlgefährdung dar. KoKi ASD Stellt sich im Beratungsverlauf mit der Familie heraus, dass die niedrigschwellige Unterstüt- zung durch die KoKi nicht ausreichend und ein höherer Bedarf konkret erkennbar ist, werden die Eltern umfassend über die Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung – HzE (§ 27 ff. SGB VIII) oder Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII) informiert. In Absprache mit den Eltern wird ein Erstkontakt mit der zuständigen ASD-Fachkraft herge- stellt. Vor dem Gespräch erhält die zuständige ASD-Fachkraft ein schriftliches Übergabeproto- koll, in dem die aktuelle familiäre Situation und der Hilfebedarf beschrieben sind. Bestätigt sich in diesem Erstkontakt der Hilfebedarf an einer HzE-Maßnahme, wechselt der „Fall“ gänzlich in den Verantwortungsbereich des ASD. Ergeben sich im Verlauf einer Begleitung durch die KoKi bei einer Familie Anhaltspunkte für eine drohende Kindeswohlgefährdung oder liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, können sich die Fachkräfte der KoKi bzgl. des weiteren Vorgehens anonym mit den Fachkräften des ASD beraten und hierzu die Teamstrukturen nutzen. Ist die Familie mit der Übergabe an den ASD nicht einverstanden bzw. wird vor der Übergabe der Kontakt zur KoKi abgebrochen, wird der Vorgang gemäß interner Dienstanweisung zum Schutzauftrag nach §8a SGB VIII an den ASD gemeldet. ASD KoKi Stellt der ASD im Verlauf eines Beratungsgespräches bei einer Familie den Bedarf einer Unter- stützung im Rahmen der Frühen Hilfen fest und wurde im Vorfeld eine Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen, kann die Kontaktaufnahme zur KoKi empfohlen werden. Die Inanspruch- nahme der Hilfen und Angebote der KoKi bleibt dabei immer in der Verantwortung der Eltern. Es erfolgt keine Rückmeldung an den ASD, ob der Kontakt zustande gekommen ist bzw. über den weiteren Verlauf (z.B. über in Anspruch genommene Hilfen, über den Abbruch der Bera- tung), außer die Eltern stimmen dem in einer schriftlichen Schweigepflichtsentbindung zu. Nach der Fallübernahme liegt die Fallverantwortlichkeit bei der KoKi. ASD + KoKi Ergibt sich im Laufe der Betreuung einer Familie (durch den ASD oder der KoKi) ein erweiterter Bedarf, sodass eine Sozialpädagogische Familienhilfe und eine Gesundheitsorientierte Famili- enberatung zur Unterstützung notwendig sind, kann ein sog. „Tandem-Einsatz“ erfolgen. Die Fachkräfte beider Hilfeformen arbeiten gleichberechtigt, aber immer in fachlicher Abstim- mung mit jeweils eigenen Arbeitsaufträgen in der Familie. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 21
Sofern erforderlich kann die GFB auch im Rahmen eines § 8a Schutzkonzeptes als Tandem-Part eingesetzt werden. Zwei Fachkräfte aus dem GFB-Team der Koordinierenden Kinderschutz- stelle stehen für diese Aufgabe zur Verfügung. Die Fallführung/-zuständigkeit liegt dabei immer in den Händen des ASD. Die KoKi-Fachkraft ist mit ihrer fachlichen Expertise im Bereich der frühen Kindheit in beratender Funktion sowohl für die ASD-Fachkraft als auch für die GFB ebenfalls im Fall tätig. Dazu wurde ein entsprechendes Schnittstellenpapier für den jugendamtsinternen Gebrauch entwickelt. 6.4.2 Schnittstellenmanagement zu anderen Fachbereichen des Jugendamtes Eltern können bei Bedarf und Interesse an die im Anschluss aufgeführten Dienste weiterver- mittelt werden und diese auch umgekehrt an die KoKi. Die Kontaktaufnahme und ggf. die Da- tenübermittlung geschieht auf Wunsch der Eltern. Ob die Eltern die Dienste in Anspruch neh- men, entscheiden sie selbst. Pflegekinderdienst / Adoptionsvermittlung Wird ein Kind von 0 – 3 Jahren in eine Pflege-/Adoptivfamilie vermittelt, können Pflege-/Adop- tiveltern bei Bedarf standardmäßig die Unterstützung durch eine GFB erhalten. Hier handelt es sich lediglich um eine vorübergehende Form der Unterstützung in den ersten Wochen nach der Inpflegegabe. Vormundschaften / Beistandschaften Insbesondere in Bezug auf die bereits benannten risikobehafteten Lebenslagen, in denen sich Klient*innen der KoKi oft befinden, wird auch die Vernetzung mit dem Aufgabengebiet der Vormundschaften und Beistandschaften notwendig. Aufgabengebiet und Angebot der KoKi müssen den zuständigen Fachkräften bekannt sein, da- mit sie ihren Klient*innen einen Zugang zum Netzwerk Frühe Kindheit ermöglichen können. Die Zusammenarbeit erfolgt also nicht nur netzwerkbezogen, sondern in der Regel vor allem einzelfallbezogen. Kindertagespflege Die Fachkräfte aus dem Bereich der Kindertagespflege dienen als Ansprechpartner*innen so- wohl für die KoKi selbst als auch für deren Klient*innen. Die Organisation einer flexiblen Kin- derbetreuung stellt insbesondere berufstätige Eltern oft vor eine Herausforderung und erfor- dert Beratung über unterschiedliche Möglichkeiten im Sozialraum. Wirtschaftliche Jugendhilfe Die Wirtschaftliche Jugendhilfe unterstützt die Fachkräfte der KoKi in Fragestellungen, die den finanziellen Bereich betreffen. Dies beinhaltet vor allem die Beantragung finanzieller Mittel sowie deren ordnungsgemäße Verwaltung und Abrechnung. Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption der Stadt Landshut 22
Sie können auch lesen