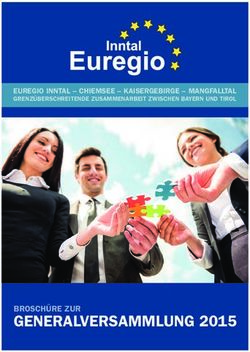Governance und Regionalentwicklung in Großschutzgebieten der Schweiz und Österreichs
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Raumforsch Raumordn (2016) 74:569–583
DOI 10.1007/s13147-016-0451-2
WISSENSCHAFTLICHER BEITRAG
Governance und Regionalentwicklung in Großschutzgebieten der
Schweiz und Österreichs
Marco Pütz1 · Hubert Job2
Eingegangen: 12. Januar 2016 / Angenommen: 17. Oktober 2016 / Online publiziert: 28. Oktober 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016
Zusammenfassung Der Beitrag untersucht Großschutzge- Governance and Regional Development in
biete aus der Perspektive der raumbezogenen Governance- Protected Areas of Switzerland and Austria
Forschung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Gover-
nance-Regime ausgewählter Großschutzgebiete in Öster- Abstract The article investigates large protected areas from
reich und der Schweiz. Es wird eruiert, durch welche Merk- a governance research perspective. The analytical focus is
male und Strukturen die Governance-Regime der Groß- on regional governance regimes of selected large protected
schutzgebiete charakterisiert sind und wie dabei die Zusam- areas in Austria and Switzerland. The analysis character-
menarbeit der Akteure beurteilt wird. Der Beitrag verbessert izes structures and patterns of regional governance regimes.
so zum einen das Verständnis der regionalen Governance Also, the kind and quality of cooperation between the actors
von Großschutzgebieten. Zum anderen werden mithilfe der is assessed. The article contributes to a deeper understand-
Ergebnisse Empfehlungen für ein effizientes Management ing of the regional governance of protected areas. Draw-
und eine bessere Organisation von Großschutzgebieten ge- ing from the empirical findings some recommendations are
geben. made for a more efficient management and organization of
large protected areas.
Schlüsselwörter Regionale Governance · Governance-
Regime · Regionalentwicklung · Großschutzgebiet · Keywords Regional Governance · Governance Regime ·
Regionaler Naturpark · Biosphärenreservat Regional Development · Large Protected Area · Regional
Nature Park · Biosphere Reserve
1 Einleitung
Der Beitrag untersucht Großschutzgebiete aus der Pers-
pektive der raumbezogenen Governance-Forschung. Groß-
schutzgebiete sind aus verschiedenen Gründen interessante
Dr. Marco Pütz Objekte für die Governance-Forschung. Sie sind Teil ei-
marco.puetz@wsl.ch nes Mehrebenensystems, das durch Regelungsstrukturen
Prof. Dr. Hubert Job auf verschiedenen Ebenen (supranational, national, regio-
hubert.job@uni-wuerzburg.de nal, lokal) und durch Top-down- und Bottom-up-Prozesse
1
gekennzeichnet sein kann (vertikale Koordination). Groß-
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Eidgenössische
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL,
schutzgebiete verfolgen unterschiedliche Fachziele und
Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf, Schweiz erfordern die Zusammenarbeit von Akteuren verschiedener
2 Politikfelder, z. B. Natur- und Landschaftsschutz, Land-
Institut für Geographie und Geologie,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Am und Forstwirtschaft und räumliche Planung (horizontale
Hubland, 97074 Würzburg, Deutschland Koordination). Außerdem zeichnen sich Großschutzgebiete
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTC570 M. Pütz, H. Job
dadurch aus, dass staatliche (v. a. Verwaltung) und halb- in der Schweiz. Es wird eruiert, durch welche Merkmale
staatliche sowie private Akteure (z. B. Verbände, Grundbe- und Strukturen die Governance-Regime dieser Großschutz-
sitzer, lokale Unternehmen, Naturtouristen) in unterschied- gebiete charakterisiert sind und wie dabei die Zusammen-
lichen Akteurkonstellationen auf verschiedenen räumlichen arbeit der Akteure beurteilt wird. Der Beitrag möchte so
Maßstabsebenen zusammenwirken (vgl. Becken/Job 2014). zum einen das Verständnis der regionalen Governance von
Großschutzgebiete brauchen einerseits die lokale und Großschutzgebieten verbessern. Zum anderen können mit-
regionale Akzeptanz und andererseits die finanzielle und hilfe der Ergebnisse Schlussfolgerungen für ein effizien-
organisatorische Unterstützung auf übergeordneter, meist tes Management und eine bessere Organisation von Groß-
nationaler Ebene. Sie befinden sich damit im Spannungs- schutzgebieten gezogen werden, die auf die Situation in
feld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Besondere Deutschland übertragen werden könnten. Im Aufsatz wer-
Brisanz erhält Letztgenannte insofern, als dass ökonomi- den drei Forschungsfragen bearbeitet:
sche Nachteile, die von Reservaten auf ihr Umfeld durch
● Welche regionalen Governance-Regime charakterisieren
Nutzungsverzichte ausgehen können, oft lokal bis regional,
die als Fallstudien ausgewählten Großschutzgebiete?
ökologische Vorteile der Parke aber zumeist national bis
● Inwiefern unterscheiden sich die Regionalen Gover-
global wirksam werden (Job/Mayer 2012). Weitere Friktio-
nance-Regime in Naturparken und Biosphärenreserva-
nen können daraus resultieren, dass Großschutzgebiete in
ten1 sowie in Österreich und der Schweiz?
der Regel grenzüberschreitend sind und mehrere Gemein-
● Wie wird die Zusammenarbeit der Akteure durch die an
den oder andere politisch-administrative Einheiten umfas-
der Entwicklung und Organisation von Großschutzge-
sen. Ein nächstes Spannungsfeld liegt in dem ressortüber-
bieten Beteiligten bewertet?
greifenden Ansatz von Großschutzgebieten, der verschie-
dene Ziele verfolgt und damit unter anderem Gegenstand Im Anschluss an die Einleitung wird in Kap. 2 ein Über-
des Natur- und Landschaftsschutzes, der Land- und Forst- blick über die aktuelle Debatte von Governance und Groß-
wirtschaftspolitik oder der Landesplanungs- und Raument- schutzgebieten gegeben. Kap. 3 bietet eine Übersicht über
wicklungspolitik ist. Eine häufig auftretende Konfrontati- die Debatte um Governance in der Regionalentwicklung.
onsebene entsteht zudem dadurch, dass mit der Auswei- Kap. 2 und 3 skizzieren jeweils den Stand der Forschung
sung eines Großschutzgebietes ein neuer raumstruktureller und führen in die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen
Akteur aufscheint, der sich in bestehende Akteurkonstella- für die Analyse von Governance und Regionalentwicklung
tionen einbringen muss. Einerseits kann er Besitzstände in in Großschutzgebieten ein. Im Kap. 4 werden Methodik
Frage stellen, wodurch Raumnutzungskonflikte bedingt sein und Analyseraster für die Empirie des Beitrags vorgestellt.
mögen, andererseits kann er neue Entwicklungen anstoßen Kap. 5 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Erhebun-
sowie mitgestalten (Job 2010). gen. Abschließend werden in Kap. 6 die Resultate diskutiert
Diese Spannungsfelder können ganz spezifische Rege- und in Kap. 7 Schlussfolgerungen gezogen.
lungsstrukturen und Koordinationsmuster hervorbringen,
die wir im Folgenden in Anlehnung an Ostrom (1990) und
Gerber, Knoepfel, Nahrath et al. (2009) als „Regionale- 2 Governance und Großschutzgebiete
Governance-Regime“ bezeichnen und als zentrale Analyse-
kategorie nutzen. Regionale-Governance-Regime entstehen 2.1 Forschungsstand und theoretisch-konzeptionelle
durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Mechanismen. Grundlagen
Sie werden verstanden als die regionalspezifische Art und
Weise, wie räumliche Entwicklungsprozesse gesteuert und Wissenschaftliche Literatur, die sich systematisch und ver-
koordiniert werden (vgl. Pütz 2004). Regionalspezifisch gleichend mit Regionalen Governance-Regimen in Groß-
sind Governance-Regime deshalb, weil davon ausgegangen schutzgebieten befasst, ist im deutschsprachigen Raum
wird, dass es keine identischen Governance-Regime geben bis dato kaum vorhanden. Auch werden die Beiträge
kann. Gleichwohl ist zu erwarten, dass bestimmte Typen aus dem deutschsprachigen Raum nur in Einzelfällen
von Governance-Regimen identifiziert werden können, die an die internationale Debatte angeschlossen (z. B. Ger-
durch jeweils vorherrschende Merkmale charakterisiert ber/Knoepfel 2008; Hirschi 2010; Mose/Jacuniak-Suda/
sind. Welche Merkmale prinzipiell zur Charakterisierung Fiedler 2014). Daher zielt dieser Beitrag auf die Bearbei-
von Governance-Regimen geeignet, welche Governance- tung dieser beiden Defizite ab. Bisher dominieren Studien,
Typen analytisch zu differenzieren und wie diese in reali-
tas anhand von konkreten Fallstudien ausgeprägt sind, wird 1 Die prominentere und zugleich strengere Flächenschutzkategorie
nachfolgend ausgeführt. „Nationalpark“ wurde hier ausgeklammert, da sie weit weniger dem
Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse der Governance- Regionalentwicklungsziel verpflichtet ist, als dies Biosphärenreservate
Regime ausgewählter Großschutzgebiete in Österreich und und traditionell Naturparke sind.
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTCGovernance und Regionalentwicklung in Großschutzgebieten der Schweiz und Österreichs 571
Abb. 1 IUCN Protected Area
Matrix: Klassifikation von Groß-
schutzgebieten nach Manage-
ment-Kategorie und Gover-
nance-Typ (Borrini-Feyerabend/
Dudley/Jaeger et al. (2013: 44))
die nur einzelne Fallstudien vertieft analysieren oder nur (2005) haben sich mit Kulturlandschaften allgemein als
auf spezifische Aspekte von Governance fokussieren. So Teil von „Metropolitan Governance“ befasst. Dahingegen
beruft sich Hirschi (2010) zur Untersuchung horizontaler leisten Moss und Gailing (2010) einen spezifischen Beitrag
und vertikaler Formen der Zusammenarbeit nachhaltiger zu geeigneten Governance-Formen für Biosphärenreservate
Entwicklung in den Regionalen Naturparken Thal und im Hinblick auf die drei Kategorien „sectoral interplay“,
Binntal in der Schweiz auf „Network Governance“. Ger- „spatial fit“ und „scale“. Am Beispiel des trilateral aufge-
ber und Knoepfel (2008) untersuchen den Umgang mit hängten, die Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen von Landschaften berührenden Biosphärenreservats Rhön diskutiert auch Po-
in Regionalen Naturpärken der Schweiz aus der Perspek- korny (2010) Fragen der regionalen Selbststeuerung und
tive „Landscape Governance“. Görg (2007) widmet sich zwar besonders unter Partizipationsgesichtspunkten (vgl.
„Landscape Governance“ aus konzeptioneller Perspekti- dazu auch Kraus 2015).
ve, ohne Empirie in Großschutzgebieten. Weiter gibt es Auf europäischer Ebene widmen sich verschiedene Ar-
einige Studien, die sich entweder mit Reservaten beschäf- beiten zu „governance of protected areas“ der Umsetzung
tigen und Governance nur streifen, oder solche, die sich Europäischer Naturschutzrichtlinien in den Nationalstaaten
mit Regionaler Governance befassen und Großschutzge- (Paavola 2004; Gibbs/While/Jonas 2007). Mehnen (2013)
biete nur indirekt behandeln. Lahner (2009) hat in ihrer vergleicht die regionale Governance von Schutzgebieten
Dissertation das „Place-Making“ durch Großschutzgebiete der IUCN2-Kategorie V (Geschützte Landschaft) in Euro-
am Beispiel der Regionen Rhön und Schaalsee erörtert. pa (vgl. Abb. 1). Speziell die Ausweisung neuer Schutz-
Weixlbaumer und Mose (2006) beschäftigen sich mit dem gebiete, als Teil der Implementation von NATURA 2000
Paradigmenwechsel von Government zu Governance an- ist ein vielfach empirisch untersuchtes Thema, beispiels-
hand von Großschutzgebieten. Biosphärenreservate als ein weise von Grodzinska-Jurczak und Cent (2011) in Polen
regionales Leitinstrument wurden am Beispiel des Bio- sowie Beunen und van Assche (2013) in den Niederlanden.
sphärenparks Großes Walsertal (Österreich) von Coy und Rauschmayer, van den Hove und Koetz (2009) fokussieren
Weixlbaumer (2009) untersucht. Die Governance von kul- in ihrer Analyse von Politiken zum Erhalt der Biodiversität
turlandschaftlichen Handlungsräumen wurde von Gailing
(2012) analysiert. Zu Regional Governance im ländlichen 2 IUCN = International Union for Conservation of Nature and Natural
Raum hat Giessen (2010) gearbeitet. Gabi und Thierstein Resources.
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTC572 M. Pütz, H. Job
auf die Rolle von Partizipation für die Governance. Parra he sogenannter „paper parks“, die nur der besseren Statistik
(2010) untersucht „Multilevel Governance“ des „Parc natu- dienen (Stoll-Kleemann/Job 2008: 86).
rel régional du Morvan“ in Frankreich. Wiederum nur in- Die Entwicklung des Großschutzgebiets-Managements
direkt Großschutzgebiete betreffend wurden von Mose, Ja- lässt sich grob in fünf Phasen nachzeichnen (hier verkürzt
cuniak-Suda und Fiedler (2014) verschiedene Governance- übernommen nach Job/Becken/Sacher 2013; vgl. auch Plie-
Stile in ausgewählten LEADER3-Gebieten in Spanien, Po- ninger/Woltering/Job 2016). Die erste Phase kann mit „Er-
len und Schottland identifiziert. haltung der landschaftlichen Schönheit“ betitelt werden. Sie
Aus internationaler Sicht ist die Arbeit von Depraz ist von der leitenden Idee der Landschaftsästhetik gekenn-
(2011), der „bonne gouvernance“ unter Akzeptanzgesichts- zeichnet. 1916 fand mit dem Gesetz über den „US Natio-
punkten von Großschutzgebieten diskutiert, von Bedeu- nal Park Service“ das nordamerikanische Totalschutzmodell
tung. Stoll-Kleemann und Welp (2008) benennen Faktoren seinen Anfang, welches das globale Großschutzgebietsmus-
für die Beeinflussung gesellschaftlicher Prozesse in Ab- ter maßgeblich geformt hat. Die klassische Naturschutz-
hängigkeit unterschiedlicher Governance-Typen anhand konzeption betont die Schutzwürdigkeit unberührter Natur
einer groß angelegten Befragung bei Biosphärenreservaten („preservation“). Die Auswahl der Schutzgebiete erfolgte
weltweit. Dabei heben sie auf den geographischen Tat- top-down ohne Rücksicht auf die Einheimischen. Die zwei-
bestand ab, ob diese in Industrie- oder Schwellen- bzw. te Phase lässt sich mit „Schutz einzelner Arten“ umschrei-
Entwicklungsländern gelegen sind, und debattieren Hemm- ben. Dabei ging es vorrangig um den Artenschutz, wo-
nisse für die Umsetzung des sustainable development im bei besonders attraktive, sogenannte emblematische Arten
operativen Management der Großschutzgebiete (vgl. auch (z. B. Eisbär, Tiger, Berggorilla) bei der Ausweisung von
Stoll-Kleemann 2010). Shafer (2015) betont die Rolle der Reservaten im Fokus standen. Diese tendenziell militaristi-
Pufferzonen von Großschutzgebieten in diesem Kontext. sche Politik „Zäune und Strafen“ (fences and fines) beinhal-
Er stellt in seinem auf die IUCN-Kategorien abhebenden tete mitunter den Ausschluss der lokalen Bevölkerung und
Beitrag die kritische Frage, ob die ,weichen‘ Kategorien Umsiedlung, was gleichermaßen auch für die erste Phase
des Gebietsschutzes, zu denen Naturparke und Biosphären- zutraf. Bei der dritten Phase lautete das Managementziel
reservate gehören, dem Erhalt der Biodiversität genügend „Biotopschutz“. Für dieses umfassendere Biotopschutzziel
verpflichtet sind bei ihrem gleichzeitig formulierten Re- war der zwischenzeitliche landschaftsökologische Erkennt-
gionalentwicklungsauftrag. Am Beispiel von Mexiko wird nisgewinn maßgeblich, dass nämlich die Interkonnektivität
diese Frage exemplifiziert durch die Studien von Bren- und die Requisitenausstattung der Ökosysteme langfristig
ner und de la Vega-Leinert (2014) sowie Brenner und entscheidend sind für das Überleben und die Abundanz der
Job (2012). Dabei geht es, mit einem speziellen Fokus charakteristischen Spezies. Auch hier waren die im Um-
auf den Tourismus, um akteurorientierte Managementfor- feld der Schutzgebiete lebenden Menschen nie wirklicher
men angesichts der von der UNESCO strikt vorgegebenen Bestandteil des Managementansatzes.
Dreier-Zonierung in Kern-, Puffer-, Entwicklungszonen in Während in den ersten 100 Jahren nach der Yellow-
Biosphärenreservaten. stone-Gründung 1872 die Nationalparkanrainer weitest-
gehend ausgeklammert wurden, kam es danach zu einer
2.2 Vom Management zur Governance von regelrechten Zäsur im Gebietsschutz. Eine Triebfeder für
Schutzgebieten die Umorientierung war das „Man and Biosphere“-Pro-
gramm (MaB) (1970) der UNESCO, insbesondere mit
Das Wachstum an Großschutzgebieten ist weltweit immens. dem Ziel, ein weltumspannendes Netz an Schutzgebieten,
Nach dem Erdgipfel von Rio 1992 sind Anzahl und Flä- sogenannten Biosphärenreservaten, aufzubauen, in denen
chen von Reservaten besonders stark gestiegen (Bertzky/ Naturschutz mit regionaler sozialer und ökonomischer Ent-
Corrigan/Kemsey et al. 2012: 5 ff.): Waren es vor 25 Jahren wicklung entsprechend der sogenannten Sevilla-Strategie
noch elf Mio. km2, so hat sich die Schutzgebietsausdehnung verknüpft werden sollte (UNESCO 1996). Als ein wei-
auf heute weltweit über 24 Mio. km2 erhöht. Nichtsdesto- terer Meilenstein im Wandel der Schutzkonzeptionen gilt
trotz ist zu hinterfragen, ob das Netz an Großschutzgebieten die „World Conservation Strategy“ (IUCN/UNEP/WWF
auch tatsächlich einen essenziellen Beitrag zum eingefor- 1980), die auf eine Integration von Naturschutz und Ent-
derten Erhalt der biologischen Vielfalt leistet (Shafer 2015). wicklung und auf eine nachhaltige Nutzung der natürlichen
Denn noch sind längst nicht alle Biodiversitäts-Hotspots un- Lebensgrundlagen abzielt. Diese neue Naturschutzphilo-
ter Schutz gestellt. Des Weiteren existieren eine ganze Rei- sophie „Schutz und Entwicklung durch integriertes Man-
agement“ steht für die vierte Phase („conservation“), die
sich ab den 1980er-Jahren besonders in Entwicklungs-
3 LEADER: Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwick- ländern in einer Vielzahl von Projekten niederschlug, die
lung ländlicher Räume. den Schutz der Biodiversität in Reservaten mit einer loka-
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTCGovernance und Regionalentwicklung in Großschutzgebieten der Schweiz und Österreichs 573
len sozioökonomischen Entwicklung zu verbinden suchen. nen Akteure, besonders indigener Volksgruppen), Respekt
Ziel ist es, das Management über die Schutzgebietsgren- (die Rechte und tradierte Landnutzungssysteme der Einhei-
zen hinaus zu betreiben, um damit regionalwirtschaftliche mischen betreffend) und „benefit-sharing“ (Zugang zu den
Effekte für die Einheimischen zu generieren und zwar natürlichen Ressourcen und darauf basierende Nutzungen)
als Kompensation für Nutzungsverzichte. Die mit dem als wichtigste Governance-Prinzipien genannt. Die IUCN-
Schutz einhergehenden Nutzungsverzichte werden durch Richtlinien differenzieren Governance anhand von drei Fak-
Maßnahmen verschiedenster Art zu kompensieren versucht toren (Borrini-Feyerabend/Dudley/Jaeger et al. 2013: 10):
(z. B. verwaltungstechnisch festgelegte Ausgleichszahlun-
A. Schlüsselakteure: „rightholders“ vs. „stakeholders“ (z. B.
gen für Wildschäden), häufig jedoch beschränkt sich die
Touristen), Regierungs- (z. B. Naturparkverwaltung) vs.
Mitwirkung auf eine schlichte Informationspflicht ohne
Nichtregierungsorganisationen (z. B. Bauernverband),
echte Mitbestimmung der lokalen Akteure bei wichtigen
B. Machtrelationen und Machtinstrumente: unter anderem
Entscheidungen des Managements. Aufgrund der größeren
Rahmengesetze und darauf basierende Verordnungen
Akteurvielfalt durch Partizipation und neue vertragliche
mit Geboten bzw. Verboten, Managementplänen, Zo-
Regeln wie beispielsweise Ausgleichszahlungen wird in
nierungsregularien, technische Durchführungsvorgaben
dieser vierten Phase die zunehmende Bedeutung von Gov-
(z. B. zur Kulturlandschaftspflege),
ernance-Elementen für die Schutzgebiete deutlich, ohne
C. Entscheidungsebenen: räumliche Maßstabsebenen von
dass hier bereits explizit der Begriff „Governance“ benutzt
global bis regional/lokal, von multi- bis bilateral und die
wird.
Untereinheiten eines bestehenden Schutzgebietsystems
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts greift die fünfte Phase
tangierend.
(„co-management“). Es wird ein neues Konzept eingeführt,
das mit „(Indigenous) Community Conservation Areas“ Anhand der jeweiligen Ausprägungen der unter A, B und
umschrieben werden kann (Job/Becken/Sacher 2013: 209). C genannten Parameter werden von der IUCN vier Gover-
Es umfasst Schutzgebiete natürlicher oder kulturell modi- nance-Typen für Großschutzgebiete unterschieden (Borrini-
fizierter Ökosysteme mit hoher Biodiversität, die freiwillig Feyerabend/Dudley/Jaeger et al. 2013: 29; vgl. Abb. 1): 1)
von indigenen und lokalen Gemeinschaften entsprechend Governance by government: hierarchisch organisierte Gov-
ihrer tradierten Gepflogenheiten gemanagt werden. Die ernance durch staatliche Behörden wie beispielsweise beim
betreffenden Großschutzgebiete werden von lokalen Ge- Schweizerischen Nationalpark (IUCN-Kategorie Ia); 2)
meinschaften im Idealfall so gemanagt, dass der Schutz der Shared governance: gemischte Governance, stark auf kol-
Biodiversität mit Partizipation im engeren Sinne, also über- laboratives Management ausgerichtet, auch grenzübergrei-
wiegend selbstbestimmter nachhaltiger Regionalentwick- fend, z. B. Biosphärenreservat Rhön (IUCN-Kategorie V);
lung, einhergeht. Solche Community Conservation Areas 3) Private Governance: private Governance durch Nicht-
sind heute weltweit auf dem Vormarsch (Bertzky/Corrigan/ regierungsorganisationen, Unternehmen oder individuelle
Kemsey et al. 2012). Der in der vierten Phase bereits ein- Rechtspersonen, z. B. wenn im Reservat ausschließlich
setzende Wandel zu mehr Governance-Elementen, die noch Familieneigentum besteht, z. B. Londolozi Private Game
eher als „integratives“ oder „Co-Management“ bezeichnet Reserve (IUCN-Kategorie II in Südafrika; 4) Governance
wurden, findet in der fünften Phase seine Fortsetzung. Die by indigenous peoples and local communities: Governance
Vielfalt an Akteuren, Regeln und Managementinstrumen- von indigenen Völkern und zeitweisen Großschutzgebiets-
ten wird größer und Governance-Formen werden explizit bewohnern bzw. -anrainern, die mitsamt ihrem lokalen
als solche benannt (vgl. Borrini-Feyerabend/Dudley/Jaeger Wissen sowie traditionellen Fähigkeiten die territorialen
et al. 2013). wie auch natürlichen Ressourcen eines Gebietes kollektiv
Im Jahr 2013 hat die IUCN „good governance prin- beanspruchen und als öffentliche Güter zumeist in Allmen-
ciples“ vorgelegt, die als Aktionsplan kurz-, mittel- und de-Form nutzen, z. B. Balanggarra in Westaustralien.
langfristige Komponenten für das Management von Groß- Die beiden zuletzt genannten Governance-Typen spielen
schutzgebieten beinhalten. Hintergrund für diese Richtlini- in Mitteleuropa derzeit keine Rolle. Für Typ C gibt es aller-
en ist die auf dem 5. Weltparks-Kongress in Sydney 2012 dings auch in unseren Breiten bereits erste privat gemanagte
entwickelte Idee betreffend die Umsetzung des von der Reservate, z. B. die Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer
„Convention on Biological Diversity“ (CBD) formulierten Heide bei Berlin, ein etwa 4500 ha großes und zugleich
Aichi-Ziels 11. Hierbei geht es darum, „to help develop and als Naturschutzgebiet ausgewiesenes Areal. Jeder der vier
implement a system for the voluntary appraisal of protec- Governance-Typen könnte für jede der von der IUCN un-
ted area governance quality to illuminate and communicate terschiedenen sechs Kategorien von Großschutzgebieten in
innovative and effective approaches to protected area gov- Frage kommen (vgl. Job/Woltering/Warner et al. 2016; vgl.
ernance“ (Borrini-Feyerabend/Dudley/Jaeger et al. 2013: Abb. 1).
XV). In diesem Kontext werden Partizipation (der betroffe-
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTC574 M. Pütz, H. Job
3 Governance in der Regionalentwicklung: Regionen oder Governance-Formen in den Mittelpunkt des
Forschungsstand und konzeptionelle Erkenntnisinteresses gestellt. In den letzten Jahren wurden
Grundlagen zudem einige Arbeiten vorgelegt (meist Dissertationen), die
Regional Governance empirisch untersucht haben. Es fällt
Der Governance-Begriff ist mehrdeutig, aber besser als an- auf, dass diese Studien sich oft mit spezifischen Themen
dere Begriffe für die Untersuchung „real existierender poli- der Regionalentwicklung beschäftigen oder einzelne regio-
tischer Ordnungen“ (Mayntz 2009: 9) geeignet, weil er al- nalpolitische Strategien und Programme untersucht haben,
le unterschiedlichen Regelungsformen umfasst (hierarchi- unter anderem Siedlungsentwicklung (Pütz 2004), Groß-
sche und nicht-hierarchische, staatliche und nicht-staatli- schutzgebiete (Fürst/Lahner/Pollermann 2005; Weber 2013;
che). Der zentrale Hintergrund für die Governance-Debat- Hammer/Mose/Siegrist et al. 2016), Freiraumentwicklung
te ist, dass die staatliche Handlungsfähigkeit, aber auch und Regionalparks (Gabi/Thierstein 2005), Regionalent-
die Wirksamkeit und Kontrollierbarkeit des Marktes gegen- wicklung im ländlichen Raum wie etwa „Regionen Aktiv“
wärtig grundsätzlich in Frage gestellt werden. Gleichzeitig oder LEADER+ (Böcher 2008; Giessen 2010), grenzüber-
treten neue und komplexere Themen auf, bei denen eine schreitende Regionalentwicklung (INTERREG) (Deppisch
intensivere Zusammenarbeit verschiedener Akteurgruppen 2012; Zäch/Pütz 2014), Wirtschaftsförderung (Panebianco
gefragt ist (Walk 2008). Governance-theoretische Ansätze 2013), Raumplanung (Beutl 2010; Harrison/Growe 2014),
gehen weiter als die politikwissenschaftliche Steuerungs- Stadtumbau (Bernt/Haus/Robischon 2010) oder überregio-
theorie, weil sie anerkennen, dass die Voraussetzungen für nale Partnerschaften (Pennekamp 2011).
eine zielorientierte Steuerung in der Praxis nicht erfüllt sind Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags stehen Re-
und die Vorstellung von einem Interventionsstaat mittler- gionalentwicklungsprozesse, die mit institutionellem Wan-
weile überholt scheint. Die Governance-Forschung, die in del auf regionaler Ebene einhergegangen sind und zur Bil-
der Regel interdisziplinär angelegt ist, wird auf Deutsch in dung neuer Regionen geführt haben, konkret: zu Naturpar-
einigen Übersichtsdarstellungen behandelt (z. B. von Blu- ken oder Biosphärenreservaten. Daher liegt es nahe, sich
menthal 2005; Schuppert 2005; Benz/Lütz/Schimank et al. auf institutionalistische Ansätze zu beziehen. Konzeptio-
2007; Benz/Dose 2010). nell werden im Folgenden „New Regionalism“ und „New
Regional Governance „bezeichnet Formen der regio- Institutionalism“ zusammengedacht. Von Interesse für den
nalen Selbststeuerung in Reaktion auf Defizite sowie als vorliegenden Beitrag ist dabei, wie reformfähig bestehen-
Ergänzung der marktwirtschaftlichen und der staatlichen de Institutionen sind und unter welchen Bedingungen in-
Steuerung. Sie tritt dort auf, wo das Zusammenspiel staat- stitutioneller Wandel stattfindet. Von den vier grundsätz-
licher, kommunaler und privatwirtschaftlicher Akteure lich zu unterscheidenden institutionalistischen Ansätzen –
gefordert ist, um Probleme zu bearbeiten“ (Fürst 2010: 49). Rational Choice, historischer, soziologischer und diskursi-
Der Begriff „Regional Governance“ ist in der deutschen ver Institutionalismus (vgl. Senge/Hellmann 2006) – ist der
und englischen Sprache ein Sammelbegriff für alle raum- letztgenannte für den vorliegenden Beitrag besonders in-
bezogenen Governance-Formen. Regional Governance be- teressant. Der diskursive Institutionalismus fokussiert auf
zieht sich auf die Regeln und Praktiken der Koordinati- Kontext, Dynamik und Diskurse des institutionellen Wan-
on räumlicher Entwicklungsprozesse. Charakteristisch für dels (Schmidt 2010), die hier am Beispiel regionalspezifi-
Regional Governance ist die Mitwirkung staatlicher, zi- scher Governance-Regime von Großschutzgebieten empi-
vilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Akteure an risch untersucht werden.
Entscheidungen zu Sachverhalten im kollektiven Interesse.
Damit ist Regional Governance als Begriff zwar unscharf
definiert, hat sich aber mit diesem grundlegenden Verständ- 4 Methodik
nis in der deutschsprachigen Debatte etabliert (Fürst 2003;
Pütz 2004; Diller 2005; Kleinfeld/Plamper/Huber 2006; 4.1 Datenerhebung und Datenauswertung
Fürst 2010).
Neben dem Begriff „Governance“ selbst ist auch das Um Governance-Regime empirisch erfassen und verglei-
Regionale oder der Raumbezug von Governance unscharf chend bewerten zu können, wurden jeweils zwei Fallstudien
und der Begriff „Raum“ wenig eindeutig. Die Beiträge in Österreich und der Schweiz durchgeführt. In der Schweiz
in Kilper (2010) betonen die wechselseitige Strukturie- wurden der Regionale Naturpark Thal und die Biosphä-
rung und den engen Zusammenhang von Governance und re Entlebuch und in Österreich der Naturpark Zirbitzko-
Raum. Hier werden die grundlegenden Arbeiten von Benz gel-Grebenzen und der Biosphärenpark Salzburger Lungau/
und Dose (2010), Fürst (2003) oder Blatter und Knieling Kärntner Nockberge als Fallstudien ausgewählt. Die Fall-
(2009) weiter gedacht und die kognitive und kommunika- studien sind gute Beispiele für die Entwicklung regionaler
tive Dimension bei der Konstitution oder Konstruktion von Governance-Strukturen. Als Kriterien für die Auswahl der
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTCGovernance und Regionalentwicklung in Großschutzgebieten der Schweiz und Österreichs 575
Tab. 1 Vergleich ausgewählter Großschutzgebiete in Österreich und in der Schweiz
Merkmal Fallstudien Österreich Fallstudien Schweiz
Naturpark Zirbitzkogel- Biosphärenreservat Lun- Naturpark Thal Biosphärenreservat Ent-
Grebenzen gau/Nockberge lebuch
Raumstruktur:
Fläche (km²) 285 1500 139 395
Bevölkerung (Einwohner) 8000 32.000 14.000 14.000
Anzahl Gemeinden 10 19 9 7
Institutioneller Rahmen:
Rechtlicher Rahmen Landesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzesetze Natur- und Heimat- Natur- und Heimat-
des Landes Steiermark der Länder Salzburg und schutzgesetz, Pärke- schutzgesetz, Pärkever-
Kärnten; Kärntner Bio- verordnung ordnung, Bundesinventar
sphärenpark Nockberge geschützter Landschaften
Gesetz K-BNG (BLN)
Weitere, wichtige institu- Teilfinanzierung durch Managementplan; LEA- Naturparkcharta; Mana- Naturparkcharta; Mana-
tionelle Regeln Landschaftspflegefonds DER+; NATURA 2000; gementplan für 10 Jahre; gementplan für 10 Jahre;
Steiermark; NATURA Tourismus-Masterplan Leistungsvereinbarung Leistungsvereinbarung
2000; Regionalversamm- mit Kanton Solothurn mit Kanton Luzern für
lung; regionale Agen- für jeweils vier Jahre; jeweils vier Jahre; Natio-
da 21 für Naturpark jährliche Rechenschafts- naler Finanzausgleich;
berichte Neue Regionalpolitik
Schlüsselakteure Bundesland Steiermark; Regionalverband Lun- Region Thal (Planungs- Direktor des Biosphären-
Gemeinden; Verband gau; Großgrundbesitzer verband und Träger des reservats; Gemeindever-
Naturpärke Steier- (u. a. Landwirte); Bio- Naturparks); Gemeinden; band Entlebuch; Land-
mark; Tourismusver- sphärenpark-Komitee Landwirte; Holzhand- wirte; Alpwirtschaftli-
band; Großgrundbesitzer (Beirat, 20 Personen); werk cher Verein; Bergbahnen
(u. a. Stift St. Lambrecht, Tourismusverband; Ge- Sörenberg
Landwirte); Berg- und schäftsführer Nock-Alm-
Naturwacht Steiermark Straße; Bergbahnen;
Schutzgemeinschaft für
die Entwicklung von
Schutzgebieten
Spezifika der Kooperati- Großer Einfluss des Tou- Themenforen; Koope- Lange Tradition der Professionelles Manage-
on rismus; viel Aktivität ration zwischen Lungau regionalen Zusammen- ment des Biosphären-
durch geförderte Projekte und Nockbergen, meist arbeit; starke lokale Ver- reservats; starke lokale
durch Fördermaßnah- ankerung; Themenforen; Verankerung; Partizi-
men; jeweils fokussierte viel Aktivität durch ge- pation über Delegier-
Zusammenarbeit im Lun- förderte Projekte tenversammlung mit
gau und in den Nockber- 40 Personen; Themenfo-
gen; großer Einfluss der ren (u. a. Landwirtschaft,
Großgrundbesitzer (90 % Energie); viel Aktivität
des Biosphärenreservats durch geförderte Projek-
sind privates Land); Bio- te; großer Einfluss der
sphärenparkbeauftragte Landwirtschaft
in den Gemeinden; Mit-
sprache der Gemeinden
über Regionalkonferenz
Fallstudien wurden herangezogen: Ähnlichkeit der räumli- In jeder Fallstudienregion wurden zunächst Dokumen-
chen Strukturen, Vergleichbarkeit des politisch-administra- tenanalysen und anschließend halbstandardisierte, leitfa-
tiven Systems (Föderalismus), kulturelle Ähnlichkeit (Spra- dengestützte, problemzentrierte Expertengespräche durch-
che), Vorhandensein eines integrativen Schutzgebietsmana- geführt. Für die Dokumentenanalyse wurden regionale
gements und eine erkennbare Ausrichtung auf regionale Entwicklungskonzepte, Managementkonzepte (Charta) der
Wirtschaftsentwicklung. Außerdem entsprechen alle Fall- Schutzgebiete, Publikationen von Verbänden und Dachor-
studien der IUCN-Kategorie V (Protected Landscape) (vgl. ganisationen wie „Netzwerk Schweizer Pärke“, „Verband
Abb. 1). Die untersuchten Fallstudien sind nicht repräsenta- der Naturparke Österreichs“ oder „Parkforschung Schweiz“
tiv für die Schutzgebietskategorie insgesamt oder den Gov- sowie Projektbroschüren und Internetseiten berücksichtigt.
ernance-Typ nach IUCN und bieten lediglich interessante Die Experteninterviews fanden in der Schweiz im Zeitraum
Einblicke in die jeweilige Governance-Praxis vor Ort. August bis Oktober 2013 und in Österreich im Zeitraum
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTC576 M. Pütz, H. Job
Abb. 2 Schutzgebiete in Österreich und in der Schweiz (ohne Nationalparks)
Februar bis Juni 2014 statt. Insgesamt wurden 26 Inter- (vgl. Tab. 1). Danach wurden die Informationen aus den In-
views geführt, davon 16 einstündige Interviews mündlich terviews den Kategorien zugeordnet, um sie strukturieren,
vor Ort, neun einstündige Interviews telefonisch sowie ein Häufigkeiten erkennen und die Forschungsfragen beant-
weiteres Interview schriftlich. Es wurden acht Interviews worten zu können. Die Inhaltsanalyse geht systematisch
mit Experten außerhalb der Fallstudienregionen geführt und theoriegeleitet vor, ist also keine freie Interpretation.
(Externe Österreich (EA) 1–5, Externe Schweiz (ES) 1–3);
je vier Interviews fanden in den beiden Naturparken statt, 4.2 Analyseraster
differenziert nach Akteuren aus der Verwaltung und Sonsti-
gen (Naturpark Verwaltung (NV) 1–4, Naturpark Sonstige Zur Strukturierung der Datenerhebung und schließlich zur
(NS) 1–4); insgesamt 10 Interviews wurden in den bei- Präsentation der Ergebnisse wird im Folgenden mit „Regio-
den Biosphärenreservaten durchgeführt, differenziert nach nalen Governance-Regimen“ gearbeitet. Wir verstehen dar-
Akteuren aus der Verwaltung und Sonstigen (Biosphärenre- unter die regionalspezifische Art und Weise, wie räumliche
servat Verwaltung (BV) 1–6, Biosphärenreservat Sonstige Entwicklungsprozesse in Großschutzgebieten gesteuert und
(BS) 1–4). Die Zitate wurden entsprechend dieser Codie- koordiniert werden. Sie entstehen durch das Zusammen-
rung anonymisiert. Alle Interviews wurden transkribiert spiel unterschiedlicher Mechanismen und bringen regional-
und qualitativ inhaltsanalytisch nach Mayring (2015) aus- spezifische Regelungsstrukturen und Koordinationsmuster
gewertet. Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, das hervor. Wir gehen davon aus, dass es keine identischen
Interviewmaterial zu verdichten und eine dahinter lie- Governance-Regime geben kann. Gleichwohl ist zu erwar-
gende Bedeutung zu erfassen. Dazu wurde zunächst ein ten, dass bestimmte Typen von Governance-Regimen iden-
Kategoriensystem erstellt, das in einem ersten Schritt die tifiziert werden können, die durch jeweils vorherrschende
vier Kategorien Raumstruktur, Institutionen, Akteure und Merkmale charakterisiert sind. Die wesentlichen Merkmale
regionale Zusammenarbeit enthielt und später weiter diffe- des Analyserasters sind (vgl. Tab. 1):
renziert und sprachlich angepasst wurde. Diese Kategorien
● raumstrukturelle Parameter: Fläche, Bevölkerung und
bilden sowohl die Forschungsfragen als auch die theo-
Anzahl der Gemeinden,
retisch-konzeptionellen Grundlagen des Beitrags ab und
● institutioneller Rahmen: rechtlicher Rahmen und weitere
werden im nachfolgenden Kapitel als Analyseraster vor-
wichtige institutionelle Regeln,
gestellt und auch zur Präsentation der Ergebnisse genutzt
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTCGovernance und Regionalentwicklung in Großschutzgebieten der Schweiz und Österreichs 577
● Schlüsselakteure und Der Einfluss der privaten Grundbesitzer, Bauern, Jäger und
● Spezifika der Kooperation. anderer auf die Schutzgebiete ist groß. Sie organisieren
sich in sogenannten Schutzgemeinschaften, um sich gegen
Das Analyseraster und unser Verständnis von Regio- naturschutzfachliche Fremdbestimmung zu wehren und ei-
nalen-Governance-Regimen knüpft an Ostrom (1990) und gene Landnutzungsinteressen durchzusetzen. Ein Beispiel
Gerber, Knoepfel, Nahrath et al. (2009) an. Das „Institu- ist die „Schutzgemeinschaft der Grundbesitzer in Kärnten“,
tional Analysis and Development Framework“ von Ostrom welche die Anliegen der Grundbesitzer bei der Ausweisung
(1990) (vgl. auch Ostrom 2009; Clement 2010; McGinnis von Schutzgebieten vertritt.
2011) ist speziell für die Analyse regionaler Governance Derzeit existieren in Österreich 48 Naturparke, die zwi-
interessant, weil hier explizit die lokal- und regionalspe- schen 20.000 und 70.000 ha groß sind und insgesamt eine
zifischen Attribute berücksichtigt werden, die gerade auch Fläche von rund 500.000 ha umfassen (vgl. Abb. 2). Die
Großschutzgebiete stark prägen. ältesten davon datieren aus dem Jahr 1979 (und sind damit
etwa 20 bzw. 10 Jahre jünger als die französischen oder
deutschen Vorbilder). Naturparke werden in Österreich als
5 Ergebnisse geschützte Landschaften, die vom Menschen durch scho-
nende Landnutzung und Landschaftspflegemaßnahmen er-
5.1 Rahmenbedingungen für die regionale Governance halten werden, definiert und sollen Schutz, Erholung, Bil-
von Großschutzgebieten in Österreich und der dung und Regionalentwicklung gleichrangig erfüllen (Ver-
Schweiz band der Naturparke Österreichs 2016: 4 f.). Diese traditio-
nell gewachsenen, historischen Kulturlandschaften werden
5.1.1 Österreich als Vertreter charakteristischer österreichischer Landschaft-
stypen angesehen. Nur bei Zustimmung aller betroffenen
In Österreich fällt Naturschutz in Gesetzgebung und Voll- Gemeinden wird das naturschützerische Prädikat „Natur-
zug in die Kompetenz der Bundesländer. Es existiert auf park“ verliehen.
der übergeordneten Ebene der Republik kein Rahmenge- Drei von der UNESCO anerkannte Biosphärenreser-
setz wie in Deutschland, was die Zusammenarbeit über vate, sogenannte Biosphärenparks, gibt es momentan in
Bundesländergrenzen erschwert. Deshalb besteht z. B. der Österreich: Großes Walsertal (19.200 ha), Wienerwald
Nationalpark Hohe Tauern aus formaljuristisch drei se- (105.645 ha) und Salzburger Lungau/Kärntner Nockberge
paraten Teilgebieten der Länder Kärnten, Salzburg und (149.000 ha). Auch sie verfolgen nicht zuletzt explizite
Tirol (mit drei Verwaltungsstellen, drei Direktoren, drei Regionalentwicklungsziele im Sinne des Sustainable-de-
Haushalten). Die Bundesländer sind unter anderem für die velopment-Paradigmas und versuchen, diese unter ihrem
Errichtung und Aufhebung von Großschutzgebieten zustän- sehr ambitionierten, weil inhaltlich viel umfassenderen
dig. Die Gemeinden kompensieren Schutzmaßnahmen von Naturschutzetikett als dies bei den Kategorien Natur- oder
privaten Grundbesitzern über sogenannte Vertragsnatur- Nationalpark der Fall ist, in der Öffentlichkeit zu kom-
schutzmodelle. Bei der Zulassung einer Schutzmaßnahme munizieren, z. B. mittels eines Kochbuchs zu regionalen
durch den Besitzer des betroffenen Gebietes erfolgt eine Gerichten aus Biosphärenreservaten (Köck/Umhack/Diry
direkte Ausgleichszahlung durch das betreffende Bundes- 2013). Zwei Gebiete, Untere Lobau und Neusiedler See, die
land. Solche Verträge können ähnlich einem Pachtvertrag in Teilen die Nationalparks Donauauen und Neusiedler See
wieder aufgehoben werden. Zahlreiche Maßnahmen in umfassten, wurden 2016 von der UNESCO-Liste genom-
den Großschutzgebiets-Gemeinden werden von Vereinen men. Zudem wurden bereits 2014 zwei weitere vormalige
getragen, z. B. das Projekt „Netzwerk-Land“, das darauf Biosphärenreservate – der Gurgler Kamm in den Ötztaler
abzielt, ländliche Regionen und damit auch Großschutzge- Alpen und der hochalpine Gossenköllesee – von der UN-
biete zu vernetzen. Je nach Schutzgebietskategorie sind vor ESCO-Liste zurückgezogen, da sie viel zu klein waren und
allem die jeweiligen Naturschutzabteilungen der einzelnen insbesondere nicht dem Sevilla-Standard entsprachen.
Bundesländer an der Entwicklung und Organisation der
Großschutzgebiete beteiligt. Auch die Fauna-Flora-Habi- 5.1.2 Schweiz
tat-Richtlinie (FFH) der Europäischen Union (EU) spielt in
Österreich eine wichtige Rolle. Sie ist Grundlage für den In der Schweiz setzen das Natur- und Heimatschutzgesetz
Aufbau des europaweiten Schutzgebietsnetzes „NATURA sowie die Pärkeverordnung (PäV) den gesetzlichen Rahmen
2000“ und muss in jedem Bundesland in Landesrecht und für Großschutzgebiete (Schweizerischer Bundesrat 2007).
in vielen Landesgesetzen umgesetzt werden. Für den Na- Laut Schweizer Pärkeverordnung sind das Regionen, die
turschutz setzen sich in Österreich Natur- und Landschafts- über seltene und vielfältige Lebensräume verfügen, eine
schutzorganisationen, wie z. B. der „Naturschutzbund“ ein. Landschaft mit besonderer Schönheit und Eigenart darstel-
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTC578 M. Pütz, H. Job
len sowie eine geringe Beeinträchtigung dieser besonderen schen ungefähr 14.000 und 125.000 ha variiert (Netzwerk
Werte zeigen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so kann Schweizer Pärke 2015: 5). Regionale Naturpärke entstan-
mithilfe der Unterstützung der Bevölkerung und mit der den in der Schweiz erst seit 20085 (noch einmal 30 Jahre
Organisation einer Pärketrägerschaft die Ausgestaltung und später als in Österreich). Mehrere Projekte für neue Groß-
Entwicklung der Region in Angriff genommen werden. In schutzgebiete sind inzwischen wieder von der Bildfläche
Regionalen Naturpärken soll eine nachhaltige ökonomische verschwunden, z. B. 2014 der Regionale Naturpark Necker-
und gesellschaftliche Entwicklung über einen naturnahen tal, weil die dortige Bevölkerung starke Einschränkungen
Tourismus oder auch die Förderung und Entwicklung von fürchtete. Aufgrund ähnlicher Befürchtungen hat sich 2015
regionalen Produkten erreicht werden. Ein explizites Ziel eine Gemeinde der Biosfera Val Müstair – Parc Naziunal
der Naturpärke ist die Erhaltung und Aufwertung der Natur (19.900 ha; erweitert den bereits 1914 gegründeten Schwei-
und Landschaft. zerischen Nationalpark in Richtung des benachbarten ita-
Über einen Parkvertrag ist der Ein- und Austritt von Ge- lienischen Nationalparks Stilfser Joch) gegen eine Erweite-
meinden in die Trägerschaft geregelt. Wenn sich der Park- rung ausgesprochen – mit der Folge, dass dieses Biosphä-
perimeter verändert, ist das Bundesamt für Umwelt ver- renreservat von der UNESCO hinsichtlich des internatio-
pflichtet, den räumlichen Zuschnitt des Großschutzgebietes nalen Status kritisch unter die Lupe genommen wird. Die
neu zu prüfen. Für die Aufhebung eines ganzen Großschutz- Biosphäre Entlebuch (39.400 ha) ist das zweite von der
gebietes ist jedoch das Bundesamt für Umwelt verantwort- UNESCO anerkannte Biosphärenreservat und gleichzeitig
lich. Mit der sogenannten „Park Charta“ muss jeder Regio- ein Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung.
nale Naturpark ein Managementkonzept vorlegen, das min-
destens zehn Jahre Bestand hat und damit über die üblichen 5.2 Governance in ausgewählten Großschutzgebieten
Legislaturperioden der Politik hinausreicht.4 Ebenfalls nach
zehn Jahren müssen alle Großschutzgebiete entscheiden, ob 5.2.1 Regionaler Naturpark Thal
sie weiter bestehen möchten. Zur Finanzierung von Groß-
schutzgebieten ist der vertikale Finanzausgleich zwischen Die Region Thal (Schweiz) ist durch ihre geographische
Bund und Kantonen wichtig. So kann der Bund strategisch Abgeschlossenheit und eine traditionell gute regionale Zu-
und die Kantone können operativ steuern. sammenarbeit charakterisiert. Das Regionale-Governance-
Auf Bundesebene ist in der Schweiz das Bundesamt Regime des Naturpark Thal wird stark durch die seit
für Umwelt für Großschutzgebiete zuständig. Es prüft die 1969 bestehende regionale Planungsorganisation ,Region
Anträge zur Anerkennung als Großschutzgebiet und zur Thal‘ geprägt, die auch die Trägerschaft für den Regio-
Benutzung des entsprechenden Etiketts und gewährt Fi- nalen Naturpark Thal wahrnimmt. Das Beispiel zeigt,
nanzhilfen. Dem Bundesamt für Umwelt stehen dafür jähr- dass eine etablierte, funktionierende Zusammenarbeit auf
lich 20 Mio. Franken für die Förderung der Großschutzge- regionaler Ebene, organisiert durch einen regionalen Ent-
biete zur Verfügung. Das Bundesamt für Umwelt hat da- wicklungsträger eine schnelle und erfolgreiche Errichtung
bei eine Aufsichtsfunktion über die korrekte Verwendung von Großschutzgebieten unterstützen kann. Außerdem wur-
des Park- und Produkte-Labels. Des Weiteren hat das Amt de hier von Anfang an die Landwirtschaft eingebunden:
eine Beratungs- und Coaching-Funktion für Kantone und „Die Landwirtschaft haben wir sehr früh involviert. Das
die Großschutzgebiete. Ebenfalls auf übergeordneter Ebene war überhaupt [...] die allererste Akteursgruppe, die wir
koordiniert das „Netzwerk Schweizer Pärke“ den Erfah- einbezogen haben beim Entwickeln der Parkidee und wir
rungsaustausch und die Öffentlichkeitsarbeit aller Schwei- haben ihr auch aufgezeigt, dass keine Einschränkungen
zer Großschutzgebiete und vertritt ihre Interessen interna- damit verbunden sind“ (Interview NV 1). Interessant am
tional. Die „Parkforschung Schweiz“ unterstützt und be- Beispiel des Regionalen Naturpark Thal ist, dass nach der
gleitet die Großschutzgebiete bei der Forschung und de- Errichtung des Naturparks Thal 2010 die Zusammenarbeit
ren Zusammenarbeit bei übergeordneten Themen. Von den der wirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen
zivilgesellschaftlichen Akteuren ist die Natur- und Land- Akteure noch gesteigert werden konnte. Großschutzgebie-
schaftsschutzorganisation „Pro Natura“ wichtig. te können also dazu beitragen, etablierte Strukturen der
Derzeit sind in der Schweiz insgesamt 20 Großschutzge- Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und zu intensivieren.
biete in Betrieb oder werden zu errichten versucht (Weissen Für die Planung, Realisierung und Finanzierung von Pro-
2009; vgl. Abb. 2); diese belegen insgesamt 650.083 ha. jekten sind die Programmvereinbarungen zwischen Kanton
15 davon sind Regionale Naturpärke, deren Größe zwi- und Park sowie zwischen Kanton und Bund wichtig und
4 Damit ist man dem Vorbild der französischen „Parc Naturels Régio- 5 Der Schweizerische Nationalpark aus dem Jahr 1914 wird hier we-
naux“ gefolgt, deren Geschichte bis ins Jahr 1970 zurückreicht (Job gen seines besonderen Status (für ihn gibt es ein eigenes Bundesgesetz)
1993). nicht mitgerechnet.
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTCGovernance und Regionalentwicklung in Großschutzgebieten der Schweiz und Österreichs 579
damit ein zentrales Element des Regionalen Governance- Einbindung von zivilgesellschaftlichen Akteuren durch
Regimes. Von den Interviewpartnern wird die Zusammen- verschiedene Themenforen. Wichtig für die Finanzierung
arbeit zwischen den Bereichen Landwirtschaft, Gastrono- des Biosphärenreservats sind die kantonalen Einnahmen
mie und Parkverwaltung als gut bewertet. Es werden je- aus dem nationalen Finanzausgleich, weil das Entlebuch
doch auch Potenziale bei Gastronomie und Landwirtschaft eine strukturschwache Region ist. Wichtig für die gute
gesehen, die Zusammenarbeit zu verbessern und vor allem Zusammenarbeit zwischen den wirtschaftlichen Akteuren
die Kooperationsbereitschaft zu steigern. Kritisch gesehen ist die Rolle der Landwirtschaft. Das zeigt sich zum einen
wird die Konkurrenz zum in unmittelbarer Nähe gelege- an der Vermarktung von regionalen Produkten auch über
nen, ebenfalls neuen Regionalen Naturpark Jurapark Aar- die Grenzen des Biosphärenreservats hinaus. Zum anderen
gau. Eine Zusammenlegung wäre aus organisatorischer und wird das an der nach wie vor hohen Bedeutung der Land-
finanzieller Sicht effektiver, scheint aber aufgrund von kul- wirtschaft für die regionale Identität deutlich: „wir haben
turellen Differenzen derzeit nicht möglich. Die Akzeptanz ja drei, vier Prozent noch aktive Bevölkerung in der Land-
des Großschutzgebietes hat nach Meinung der Interview- wirtschaft, aber im Kopf haben wir immer noch dreißig,
partner nach der Einrichtung etwas abgenommen, ist jedoch vierzig Prozent Bauern“ (Interview BV 2). Am Beispiel
immer noch auf hohem Niveau. vom Biosphärenreservat Entlebuch wird auch deutlich, dass
ein Regionales Governance-Regime nicht zwingend eine
5.2.2 Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen rechtliche Grundlage braucht, damit Akteure zusammen-
arbeiten und Projekte verwirklichen. Denn diese befindet
Der österreichische Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen, ge- sich derzeit noch in der Erarbeitungsphase.
gründet 1983, verfolgt das ehrgeizige Ziel, finanziell unab-
hängig von Fördermaßnahmen des Bundes zu werden. Cha- 5.2.4 Biosphärenpark Salzburger Lungau/Kärntner
rakteristisch für das Regionale-Governance-Regime dieses Nockberge
Großschutzgebiets ist die intensive Kooperation mit dem
Tourismusverband, da die Naturparkverwaltung mit Tou- Der die Landesgrenzen übergreifende Biosphärenpark Lun-
ristikern besetzt ist. Eine intensive Zusammenarbeit aller gau/Nockberge (Österreich) besteht erst seit dem Jahr 2012
Akteure findet vor allem zu Anfang einer neuen EU-För- und hat zwei Verwaltungen. Dadurch ist das Regionale-
derperiode statt. Daraus kann geschlossen werden, dass die Governance-Regime durch verschiedene administrative und
in Aussicht stehenden finanziellen Mittel als Anreiz für die organisatorische Strukturen im selben Biosphärenreservat
Zusammenarbeit von Akteuren sehr förderlich sein kön- geprägt, was die Transaktionskosten erhöht. Die Intensität
nen. Eine Vielzahl an Projekten und Initiativen weist auf der Zusammenarbeit ist in den Kärntner Nockbergen weiter
eine gute Vernetzung der Akteure hin. So gibt es eine ei- entwickelt als im Lungauer Teil, weil die Kärntner Nock-
gene Naturparkzeitschrift, einen Naturleseweg und Bestre- berge vor der Ausweisung als Biosphärenreservat eine Zeit
bungen, Angebote zur Burnout-Prävention zusammen mit lang Nationalpark waren.6 Dadurch konnten bereits Verwal-
anderen Partnern aufzubauen. Die Akzeptanz wird generell tungs- und Vernetzungsstrukturen wie beispielsweise The-
als gut angesehen, scheint aber in den Bereichen Jugend und menforen übernommen werden, die im Lungauer Teil erst
Landwirtschaft ausbaufähig. Projekte, die nicht in der Re- aufgebaut werden mussten. Es haben sich jedoch schnell
gion selbst entstanden sind, werden kritisch gesehen: „Das Bürgervereine organisiert, die ein großes Interesse an der
ist dann auch schief gelaufen, weil es nicht in der Regi- Entwicklung des Biosphärenreservats zeigen.
on entstanden ist. Das ist von oben draufgesetzt worden. In den Expertengesprächen wurde deutlich, dass die Zu-
Da waren irgendwelche Burschen irgendwo in der Welt. sammenarbeit zwischen beiden Teilen des Biosphärenre-
Ich glaube in Frankreich und in der Schweiz haben sie so servates lediglich in der Anfangsphase ausgeprägt war und
etwas gesehen und dann sind überall in der ganzen Stei- danach zurückgegangen ist. Als hinderlich für die Zusam-
ermark so Leitprojekte in schwächere Regionen hingesetzt menarbeit wurden die Dominanz der Landesregierungen
worden“ (Interview NS 2). bei Großschutzgebieten und der damit verbundene doppel-
te gesetzliche Rahmen durch zwei Naturschutzgesetze an-
5.2.3 Biosphäre Entlebuch gesehen. In den Kärntner Nockbergen ist die Akzeptanz
insbesondere von Seiten der Großgrundbesitzer reserviert.
Die Biosphäre Entlebuch verkörpert seit 2008 den ersten
Regionalen Naturpark von nationaler Bedeutung in der
6 Da dieser allerdings nicht den internationalen IUCN-Standards ent-
Schweiz. Bereits seit 2001 ist das Entlebuch UNESCO-
sprochen hat, wurde er deklassifiziert, insbesondere weil von national-
Biosphärenreservat, das einzige nach den Sevilla-Kriterien
staatlicher Ebene Druck ausgeübt wurde, indem die in Österreich bei
der UNESCO von 1996. Eine Besonderheit hinsichtlich Nationalparken übliche hälftige Etatisierung durch die Republik unter-
des Regionalen Governance-Regimes ist die intensive blieb.
Unauthentifiziert | Heruntergeladen 07.02.20 04:26 UTCSie können auch lesen