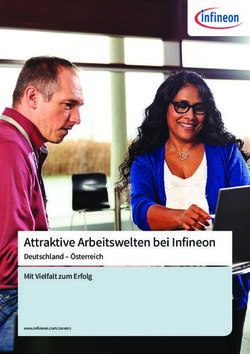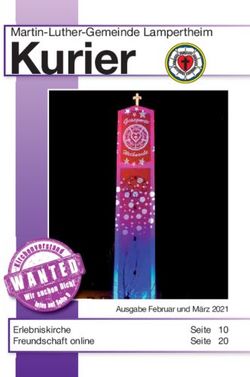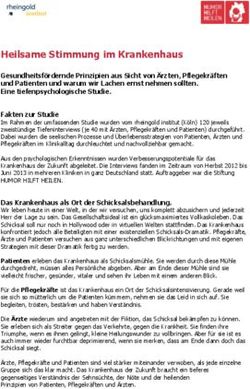HELMUT WÜRTH Festschrift - Dr. Ingmar Etzersdorfer Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonkilch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
III
Festschrift
HELMUT WÜRTH
Herausgegeben von
Dr. Ingmar Etzersdorfer
Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonkilch
F T I
A
S T
K R
W I L L E
A L L E
1 8 4 9
Wien 2014
MANZ’sche Verlags- und UniversitätsbuchhandlungIV
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der
Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Pho-
tokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des
Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert,
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne
Gewähr; eine Haftung der Autoren, der Herausgeber sowie des Verlages ist aus-
geschlossen.
ISBN 978-3-214-01094-2
© 2014 MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Wien
Telefon: (01) 531 61-0
E-Mail: verlag@manz.at
www.manz.at
Foto Helmut Würth: Das Portrait – Barbara Grabenbauer, 1180 Wien
Datenkonvertierung und Satzherstellung:
Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn
Druck: FINIDR, s. r. o., Český TěšínMietrecht und Konsumentenschutz 55
Mietrecht und Konsumentenschutz
Parallelwelten oder kommunizierende Gefäße?
Anton Holzapfel, Wien
Übersicht:
I. Eine immobilienrechtliche Zeitreise
A. Mietrecht und Konsumentenschutz – zwei historische Parallelwelten
B. Ein MRG für alle? Der Geltungsbereich des Mietrechts in Zahlen
II. EU-Verbraucherschutz und Mietrecht
A. Im Lichte der Judikatur des EuGH
B. Wohnrechtliche Aspekte der Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU
C. Schlichten statt richten
III. Das KSchG als Sediment im Bestandrecht von ABGB und MRG
I. Eine immobilienrechtliche Zeitreise
Bei der Recherche zum vorliegenden Artikel bin ich auf einen Kommentar
des – leider allzu früh verstorbenen – Weggefährten von Prof. Helmut Würth,
Dr. Wolfgang Dirnbacher gestoßen, der einleitend zur Besprechung der ersten
Klauselentscheidung (OGH 11. 10. 2006, 7 Ob 78/06 f) im Herausgeberbrief der
43. Lieferung der EWr1) schreibt: „Zunächst stellt sich natürlich die Frage, worin das
‚Sensationelle‘ an dieser Entscheidung liegt. Die Antwort darauf ist zweigeteilt. Zum
einen kann bei näherer Betrachtung nicht ernsthaft verblüffen, dass die Rechtsprechung
28 Jahre nach dem Inkrafttreten des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) dieses auch
im Bereich des Mietrechts anwendet; insofern erstaunt eher, warum nicht schon viel frü-
her seitens des Konsumentenschutzes dessen Beachtung eingefordert wurde“. Trotzdem
war die Immobilienwirtschaft gleichsam in den Grundfesten erschüttert2), hatte
doch der OGH konkret zur Frage der Erhaltungspflichten einen Standpunkt ein-
genommen, der, so Dirnbacher weiter, „überaus diskussionswürdig ist und zudem
von der Vorjudikatur – pikanterweise vom selben Senat – sowie einer nicht unerhebli-
chen Anzahl anderslautender Lehrmeinungen ohne auch nur den Versuch einer Begrün-
dung (ja nicht einmal Erwähnung) abweicht“. Ausgehend von dieser Feststellung
erscheint daher als lohnend, das historische „Nicht einmal ignorieren“ zu er-
1) Datiert mit April 2007.
2) Vonkilch bezeichnet in wobl 2007, 185 f die ersten beiden E des OGH treffend als
„Sturmflut mit Zeitverzögerung“.56 Anton Holzapfel
gründen. Ein weiterer Fokus soll aktuelle Entwicklungen, die wesentlich vom
EU-Recht beeinflusst sind, aufzeigen.
A. Mietrecht und Konsumentenschutz – zwei historische Parallelwelten
Die Rechtsprechung befindet sich mit ihrer 28-jährigen Vakanz betreffend
Mietrecht und KSchG in bester Gesellschaft. Auch bei der Literaturrecherche
gelangt man zum selben Ergebnis: Bis 2006 finden sich kaum Beiträge, die Quer-
beziehungen von Konsumentenschutz und Mietrecht herstellen3). Auch die
Österreichische Immobilienzeitung, jenes Medium, das sich über Jahrzehnte tra-
ditionell an der Schnittstelle Immobilienwirtschaft und Recht verdienstvoll um
die praxisnahe Umsetzung immobilienrelevanter Normen gekümmert hat, äu-
ßert sich in Sachen Konsumentenschutz und Mietrecht kaum. Primär sind in der
damals als ImmZ zitierten 14-tägig erscheinenden Zeitschrift konsumenten-
schutzrelevante Thematiken im Konnex mit Immobilienvermittlung zu finden4).
KSchG-Beiträge findet man dort bis zur erwähnten legendären 1. Klauselent-
scheidung einmalig aus Anlass des Inkrafttretens des KSchG im Jahr 19795).
Einzig der Widmungsträger dieser Festschrift selbst hat im Handbuch zum Kon-
sumentenschutzgesetz6) eine grundlegende Arbeit geliefert, deren Prognose-
wirkung ex post einmal mehr von dessen großartiger Analysefähigkeit zeugt. Es
lohnt sich daher ein genauerer Blick auf dieses Zeitdokument zu richten und
dies auch auszugsweise zu zitieren. Bezeichnend ist jedoch auch, dass im Kom-
mentar Würth/Zingher, Miet-und Wohnrecht, in der 19. und 20. Auflage aus dem
Jahr 1989 bzw 1997 nur auszugsweise Bestimmungen des KSchG – und diese
unkommentiert – abgedruckt sind.
Würth beschäftigt sich im 17. Kapitel des zitierten Handbuchs zum Kon-
sumentenschutzgesetz mit dem Verhältnis KSchG und Wohnungsrecht. Nach-
haltig sind seine Ausführungen betreffend das Verhältnis des KSchG zu anderen
Gesetzen. „Obwohl – von dem ausdrücklich ausgenommenen Arbeitsrecht abgesehen –
kaum ein Rechtsgebiet im Vermögensrecht so sehr von zwingenden Rechtsvorschriften
beherrscht ist wie das Mieten- und Wohnungseigentumsrecht, finden sich erstaunlich
wenig Überschneidungen, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass das KSchG im Ge-
gensatz etwa zum MG kein ‚Preisgesetz‘ sein will und sich vor allem auf ‚Nebenbestim-
mungen‘ konzentriert. Für Konkurrenzfälle ist zu beachten, dass die Normen des MG
(und anderer mietrechtlicher Vorschriften), des WGG und des WEG gegenüber dem
KSchG dort als leges speciales anzusehen sind, wo sie eine Frage unter Berücksichtigung
der Besonderheiten des Rechtsverhältnisses zwingend regeln.“ Liegen dispositive Nor-
men vor, so unterscheidet er, je nachdem, welche Regelung für den Konsumen-
3) Zu erwähnen ist der Beitrag Bauer, Konsumentenschutz und Mietrecht, wobl 2000,
257 f.
4) Vgl etwa Meinhart, Ausübungsregeln und Konsumentenschutz, Österreichische Im-
mobilien-Zeitung 1981, 5.
5) Meinhart, Konsumentenschutz und Immobilienrecht, Österreichische Immobilien-Zei-
tung 1980, 5 ff und 21 ff.
6) Würth, KSchG und Wohnungsrecht, in Krejci ua, Handbuch zum Konsumenten-
schutzgesetz (1981).Mietrecht und Konsumentenschutz 57
ten (= Mieter, Nutzungsberechtigter oder Wohnungseigentumsbewerber) güns-
tiger wäre. Sowohl Rechtsprechung als auch Lehre sind ihm bei dieser Aus-
legung gefolgt7). Im Detail sollen noch weitere Aspekte seiner Analyse wiederge-
geben werden:
a) Wesen des Verbrauchergeschäfts (§ 1 KSchG)
Intensiv beschäftigt sich Würth vor allem mit dem Unternehmerbegriff im
Hinblick auf Miet- und Nutzungsverträge. Dies hatte zuvor auch schon Meinhart
in der ImmZ mit Berufung auf Würth unternommen8). Bereits für die Verwal-
tung eines einzigen typischen „Zinshauses“ wird von ihm im Hinblick auf die
Vielzahl organisatorischer Maßnahmen eine auf Dauer angelegte Organisation
iS des § 1 Abs 2 KSchG bejaht. Als Regelungslücke erkennt er den Abschluss von
Mietverträgen, die nicht als Verbrauchergeschäft anzusehen sind (insb die Ver-
mietung einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses), bei denen der
Vermieter jedoch ein (praktisch stets im Interesse des Vermieters aufgelegtes)
Formblatt verwendet. Eine analoge Anwendung des 1. Hauptstückes des KSchG
scheint ihm daher – mit der Beschränkung auf die Bekämpfung jener Klauseln,
wie sie für derartige Formulare typisch sind – empfehlenswert.
b) Rücktrittsrecht bei Haustürgeschäften (§§ 3 f KSchG)
Für die Anwendung dieser Bestimmung im Wohnungsrecht sieht Würth
wenig praktische Fälle. Nur dann, wenn zufällig die Willenseinigung nicht in
den Arbeitsräumen des Vermieters oder eines Vertreters zustande kommt, lägen
die Voraussetzungen des § 3 leg cit vor9). Erst mit jahrzehntelanger Verspätung
hatte der OGH einen derart gelagerten Sachverhalt dann auch zu beurteilen10).
c) Verbandsklage (§§ 28 ff KSchG)
Geradezu prophetisch muten die Worte Würths an:11) „Die Verbandsklage ist
im Bereich des Mietenrechts (einschließlich der Nutzungsverträge) in einem Ausmaß
möglich, das der Gesetzgeber wohl nicht zur Gänze gesehen hat. Denn auf Unterlassung
kann von den in § 29 genannten Verbänden jedermann geklagt werden, der im geschäft-
7) Vgl Riss, Zur Abdingbarkeit der Erhaltungspflicht des Vermieters im Verbraucher-
geschäft, wobl 2002, 345.
8) AaO 5 ff und 21 ff. Wesentlicher Fokus dieses Beitrags liegt in der Analyse des Gel-
tungsbereichs des KSchG. Ist der private Hauseigentümer bei Verträgen mit Hand-
werkern als Verbraucher zu qualifizieren? Ist der Vermieter Unternehmer iS des
KSchG gegenüber dem Mieter? Meinhart stellt die ablehnende Meinung zur Unterneh-
mereigenschaft des Vermieters eines Teils der Literatur seiner eigenen und jener von
Würth im Folgejahr dann publizierten Ansicht entgegen, wonach vorrangig eine funk-
tionale Betrachtung des Unternehmerbegriffs gefordert sei, daher im Regelfall von
einem Unternehmer-Verbraucher-Verhältnis auszugehen sei, wenn eine auf Dauer
angelegte Organisation (zB auch in Form der Beschäftigung eines Dritten, etwa einer
Hausverwaltung) vorliegt.
9) Für rechtspolitisch bedenklich hielt Würth hier die Zufälligkeit des Abschlussortes.
10) OGH 28. 6. 2012, 2 Ob 1/12 d.
11) AaO 651.58 Anton Holzapfel
lichen Verkehr, worunter zweifellos auch Abschlüsse von Miet- und Nutzungsverträgen
fallen, Formblätter verwendet (also nicht verfasst oder auflegt). Da in der Praxis für
Mietverträge durchwegs Formblätter verwendet werden, die von Verlagen im Interesse
der Vermieter aufgelegt werden, enthalten sie meistens Bestimmungen, die jedenfalls im
Mietvertrag unzulässig sind, die dem Mietengesetz (und nicht nur dessen Kündigungs-
schutzbestimmungen) unterliegen.“
Mehr als ein Vierteljahrhundert später hatte die Rechtsprechung diese Auf-
gabe erstmals zu bewältigen12). StRsp ist mittlerweile, dass die Anwendbarkeit
des KSchG auch im Anwendungsbereich des MRG schon aufgrund der Klausel-
entscheidungen geklärt ist13).
Auch Jahre nach dieser einschneidenden Verbandsklagen-Judikatur, die
durch nachfolgende Entscheidungen zu Einzelfällen, gerade was die Frage der
Erhaltungspflicht und Mietzinsminderungsansprüche im Vollanwendungsbe-
reich des MRG betraf, wiederum zu relativieren war14), ist noch vieles offen. Ver-
tragsverfasser stehen vor dem Problem, dass es zur Anwendbarkeit des KSchG
und der Frage, (ab) wann ein Vermieter Unternehmer iS dieser Bestimmung ist,
nur vereinzelt oberstgerichtliche Rechtsprechung gibt. Fast schon notorisch zu
nennen ist hier die annähernde Richtzahl beim Zinshauseigentümer von etwa
fünf Wohnungen (zuletzt OGH 5. 5. 2010, 7 Ob 78/10 m).15) Vor allem hinsicht-
lich der Vermietung einzelner Eigentumswohnungen ist bislang – soweit über-
blickbar – noch keine Entscheidung ergangen16). Spätestens seit 2006 sind KSchG
und Mietrecht keine Parallelwelten mehr, sondern müssen vom Rechtsanwen-
der als kommunizierende Gefäße betrachtet werden.
B. Ein MRG für alle? Der Geltungsbereich des Mietrechts in Zahlen
Folgt man der Ansicht von Würth, wonach das MRG lex specialis zum KSchG
sei, so gilt es auch noch, einen quantitativen Überblick über die Anwendung des
historisch gewachsenen und mittlerweile auch Experten nur noch schwer über-
schaubaren Mietrechts zu gewinnen. Denn durchaus pointiert ist die Frage zu
12) Vgl hiezu ausführlich Vonkilch, Mietverträge im Fokus des Verbraucherrechts – Eine
Zwischenbilanz nach den ersten beiden Verbandsprozessen, wobl 2007, 185ff.
13) OGH 27. 5. 2010, 5 Ob 64/10 p mit Verweis auf 1 Ob 241/06 g, 7 Ob 78/06 f (JBl 2007,
181 = wobl 2007/26) und 6 Ob 81/09 v.
14) Stichwort „Grauzone“ des § 3, dazu zuletzt Fidler, Mietzinsminderung ohne Mangel,
wobl 2014, 129 mwN.
15) Übrigens die erste in der Sammlung Dirnbacher, EWr in der Rubrik KSchG zitierte Ent-
scheidung!
16) Vgl eine ähnlich unbefriedigende rechtliche Situation in Deutschland, wo die eigene
Vermögensverwaltung nicht dem Unternehmerbegriff des § 14 BGB unterstellt wird,
außer sie erfordert einen planmäßigen Geschäftsbetrieb (BGHZ 149, 80, juris RN 23f).
In der Rechtsprechung der Instanzgerichte reicht aber zuweilen schon die Vermietung
von zwei Einfamilienreihenhäusern und einer Einliegerwohnung (OLG Düsseldorf
NJW-RR 1995, 13, 17), um den Unternehmerbegriff zu erfüllen. Das AG Lichtenberg
hatte dies schon bei einer einzelnen Wohnung angenommen, wenn diese im Wettbe-
werb mit anderen zum Zweck der Gewinnerzielung angeboten werde (21. 6. 2007, AZ
10 C 69/07 RN 33).Mietrecht und Konsumentenschutz 59
stellen: Wen schützt das Mietrechtsgesetz? Beati possidentes von Altverträgen
und glückliche „Erben“ von Mietwohnungen, für die im Schnitt zwischen zwei
und drei Euro pro Quadratmeter, maximal ein mit dem Kat-A-Betrag limitierter
Richtwertmietzins von derzeit 3,43 Euro lukriert werden kann, fern von Markt
und Erhaltungsnotwendigkeiten des Hauses?17) Wie viele Verträge unterliegen
nur dem Bestandrecht des ABGB?
Analysiert man die Segmente des Wohnungsbestands zeigt sich, dass Öster-
reich ein klassisches Land der Eigenheimbesitzer ist18): Rund die Hälfte des
Wohnungsbestands wird von privaten Eigentümern selbst bewohnt. Der über-
wiegende Teil davon bewohnt ein Ein- oder Zweifamilienhaus. Für eine An-
mietung eines dieser Objekte gilt das MRG bekanntermaßen überhaupt nicht
(mehr).
Rund 24% des Wohnungsbestandes stellen sozial gebundene Mietwohnun-
gen (Kommunen, gemeinnützige Bauvereinigungen). Nur 16% des Wohnungs-
bestands entfallen auf private Mietwohnungen. Von österreichweit rund 1,5 Mio
als Hauptwohnsitz genutzten Hauptmietwohnungen werden mehr als die
Hälfte (60%) durch kommunale und gemeinnützige Vermieter vermietet19).
Der „klassische“ private Mietwohnungsbestand, der dem Vollanwendungs-
bereich des Mietrechtsgesetzes (Altbau) unterliegt, nimmt mit rund 325.000 Woh-
nungen etwas weniger als ein Viertel des Mietwohnungsbestandes ein, ein Groß-
teil davon ist in Wien zu finden.20)
Dadurch, dass die Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes primär auf das
Gebäudealter abstellt, reduziert sich dessen wohnrechtliche Bedeutung auf Wien
und einzelne größere Landeshauptstädte. Für das übrige Österreich hat der dem
Vollanwendungsbereich des MRG unterliegende Mietwohnungsbestand zah-
lenmäßig hingegen nur wenig Bedeutung21).
Insoferne mag es nicht verwundern, dass Vertreter aller interessierten Grup-
pen (Mieter, Vermieter, rechtsberatende Berufe, Immobilientreuhänder, Richter,
Konsumentenschutzorganisationen) mit dem Status quo des Mietrechts nicht
zufrieden sind. Selbstverständlich ist das Thema Wohnen ein beliebtes Wahl-
kampf-Instrument. Hinzu kommt, dass gerade mit der zu erwartenden stark
steigenden Bevölkerungsentwicklung in Wien bis zum Jahr 203022) die Wohn-
raumsituation keinesfalls entspannt wird. Demographische Entwicklungen
17) Welche gravierenden Auswirkungen das zB auf die verfügbare HMZ-Reserve hat,
zeigt Kothbauer in dieser Festschrift 79 ff hinsichtlich des Lagezuschlags beim Richt-
wert eindrucksvoll auf. Umso mehr ist diese Rechnung bei jenen Häusern frappie-
rend, die noch von vielen Altverträgen belastet werden.
18) Dazu ausführlich Holzapfel/Weinberger, Mietrecht Österreich in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft – die Sicht der Immobilienwirtschaft, in Wippel, Wohnbaukultur in
Österreich. Geschichte und Perspektiven (in Druck).
19) Lugger/Amann, Der soziale Wohnbau in Europa – Österreich als Vorbild (2006).
20) Statistik Austria, Mikrozensus 2012, Sonderauswertung ÖVI.
21) Vgl dazu ausführlich Kothbauer in dieser Festschrift 79 ff mit Bezug die Anwendbar-
keit des Richtwertmietzinses.
22) Der gerade in Verhandlung befindliche Stadtentwicklungsplan 2025 (STEP) geht von
einem zusätzlichen Wohnraumbedarf für mehr als 200.000 Personen aus.60 Anton Holzapfel
(mehr Single-Haushalte, längerer Verbleib der immer älter werdenden Bevöl-
kerung in den eigenen vier Wänden) verstärken diese Erwartungen. Die Posi-
tionen in der derzeit beim BMJ angesiedelten Expertengruppe scheinen dem
Vernehmen nach verhärtet: Investitionsanschub durch Liberalisierung und
Schaffung von mehr Angebot steht der Erwartung von fixen Preisbildungsrege-
lungen gegenüber.
Spätestens hier findet das Konsumentenschutzgesetz wieder Eingang in die
Diskussion. Unter der Prämisse der Transparenz wird die Preisbildung beim
Richtwertmietzins als ineffizient kritisiert. Wie Kothbauer 23) überzeugend dar-
zustellen weiß, sind wohl maßgebliche Geburtsfehler des Richtwertsystems für
gewisse Fehlentwicklungen verantwortlich. Eine Rückkehr zu einem fixen Preis-
bildungssystem wird selbst von manchen Mietervertretern abgelehnt24).
Ein europäisches rechtsvergleichendes Projekt, angesiedelt an der Universi-
tät Bremen, erarbeitet derzeit eine detaillierte Beschreibung der länderweise gel-
tenden Mietrechtsbestimmungen25). Zu hoffen ist, dass ein verantwortungs-
voller Gesetzgeber weiter als bis zum nächsten Wahltermin denkt, und hier mit
Augenmaß vorgeht. Bedenkt man, dass ohnehin sechzig Prozent aller Mieter mit
Unterstützung der öffentlichen Hand wohnversorgt sind, so stellt sich ferner die
Frage, ob gerade jene, die eine günstige Wohnversorgung bräuchten, auch da-
von profitieren können26). Vorerst bleibt ein Mietrecht für alle wohl realpolitisch
gesehen Utopie.
II. EU-Verbraucherschutz und Mietrecht
Spätestens mit der Umsetzung der EU-Verbraucherrechte-RL wurde auch
in der Immobilienwirtschaft erneut das Bewusstsein geschärft, dass viele
der relevanten Normen nicht mehr vom nationalen Gesetzgeber, sondern vom
europäischen Gesetzgeber determiniert werden27). Mieterschutzbestimmun-
gen sind seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in vielen europäischen Ländern
nachzuweisen. Kriegsbedingte Wohnraumzwangsbewirtschaftung wurde in
den Jahren nach dem 1. Weltkrieg abgelöst von Spezialgesetzen oder Novel-
lierungen der allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen.28) Über viele Jahr-
23) In dieser Festschrift 79 ff.
24) http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140228_OTS 0040/mieterbund-oemb-
bezweifelt-aussagekraft-der-ak-umfrageergebnisse (zuletzt abgefragt am 24. 6. 2014).
25) http://www.tenlaw.uni-bremen.de/ (zuletzt abgefragt am 24. 6. 2014).
26) Weiterführend dazu Holzapfel/Weinberger aaO.
27) Vgl Holzapfel, Die Verbraucherrechte-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf den Mak-
lervertrag, immolex 2014, 181.
28) Die „Verordnung über den Schutz der Mieter“ vom 26. 1. 1917 schränkte das Kündi-
gungsrecht der Vermieter weitgehend ein. Mietzinsanpassungen waren nur mehr
hinsichtlich veränderter Betriebs- und Instandhaltungskosten und der seit Kriegsbe-
ginn gestiegenen Steuern möglich. Am 1. 5. 1922 wurde das Mietengesetz beschlos-
sen, das nach Struktur und Inhalt – trotz aller Unterschiede – für das heute geltende
Mietrechtsgesetz (MRG) von 1982 als Vorlage dient.
Vgl für Deutschland VO zum Schutz der Mieter vom 26. 7. 1917, RGBl 1917, 659.Mietrecht und Konsumentenschutz 61
zehnte war das Mietrecht als nationale Domäne unangefochten. Die EU hat das
Thema Konsumentenschutz erst relativ spät für sich reklamiert und in ein-
zelnen Rechtsakten umgesetzt, so in der Haustürgeschäfte-Richtlinie 85/577/
EWG. Maßgeblichen Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung von Verbrau-
cherverträgen – und damit auch viele Mietverträge – hatte erstmals die Richt-
linie 93/13/EWG des Rates vom 5. 4. 1993 über missbräuchliche Klauseln in
Verbraucherverträgen.
Letztlich wirken die europäischen Rechtsakte betreffend Verbraucher aber
eher fragmentarisch. Auch wenn mit der Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU die
Zielsetzung der Schaffung eines kohärenten Systems verbunden war, ist das
schlussendlich verabschiedete Dokument weit davon entfernt29).
Es scheint so, als ob die Zielsetzungen der binnenmarktorientierten Verbrau-
cherrechte-Aktivitäten mit anderen Prioritäten versehen wären, als man sie aus
dem innerstaatlichen Schutzgedanken kennt. Sie dienen nicht primär dem sozia-
len Verbraucherschutz, sondern dem Schutz des grenzüberschreitend agieren-
den Verbrauchers, der in einem möglichst perfekten Binnenmarkt seine Grund-
freiheiten leben kann30).
A. Im Lichte der Judikatur des EuGH
Vor allem die Rechtsfortbildung durch die Judikatur des EuGH scheint in-
nerstaatlich noch immer zu wenig auf dem Monitor der Rechtsanwender auf
und sorgt zuweilen für Erstaunen. Man denke beispielsweise an die E EuGH
14. 6. 2012, C-618/10 (Banco Espanol de Credito), in der eine ergänzende Vertrags-
auslegung einer missbräuchlichen Klausel ausgeschlossen wird. Die Nichtan-
wendbarkeit der geltungserhaltenden Reduktion bei intransparenten Klauseln
war schon bisher Judikatur des OGH, in Zukunft wird nach der Auslegung des
EuGH einer ergänzende Vertragsauslegung einer missbräuchlichen Klausel nur,
wenn es dem Verbraucher zum Vorteil gereicht, möglich sein.31)
Von Interesse ist eine weitere jüngere E des EuGH zur Anwendbarkeit der
RL 93/13/EWG auf Wohnraummietverträge, die mit einer bemerkenswerten so-
zialen Begründung aufhorchen lässt32): „Dieser Schutz ist von besonderer Bedeutung
bei einem Vertrag über die Vermietung von Wohnraum, der von einer Privatperson, die
zu privaten Zwecken handelt, und einem Gewerbetreibenden der Immobilienbranche ge-
schlossen wird. Die Folgen der zwischen den Parteien bestehenden Ungleichheit werden
nämlich noch dadurch verschärft, dass sich ein solcher Vertrag in wirtschaftlicher Hin-
sicht auf ein grundlegendes Bedürfnis des Verbrauchers, nämlich die Wohnungsbeschaf-
fung, bezieht und Beträge betrifft, die für den Mieter meist einen der größten Haushalts-
29) Vgl Tonner, Das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie – unionsrecht-
licher Hintergrund und Überblick, VuR 2013, 443.
30) Vgl die Erwägungsgründe 3 und 4 der RL 2013/11/EU über die alternative Streitbei-
legung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten: „. . . Für die Vollendung des Binnenmarkts
ist es unerlässlich, direkte oder indirekte Hemmnisse für das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarkts zu beseitigen und das Vertrauen der Bürger zu stärken“.
31) OGH 5. 6. 2007, 10 Ob 67/06 k.
32) EuGH 30. 5. 2013, C-488/11 (Asbeek Brusse und de Man Garabito).62 Anton Holzapfel
posten darstellen, während es sich in rechtlicher Hinsicht um einen Vertrag handelt, der
in der Regel unter eine komplexe nationale Regelung fällt, die den Privatpersonen oft
kaum bekannt ist.“
Im Geiste einer solchen Judikatur sind weitere Entscheidungen des OGH in
Sachen Transparenzgebot wohl schon bald zu erwarten.
B. Wohnrechtliche Aspekte der Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU
Die Verbraucherrechte-RL wird in Österreich mit dem FAGG 2014, BGBl
I 2014/33 umgesetzt. Grundsätzlich sind sowohl von der Richtlinie als auch in
der Umsetzung durch den österreichischen Gesetzgeber, vereinfachend gespro-
chen, Kaufverträge über Immobilien und Wohnungsmietverträge ausgenom-
men. Warum diese sprachliche Differenzierung? In den wortidenten Ausnahme-
tatbeständen von RL und FAGG sind ua folgende Verträge angeführt:
• über die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder
anderen Rechten an unbeweglichen Sachen
• über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an beste-
henden Gebäuden oder die Vermietung von Wohnraum.
Erwägungsgrund 26 der zit RL begründet dies damit, dass diese angeführten
Verträge bereits Gegenstand einer Reihe spezifischer einzelstaatlicher Rechts-
vorschriften wären. Auf den ersten Blick mag verwundern, dass die Wohnraum-
miete ausdrücklich angeführt ist, wo doch schon die Wendung „oder anderen
Rechten an unbeweglichen Sachen“ die Subsumierung der Miete unter die Aus-
nahmetatbestände der RL nahelegen würde. Stabentheiner argumentiert argu-
mentum e contrario damit, dass Mietverträge zu anderen Zwecken als Wohn-
zwecken sehr wohl dem Anwendungsbereich des FAGG unterliegen, also
beispielsweise Verträge über neutrale Objekte wie etwa Garagen33). Folgt man
dieser Einschätzung, dann ist eine viel wesentlichere Gruppe von Verträgen
auch vom FAGG erfasst, nämlich Gründungsgeschäfte über Mietverträge. Frei-
lich stimmt schon bedenklich, dass der vom österreichischen Gesetzgeber (in ge-
genüber der RL überschießender Umsetzung) verwendete Unternehmerbegriff
des KSchG, der auch Gründungsgeschäfte umfasst, hier zu Ehren kommt. In der
Praxis wird das Problem wohl nicht so von erheblicher Bedeutung sein, da ja je-
denfalls ein Vertragsschluss in einer Fernabsatz- oder Auswärtsgeschäft-Situa-
tion vorliegen müsste. Es mag schon sein, dass manch Mietvertrag bisher im
Rahmen der Übergabe des Objekts direkt vor Ort unterzeichnet wurde (arg
„Rügepflicht“), ein Vermeiden der AGV-Situation wird aber leicht möglich sein,
indem der Vertrag beispielsweise in den Geschäftsräumen des beauftragten
Hausverwalters oder Maklers abgeschlossen wird. Zu klären wird jedoch eine
andere Frage im Zusammenhang mit der Vermietung sein: Sollte ein Vermieter,
der als Unternehmer iS des KSchG angesehen wird, keine Verwaltung beschäf-
tigen, sondern diese Tätigkeiten selbst durchführen, welche Räume können als
seine Geschäftsräume iS des FAGG angesehen werden?
33) Stabentheiner, Jahrbuch Wohnrecht 2014 (2014) 18.Mietrecht und Konsumentenschutz 63
C. Schlichten statt richten
Das österreichische Wohnrecht kennt seit vielen Jahren das landläufig
„Schlichtungsstellenverfahren“ genannte Institut der Gemeindeschlichtungs-
stelle. Verfügt eine Gemeinde über einen in Mietangelegenheiten geschulten
Beamten oder Angestellten und rechtfertigt die Anzahl der anfallenden Ver-
fahren nach § 37 Abs 1 MRG die Betrauung der Gemeinde mit dem Zweck der
Entlastung des Gerichts, so kann ein Verfahren nach § 37 Abs 1 MRG hin-
sichtlich der in der Gemeinde gelegenen Mietgegenstände nur bei Gericht
eingeleitet werden, wenn zuvor die Sache bei der Gemeinde anhängig ge-
macht wurde. Solche Schlichtungsstellen existieren derzeit in Graz, Innsbruck,
Klagenfurt, Leoben, Linz, Mürzzuschlag, Neunkirchen, Salzburg, St. Pölten,
Stockerau und Wien. Ergänzend sei erwähnt, dass auch bestimmte Angele-
genheiten des WEG und WGG von den Gemeindeschlichtungsstellen wahrge-
nommen werden.
Mit zwei EU-Rechtsakten, nämlich der ADR RL 2013/11/EU und der ODR-
Verordnung der EU werden Instrumente der außergerichtlichen Streitbeilegung
bis Sommer 2015 in Österreich umzusetzen sein, die ein ganz anderes, näm-
lich weitaus geringeres Instrumentarium zur Verfügung haben, um im Streitfall
schlichtend einzugreifen. Anders als bei den Gemeindeschlichtungsstellen
kommt diesen Institutionen keine entscheidende, sondern immer nur ein vermit-
telnde Rolle zu34). Die Grundsätze dieser Schlichtungsstellen basieren im We-
sentlichen auf dem Gedanken der Freiwilligkeit aller Beteiligten. Das Verfahren
muss kostenlos bzw nur gegen eine geringe Gebühr möglich sein. Ein Abschluss
muss grundsätzlich binnen 90 Tagen erfolgen. Nicht primär spezifische miet-
rechtliche Fachkompetenz ist gefragt, sondern Mediationskunst. Die Erfahrun-
gen eines vom BMASK 2013 angesetzten Pilotprojekts sind – soweit ersichtlich –
noch nicht öffentlich zugänglich. Im Jahrbuch Wohnrecht 201435) beschreibt
Stabentheiner etliche der auftauchenden Problemstellungen: Parallelität von
Gemeindeschlichtungsstellen und allgemeinen Schlichtungsstellen, territoriale
Verteilung in Österreich, Fachkompetenz der Schlichter.
Der Autor dieses Beitrags stellt gerne die in mehr als 15 Jahren erworbene
Expertise einer Clearingstelle des Österreichischen Verbands der Immobilien-
wirtschaft zur Verfügung, um die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die
mit einem solchen Instrument verbunden sind, aufzuzeigen. Als äußerst kom-
plex erweist sich im Regelfall die Feststellung des Sachverhaltes und ein mögli-
ches Außerstreitstellen von Tatsachen. Auch wenn der Schlichter die fachliche
Kompetenz hat, einen Lösungsvorschlag einzubringen, begibt er sich oft auf
dünnes Eis, weil zuweilen kein ausreichendes Vorbringen gegeben ist, um dem
Wahrheitsgehalt näher zu kommen. Der in einem gerichtlichen Verfahren gege-
bene Rechtsschutz im Interesse beider Parteien wird hier sicherlich verdünnt.
Das Instrument ist primär geeignet, blockierte Kommunikation wieder in Gang
zu bringen und lösungsorientierte Verhandlungen zu unterstützen. Als echte
34) Stabentheiner aaO.
35) Siehe FN 33.64 Anton Holzapfel
Alternative zu einem bisher in Österreich gängigen Schlichtungsverfahren ist es
mE nicht geeignet, weil die Sachverhalte zu komplex sind.
III. Das KSchG als Sediment im Bestandrecht von ABGB und MRG
Ein weiterer Aspekt soll noch angeführt werden. Nicht nur das Europarecht
beeinflusst unmittelbar die wohnrechtliche Rechtslage in unterschiedlichen Seg-
menten. Auch die Differenzierung zwischen dem Vollanwendungsbereich des
MRG, dem Teilanwendungsbereich und dem Vollausnahmebereich bringt deut-
liche Disparitäten zu Tage. Schichtartig lagern sich verschiedene Normen über-
einander. Zwar gilt das eingangs konstatierte Bild der Parallelwelten nicht mehr;
dass kommunizierende Gefäße Wohnrecht – KSchG vorhanden wären, ist aber
auch nicht erkennbar, es handelt sich eher um Ablagerungen. Als redaktioneller
Herausgeber der letzten, von Dr. Dirnbacher noch zum großen Teil persönlich er-
stellten Auflage des Buches MRG sei es mir gestattet, Dirnbachers Zusammenfas-
sung bezüglich Erhaltungspflichten an dieser Stelle besonders zu empfehlen und
darauf zu verweisen. Sie geben ein anschauliches Bild davon, welche Auswir-
kungen das KSchG auf die Zulässigkeit derartiger Vereinbarungen in den unter-
schiedlichen Anwendungsbereichen des Bestandrechts hat.36). Abschließend
kann nur der Wunsch an den Gesetzgeber geäußert werden, de lege ferenda für
Rechtssicherheit zu sorgen, und das komplexe Zusammenspiel von Bestand-
recht und KSchG mehr zu berücksichtigen.
36) Dirnbacher, MRG 2013 (2013) 121 ff.Sie können auch lesen