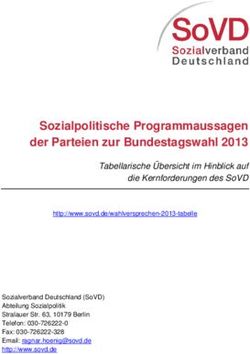Im Dickicht der Gesundheitsreform - "Bürgerversicherung" und "Kopfpauschale"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Nr. 79
November 2003
Argumente
zu Marktwirtschaft und Politik
„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der
Gesundheitsreform
Verkürzte Begriffe verschleiern die inhaltliche
Unzulänglichkeit beider Vorschläge
Von Lüder Gerken und Guido Raddatz
Stiftung Marktwirtschaft, Berlin
ISSN: 1612 – 7072 (Print-Version)
Vorstand Charlottenstraße 60 Telefon: +49 (0)30 206057-0 E-Mail: info@stiftungmarktwirtschaft.de
Dr. habil. Lüder Gerken D-10117 Berlin Telefax: +49 (0)30 206057-57 Internet: www.stiftung-marktwirtschaft.de„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
chen. Erstens werden die Reformvorschläge durch-
weg mit irreführenden und teilweise auch pola-
1 Einleitung risierenden Begriffen versehen, die – zumindest dem
gesundheitsökonomischen Laien, an den sich die
Kontinuierlich steigende Beitragssätze in der Ge- Politik in der Regel wendet – eine sinnvolle Differen-
setzlichen Krankenversicherung sind für die Politik zierung erschweren, wenn nicht gar unmöglich ma-
nichts Neues. Seit Jahrzehnten versucht sie dieser chen. Diese Begriffswahl trägt dazu bei, daß zwei-
Entwicklung durch wiederholte Neuauflagen soge- tens die entwickelten Modelle inhaltlich nur verkürzt
nannter Gesundheitsreformen entgegenzuwirken. aufgegriffen werden, so daß die entscheidenden
Die Bezeichnung „Reform“ verdienen diese Pro- Elemente der einzelnen Konzepte, aber auch die
gramme jedoch allesamt nicht. Denn anstatt effi- Unterschiede zwischen ihnen unberücksichtigt blei-
zienzsteigernde Systemveränderungen vorzuneh- ben. Und beides erleichtert es drittens der Politik,
men, hat man bislang mit planwirtschaftlich anmu- sich vor allem darum zu sorgen, wie mit inhaltsver-
tenden Instrumenten versucht, die Gesundheits- zerrenden Worthülsen die nächste Wahl zu gewin-
märkte zu steuern – ein Vorgehen, das notwendiger- nen ist, statt sich um Sachargumente für ein lang-
weise zum Scheitern verurteilt ist. Auch die jüngst fristig tragfähiges Konzept zu bemühen. Der folgen-
von der Bundesregierung und der CDU/CSU-Oppo- de Abschnitt setzt sich zunächst mit den ersten bei-
sition gemeinsam beschlossenen Kurzfristmaßnah- den Problemen auseinander. Im Anschluß daran
men stehen in der bisherigen Tradition. wird auf die zentralen inhaltlichen Argumente einge-
gangen, die in der politischen Diskussion eine Rolle
Inzwischen ist jedoch Bewegung in die politische spielen sollten.
Diskussion gekommen. Zumindest ein Teil der poli-
tischen Akteure hat erkannt, daß grundlegendere
Reformen als in der Vergangenheit notwendig sind,
um das System der Gesetzlichen Krankenversiche-
2 Begriffsverwirrung und
rung wieder zukunftsfähig zu machen. Insbesondere
die von der Bundesregierung eingesetzte Rürup- inhaltliche Verkürzungen der
Kommission wie auch die von der CDU eingesetzte gegenwärtigen Diskussion
Herzog-Kommission haben Vorschläge entwickelt,
die derzeit sowohl in den jeweiligen Parteien als
auch unter Gesundheitsexperten und in der Öffent- 2.1 Die zwei Vorschläge
lichkeit heftig diskutiert werden. Bei allen zu be- der Rürup-Kommission
rücksichtigenden Unterschieden ist diesen Reform-
modellen eines gemein: Jedes für sich würde das Begonnen haben die begrifflichen Unzulänglich-
gegenwärtige Krankenversicherungssystem in keiten mit den Vorschlägen der sogenannten
Deutschland grundlegend verändern. Daß der Rürup-Kommission. Aufgrund inkompatibler Vor-
Status quo in Frage gestellt wird, ist angesichts der stellungen der beiden gesundheitspolitischen
bisher zu beobachtenden Beharrungstendenzen im Hauptakteure, Bert Rürup und Karl Lauterbach,
Gesundheitswesen zu begrüßen. Zentrale Aufgabe hat sie zwei alternative Grundmodelle zur Dis-
der nächsten Monate muß es daher sein, aus den kussion gestellt, zwischen denen die Politik eine
diversen Vorschlägen dasjenige Reformkonzept Wahlentscheidung treffen soll. Beide haben eine
herauszufiltern, das die zukünftigen Herausforde- Abkopplung der Lohnnebenkosten vom überpro-
rungen im Gesundheitswesen am besten bewältigen portionalen Ausgabenanstieg im Gesundheits-
kann. wesen zum Ziel. So soll verhindert werden, daß
der Faktor Arbeit immer stärker belastet wird,
Es ist allerdings mehr als fraglich, ob der gegenwär- wenn die Ausgaben im Gesundheitswesen auf-
tige Diskussionsprozeß dazu in der Lage ist. Denn grund der zunehmenden Altersstruktur und des
die medial geprägte politische und öffentliche medizinisch-technischen Fortschritts stärker als
Auseinandersetzung über die vorliegenden Vor- der Rest der Wirtschaft wachsen. Denn im gegen-
schläge ist durch gravierende Defizite charakteri- wärtigen lohnbezogenen System erhöht jeder
siert, die eine rationale Entscheidung zugunsten des Anstieg der Beitragssätze die Lohnnebenkosten
besten Reformkonzeptes unwahrscheinlich ma- und damit die Arbeitslosigkeit.
3„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
n
Das „Lauterbach-Modell“ lich machen. Verantwortlich für die begriffliche
Kernelement ist erstens die Erweiterung der und damit auch für die inhaltliche Konfusion sind
gegenwärtig ausschließlich lohnbezogenen die beiden Antipoden der Rürup-Kommission
Bemessungsgrundlage selbst, die die Begriffe für
auf alle Einkommensar- Wer „Bürgerversicherung“ ihre beiden Modelle ge-
ten; der Versicherungs- und „Kopfpauschale“ gegen- prägt haben: Gegen die
beitrag soll sich also überstellt, vergleicht Apfelsaft „Bürgerversicherung“ des
nicht mehr allein nach mit Birnenschnaps. Karl Lauterbach stellte man
dem Arbeitseinkommen das „Gesundheitsprämien-
einer Person, sondern nach dem gesamten Ein- modell“ des Bert Rürup.
kommen einschließlich z.B. Zinserträgen und
Mieteinnahmen richten. Kernelement ist zwei- Als Ausdruck zweier alternativer, einander gegen-
tens, daß alle Bürger in der Gesetzlichen überstehender Reformvorschläge ergibt das Be-
Krankenversicherung pflichtversichert sein sol- griffspaar „Bürgerversicherung“ versus „Gesund-
len und so zu ihrer Finanzierung herangezogen heitsprämie“ oder „Kopfpauschale“ jedoch keinen
werden. Für die lohnabhängigen Beitragsteile Sinn. Denn für eine sachgerechte Diskussion die-
ist weiterhin eine paritätische Finanzierung vor- ser beiden Vorschläge muß zwingend zwischen
gesehen; Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen zwei inhaltlichen Problemkreisen und damit zwi-
also insoweit jeweils die Hälfte des Versiche- schen zwei zu treffenden Entscheidungen differen-
rungsbeitrags zahlen. Für dieses Modell wurde ziert werden:
der Begriff der „Bürgerversicherung“ geprägt.
— Welcher Personenkreis unterliegt der Versiche-
n
Das „Rürup-Modell“ rungspflicht, wird also in die Versicherung
Kernelement ist erstens eine pauschale Ver- gezwungen?
sicherungsprämie; die erwachsenen Versicher-
ten einer Krankenkasse sollen also unabhängig — Wovon hängt die Höhe des Beitrags für den ein-
von ihrem Einkommen einen einheitlichen Bei- zelnen Versicherten ab?
trag zahlen. Kernelement ist zweitens, daß
nicht sämtliche Bürger in einer solchen Versi- Beide Fragen sind unabhängig voneinander, so
cherung zwangsversichert sein sollen, sondern daß eine Vielzahl von Reformmodellen möglich ist.
nur – wie bisher auch – Arbeitnehmer bis zu ei- In der gegenwärtigen Diskussion herrschen jeweils
ner bestimmten Einkommensgrenze und Rent- zwei Vorschläge vor.
ner. Der soziale Ausgleich wird in diesem Mo-
dell über das Steuer-Transfer-System vollzo- Beim pflichtversicherten Personenkreis wird diffe-
gen, indem sozial Schwache eine staatliche renziert zwischen
Transferzahlung zur Finanzierung ihrer Versi-
cherungsprämie erhalten. Für diesen Vorschlag n
Arbeitnehmern und
wurde von der Kommission der Begriff „Ge- n
allen Bürgern.
sundheitsprämien-Modell“ gewählt. In der all-
gemeinen Diskussion hat sich jedoch der Be- Die Bemessungsgrundlage für die individuellen
griff „Kopfprämien-Modell“ oder „Kopfpau- Versicherungsbeiträge orientiert sich entweder an
schalen-Modell“ etabliert.
n
der einzelnen Person oder
n
am Einkommen.
2.2 Begriffsdurcheinander:
Eine Klarstellung Aus der Kombination dieser Vorschläge ergeben
sich vier Reformmodelle:
Die Begriffe „Bürgerversicherung“ und „Kopfpau-
schale“ kleiden die Reformvorschläge in unge- (1) Pauschale Arbeitnehmerversicherung
naue, nebulöse und irreführende Worthülsen, die Pflichtversichert sind nur Arbeitnehmer mit einem
eine sachliche Diskussion und eine sachgerechte Einkommen unterhalb einer Versicherungspflicht-
Abwägung zwischen beiden Konzepten unmög- grenze (und Rentner). Der Versicherungsbeitrag
4„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
wird pauschal erhoben, ist also innerhalb einer (4) Einkommensabhängige Bürgerversicherung
Kasse für alle Versicherten gleich. Das ist der Vor- Pflichtversichert sind alle Bürger. Der Versiche-
schlag Rürups. rungsbeitrag orientiert sich bis zu einer Beitrags-
bemessungsgrenze am Gesamteinkommen. Das
(2) Pauschale Bürgerversicherung ist der Vorschlag Lauterbachs.
Pflichtversichert sind alle Bürger. Auch hier wird
der Versicherungsbeitrag pauschal erhoben. Einen Diese vier Reformmodelle sind in Abbildung 1
solchen Vorschlag haben beispielsweise Knappe wiedergegeben. Die modellübergreifenden Be-
und Arnold für die Vereinigung der Bayerischen griffe „Kopfpauschale“ und „Bürgerversicherung“
Wirtschaft (vbw) entwickelt. stehen in dieser Tabelle, wo sie hingehören, also
gerade nicht dort, wo sie als – falsche – Synonyme
(3) Einkommensabhängige des Rürup-Modells und des Lauterbach-Modells
Arbeitnehmerversicherung in der öffentlichen Diskussion immer wieder auf-
Pflichtversichert sind nur Arbeitnehmer (und Rent- tauchen. Zum Vergleich wird in der letzten Zeile
ner). Der Versicherungsbeitrag orientiert sich bis auch der Status quo in dieses Betrachtungskon-
zu einer Versicherungspflichtgrenze am Gesamt- zept eingeordnet: In der Gesetzlichen Krankenver-
einkommen. Dieses Modell schlägt die Herzog- sicherung pflichtversichert sind heute nur die
Kommission für einen Übergangszeitraum von Arbeitnehmer mit Lohneinkommen unterhalb der
rund 10 Jahren vor. Versicherungspflichtgrenze sowie Rentner.
Abbildung 1: Reformkonzepte der Rürup-Kommission und alternative Varianten
Pflichtversicherte
Alle Bürger
Arbeitnehmer
„Bürgerversicherung“
Bemessungsgrundlage
pauschale Beiträge pauschale pauschale
Arbeitnehmerversicherung Bürgerversicherung
„Kopfpauschale“ (Rürup-Modell) (u.a. Knappe/Arnold)
einkommensabhängige einkommensabhängige
einkommensabhängige
Arbeitnehmerversicherung Bürgerversicherung
Beiträge
(Herzog-Modell, Stufe 1) (Lauterbach-Modell)
lohnabhängige
lohnabhängige
Arbeitnehmerversicherung —
Beiträge
(Status quo)
5„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
Die Übersicht macht deutlich, daß unterschiedliche All dies zeigt, wie kontraproduktiv die bisherige
Sachverhalte undifferenziert miteinander vermischt Diskussion auf Basis der Begriffe „Bürgerversiche-
werden. Anders ausgedrückt: Wer „Bürger- rung“ und „Kopfpauschalen“ verläuft. Während
versicherung“ und „Kopfpauschale“ gegenüber- das Konzept einer pauschalen Bürgerversicherung
stellt, vergleicht Apfelsaft mit Birnenschnaps. von Arnold und Knappe sowohl eine „Bür-
gerversicherung“ als auch ein „Kopfpauschalen“-
Die Begriffe „Kopfpauschale“ und „Gesundheits- Modell ist, fällt die einkommensabhängige Arbeit-
prämie“ umschreiben lediglich, daß es einen ein- nehmerversicherung der ersten Stufe des Herzog-
heitlichen Beitrag für die Versicherten, unabhängig Konzepts durch das bisherige Begriffsraster kom-
von ihrem jeweiligen Einkommen, geben soll. Of- plett hindurch.
fen bleibt dabei, wer zu dem Kreis der Pflichtver-
sicherten gehört. Umgekehrt stellt der Begriff Zielführend ist dagegen die folgende Begriffsbil-
„Bürgerversicherung“ ausschließlich darauf ab, dung, welche die beiden relevanten inhaltlichen
wer pflichtversichert ist, und läßt die Grundlage Dimensionen der Bemessungsgrundlage und des
der Beitragserhebung – lohnabhängige, einkom- Pflichtversichertenkreises umfaßt. Entsprechend
mensabhängige, pauschale oder vielleicht gar risi- den in Abbildung 1 dargestellten Kombinations-
koabhängige Beiträge – unbeachtet. Mit dem glei- möglichkeiten sind vier Alternativen zu unterschei-
chen Recht, mit dem derzeit die einkommensab- den:
hängige Bürgerversicherung (Lauterbach-Modell)
mit dem Begriff Bürgerversicherung besetzt ist, n
die einkommensabhängige Arbeitnehmerver-
könnte man auch eine pauschale Bürgerversiche- sicherung,
rung (Knappe-Arnold-Modell), als Bürgerversiche- n
die pauschale Arbeitnehmerversicherung,
rung bezeichnen. Beide Bürgerversicherungen ha- n
die einkommensabhängige Bürgerversiche-
ben jedoch völlig unterschiedliche Implikationen, rung sowie
so daß man sie auch sprachlich auseinander hal- n
die pauschale Bürgerversicherung.
ten muß. In der öffentlichen Diskussion werden
diese verschiedenen Implikationen aufgrund der Allein eine solche differenzierende Begriffsabgren-
irreführenden Begriffsprägung derzeit nicht einmal zung kann als Grundlage für eine transparente und
ansatzweise wahrgenommen. an Sachargumenten orientierte politische Ausein-
andersetzung dienen.
Daß die derzeitige Begriffsverwendung zu einer in-
haltlich verkürzten Diskussion führt, wird auch deut-
lich, wenn man das Konzept der Herzog-Kommis-
sion in die Betrachtung einbezieht, welche eine ein-
3 Pauschale oder
kommensabhängige Arbeitnehmerversicherung
propagiert. Für eine Übergangsphase von circa 10 einkommensabhängige
Jahren fordert die Herzog-Kommission, ähnlich wie Versicherungsbeiträge?
das Lauterbach-Modell und im Gegensatz zum
Rürup-Modell, eine Ausweitung der Bemessungs- Für die Frage, ob pauschale oder einkommensab-
grundlage auf alle Einkommenskategorien. Aller- hängige Versicherungsbeiträge sachgerecht sind,
dings sollen, wie bislang und wie im Rürup-Modell, spielen die jeweiligen Auswirkungen auf die
aber im Gegensatz zum Lauterbach-Modell, nur Ar- Arbeitslosigkeit, auf die Einkommensverteilung
beitnehmer (und Rentner) der Versicherungspflicht und auf den Wettbewerb zwischen den Kranken-
in der Gesetzlichen Krankenversicherung unterlie- kassen eine wesentliche Rolle.
gen. Beamte, Selbständige und Arbeitnehmer über
der Versicherungspflichtgrenze wären danach nicht 3.1 Auswirkungen
pflichtversichert. Daß aufgrund der vorgesehenen auf die Arbeitslosigkeit
Erweiterung der Bemessungsgrundlage eine Nähe
zum Lauterbach-Modell besteht, geht in der Schaffung von Arbeitsplätzen
öffentlichen Diskussion genauso unter wie die Nähe
zum Rürup-Modell hinsichtlich des pflichtversicher- Nimmt man als Bewertungsmaßstab das erklärte
ten Personenkreises. Ziel der Rürup-Kommission, positive Beschäfti-
6„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
gungseffekte für den Arbeitsmarkt zu erzielen, so kosten und – da hier der Bruttolohn unverändert
schneiden pauschale Versicherungsbeiträge, wie bleibt – zu geringeren Gesamtarbeitskosten für die
sie auch das Rürup-Modell vorsieht, im langfristi- Unternehmen. Denn aufgrund der verbreiterten
gen Vergleich besser ab als einkommensabhängi- Bemessungsgrundlage kann bei gleichem Finan-
ge. Da pauschale Beiträge lohn- und einkom- zierungsvolumen der Beitragssatz gesenkt wer-
mensunabhängig sind, werden sie vollständig aus den. Berechnungen der Rürup-Kommission zufol-
den Lohnzusatzkosten eliminiert. Damit gelingt die ge liegt diese einmalige Beitragssatzsenkung bei
vollständige Entkopplung der Lohnnebenkosten konstanter Bemessungsgrenze und unveränder-
von den Krankenversicherungsbeiträgen. Ein im tem Versichertenkreis jedoch nur bei 0,5 Prozent-
Zeitablauf wachsender Finanzierungsbedarf im punkten.
Gesundheitswesen, der steigende pauschale
Beiträge nach sich zieht, übt damit – anders als in Pauschale Versicherungsbeiträge sind folglich für
der Vergangenheit – keine negativen Rückwirkun- die Schaffung von Arbeitsplätzen auf Dauer för-
gen mehr auf die Lohnnebenkosten und damit auf derlicher als einkommensabhängige Beiträge.
die Beschäftigung aus. Angesichts des zu erwar-
tenden überproportional wachsenden Finanzie- Anreiz zur Arbeitsaufnahme
rungsbedarfs im Gesundheitswesen ist diese Ent-
kopplung von Beiträgen und Lohnnebenkosten Außerdem haben die Unterschiede zwischen pau-
von höchster Bedeutung. schalen und einkommensabhängigen Beiträgen
Auswirkungen auf die Bereitschaft der Arbeitneh-
Kurzfristig, zum Zeitpunkt einer Systemumstel- mer, eine angebotene Arbeit anzunehmen oder
lung, entsteht dagegen kein positiver Beschäfti- ihren Arbeitseinsatz zu erhöhen. Diese Bereit-
gungseffekt. Zwar sinken die Lohnnebenkosten schaft wiederum ist neben der Schaffung von Ar-
um den Arbeitgeberbeitrag. Dieser soll jedoch im beitsplätzen eine wichtige Determinante für die
Rürup-Modell als Lohnbestandteil vollständig an Situation auf dem Arbeitsmarkt.
die Arbeitnehmer ausgezahlt werden. Folglich ver-
ändern sich die Gesamtkosten der Unternehmen Hier spielt die sogenannte Grenzbelastung des
nicht. Arbeitseinkommens eine zentrale Rolle. Sie gibt
an, wie hoch die staatliche Abgabenlast für jeden
Anders sieht die Situation dagegen bei einkom- zusätzlich verdienten Euro ist oder, anders ausge-
mensabhängigen Beiträgen aus, wie sie auch das drückt, was dem Arbeitnehmer netto von jedem
Lauterbach-Modell vorsieht. Hier kann von einer zusätzlich verdienten Euro bleibt. Aus arbeits-
wirklichen Abkopplung der Versicherungsbeiträge marktpolitischer Sicht sind möglichst niedrige
von den Lohnebenkosten keine Rede sein. Bei den Grenzbelastungen optimal, denn dann verbleibt
meisten Versicherten machen Lohneinkünfte den viel beim Arbeitnehmer, was seine Leistungsbe-
mit Abstand größten Teil des Einkommens aus. reitschaft erhöht.
Wenn jedoch für diesen Teil, wie im Lauterbach-
Modell, weiterhin eine paritätische Finanzierung Für die Grenzbelastung relevant sind einerseits
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorgesehen einkommensbezogene Steuern und Sozialabga-
ist, dann führen steigende Beitragssätze wie bis- ben, andererseits die Kürzung von staatlichen So-
her automatisch zu ansteigenden Lohnneben- zialleistungen oder anderen Transfers bei der Auf-
kosten (wenn auch absolut in geringerem Maße als nahme oder Ausweitung einer Beschäftigung.
bei ausschließlich lohnabhängigen Beiträgen, weil
die Beitragssätze aufgrund der breiteren Bemes- Derartige Transferkürzungen sind vor allem für
sungsgrundlage weniger stark angehoben werden Arbeitslose und im Bereich niedriger Einkommen
müssen). Der Faktor Arbeit wird verteuert und die relevant, da sie ein entscheidendes Hindernis für
Arbeitslosigkeit steigt. die Aufnahme oder Ausweitung einer Beschäfti-
gung darstellen. Werden etwa die Transferleistun-
Lediglich kurzfristig, zum Zeitpunkt der Auswei- gen — z.B. Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe —
tung der Bemessungsgrundlage, kommt es durch (fast) vollständig um das neue Arbeitseinkommen
die Einbeziehung weiterer Einkommensarten zu gekürzt, so liegt die Grenzbelastung bei (fast) 100
einem einmaligen Rückgang der Lohnneben- Prozent. Man spricht in diesem Fall auch von einer
7„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
Armutsfalle für die Betroffenen: Da sich das Netto- findet; allerdings nicht innerhalb der Kran-
einkommen durch eine Arbeitsaufnahme nicht oder kenversicherung, sondern über das allgemeine
nur unwesentlich erhöhen läßt, ist die Arbeitsauf- Steuer-Transfer-System. Aus ordnungspolitischer
nahme nicht attraktiv. Der Transferempfänger stellt Sicht ist das auch der richtige Ort für Umver-
sich letztlich besser, wenn er nicht bzw. nicht länger teilungsmaßnahmen, denn in der Krankenver-
arbeitet. sicherung stellen sie ein systemwidriges Element
dar, das die Funktionsfähigkeit des gesamten
Pauschale und einkommensabhängige Versiche- Gesundheitssystems beeinträchtigt.
rungsbeiträge haben unterschiedliche Auswirkun-
gen auf die Grenzbelastung. Nach den Berech- Der Status quo zeigt, wie problematisch die
nungen der Rürup-Kommission würde eine ein- Umverteilung innerhalb der Krankenversicherung
kommensabhängige Beitragserhebung (bei kon- ist. Abgesehen von willkürlichen Verteilungseffek-
stanter Bemessungsgrenze und unverändertem ten – etwa aufgrund der beitragsfreien Mitver-
Versichertenkreis) im unteren Einkommensbereich sicherung von nicht erwerbstätigen Ehepartnern
eine Entlastung von 0,25 Prozentpunkten gegen- im Vergleich zu Doppelverdienern – führt vor allem
über dem heutigen Zustand ergeben. Diese Zahl ist die Beitragsbemessungsgrenze dazu, daß sich die
vernachlässigbar klein, aber immerhin wird die Menschen mit sehr hohem Einkommen nicht ent-
Grenzbelastung in diesem Bereich nicht erhöht. sprechend ihrer Leistungsfähigkeit an dieser Um-
Die Auswirkungen einer pauschalen Beitrags- verteilung beteiligen. Sind sie Mitglied einer priva-
erhebung auf die Grenzbelastung dagegen hängen ten Krankenversicherung, so sind sie aus der
zwar in starkem Maße von der näheren Ausge- krankenversicherungsinternen Umverteilung voll-
staltung des sozialen Ausgleichs über das Steuer- ständig ausgeklinkt.
Transfer-System ab, insbesondere davon, bis zu
welchen Einkommensgrenzen ein Zuschuß zum Die Ausgliederung der Umverteilung in das
Versicherungsbeitrag gewährt wird und mit wel- Steuer-Transfer-System würde ein deutlich er-
cher Rate dieser Zuschuß bei steigendem Ein- höhtes Maß an Zielgenauigkeit mit sich bringen,
kommen gekürzt wird. Gleichwohl gehen alle als es im Status quo oder auch mit einkommens-
Berechnungen davon aus, daß die Grenzbelastung abhängigen Beiträgen möglich ist. Denn erstens
im unteren Einkommensbereich hier gegenüber berücksichtigt das Steuersystem neben dem Ein-
dem heutigen Zustand ansteigt. Pauschale Ver- kommen weitere Lebensumstände, die die
sicherungsbeiträge senken also im unteren Ein- Leistungsfähigkeit der Beitragszahler beeinflus-
kommensbereich den Anreiz Arbeitsloser, eine sen. Und zweitens werden, wenn man bei der ein-
Arbeit aufzunehmen. Dies spricht für einkommens- kommensabhängigen Versicherung, wie im
abhängige Beiträge. Im mittleren Einkommens- Lauterbach-Modell vorgesehen, eine Beitragsbe-
bereich dagegen haben, genau umgekehrt, pau- messungsgrenze einführt, die Menschen mit den
schale Versicherungsbeiträge deutlich bessere An- höchsten Einkommen weiterhin nur begrenzt zur
reizwirkungen als einkommensabhängige. Umverteilung herangezogen. Im Steuersystem
existiert eine solche Bemessungsgrenze dagegen
nicht, so daß die Bezieher hoher Einkommen bei
3.2 Auswirkungen auf die einer pauschalen Versicherung stärker belastet
Einkommensverteilung werden als bei einer Umverteilung innerhalb der
Krankenversicherung.
Die Frage der Umverteilung ist schon deshalb rele-
vant, weil politische Gegner einer pauschalen Prä- Die konkreten Umverteilungswirkungen eines auf
mienausgestaltung häufig das Argument der sozi- pauschalen Versicherungsprämien basierenden
alen Kälte vortragen, teilweise polemisch assozi- Krankenversicherungssystems hängen von der
iert mit Kopf(geld)prämien. An die Wand gemalt konkreten Ausgestaltung des sozialen Ausgleichs
wird das Schreckgespenst, ein Hausmeister über das Steuer-Transfer-System ab. Zu den
müßte dann ebenso viel wie ein Vorstandsvorsit- Stellschrauben gehören
zender für seine Gesundheit bezahlen. Übergan-
gen wird dabei allerdings, daß auch bei einer pau- n
die Einkommensgrenzen, bis zu denen ein
schalen Versicherung ein sozialer Ausgleich statt- Zuschuß gewährt wird,
8„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
n
die Rate, mit der der Zuschuß bei steigendem Zentrales Element des Wettbewerbs auf der
Einkommen gekürzt wird, Einnahmenseite ist die Konkurrenz zwischen den
Krankenversicherungen um die Versicherten. Vo-
n
die steuerliche Behandlung der Auszahlung des raussetzung für einen Wettbewerb, der als Anreiz-
bisherigen Arbeitgeberbeitrags sowie und Entdeckungsverfahren produktive Wirkungen
entfaltet, sind Rahmenbedingungen, die den
n
eventuelle Änderungen im Einkommensteuer- Wettbewerb nicht auf den Beitragssatz reduzieren,
tarif oder beim Solidaritätszuschlag, um den sondern auch Differenzierungen hinsichtlich des
erhöhten Finanzbedarf im Steuer-Transfer- Leistungsangebots oder der Vertragsbedingungen
System zu decken. – z.B. in Form von Selbstbehalten oder der Unter-
scheidung von Grund- und Wahlleistungen – er-
Die Ausgliederung der Umverteilung aus der Kran- möglichen. Einkommensabhängige Beiträge sind
kenversicherung in das Steuer-Transfer-System ist insoweit problematisch. Denn Bezieher hoher
neben der besseren Zielorientierung aus einem Einkommen, insbesondere wenn sie jung und
weiteren Grund vorteilhaft. Sie entzieht dem sozi- gesund sind, haben besonders hohe Anreize, ein-
alpolitisch motivierten Vorwurf, daß sich die Mit- zelne Leistungspakete abzuwählen, um sich so
glieder der Privaten Krankenversicherungen nicht eines Teils der umverteilungsbedingten Lasten zu
am Solidarausgleich beteiligen, den Boden, da entledigen. Für die Bezieher geringer Einkommen
auch die Gesetzliche Krankenversicherung von lohnt sich dagegen die Abwahl eines identischen
dieser systemfremden Last befreit wird. Alle Bür- Leitungspaktes weniger oder überhaupt nicht.
ger, egal ob sie privat oder gesetzlich versichert Dies führt zu einer unerwünschten negativen Risi-
sind, werden über das Steuersystem zur gesell- koselektion, die im Zeitablauf steigende Beitrags-
schaftlich gewünschten Umverteilung herangezo- sätze nach sich zieht. Bei pauschalen Versiche-
gen. Damit gibt es kein verteilungspolitisches Ar- rungsbeiträgen tritt dieses Problem nur in deutlich
gument mehr gegen die Koexistenz von Privater abgeschwächter Form auf, da die mit dem Ver-
und Gesetzlicher Krankenversicherung. zicht auf Wahlleistungen verbundene Beitragsre-
duktion einkommensunabhängig ist. Allerdings
läßt sich auch in diesem Fall eine negative Risiko-
3.3 Auswirkungen auf den Wettbewerb selektion nicht völlig ausschließen, da es vor allem
für Versicherte mit einer guten Gesundheit vorteil-
Ziel jeder Gesundheitsreform muß eine Verbes- haft ist, auf Wahlleistungen zu verzichten oder
serung der marktlichen Funktionsfähigkeit des Ge- Selbstbehalte in Anspruch zu nehmen. Ein von
sundheitssystems und eine Steigerung des Wett- solchen Verzerrungen freier Wettbewerb wäre nur
bewerbs sein, da nur so Mittelverschwendungen, bei risikoäquivalenten Prämien möglich.
Ineffizienzen und Organisationsmängel gering
gehalten werden können. Sowohl auf der Aus-
gabenseite der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung, also bei den medizinischen Leistungserbrin-
4 Arbeitnehmerversicherung
gern – Ärzte und ihre Kassenärztlichen Vereinigun-
gen, Krankenhäuser, Apotheken und Pharmaindu- oder Bürgerversicherung?
strie – als auch auf der Einnahmenseite besteht
diesbezüglich großer Handlungsbedarf. Die Befürworter einer Bürgerversicherung argu-
mentieren gerne, daß sich nur durch die Einbe-
Die derzeit diskutierten Reformvorschläge betref- ziehung aller Bürger in die Gesetzliche Kranken-
fen die Einnahmenseite, so daß der Wettbewerb versicherung eine Ungleichbehandlung zwischen
zwischen den Leistungserbringern auf der Ausga- unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen verhin-
benseite hier nicht behandelt werden muß. Im üb- dern lasse; nur eine Bürgerversicherung könne
rigen sind grundlegende Reformen in diesem Be- alle Bürger gemäß ihrer Leistungsfähigkeit in glei-
reich auch unabhängig von der Ausgestaltung des chem Maße zur sozialpolitisch gebotenen Umver-
Finanzierungssystems möglich und müßten schon teilung heranziehen.
heute – ohne Rücksicht auf einzelne Interes-
sengruppen – angegangen werden.
9„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
Diese Argumentation ergibt jedoch nur einen Sinn,
wenn man eine einkommensabhängige Bürgerver-
5 Rürup-Modell oder
sicherung propagiert. Denn im Falle einer pau-
schalen Bürgerversicherung ist die Umverteilung Lauterbach-Modell – Beide
über das Steuer-Transfer-System nicht nur mög- Vorschläge greifen zu kurz
lich, sondern, wie gezeigt, sogar die bessere Wahl.
Folglich knüpft auch das Umverteilungsargument Zukünftige Generationen können in Zeiten einer
nicht am Gegensatz zwischen Arbeitnehmer- und alternden Bevölkerungsstruktur nur dann vor per-
Bürgerversicherung an, sondern am Gegensatz manent steigenden finanziellen Belastungen im
zwischen einkommensabhängiger und personen- Gesundheitssystem geschützt werden, wenn
bezogener Gestaltung der Versicherungsbeiträge. unsere Gesellschaft dazu übergeht, daß jede
Es ist kein Argument für eine Bürgerversicherung Generation im wesentlichen für sich selbst sorgt.
und damit auch kein Argument für eine einkom- Das erfordert, daß Versicherte in jungen Jahren
mensabhängige Bürgerversicherung, wie sie das Alterungsrückstellungen aufbauen, mit denen der
Lauterbach-Modell vorsieht. Ausgabenanstieg in späteren Jahren ausgeglichen
werden kann, ohne daß es zu massiven Bei-
Umgekehrt jedoch spricht folgendes gegen die tragserhöhungen kommt. Welche Dimension das
Einführung einer für alle Menschen verbindlichen zukünftig zu erwartende Ausgabenwachstum
Bürgerversicherung: Sie hätte die unvermeidliche annehmen kann, verdeutlichen Prognoserechnun-
Konsequenz, daß die Private Krankenversicherung gen für den Status quo. Modellrechnungen zufolge
keine Vollversicherungsverträge mehr anbieten ergäben sich bis zum Jahr 2050 Beitragssätze von
könnte und damit ihres Hauptgeschäftsfeldes über 30 %, wenn man das gegenwärtige System
beraubt würde. Da die Private Krankenversiche- der Gesetzlichen Krankenversicherung beibehal-
rung jedoch auf dem gesamtwirtschaftlich überle- ten würde.
genen Kapitaldeckungsverfahren basiert, hätte
dies negative Auswirkungen für die Volkswirt- Bedauerlicherweise übergehen beide in der
schaft insgesamt. Nur in einem Kapitaldeckungs- Rürup-Kommission entwickelten Modelle dieses
verfahren, in dem die Versicherten Alterungsrück- fundamentale demographische Problem. Schon
stellungen aufbauen, wird der Umverteilungsbe- deshalb sind sie als Richtschnur für langfristig
darf zwischen den verschiedenen Generationen orientierte Reformkonzepte ungeeignet. Daran
minimiert. ändert auch die Tatsache nichts, daß beide Alter-
nativvorschläge marginal demographiefreund-
Daher wäre es trotz aller berechtigten Kritik, die licher als der Status quo sind, indem die Hauptlast
man dem Wettbewerbsverständnis der Privaten der Finanzierung infolge der (partiellen) Abkehr
Krankenversicherung in ihrer heutigen Form ent- vom Lohneinkommen in etwas geringerem Maße
gegenhalten kann, unverantwortlich, dieses bei den Erwerbstätigen liegt. Generationengerech-
System zugunsten einer Bürgerversicherung, die tigkeit läßt sich mit diesen Konzepten nicht ver-
dem Umlageverfahren verhaftet bleibt, wie es das wirklichen.
Lauterbach-Modell vorsieht, zu zerschlagen. Das
Rürup-Modell, das ebenfalls dem Umlageverfah- Ein optimales Krankenversicherungssystem
ren verhaftet bleibt, unterliegt dieser Kritik nicht, müßte dagegen auf zwei Säulen ruhen:
weil es als Arbeitnehmerversicherung zumindest
die Kapitaldeckung der Privaten Krankenversiche- n
risikoabhängige Versicherungsprämien und
rung aufrechterhält. n
übertragbare individuelle Alterungsrückstel-
lungen.
Bei risikoabhängigen Versicherungsprämien be-
mißt sich die Prämienhöhe nach dem individuellen
Krankheitsrisiko der Versicherten. Übertragbare
individuelle Alterungsrückstellungen teilen die
Summe der für einen Altersjahrgang gebildeten
Alterungsrückstellungen entsprechend den indivi-
10„Bürgerversicherung” und „Kopfpauschale”
Im Dickicht der Gesundheitsreform
duellen Krankheitsrisiken – und damit entsprechend Sollte sich die Übertragbarkeit individueller Alte-
den zu erwartenden zukünftigen Ausgaben – auf die rungsrückstellungen politisch nicht durchsetzen
Versicherten auf, und sie werden dem Versicherten lassen, so sollte zumindest eine Kombination aus
bei einem Wechsel seiner Versicherung mitgege- pauschalen Versicherungsprämien mit jahrgangs-
ben. bezogenen Alterungsrückstellungen eingeführt
werden. Die Grundzüge eines solchen Modells
Die Kombination dieser beiden Elemente löst zum wurden von der Herzog-Kommission als anzustre-
einen das demographische Problem, weil die Alte- bendes Langfristziel entwickelt.
rungsrückstellungen die mit zunehmendem Alter an-
steigenden Gesundheitsausgaben kompensieren.
Zum anderen sichern die beiden Säulen ein
6 Fazit
Maximum an effizienzförderndem Wettbewerb.
Denn nur mit risikoäquivalenten Versicherungsprä- Das deutsche Gesundheitssystem steht vor ent-
mien lassen sich Selbstbehalte und Wahllei- scheidenden Weichenstellungen. Nur ein mutiges
stungen korrekt kalkulieren. Angesichts risikoäqui- Handeln kann es noch vor dem finanziellen Kol-
valenter Versicherungsprämien würde zudem auch laps retten. Obwohl Teile der Politik den Hand-
der bürokratische und höchst unvollkommene lungsbedarf endlich erkannt haben, beschränkt
Risikostrukturausgleich überflüssig. sich die politische und öffentliche Diskussion
größtenteils auf Scheingefechte in inhaltlichen
Schreibt man zudem eine Versicherungspflicht von Randbereichen. Entscheidenden Anteil an dieser
Geburt an vor, wenn das Gesundheitsrisiko noch Entwicklung hat eine irreführende und ungenaue
hinter einem Schleier der Unwissenheit verborgen Begriffsbildung, die zwar für emotionale Wahl-
liegt, dann besteht auch nicht die Gefahr, daß Men- kampfreden, nicht aber für eine konstruktive in-
schen mit einem sehr hohen Risiko keinen finan- haltliche Auseinandersetzung geeignet ist. Letzte-
zierbaren Versicherungsschutz finden. Das Niveau re ist unerläßlich, wenn die immensen Herausfor-
der risikoäquivalenten Prämie bei Geburt ist dem derungen im Gesundheitssystem noch gemeistert
einer Kopfpauschale vergleichbar. Aufgrund der werden sollen.
übertragbaren individuellen Alterungsrückstellun-
gen bleibt auch in späteren Jahren ein Versiche- Eine sachliche Diskussion würde erstens zeigen,
rungswechsel für hohe Risiken jederzeit möglich. daß pauschale Versicherungsprämien im Vergleich
Denn die risikobedingt höhere Versicherungsprä- zu einer einkommensabhängigen Beitragsgestal-
mie wird dann aus der entsprechend hoch ausfal- tung die überlegene Lösung sind. Zweitens würde
lenden individuellen Alterungsrückstellung ausge- auch deutlich, daß eine Bürgerversicherung auf-
glichen, die der Versicherte zur neuen Versicherung grund ihrer Defizite keine überzeugende Reform-
mitnimmt. Umgekehrt wird guten Risiken bei einem alternative zur Arbeitnehmerversicherung dar-
Versicherungswechsel nur eine niedrige Alterungs- stellt. Folglich ist die einkommensabhängige Bür-
rückstellung mitgegeben. Die Krankenversiche- gerversicherung des Lauterbach-Modells der pau-
rungen haben somit, anders als gegenwärtig in der schalen Arbeitnehmerversicherung des Rürup-
Privaten Krankenversicherung, einen Anreiz, einen Modells in beiden Hinsichten unterlegen.
intensiven Wettbewerb um Bestandskunden, un-
abhängig von deren Risikoprofilen, zu führen. Vor allem aber würde drittens deutlich, daß diese
derzeit von der Politik schwerpunktmäßig disku-
Ähnlich wie bei pauschalen Versicherungsbei- tierten konkreten Reformkonzepte beide unzurei-
trägen hat auch in einem solchen System der so- chend sind, um das deutsche Gesundheitswesen
ziale Ausgleich über das Steuer-Transfer-System nachhaltig zu reformieren — beiden fehlt die drin-
zu erfolgen. Ein Modell, das auf diesen Grundprin- gend notwendige Kapitaldeckung.
zipien aufbaut, hat beispielsweise der Kronberger
Kreis im Sommer 2002 entwickelt. Auch der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung hat Sympathien für
eine solche Reform.
11Sie können auch lesen