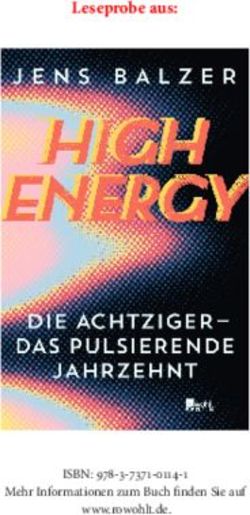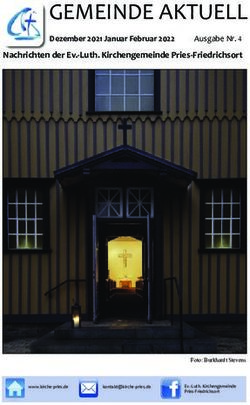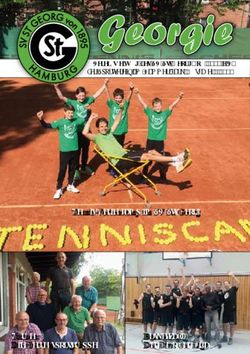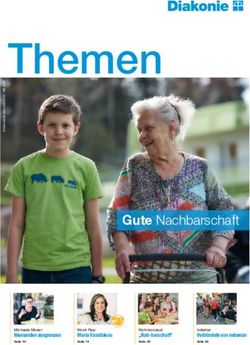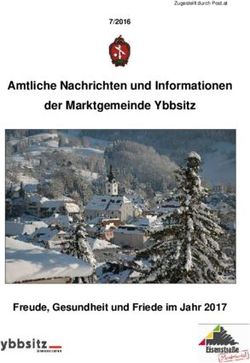INSIDER AUSGABE 18/SEPTEMBER 2015 - HZDR
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Insider
Ausgabe 18/September 2015
© DESY 2015
Internationales Extremlabor in Hamburg
Von der Material- und Geoforschung über die Biologie und Chemie bis zur
Plasma- und Astrophysik – von den „Helmholtz International Beamlines“ (HIB),
die das HZDR und das Forschungszentrum DESY am europäischen Röntgenlaser
XFEL aufbauen, profitieren die unterschiedlichsten Forschungsrichtungen.
Mit rund 30 Millionen Euro fördert die Helmholtz-Gemeinschaft das Projekt.
Der größte Anteil fließt dabei an HIBEF (Helmholtz International Beamline for
Extreme Fields), die das HZDR koordiniert. Vielfältige Unterstützung erhält das
Forschungszentrum dafür von einem internationalen Konsortium.
Topthema Lesen Sie weiter auf Seite 4Di r e c t o r ’ s C o r n e r
2
Röntgenlaser XFEL konnten wir Ende Juni Dies hat auch die Helmholtz-weite Dok-
ein solches Projekt anstoßen. Gemeinsam torandenbefragung gezeigt, bei der unser
mit unseren Kollegen vom Deutschen Zentrum gerade in diesem Bereich sehr gut
Elektronen-Synchrotron DESY bauen wir abgeschnitten hat. Es gibt aber auch Fel-
unter anderem die Helmholtz International der, auf denen wir uns verbessern können,
Beamline for Extreme Fields (HIBEF) auf. um den führenden Forschern von morgen
Dort werden ab 2018 Experimente unter einen perfekten Start in ihre Karriere zu
extremen Bedingungen wie hohen Drücken, geben. Dass wir uns auf einem guten Weg
Temperaturen oder elektromagnetischen befinden, zeigen die Promotionen des letz-
Feldern möglich. Die Kombination aus bril- ten Jahres. Wie schon 2013 sind sie sowohl
Liebe Leserinnen und Leser, lantem Röntgenlicht und Hochleistungslaser quantitativ als auch qualitativ weiterhin auf
eine zentrale Aufgabe der Helmholtz-Ge- erlaubt uns tiefere Einblicke in die Struktur einem hohen Niveau. Dies trifft auch auf
meinschaft als größte deutsche For- der Materie. Das internationale Interesse an unsere Auszubildenden zu, die durchweg
schungsorganisation besteht darin, dem Labor, das die Station für Experimente ihren Abschluss mit guten und sehr guten
komplexe Infrastrukturen und große bei hohen Energiedichten erheblich erwei- Leistungen ablegen konnten.
Forschungsanlagen für die internationale tert, ist bereits jetzt riesig. Es sind solche Es gilt nun, diesen Stand in den nächsten
Wissenschafts-Community zu entwickeln exzellenten Infrastrukturen, die hervorra- Jahren nicht nur zu halten, sondern weiter
und zu betreiben. Mit den Helmholtz Inter- gende Wissenschaftler nach Deutschland auszubauen.
national Beamlines (HIB) am europäischen ziehen. Roland Sauerbrey und Peter Joehnk
95 Messkampagnen liefen im letzten aus Europa, Amerika und Asien sowie des
Jahr am Hochfeld-Magnetlabor Dresden HZDR-Instituts für Strahlenphysik haben
(HLD) ab. Etwa 75 Prozent dieser Projekte die HLD-Forscher mit Hilfe intensiver Mag-
gingen von externen Forschergruppen aus, netfeld- und Laserpulse maßgeschneiderte
die sich um Messzeit beworben hatten. Plasmajets erzeugt. Das Team konnte so
Als internationales Nutzerzentrum bietet den Entstehungsprozess astrophysikali-
das HLD Wissenschaftlern aus aller Welt scher Jets im Laborexperiment erforschen
einzigartige Möglichkeiten, um moderne und dieses erstaunliche Naturphänomen
Materialforschung in hohen Magnetfeldern mit einem Modell beschreiben. Die Studie
zu betreiben. 2014 feuerten die Dresdner sowie weitere Zahlen – zum Beispiel die
Forscher an der weltweit größten Konden- Nutzerstunden am Ionenstrahlzentrum
© HZDR/Oliver Killig
satorbank rund 4.000 Magnetpulse ab. oder an der Strahlungsquelle ELBE – wer-
Die Experimente führten neben mehreren den übrigens auch im HZDR-Online-Jahres-
Publikationen in den Physical Review Let- bericht 2014 vorgestellt:
ters auch zu einem Paper in der Fachzeit-
schrift Science. Zusammen mit Kollegen http://www.hzdr.de/jahresbericht
Film zur Endlagerforschung künftigen Generationen. Wissenschaftler chungen nutzen sie moderne spektroskopi-
Der Ausstieg aus der Kernenergienut- am Institut für Ressourcenökologie sche Methoden, um ein Prozessverständnis
zung ist in Deutschland beschlosse- des HZDR erforschen deshalb Ausbrei- auf molekularer Ebene zu gewinnen. So
ne Sache, und doch werden uns die tungs- und Rückhaltemechanismen von liefert diese wichtige Grundlagenforschung
Hinterlassenschaften dieser Technik Radionukliden. fundierte Daten, die Fachleuten und Politi-
noch lange beschäftigen. Über mehrere In einem neuen Kurzfilm stellen Chemi- kern bei der Beurteilung möglicher Endla-
Eiszeiten hinweg müssen wir hochra- ker, Physiker, Biologen und Geologen ihre gerstandorte helfen sollen. Das Video ist
dioaktive Abfälle sicher verwahren – Arbeit an den HZDR-Standorten Dresden, in der HZDR-Mediathek sowie auf YouTube
eine große Verantwortung gegenüber Leipzig und Grenoble vor. Für ihre Untersu- verfügbar. CDF o r s c h u n g
In si der 18/September 2015 3
>
„Wir legen die Grundlage für die
erfolgreiche Zukunft des Instituts“
Zentrum für Radiopharmazeutische Tumorforschung nimmt Gestalt an
Seit dem Herbst 2012 entsteht direkt neben dem Institut für Radio
pharmazeutische Krebsforschung – also mitten auf dem Campus
des HZDR – ein neues Gebäude. Es soll ab 2017 als Zentrum für
Radiopharmazeutische Tumorforschung große Teile des Instituts
beherbergen. Durch den Neubau schafft das HZDR die Vorausset-
zungen, um die dortige Forschung auszubauen und die Herstellung
radioaktiver Arzneimittel zu erweitern. insider hat sich mit dem
Institutsdirektor, Prof. Jörg Steinbach, und dem Projektkoordina-
tor am Institut, Dr. Frank Füchtner, über den Stand der Arbeiten
unterhalten.
insider: Warum wurde der Neubau eines kompletten
Gebäudes nötig?
Jörg Steinbach: Obwohl die einzelnen Abteilungen unseres Ins-
tituts eng kooperieren, ist das Personal auf vier unterschiedliche
Gebäude aufgeteilt. Das beeinträchtigt eine gute Zusammenarbeit
© Sven Ellger
zwangsläufig. Durch das neue Zentrum konzentriert sich das Team
auf zwei zusammenhängende Häuser, was die Kommunikation und
die Kooperation vereinfachen sowie dadurch die Arbeit effektiver
gestalten wird.
Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile …
Jörg Steinbach: Natürlich nicht. Das Zentrum eröffnet uns völlig Das klingt nach einem sehr komplexen Projekt.
neue Möglichkeiten – sowohl für die Forschung als auch für die Frank Füchtner: Das ist es. Allein für die Reinräume brauchen wir
Herstellung radioaktiver Arzneimittel. Wir installieren zum Beispiel ein aufwendiges Lüftungssystem. Als Institut allein könnten wir
ein Zyklotron, das eine Protonenenergie bis 30 Megaelektronen- eine solche Planung nicht stemmen. Dank der wirklich hervorra-
volt erreicht. Die gegenwärtige Anlage hat 18 Megaelektronenvolt. genden Zusammenarbeit mit den Zentralabteilungen Technischer
Dadurch können wir dann für die Forschung auch auf Radionuklide Service, die mit den zahlreichen Firmen unsere Nutzungsanforde-
zurückgreifen, die bislang außerhalb unserer Möglichkeiten lagen, rungen umsetzt, und Forschungstechnik, die ein spezielles Vertei-
wie Kupfer-67. Auf dieser Grundlage können wir uns auf Felder lungssystem für die Radionuklide entwickelt, konnten wir bisher
ausbreiten, von denen wir bislang nur träumen können. aber alle Herausforderungen erfolgreich meistern.
Frank Füchtner: Außerdem bauen wir die Anzahl der Reinräume
aus. Wir erreichen darüber hinaus eine höhere Reinraumklasse. Das Welche Hürden müssen Sie nun noch nehmen?
bedeutet, dass wir den Herstellungsprozess der Medikamente an Frank Füchtner: Abgesehen vom Innenausbau werden die Geneh-
die jeweils erforderlichen sterilen Bedingungen anpassen können. migungsprozesse noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Betrieb
Das gibt uns die Möglichkeit, neue Substanzklassen zu erschließen. des Zyklotrons, der Röntgen- und der gentechnischen Anlagen,
Herstellung von Radiopharmaka und die Tierhaltung – für all diese
Was wird das neue Gebäude noch alles beherbergen? Bereiche benötigen wir eine entsprechende Genehmigung.
Frank Füchtner: Neben dem Zyklotron und den Reinräumen gibt Jörg Steinbach: Wir haben fast alles, was eine staatliche Bewil-
es radiochemische Labore sowie Einrichtungen für radiophar- ligung für das Arbeiten braucht. Ich bin mir aber sicher, dass die
mazeutisch-biologische Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Investitionen in das Zentrum für Radiopharmazeutische Tumorfor-
beispielsweise für molekularbiologische Techniken und zur Klein- schung die Möglichkeiten des Krebsforschungsstandorts Dresden
tier-Bildgebung. Dafür benötigen wir natürlich auch einen Bereich als Ganzen deutlich verbessern werden. Das Institut kann dadurch
für die moderne Versuchstierhaltung … flexibler auf Forschungsentwicklungen reagieren. Außerdem
Jörg Steinbach: … der übrigens längerfristige Studien zur thera- schaffen wir die Voraussetzung für translationale Erfolge – also für
peutischen Wirkung radioaktiver Arzneimittel ermöglicht, da wir einen schnelleren Transfer der präklinischen Untersuchungen in
die Tiere hier länger halten können. So können wir uns stärker auf die Anwendung.
die Forschung zur Tumortherapie konzentrieren, die aufgrund des
Platzmangels bislang nur eher improvisiert möglich war. Das Interview führte Simon Schmitt.F o r s c h u n g
4
> Internationales Extremlabor in Hamburg
HZDR beteiligt sich an dem Aufbau mehrerer Beamlines am European XFEL
Mehr als 2.000 Stunden scheint die Sonne durchschnittlich pro Erkenntnisse zu bislang verborgenen Vorgängen in Materie und
Jahr auf Grenoble. Mit seinen knapp 650 Sonnenstunden kann Materialien gewinnen.“
sich Hamburg in dieser Kategorie mit der französischen Stadt So können zum Beispiel die Diamant-Stempelzellen extrem
nicht vergleichen. Die Elbmetropole bietet in wissenschaftli- hohe Drücke von bis zu zehn Millionen Bar erzeugen. Eine Anlage
cher Hinsicht nun aber eine spannende Herausforderung: die – unter anderem entwickelt vom Hochfeld-Magnetlabor Dresden
Entwicklung der „Helmholtz International Beamline for Extreme des HZDR – kann Magnetfelder von 60 Tesla auslösen. Mit einem
Fields“ (HIBEF) am Europäischen Röntgenlaser XFEL. Nach fast speziellen Hochenergielaser, den die HIBEF-Kooperationspartner
acht Jahren an der Rossendorf Beamline (ROBL) verlässt deshalb STFC (Science and Technology Facilities Council) und Oxford
Dr. Carsten Bähtz die Europäische Synchrotron-Strahlenquelle University bereitstellen, können die Forscher ebenfalls gewaltige
(ESRF) in Grenoble mit einem weinenden und einem lachenden Drücke kreieren. Ein weiterer Hochleistungslaser für ultrakurze
Auge. Der HZDR-Forscher hat dort das materialwissenschaftliche Lichtpulse kann Elektronen an der Oberfläche eines Materials auf
Messlabor betreut. einige Milliarden Grad erhitzen und so ein Plasma erzeugen.
Nun soll er den Aufbau des Millionenprojekts in Hamburg
koordinieren: „Die Zeit in Grenoble war sehr spannend. Da Ein Supermikroskop für
unsere Beamline – übrigens die einzige allein von Deutschland neue Einblicke in die Materie
betriebene Anlage an der ESRF – vor allem eine Nutzereinrich- „In gewissem Sinne quälen wir die Materie zunächst mit unseren
tung ist, konnten wir über die Jahre viele erfolgreiche Kooperati- Anlagen, indem wir sie extremen Bedingungen ausliefern, um
onen aufbauen, was zu zahlreichen hochrangigen Publikationen sie anschließend mit dem Röntgenlaser als einer Art Supermik-
geführt hat.“ Trotzdem zieht es ihn nun nach Hamburg, „um in roskop zu analysieren“, erläutert Cowan. „Wir nehmen Moment-
der besten Liga mitzuspielen.“ Den freigewordenen Messplatz in aufnahmen von diesen Zuständen. Auf diese Weise können wir
Grenoble übernimmt das HZDR-Institut für Ressourcenökologie, zum Beispiel die Eigenschaften von Materie bei Voraussetzungen
das dort seit vielen Jahren ein radiochemisches Labor betreibt. untersuchen, die denen im Inneren von Planeten entsprechen. So
lassen sich präzisere Modelle für die Entstehung und Evolution
DESY + HZDR + XFEL = HIB von Planeten erstellen.“ Bis sich die Forscher in dem Extremlabor
„Die ,Helmholtz International Beamlines‘ (HIB) setzen sich neben austoben können, wird allerdings noch einige Zeit vergehen.
HIBEF aus zwei weiteren Anlagen zusammen, deren Aufbau das Ab dem Jahr 2017 sollen die ersten Experimente möglich sein.
Helmholtzzentrum DESY koordiniert: dem ,Heisenberg Resonant Bis dahin gibt es noch Einiges zu erledigen. „Wir müssen die
Inelastic X-Ray Scattering‘ und der ,Serial Femtosecond X-Ray unterschiedlichen Beiträge unserer Partner zu einer ganzheitlichen
Crystallography‘“, erläutert der Direktor des HZDR-Instituts für Messstation zusammenfügen und in die HED-Beamline integrie-
Strahlenphysik, Prof. Thomas Cowan, der das Nutzerkonsortium ren, um für alle Beteiligten optimale Forschungsvoraussetzungen
HIBEF leitet. HIBEF wird die Station für Experimente bei hohen zu schaffen“, berichtet Bähtz. „Das erfordert einen gewaltigen
Energiedichten (HED) mit neuen Instrumenten ausstatten. Planungsaufwand und erzeugt auch bei uns – ironischerweise ähn-
„Hohe Magnetfelder, zwei Hochleistungslaser, Diamant-Stem- lich wie wir es später bei der Materie vorhaben – einen gewissen
pelzellen – all das werden wir, unser Projektpartner DESY und Druck.“ Für den Dresdner Naturwissenschaftler hat das allerdings
internationale Forschungseinrichtungen beisteuern“, erzählt auch einen wissenschaftlichen Reiz: „Es liegt in der Natur des
Thomas Cowan. Durch die Kombination des Röntgenlasers mit Forschers, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Das wird
diesen Anlagen werden Experimente möglich, die bislang nicht uns mit diesem Projekt gelingen.“ Vielleicht scheint dann auch
realisierbar waren, ist sich der Physiker sicher: „Wir werden neue über Hamburg öfter einmal die Sonne.
> Fast acht Jahre arbeitete Dr. Carsten Bähtz an der Rossendorf Beamline in Grenoble - nun zieht es ihn zum XFEL nach Hamburg.
© HZDR/D. MorelF o r s c h u n g
In si der 18/September 2015 5
> Auszeichnungen für Dresdner Forscher
Gleich vier Preise gingen bei der letzten zur Verteilung eines Zeitreferenzsignals für
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft den HZDR-Elektronenbeschleuniger ELBE.
für Radioonkologie an OncoRay-Forscher. Dadurch konnte eine wesentliche Vorausset-
Mit dem Hermann-Holthusen-Preis, der mit zung für neue Experimente an der Anlage mit
5.000 Euro dotiert ist, zeichnete die Jury einer zeitlichen Auflösung im Bereich von we-
Dr. Iris Eke für ihre Habilitationsschrift, die nigen zehn Femtosekunden gelegt werden.
sie bei Prof. Nils Cordes abgelegt hatte,
aus. Darin untersuchte Eke Tumorresisten- Best Paper Awards
zen gegenüber neuen zielgerichteten Medi- Während der Jahrestagung für Kerntechnik
kamenten in Kombination mit Strahlenthe- (Annual Meeting on Nuclear Technology)
rapie. Für den besten Vortrag während hat sich Dr. Polina Tusheva vom Institut für
© privat
der Tagung erhielt Dr. Annett Linge den Ressourcenökologie den Best Paper-Award
Koester-Preis. Den Dissertationspreis hat gesichert. In ihrem Vortrag präsentierte die
die Fachgesellschaft an Dr. Julia Hennig
und Dr. Steffen Barczyk verliehen.
Dresdner Forscherin ein Modell zur Unter-
suchung schwerer Störfälle für Druckwas-
> Stefanie Hopfe
serreaktoren des Typs Konvoi. In der Studie
beschreibt Polina Tusheva zusammen mit Schülerin des Sächsischen Landesgym-
Kollegen der Gesellschaft für Anlagen- und nasiums Sankt Afra zu Meißen hatte sich
Reaktorsicherheit, der Universität Stuttgart in ihrer Besonderen Lernleistung (BeLL)
sowie des HZDR die Anwendung des Modells mit magneto-optischen Untersuchungen
für die Analyse hypothetischer Kernschmelz- an ferromagnetischen geometrischen
szenarien und mögliche Notfallmaßnahmen. Mikrostrukturen aus Kobalt und Permalloy
Auf der Internationalen Konferenz für befasst. Erstellt hatte sie die Arbeit bei Dr.
Biotechnologie ICBB 2015 erhielt Stefa- Helmut Schultheiß, der am HZDR-Institut
nie Hopfe einen „Best Paper Award“. Die für Ionenstrahlphysik und Materialfor-
HZDR-Doktorandin vom Helmholtz-Institut schung die Emmy Noether-Nachwuchsgrup-
Freiberg für Ressourcentechnologie stellte pe Magnonik leitet.
© privat
ihre Arbeit zur mikrobiellen Laugung von Auf der Mitgliederversammlung des Ma-
Seltenen Erden aus dem Leuchtpulver von terialforschungsverbundes Dresden (MFD)
> Dr. Iris Eke Energiesparlampen vor. Hopfe will nachwei- wurde Prof. Manfred Helm zum Beisitzer
sen, dass Mikroorganismen grundsätzlich des Vorstands gewählt. In den nächsten
Hervorragender Nachwuchs dazu geeignet sind, die Metalle aus dem drei Jahren unterstützt der Direktor des
Ihren Nachwuchsforscherpreis 2015, der mit schwerlöslichen Substrat zu gewinnen. Mit HZDR-Instituts für Ionenstrahlphysik
1.000 Euro dotiert ist, hat die Hochschule ihrer Forschung will sie die Grundlage für und Materialforschung die MFD-Leitung
für Technik und Wirtschaft Dresden an Dr. ein umweltverträgliches Recyclingverfahren bei ihren Aufgaben. Im MFD haben sich
Michael Kuntzsch verliehen. Der Forscher für Seltene Erden legen. 20 universitäre und außeruniversitäre
vom Institut für Strahlenphysik überzeugte Forschungseinrichtungen, die auf den
mit seiner Abschlussarbeit die Jury. Darin Gefragte Kompetenz Gebieten Werkstofftechnik und Materi-
konzipierte und realisierte Kuntzsch ein Die TU Chemnitz hat ihren BeLL-PRIX- alwissenschaft tätig sind, zusammenge-
Laser-basiertes Synchronisationssystem Preis 2015 an Eva Paprotzki verliehen. Die schlossen.
>
Jubiläen – Wir gratulieren ganz herzlich zum
60. Geburtstag
Hannelore Riemer FKVF 12.08.2015
© HTW Dresden
André Hoffmann FKVI 25.07.2015
Gudrun Sauerbrey FS 15.07.2015
Peter Maeding FWPH 10.06.2015
Dr. Holger Stephan FWPR 17.05.2015
Dr. Johannes von Borany FWIZ 22.04.2015
> Dr. Michael Kuntzsch (rechts)F o r s c h u n g
6
> Den Horizont erweitern mit Kooperationen
In einer sogenannten Target-Kammer trifft der Lichtstrahl eines Hochleistungslasers auf den Elektronenstrahl des
> ELBE-Beschleunigers im Zentrum für Hochleistungs-Strahlenquellen des HZDR.
© HZDR/F. Bierstedt
Mit dem Förderprogramm „Horizon 2020“ hat sich die EU zum Ziel um Dr. Eberhard Altstadt sowie 23 europäische Projekt-Partner
gesetzt, Forschung und Innovationen durch europaweite Koopera- die Alterungsprozesse in Konstruktionswerkstoffen von Kernkraft-
tionen voranzutreiben. Aufgrund der breit aufgestellten Forschung werken. Im Fokus stehen dabei insbesondere der Langzeitbetrieb
beteiligt sich unser Zentrum auch 2015 wieder an mehreren Projek- von Reaktordruckbehältern und die Alterung von Stahlkonstruktio-
ten. Drei davon stellen wir Ihnen an dieser Stelle vor. nen im Inneren des Reaktors. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse
sollen bessere Sicherheitsabschätzungen erlauben und so einen
OptimOre sicheren Betrieb über die geplanten Laufzeiten der Kernkraftwerke
Im Ressourcen-Forschungsprojekt „OptimOre“ (Optimal Ore, zu gewährleisten.
Deutsch: Optimales Erz) wird die Zerkleinerung und Trennung
komplexer, metallhaltiger Minerale untersucht. Das Ziel sind au- Laserlab-Europe
tomatisierte Abläufe, mit denen die begehrten Rohstoffe Wolfram In diesem europäischen Projekt haben sich die 30 wichtigsten
und Tantal effizienter aufbereitet werden können. Die HZDR-For- Einrichtungen für Laserforschung aus 16 Ländern in Europa zusam-
scher um Dr. Martin Rudolph am Helmholtz-Institut Freiberg für mengeschlossen. Als „Excellent Science“ – eine der drei Säulen
Ressourcentechnologie untersuchen hierfür die Flotation, einen des „Horizon 2020“-Programms – wird das Konsortium ab Dezem-
physikochemischen Trennprozess. Bekannt ist Wolfram vor allem ber 2015 für vier Jahre gefördert. Koordinator ist die Universität
als Glühmaterial in Lampen, doch der größte Bedarf herrscht in Lund in Schweden. Das HZDR vertritt der Direktor des Instituts für
der Materialtechnik: Mit hochfesten Verbindungen wie Wolfram- Strahlenphysik, Prof. Ulrich Schramm. Hauptanliegen des Projekts
stahl oder Wolframcarbid lassen sich belastbare Werkzeuge und ist es, Forschern über Landesgrenzen hinweg einen einfachen
Industrie-Bauteile fertigen. Tantal ist wiederum interessant für die Zugang zu Lasern zu gewähren. Gemeinsame Forschungsaktivitä-
Herstellung von Kondensatoren in der Mikroelektronik, zum Bei- ten zielen zudem darauf ab, die bereitgestellten Forschungsinfra-
spiel für Smartphones. Koordiniert wird das drei Jahre andauernde strukturen weiterzuentwickeln. Europa könnte damit eine weltweit
Projekt von der Technischen Universität Barcelona in Spanien. führende Rolle auf den Gebieten der Bio- und Nanophotonik, der
Materialanalyse, der Biologie und der Medizin einnehmen. Um dies
SOTERIA auch langfristig sicherzustellen, widmet sich das Laserlab-Europe
Seit dem 1. September 2015 beteiligt sich das Institut für Ionen- auch der Aus- und Weiterbildung von Nachwuchswissenschaftlern,
strahlphysik und Materialforschung am vierjährigen SOTERIA-Pro- Technikern sowie von Forschern, die selbst über keine nationalen
jekt. Unter Koordination des Französischen Kommissariats für Atom Hochintensitätslaser verfügen.
energie und alternative Energien (CEA) untersuchen die Gruppe CD/TSF o r s c h u n g
In si de r 18/September 2015 7
> Freier Zugang für alle
Anzahl der Open Access-Publikationen am HZDR steigt
Stetes Wachstum sieht die Leiterin der Jahr ein Drittel aller Artikel in referierten
HZDR-Bibliothek, Edith Reschke, beim Zeitschriften als Gold-Open-Access-Publi-
Open Access-Publizieren (OA) am For- kation. Die Finanzierung dieses Veröffent-
schungszentrum. Hinter dem Begriff lichungsweges kommt aus dem Etat der
verbirgt sich der unbeschränkte und kos- Bibliothek – sofern keine Projektmittel zur
tenfreie Zugang zu wissenschaftlicher Infor- Verfügung stehen.
mation im Internet. Im Fokus stehen dabei
Publikationen, die im Rahmen öffentlich Vorteil Open Access
© Oliver Killig
finanzierter Forschung entstanden sind. „Der Corresponding Author – also die
So hat die Europäische Kommission zum Kontaktperson – muss HZDR-Mitarbeiter
Beispiel in ihrem Förderprogramm „Horizon sein und der Artikel in einer OA-Zeitschrift
2020“ Open Access als allgemeines Prinzip
verankert. Auch die Helmholtz-Gemein-
erscheinen“, beschreibt Reschke die Voraus-
setzungen für die Kostenübernahme. „Der > Edith Reschke
schaft positioniert sich in ihrer OA-Richtli- Antrag muss außerdem über die HZDR-Pu-
nie eindeutig zu diesem Wandel im wissen- blikationsdatenbank gestellt werden.“ Das „Da die Gebühren zu den Autoren wandern,
schaftlichen Publikationssystem. OA-Publizieren auf dem Grünen Weg ist zwar könnten finanzstarke Länder und Institutio-
„Ein wesentlicher Vorteil von OA-Ar- kostenlos. Der organisatorische Aufwand nen bevorzugt werden. Im schlimmsten Fall
tikeln ist ihre erhöhte Sichtbarkeit“, ist aber wesentlich höher, erzählt Reschke: könnten Forscher ärmerer Länder dann zwar
meint Reschke. „So werden sie von der „Deshalb bereiten wir einen Arbeitsablauf alles lesen, jedoch nicht mehr publizieren.“
Fach-Community schneller wahrgenommen vor, um die Autoren davon weitestgehend Reschke spricht sich deswegen da-
und in neuen Publikationen zeitnah refe- zu entlasten. Generell bietet die Bibliothek für aus, die Entwicklungen kritisch zu
riert. In der Praxis gibt es zwei Strategien: jederzeit gerne Beratungsgespräche an.“ begleiten, um den guten Ansatz zum
die Erstveröffentlichung in einer OA-Zeit- Beim Open Access bleiben alle Rechte bestmöglichen Ziel zu führen. Die Helm-
schrift – der Goldene Weg – oder, sofern beim Autor – ein klarer Vorteil gegenüber holtz-Gemeinschaft hat deshalb ein
der Beitrag in einem subskriptionsgebun- dem alten System, wie Reschke einschätzt. OA-Koordinationsbüro eingerichtet und
denen Journal veröffentlicht wird, die nach- „Dadurch stehen weiteren Veröffentlichun- den Arbeitskreis Open Science gegrün-
trägliche Einstellung in ein institutionelles gen weniger Hürden im Weg.“ Die Leiterin det. Beide Institutionen unterstützen die
oder disziplinäres Repositorium – der Grüne der Bibliothek verweist aber auch auf Gefah- Helmholtz-Zentren in allen Fragen zu Open
Weg.“ Im HZDR erschien im vergangenen ren, die in der OA-Initiative liegen könnten. Science.
> Augen auf beim Bilderkauf
Sorglosigkeit beim Urheberrecht von Fotos kann Folgen haben
Das Internet liefert zu jedem Thema pas- athek (https://www.hzdr.de/mediathek). mationen zu den CC-Stufen gibt es hier:
sendes Bildmaterial. Auch Forscher greifen Das Team der Abteilung Kommunikation https://creativecommons.org/licenses/
gerne für ihre Vorträge auf das vielfältige und Medien hat hier zahlreiche Motive Die Finger sollte man dagegen von Fotos
Angebot zurück. Wer sich aber nicht an zu den Rossendorfer Forschungsthemen lassen, deren Urheber unbekannt ist. Hier
die Spielregeln hält, läuft Gefahr, sich eine zusammengestellt. Aber auch hier muss bei könnten sogar zwei Gruppen klagen. Zum
Klage wegen Verletzung des Urheberrechts Verwendung der komplette Bildnachweis einen der Urheber, zum anderen eventuell
einzufangen. Abmahnungen im mittleren angegeben werden. Etwas schwieriger abgebildete Personen – denn bei beiden
vierstelligen Eurobereich sind bereits wird es bei Fotos mit einer sogenannten ist fraglich, ob sie einer Veröffentlichung
keine Seltenheit mehr. Sobald Fotos an die Creative Commons-Lizenz (CC). Bei diesen zugestimmt haben. Bilder, die mit dem Co-
Öffentlichkeit gehen, muss der Nutzer das Bildern kommt es auf den genauen Lizenz- pyright-Zeichen (©) versehen sind, sind ur-
Urheberrecht und die Bedingungen beach- typ an, der in den Metadaten steht. Bei der heberrechtlich geschützt und dürfen nicht
ten. Fotografen vermerken diese Angaben Abkürzung CC BY-ND darf das Foto zum ohne Freigabe des Urhebers eingesetzt
in den Metadaten, die über die Bildinforma- Beispiel weiterverbreitet werden, solange werden. In diesem Fall müssen unbedingt
tionen abrufbar sind. der Name des Urhebers genannt und die vor der Verwendung mit dem Autor die
Eine sichere Quelle ist die HZDR-Medi- Aufnahme nicht verändert wird. Alle Infor- genauen Bedingungen abgestimmt werden.
© Horia Andrei Varlan
(CC BY 2.0)F o r s c h u n g
8
> Die ELBE auf einen Blick
Neuer Flyer beleuchtet die Möglichkeiten des größten Forschungsgeräts in Sachsen
Das ELBE-Zentrum für Hochleistungs-Strahlenquellen (mit dem auslöst, oder eine supraleitende Elektronenkanone (2), die sie mit
Elektronen Linearbeschleuniger für Strahlen hoher Brillanz Hilfe eines Lasers aus einem fotoempfindlichen Material schießt.
und niedriger Emittanz ELBE) ist die wohl vielseitigste For- Zwei Beschleunigermodule (3) treiben die Elektronen anschlie-
schungsanlage des HZDR, denn an ihr lassen sich verschiedene ßend fast bis zur Lichtgeschwindigkeit an. Mit dem Bunch-Kom-
Strahlungsarten erzeugen. Davon profitieren unterschiedlichste pressor (4) lässt sich die Elektronenpulsdauer anpassen, indem
Forschungsbereiche – von der Kern- und Teilchenphysik über die unterschiedlich schnelle Elektronen sortiert werden.
Materialwissenschaft bis hin zur Medizin. Diese einzigartige Infra Der Kernphysik-Messplatz erlaubt Experimente mit intensi-
struktur erlaubt Wissenschaftlern aus aller Welt tiefe Einblicke in ver Bremsstrahlung (5), die in bestrahlten Proben Positronen
die Struktur und die Zustände von Materie und Materialien. erzeugen kann. Mit Hilfe der Positronen-Spektroskopie können
Ausgangspunkt für den primären Elektronenstrahl ist entweder Forscher so Defekte im atomaren Bereich untersuchen. An
eine thermische Elektronenquelle (1), die die geladenen Teilchen einer speziellen Elektronenstrahl-Teststation (6) kann der Strahl
über hohe Temperaturen aus einer Metallplatte (Glühkathode) her- aus dem Vakuumstrahlrohr geleitet werden, um Detektoren
> Die ELBE auf einen BlickF o r s c h u n g In si der 18/September 2015 9 zu überprüfen oder radiobiologische Experimente an Luft zu von Atomkernen untersucht werden. Die Positronenquelle pELBE ermöglichen. (11) ist besonders gut für Materialuntersuchungen geeignet. Sie Der Freie-Elektronen-Laser FELBE (7) produziert intensive kohä- erlaubt die zerstörungsfreie Messung von Defekten in Kristallen, rente Infrarot-Strahlung, mit der Messungen zu Zeitabläufen im Metallen, Halbleitern und Polymeren. Pikosekundenbereich oder von Halbleiter-Mikrostrukturen möglich In der Röntgenquelle PHOENIX (12) wird der Elektronenstrahl werden. Die breit- (8) und schmalbandige (9) Terahertz-Anlage mit dem intensiven Licht des Hochleistungslasers DRACO (13) TELBE verspricht vielfältige Möglichkeiten für Anregungs- und gekoppelt, wodurch Röntgenstrahlung entsteht. Abfrage-Experimente und für neuartige Diagnostik der Elektronen- strahlparameter. An der Neutronenquelle nELBE (10) kann die inelastische Neutronenstreuung – also die Anregung von Atomkernen durch Den kompletten Flyer und weitere Informationen gibt es hier: Energieübertragung der Neutronen – und der Neutroneneinfang https://www.hzdr.de/elbeflyer
S c h n itt s t e l l e
10
> „Die gefährlichste Sicherheitslücke
ist der Mensch“
HZDR informiert über sichere Nutzung des Internets
Pling – eine scheinbar harmlose E-Mail poppt im Postfach auf. Per- Robby Gorek zwei Mails an über 1.100 Adressen. Bei der ersten
sönlich an den Empfänger adressiert berichtet sie, dass es beim Variante handelte es sich um eine angebliche Versandinformation
Ablauf einer Konferenz, an der der Forscher tatsächlich teilnimmt, eines großen Internethändlers, bei der zweiten Version um eine
Änderungen gibt. Details stehen auf der folgenden Webseite. Ein fiktive Systemnachricht, dass das Mailpostfach voll sei. In beiden
Klick auf den Link – und der Angriff beginnt. Von der täuschend Fällen wurden die Empfänger aufgefordert, einem Link zu folgen.
echten Seite installiert sich unbemerkt schädliche Software auf „Der erste Versuch verlief an sich positiv“, berichtet Robby
dem Computer, infiltriert das Netzwerk der Einrichtung, sammelt Gorek. „Nur 86 Mitarbeiter klickten auf den Link. Die Ergebnisse
Daten und verschickt sie an ihren Auftraggeber. Es sind solche des zweiten Tests sind jedoch ernüchternd. Fast 400 Kollegen
Szenarien, die dem IT-Sicherheitsbeauftragten des HZDR, Robby öffneten den Link – und davon gaben dann noch einmal rund 200
Gorek, Alpträume bereiten. ihre persönlichen Daten auf einer gefälschten Webseite ein.“ Das
Denn was nach dem Anfang eines fiktiven Krimis klingt, ist Problem: Nur eine Schwachstelle genügt der schädlichen Soft-
tatsächlich eine Methode, mit der Hacker deutsche Forschungs- ware, um ihren Weg in das System zu finden. In zwei Kolloquien im
einrichtungen attackieren. „Zwar gab es in Rossendorf einen so Juli haben Gorek und die IT-Abteilung den Test ausgewertet und
ausgefeilten Angriff bisher glücklicherweise noch nicht“, erzählt die Mitarbeiter über die sichere Nutzung des Internets informiert.
Gorek. „Andere Zentren – auch der Helmholtz-Gemeinschaft – Außerdem sollen die Systemnachrichten vereinheitlicht werden,
haben dies allerdings schon erlebt.“ Und die Attacken nehmen damit die Nutzer Abweichungen leichter erkennen können.
zu. Als die IT-Abteilung des HZDR Anfang des Jahres eine Welle Sicherheitsexperte Gorek rät auch davon ab, externe Datenspei-
an E-Mails mit Schadsoftware bemerkte, entschloss sich Gorek, cher im Internet zu nutzen. Eine praktische Alternative bietet das
einen Phishing-Test durchzuführen, um herauszufinden, wie die HZDR mit dem eigenen Programm OwnCloud, das jedem Mitarbei-
Mitarbeiter auf solche Nachrichten reagieren. ter zur Verfügung steht. „Für Phishing-Mails genügen häufig aber
Beim Phishing versuchen Betrüger, mit Hilfe gefälschter Websei- schon ein paar einfache Sicherheitsregeln“, fasst Gorek zusam-
ten oder E-Mails persönliche Daten abzugreifen. Typischerweise men. „Prüfen Sie den Absender, versichern Sie sich, dass Sie auf
wird dabei eine vertrauenswürdige Einrichtung nachgeahmt. In der richtigen Internetseite sind, geben Sie niemals Ihr Passwort
Absprache mit dem Datenschutzbeauftragen des HZDR versandte preis und vor allem klicken Sie nicht jeden Link an.“
>
Own-Cloud – das HZDR-Filesharing-System
Mit der Software OwnCloud bietet das HZDR eine sichere
Alternative zu anderen Speicherdiensten im Internet, wie
Dropbox oder Google Drive. Über das Programm können
große Mengen an Daten schnell und einfach geteilt werden.
Aktuell stehen jedem Nutzer standardmäßig bis zu fünf
Gigabyte zur Verfügung. Der Zugriff ist über die Internetseite
(https://owncloud.hzdr.de) mit der persönlichen Kennung
möglich. Da der Speicher im Netz des HZDR liegt, können die
Daten jederzeit ohne die Hilfe Dritter von überall abgerufen
werden. Über einen Link und ein Passwort, die der Nutzer
selbst in der Software anlegt, lassen sich gespeicherte Daten
mit externen Partnern austauschen.
Weitere Informationen:
http://www.hzdr.de/owncloudS c h n itt s t e l l e
In si der 18/September 2015 11
>
Den neuesten Entwicklungen
einen Schritt voraus
Personalentwicklungskonzept bündelt Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung
Im Kampf um die besten Köpfe spielen Angebote zur persönlichen
und fachlichen Weiterbildung eine immer wichtigere Rolle im
Arbeitsleben. Die rasanten technischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen machen das „Lebenslange Lernen“ notwendig, um
alle Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Das HZDR hat
deswegen ein Personalentwicklungskonzept aufgesetzt. Damit will
das Forschungszentrum die Qualifikationen und Fähigkeiten seiner
Mitarbeiter gezielt fördern. Das Konzept bündelt für die unter-
schiedlichen Personalgruppen verschiedene Angebote.
„Gerade bei den neuen Bewerbern nehmen die Nachfragen
nach Möglichkeiten zur Weiterbildung stark zu“, erzählt die Verwal-
tungschefin des HZDR, Andrea Runow. „Vor allem junge Forscher
erkennen zunehmend, dass fachliche Kompetenz allein nicht für
den beruflichen Erfolg ausreicht – auch wenn sie natürlich die
grundlegende Voraussetzung dafür bildet. Es geht aber darum, das
Fachwissen mit geeigneten Soft Skills zu ergänzen.“ Das HZDR hat
deshalb zum Beispiel den Junior Manager in Science aufgesetzt,
der sich an wissenschaftliche Nachwuchsführungskräfte richtet.
„Die Weiterbildung besteht aus sechs Modulen – Konfliktma-
© HZDR/O. Killig
nagement, Grundlagen der Führung, Kommunikation, Präsentati-
onstechnik und Rhetorik, Moderation sowie Zeit- und Selbstma-
nagement“, beschreibt Ines Göhler von der Abteilung Personal die
Themen des Kurses, der ein knappes Jahr dauert. Das Fazit der
Teilnehmer ist positiv, wie Nicole Wagner erzählt. Die Mitarbeiterin
der Zentralabteilung Forschungstechnik nahm im vergangenen Jahr > Das HZDR gilt seit vielen Jahren als hervorragender
Ausbildungsbetrieb.
das Angebot wahr – und würde es wieder machen: „Das Programm
ist sehr empfehlenswert. Da die Anzahl der Teilnehmer eher klein
ist – in unserem Fall waren wir zu zwölft –, lernt man sehr viel.“
Nicole Wagner, die fast zeitgleich mit dem Start des Kurses
die Leitung der Abteilung Instrumentierung übernahm, konnte
so Inhalte aus dem Programm direkt in ihren neuen Berufsalltag
Aus der Praxis in die Praxis – einbringen. „Als Teil des Personalentwicklungskonzepts erfüllt
>
die HZDR-Technikerakademie der Junior Manager in Science somit die Ziele, die wir mit dem
Programm verfolgt haben“, bilanziert Ines Göhler. Eine ähnliche
Maßnahme aus dem neuen Konzept, die besonders das techni-
Am 10. September 2015 hat das HZDR mit der Techniker- sche Personal ansprechen soll, startete im September dieses
akademie ein neues Fortbildungsprogramm gestartet, das Jahres. „Gemeinsam mit der Sächsischen Bildungsgesellschaft
sich speziell an die rund 200 technischen Mitarbeiter des für Umweltschutz und Chemieberufe haben wir ein vielfältiges
Forschungszentrums richtet. Dadurch sollen die schon Schulungsangebot entwickelt.“
bestehenden Kurse gebündelt und gezielt um neue Elemente Die Technikerakademie soll praxisnah die Kenntnisse der lang-
ergänzt werden. Das Programm umfasst insgesamt sieben jährigen Experten auffrischen und erweitern. Das Angebot reicht
Themenkomplexe, die sich wiederum in einzelne Lehrgänge von Fachkundethemen, wie Umgang mit chemischen Gefahrstof-
unterteilen: Fachkunde, Strahlenschutz, Arbeitssicherheit, fen, über Strahlen- und Arbeitsschutz bis zu Sozialkompetenzen.
Informationstechnik, Kommunikation und Sozialkompetenz, „Die beiden Programme sind zwei wichtige Maßnahmen aus dem
HZDR intern sowie das Expertenforum für Ausbilder. Die Personalentwicklungskonzept, das sich allerdings auch noch mit
Akademie wird jährlich im Frühjahr und Herbst für jeweils vielen weiteren Bereichen beschäftigt“, erzählt Göhler. So fasst es
zwei Wochen veranstaltet. Über die HZDR-Intranetseite kön- ebenfalls die HZDR-Positionen zu Themen, wie dem Gesundheits-
nen sich interessierte Mitarbeiter zu den einzelnen Kursen management, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder der
informieren und sich anmelden. Befristungspolitik, zusammen.
www.hzdr.de/personalentwicklungS c h n itt s t e l l e
12
> Gründung der Zentralabteilung für
Informationsdienste und Computing
Im Juli wurde am HZDR die neue Zent- Vernetzung mit den HZDR-Forschergruppen
ralabteilung für Informationsdienste und und mit externen Partnern wie der Tech-
Computing (FWC) im wissenschaftlichen nischen Universität Dresden und mit den
Geschäftsbereich gegründet. Sie ersetzt Forschungszentren in der Helmholtz-Ge-
die Abteilungen Informationstechnologie meinschaft gestärkt werden.
und Bibliothek des Technischen Services Im Zuge der neuen Organisation wurde
und wird erweiterte Aufgaben vor allem im auch die Bibliothek in die Zentralabteilung
Bereich der wissenschaftlichen Informatik integriert. Grund dafür ist das veränderte
übernehmen. Die Leitung übernimmt Informationsverhalten in der Wissenschaft,
Dr. Uwe Konrad. das zu einem Wandel in der Rolle der
Die Zentralabteilung wird weiterhin Bibliotheken geführt hat. Deshalb wird eine
Infrastruktur, Software und Services für das gemeinsame, nutzerorientierte Infrastruk-
gesamte Zentrum bereitstellen, aber auch tur von Bibliothek und IT aufgebaut, die
zunehmend Lösungen für wissenschaftliche qualitätsgesicherte Daten für die Forschung
© Oliver Killig
Projekte entwickeln. Die HZDR-Institute abfragt, analysiert und aufbereitet. Die
werden beispielsweise bei der Simulation kaufmännische Informationstechnologie
physikalischer Prozesse oder der Über- verbleibt hingegen als Abteilung der Verwal-
tragung und Speicherung extrem großer tung im Geschäftsbereich des Kaufmänni-
> Dr. Uwe Konrad Datenmengen unterstützt. Dafür soll die schen Direktors des HZDR. CD
> Mit neuem Leiter auf eigenen FüSSen
Kaufmännische IT ist nun eine eigenständige Abteilung in der Verwaltung
Im Juni ein neuer Abteilungsleiter, im Juli der Die erste große Herausforderung steht den Wechsel an das HZDR waren vor allem
„Umzug“ in eine neue Zentralabteilung – die bereits für die Kaufmännische IT an: Als das noch breiter gefächerte Themenfeld
Kaufmännische IT hatte einen turbulenten neue Personalsoftware wird das System und die gute Vereinbarkeit von Beruf und
Sommer. „Die generelle Neuordnung der „Human Capital Management“ (HCM) von Familie. CD
Informationstechnologie am HZDR ermög- SAP eingeführt. „SAP-Software hat sich be-
lichte es auch, die Kaufmännische IT auf reits in anderen Bereichen unserer Verwal-
organisatorischer Ebene neu aufzustellen“, tung bewährt, deshalb war es sinnvoll, die
erläutert der neue Leiter Andreas Rex. Von mittlerweile veraltete Software am HZDR
nun an zählt seine Abteilung zur Verwal- durch das HCM-Modul abzulösen.“ Der
tung. Zuvor war sie Teil der Informations- Datenschutz hat dabei weiterhin obers-
technologie im Technischen Service. te Priorität: Alle Personaldaten bleiben
Aus Sicht des neuen Abteilungsleiters ist gekapselt von anderen Programmteilen am
die Umstrukturierung zu begrüßen: „Wir HZDR gespeichert.
sind zentral für alle kaufmännischen Soft- Für diese anspruchsvollen Aufgaben
ware-Systeme zuständig, während die neue bringt der gebürtige Zwickauer viel Erfah-
Zentralabteilung Informationsdienste und rung mit: Nach einem Studium der Wirt-
Computing die technische Infrastruktur schaftsinformatik arbeitete Rex für sechs
am Zentrum zur Verfügung stellt und die Jahre bei einem Dresdner IT-Unternehmen.
Wissenschaftler unterstützt.“ Die beiden Als Berater war er dort verantwortlich
IT-Abteilungen sind demnach noch immer für die Integration von SAP-Systemen für
eng verzahnt, in Bezug auf Zielsetzung und
Zuständigkeiten nun aber klarer getrennt.
Kunden- und Logistikprozesse bei europäi-
schen Großunternehmen. Entscheidend für > Andreas RexN a c h w u c h s
In si der 18/September 2015 13
>
The results are in
Helmholtz Juniors Ph.D. survey indicates strengths and weaknesses
Almost 1.500 doctoral candidates participated in last year’s In this category HZDR
Helmholtz-wide Ph.D. survey. The study, which is conducted shares the last place with one
biannually, provides an overview of the young researchers’ other center of the Helmholtz
situation at the different centers. At HZDR 65 doctoral candidates Association. Nevertheless, the
– about 43 percent of the total number – contributed their two representatives do not
opinion concerning various topics, like funding, supervision, think that these data are reason
or infrastructure. As it turns out the conditions at the Dresden for panic. “We reckon, that the
research center are in parts ambivalent. negative result stems rather
“In general we think the situation for Ph.D. students at HZDR from the method of the survey
is good,” Cemena Gassner, a doctoral candidate at the Institute than actual disappointment,”
of Radiopharmaceutical Cancer Research, evaluates. “This is also Gassner explains. “The study
mostly shown by the data of the survey.” The Ph.D. representative evaluated the supervision
highlights especially the employment via regular working via four parameters: the
contracts instead of scholarships – a policy that is not common
for all Helmholtz centers. “Thanks to this type of recruitment
> Cemena Gassner and
Matthias Ratajczak
existence of regular progress
reports, a project outline,
doctoral candidates have all the advantages of normal employees, a thesis committee and
like health and pension insurance.” a supervision agreement.”
This strategy provides security for young researchers, Matthias On the basis of the participants’ answers – yes or no – a
Ratajczak, also a Ph.D. representative at HZDR, believes. The supervision index, ranging from zero to four, was calculated. “This
doctoral candidate from the Institute of Fluid Dynamics adds: “As approach might oversimplify the complexity of the issue and does
the contracts usually last three years, it becomes easier to plan not lead to meaningful results,” Ratajczak points out. Thus, the
one’s career. Moreover, extensions are usually unproblematic.” representatives want to conduct a further survey concerning this
Further areas, in which the Dresden research center fares well, issue during the upcoming Ph.D. seminar of the HZDR. “This will
are infrastructure and support of families. However, one result illustrate if there is really a problem or if the data are biased.”
surprised Gassner and Ratajczak: the state of supervision. The entire results can be found here: http://www.heju-survey.de
>
Zahl der abgeschlossenen Promotionen
weiterhin auf hohem Niveau
Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 43 Nachwuchswissen-
schaftler am HZDR und an seinen Partnereinrichtungen ihre
Doktorarbeiten ablegen. Im Vergleich zu 2013, als 39 Dokto-
randen promovierten, hat sich die Anzahl leicht erhöht. Von den
Promotionen im Jahr 2014 verteilen sich 13 auf das Institut für
Ionenstrahlphysik und Materialforschung, neun auf das Institut
für Radiopharmazeutische Krebsforschung, sechs auf unser
Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie, fünf auf
das Institut für Strahlenphysik, vier auf das Institut für Ressour-
cenökologie, drei auf das Institut für Fluiddynamik, zwei auf
das Institut für Radioonkologie bzw. das Nationale Zentrum für
Strahlenforschung in der Onkologie – OncoRay und eine auf das
Institut Hochfeld-Magnetlabor Dresden. Den Doktorandenpreis
des Forschungszentrums sicherte sich 2014 Dr. Georg Schramm
vom Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung. Er leistete
wertvolle Beiträge für die medizinische Diagnostik mit Hilfe der
kombinierten Positronen-Emissions- und Magnet-Resonanz-Tomo-
graphie (PET/MRT).
> Beim HZDR-Jahresempfang 2014 erhielt Dr. Axel Jochmann
(Mitte) von der Sächsischen Wissenschaftsministerin,
Eine vollständige Liste aller Doktorarbeiten aus dem vergange- Dr. Eva-Maria Stange, und dem Wissenschaftlichen Direktor
nen Jahr steht im Online-Jahresbericht unter: des HZDR, Prof. Roland Sauerbrey, einen Anerkennungspreis
https://www.hzdr.de/jahresbericht für seine Doktorarbeit.N a c h w u c h s
14
> Was zeichnet einen guten Lehrer aus?
DeltaX-Doktorand erforscht Interessensentwicklung durch Schülerlabore
rand unterstützen. Im Schülerlabor will er Untersuchung will er zusammen mit dem
untersuchen, welche Kompetenzen und DeltaX-Team auch das Experimentierange-
Merkmale Betreuer aufweisen müssen und bot ausbauen. Vor allem die astronomisch
wie die Betreuung gestaltet sein muss, oder astrophysikalisch geprägten Themen
um das Interesse an und das Fachwissen sieht Florian Simon dabei als spannende
in den Naturwissenschaften zu steigern. Anknüpfungspunkte zum Lehrangebot
So reichen für optimale Lernerfolge etwa der Schulen. Mit einem ähnlichen Projekt
> Florian Simon gutes Fachwissen oder pädagogische
Kenntnisse allein nicht aus, wie der gebür-
beschäftigte er sich bereits während eines
Forschungsaufenthalts an der Tōhoku
Beim Schülerlabor des HZDR gibt es seit tige Erzgebirgler meint: „Aus der Forschung University im japanischen Sendai. Dort
März ein neues Gesicht: Florian Simon. Der geht hervor, dass besonders die Gestaltung programmierte er Animationen zu Experi-
26-Jährige hat an der TU Dresden Physik des Unterrichts und die Art der Vermittlung menten, die im Unterricht nur schwer zu
und Mathematik auf Lehramt studiert und des Lernstoffes eine starke Rolle spielen.“ realisieren sind.
wird künftig das DeltaX-Team als Dokto- Neben seiner wissenschaftlichen Florian Simon/CD
> Die Freude am Experimentieren wecken
Programm „Kids mit Grips“ geht in die nächste Runde
Seit 2011 bieten Forscher des HZDR im ihre Erfahrungen mit dem Projekt „Kids Ionenstrahlphysik und Materialforschung.
Rahmen einer Kooperation regelmäßig mit Grips“. Die Forscherin vom HZDR-In- Seit dem Start des Programms hat er
Experimentiernachmittage für die Vor- stitut für Fluiddynamik hatte sich im jedes Jahr einen Nachmittag an der Kita
schulgruppe der Kita Hutbergstrolche in vergangenen Jahr an dem Programm übernommen – und eine interessante
Dresden-Weißig an. Mit Hilfe spannender beteiligt. Ausgestattet mit einer großen Entdeckung gemacht: „Die kindliche und
Versuche wollen die Wissenschaftler die Menge Seifenwasser und verschiedenen wissenschaftliche Neugier liegen nahe
Kinder an die Welt der Naturwissenschaf- Drahtformen zum Durchpusten erklärte beieinander.“
ten und Technik heranführen. Das neue sie den Kindern, warum sich auch Bla- Anhand einfacher Versuche zum Fliegen
Programm startete Anfang September mit sen aus eckigen Gestellen immer wieder und zu Luftströmungen gibt der Physiker
dem Thema Magnetismus. Neun weitere in eine Kugel verwandeln. den Kindern einen ersten Einblick in das
Termine bis Mitte Juni 2016 stehen eben- „Gerade in diesem Alter sind Kinder wissenschaftliche Experimentieren. Der
falls bereits fest. extrem neugierig“, stellt Friederike Gauß Aufwand hält sich dabei eher in Gren-
„Es ist ein sehr schönes Gefühl, zu fest. „Es macht riesigen Spaß, diese zen, wie Winnerl berichtet. „Zwar muss
sehen, wie die Kinder neue Dinge ent- Neugier zu befriedigen.“ Ähnlich sieht das man an den Nachmittagen selbst etwas
decken“, beschreibt Dr. Friederike Gauß auch Dr. Stephan Winnerl vom Institut für Geduld mitbringen, wenn das Programm
aber einmal steht, ist es eigentlich ein
Selbstläufer.“
Anderen Forschern kann er deshalb die
Beteiligung an dem Projekt nur empfehlen:
„Gerade in den Tagen danach stellen die
Kinder noch viele Fragen. Das zeigt, dass
die Experimente in ihren Köpfen nachwir-
ken und sie sich damit auseinandersetzen.“
Für den kommenden Durchgang
2015/2016 sind schon alle Termine belegt,
erzählt Susann Gebel, die das Programm
koordiniert: „Für den Jahrgang danach
suchen wir aber schon jetzt nach neuen
> Auch beim Tag des offenen Labors bieten HZDR-Wissenschaftler Experimente
für die Forscher von Morgen an.
Vorschlägen. Interessierte HZDR-Mitarbei-
ter können sich jederzeit bei mir melden.“P a n o r a m a
In si der 18/September 2015 15
>
Medaillenregen in Belgien
Erfolgreiche HZDR-Beteiligung an der 15. Atomiade
Anfang Juni haben sich 35 HZDR-Mitarbeiter noch nie miteinander trainiert“, erzählt
und Mitglieder des SV FS Rossendorf auf HZDR-Rechtsassessorin Merit Grzega-
den Weg in das belgische Geel gemacht. nek, die die Beteiligung am Tennisturnier
Das dortige Institut für Referenzmaterialien angestoßen hatte. Da sich in Dresden nicht
und -messungen hatte zur Olympiade der genügend interessierte Spieler fanden, ging
europäischen Forschungszentren – der der Aufruf an die anderen Zentren, was zu
© E. Schuster
Atomiade – eingeladen. Insgesamt nahmen einem gemeinsamen Helmholtz-Team mit
rund 1.200 Sportler aus 12 Ländern an den internationaler Unterstützung führte. Am
Wettkämpfen teil. Auf dem Konto des Dresd- Ende konnten sich die sieben Sportler die
ner Forschungszentrums standen am Ende Bronzemedaille sichern.
der dreitägigen Veranstaltung insgesamt „Ich denke, dieser Erfolg verkörpert die Besonders erfolgreich waren die Ros-
zehn Medaillen, was dem Team den 15. von Idee, die hinter der Atomiade steht“, meint sendorfer in den Einzelsportarten. Hier
36 Plätzen einbrachte. Jörg Voigtländer. „Der Konkurrenzgedanke erhielten sie bei den Disziplinen Schwim-
Einen überraschenden Erfolg konnte steht im Hintergrund. Es geht vielmehr dar- men, Inline-Skaten, Mountainbike, Triathlon
dabei das Tennisteam verbuchen, das sich um, den Austausch zwischen den verschie- und Radfahren insgesamt sechs Gold-, zwei
aus Mitarbeitern der Helmholtz-Zentren denen Forschungszentren in Europa auf Silber- und eine Bronzemedaille. Aber auch
Berlin, Jülich, Dresden-Rossendorf sowie informeller Basis zu fördern.“ Die sportlichen die Fußballer mit dem 6. und die Volleybal-
zwei weiterer Forschungseinrichtungen Ergebnisse erfreuen den Leiter der Abteilung ler mit dem 8. Platz boten solide Leistun-
aus dem Ausland zusammensetzte. „Das Elektronische Messtechnik, der seit 1994 gen. Einen ausführlichen Bericht gibt es auf
Team hatte sich tatsächlich zum ersten die HZDR-Beteiligung an den internationalen der Homepage des Sportvereins:
Mal vor Ort getroffen – wir hatten zuvor Wettkämpfen organisiert, trotzdem. www.sv-rossendorf.de.vu
>
Entdecken statt schlafen
HZDR auf der Langen Nacht der Wissenschaften in Dresden und Freiberg
Dem Motto „nachtaktiv!“ folgend zog es Thema Licht und Strahlung. Unter anderem Freudenstein. Auf der Meile für Geowissen-
am 3. Juli 2015 rund 33.000 Gäste zur zeigte das Forschungszentrum einen Laser, schaften, Geotechnik und Bergbau stellte
13. Langen Nacht der Wissenschaften in dessen Licht sich nicht immer nur geradli- sich das Helmholtz-Institut Freiberg für
Dresden. Jeder zehnte Besucher kam in nig ausbreitet. Ressourcentechnologie (HIF) vor. „Alles
das Hörsaalzentrum der TU Dresden. Pas- Mit der „Nacht der Wissenschaft und Kupfer: Vom Mineral bis zum Draht!“ hieß
send zum „Internationalen Jahr des Lichts Wirtschaft zum Jubiläum“ feierte die TU es an dem Stand, den die HIF-Wissen-
und lichtbasierter Technologien 2015“ Bergakademie Freiberg im Juni ihr 250-jäh- schaftler gemeinsam mit dem Institut für
präsentierten sich dort fast 100 Forscher riges Gründungsjubiläum. Etwa 7.000 Be- Mineralogie der Bergakademie nutzten, um
und Mitarbeiter des HZDR mit spannenden sucher strömten trotz Dauerregen auf die Jung und Alt für die faszinierende Welt der
Experimenten und Vorträgen rund um das Experimentiermeilen rund um das Schloss Rohstoffe zu begeistern.
© HZDR/Stephan Floss
© HZDR/Stephan Floss
> Die Langen Nächte der Wissenschaft in Dresden (links) und Freiberg (rechts) lockten viele Besucher an.Sie können auch lesen