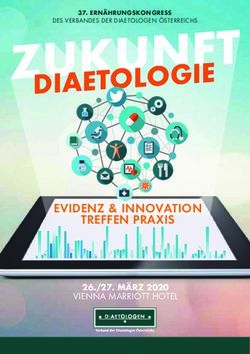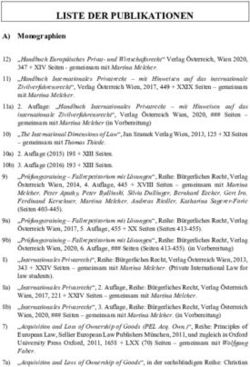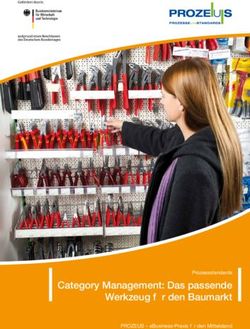Klagenfurter Geographische Schriften Heft 28 - Eine Zukunft für die Landschaften Europas und die Europäische Landschaftskonvention
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Klagenfurter
Geographische
Schriften Heft 28
Institut für Geographie und Regionalforschung
der Universität Klagenfurt 2012
Hans Peter JESCHKE und Peter MANDL (Hrsg.)
Eine Zukunft für die Landschaften Europas
und die Europäische LandschaftskonventionTitelblatt: „Unsere Umwelt beginnt in der Wohnung und endet in der Weite der Landschaft“
Aus: IVWSR (1973): Wiener Empfehlungen. Luxemburg. In: Jeschke, Hans Peter (Hrsg.)
(1982): Problem Umweltgestaltung. Ausgewählte Bestandsaufnahme, Probleme, Thesen
und Vorschläge zu Raumordnung, Orts- und Stadtgestaltung, Ortsbild- und
Denkmalschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz. Verlag Stocker, Graz.
(= Schriftenreihe für Agrarpolitik und Agrarsoziologie, Sonderband 1)
Medieninhaber (Herausgeber und Verleger):
Institut für Geographie und Regionalforschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67, A-9020 Klagenfurt
Herausgeber der Reihe: Ass.-Prof. Mag. Dr. Peter MANDL
Prof. Mag. Dr. Friedrich PALENCSAR
Schriftleitung: Prof. Mag. Dr. Friedrich PALENCSAR
Redaktionelle Betreuung: Dipl.-Ing. Stefan JÖBSTL, Bakk.
Webdesign und –handling: Natalie SCHÖTTL, Dipl.-Geogr. Philipp AUFENVENNE
ISBN 978-3-901259-10-4
Webadresse: http://geo.aau.at/kgs28Hans Peter Jeschke, Peter Mandl (Hrsg.) (2012): Eine Zukunft für die Landschaften Europas und
die Europäische Landschaftskonvention. Institut für Geographie und Regionalforschung an der
Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Klagenfurter Geographische Schriften, Heft 28.
DIE KULTURGÜTERDATENBANK DER STADT WIEN
Manfred WEHDORN
1. Einleitung
Der Aufbau jeder Kulturgüterdatenbank wird durch drei Fragen bestimmt:
- Für wen wird inventarisiert?
- Warum, das heißt, für welchen Zweck ?
- Was und wie, bzw. in welcher Form wird inventarisiert?
Für Wien sind die Fragen einfach zu beantworten:
Wien ist sich – als kulturell und historisch vielschichtig geprägte Stadt – der Verantwortung
für Ihr historisches Erbe bewusst. Nur eine konsequent durchgeführte Inventarisation auf
wissenschaftlicher Basis ermöglicht letztendlich auch die Kontrolle über den möglichen
Ausbau der historischen Bausubstanz einer Stadt. Der Aufbau einer Kulturgüterdatenbank ist
aber auch Teil einer gezielten Bürgerinformation, also politisches Instrument.
Historisch gesehen, geht die Wiener Kulturgüterdatenbank auf die sogenannte
Altstadterhaltungsnovelle aus dem Jahr 1972 zurück (LGBL. für Wien, Nr. 16/1972), mit der
entsprechenden Bestimmungen zum Schutz der Altstadt in die Bauordnung aufgenommen
wurden ("Ensembleschutz"). Wesentliches Mittel hierfür war die Festlegung von
Schutzzonen, die seither in den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen der Stadt Wien
ausgewiesen werden. Als die beiden ersten Wiener Schutzzonen beschloss man bekanntlich
den Wiener Spittelberg und den ehemaligen Ortskern von Altmannsdorf um den Khleslplatz.
Als größte zusammenhängende Schutzzone gilt die Wiener Innenstadt, die ebenfalls bereits
1973 vom Wiener Gemeinderat beschlossen wurde.
Abb. 1: Blick über die Wiener Innenstadt, vom Wiener Gemeinderat am 20.12.1973 zur Schutzzone
erklärt (© Stadt Wien, MA 18)
800DIE KULTURGÜTERDATENBANK DER STADT WIEN 801 ___________________________________________________________________________ Die Kulturgüterdatenbank der Stadt Wien in ihrer heutigen Form ist in Zusammenhang mit der Erneuerung der Wiener Schutzzonenmethodik zu sehen, die zu Beginn der neunziger Jahres des 20. Jahrhunderts – nach rund zwanzig Jahren Erfahrung mit dem Schutzzonengesetz – in Angriff genommen wurde. Eine kritische Analyse zeigte damals, dass in Wien ein Mangel vor allem auf den Gebieten der Grundlagenaufbereitung und der Inventarisierung bestand. Unter Einbeziehung internationaler Erfahrungen wurde in der Folge eine wissenschaftliche Inventarisierung des baulichen Erbes auf computerisierter Basis erarbeitet, die über das GIS-System (Geographisches Informations-System) der Stadt Wien auf elektronischem Wege auch graphisch in Form von Übersichtskarten abrufbar ist: www.wien.gv.at/kulturportal/public/grafik.aspx?ThemePage=1&RadioButtonState=1111111011111 2. Das aktuelle Schutzzonenmodell als Basis der Kulturgüterdatenbank. Zu Methodik, Durchführung und Stand der Inventarisierung Im Rahmen des aktuellen Schutzzonenmodells wurde – obwohl dies gesetzlich nicht verankert ist – eine Differenzierung der Bausubstanz in erhaltenswerte Objekte und Füllobjekte als sinnvoll und notwendig erachtet und mit dieser Differenzierung eine nahezu flächendeckende und phasenweise Untersuchung der bedeutenden Wiener Bausubstanz durchgeführt. Hierbei bedeuten: Erhaltenswerte Objekte: Das sind solche Objekte, die von ihrem Erscheinungsbild und ihrer Qualität her für das Ensemble als integrierend zu betrachten sind und daher einem generellen Abbruchverbot unterliegen. Der Schutz dieser Objekte bezieht sich sowohl auf Bauform und Gestalt als auch auf historische Baumaterialien. Primär geschützt werden sollen der Straßentrakt mit seiner Hauptfassade mit öffentlichen Durchgängen, Dachbereichen samt Dachaufbauten usw.; Zusätzlich werden die erhaltenswerten Objekte in zwei Kategorien differenziert: A – das sind Objekte mit hohem Originalzustand, überregionaler Bedeutung und Qualität, sowie B – das sind gut erhaltene Objekte von regionaler (lokaler) Bedeutung, deren Erhaltung vor allem aufgrund des Ensemblewertes notwendig erscheint. Füllobjekte: Dies sind Objekte, welche aufgrund ihrer architektonischen und städtebaulichen Qualität keinen bestimmenden Bestandteil des Ensembles darstellen. Veränderungen, Teilabbrüche und Abbrüche des gesamten Gebäudes sind grundsätzlich möglich. Diese Differenzierung der Bausubstanz ist, wie bereits eingangs erwähnt, mit keiner rechtsverbindlichen Wirkung verbunden; sie stellt lediglich eine erste und diskutierbare Einschätzung des Objektbestandes dar.
802 MANFRED WEHDORN ___________________________________________________________________________ Die einzelnen Phasen der Inventarisierung umfassten (vergleiche hierzu Abb. 2): Phase 1 – Erfassung vorhandener Daten: Zu Beginn der Inventarisation wurden ca. 25.000 Hausbeschreibungen aus der Fachliteratur wie auch aus anderen Quellen (wie z. B. Archivbestände aus dem Bundesdenkmalamt und dem Kulturamt der Stadt Wien) digital erfasst sowie eine Verknüpfung dieser Daten mit dem Grafischen Informationssystem der Stadt Wien (Vienna-GIS) hergestellt. Phase 2 – Schnellinventarisierung: Nach einer Eu-weiten Ausschreibung wurden sieben Architektenteams beauftragt, eine Felduntersuchung von speziell ausgewiesenen Bereichen des Stadtgebietes durchzuführen, wobei das Hauptaugenmerk auf noch nicht erfasste, schützenswerte Ensembles gelegt wurde. Die hierbei durchgeführten Untersuchungen dienten einerseits der flächendeckenden Gebäudebewertung und – daraus abgeleitet – einer Feststellung eventuell neuer Schutzzonengebiete sowie andererseits einer Analyse des Stadtbildes (Stadtstruktureller Plan). Die Erhebung umfasste zahlreiche Daten, bzw. Bauperiode, Bedeutung der Objekte (für die Stadt, den Bezirk, das Ensemble, den Städtebau, die Architektur), bauhistorische und baukünstlerische Werte und Fassadenzustand. Diese Daten können auch über das Vienna-GIS zusammengeführt und so flächendeckende Pläne zu den unterschiedlichen Themenbereichen erstellt werden. Von den einzelnen Gebäuden wurden auch Fotos angefertigt, digital verarbeitet und mit dem Vienna-GIS verknüpft.
DIE KULTURGÜTERDATENBANK DER STADT WIEN 803 ___________________________________________________________________________ Alle Daten wurden in einem weiteren Arbeitsschritt analysiert und die Bausubstanz in Form eines Kategorieplans in erhaltenswerte Gebäude und Füllobjekte differenziert. Daraus wurden in weiterer Folge Vorschläge für Modifikationen bestehender Schutzzonen bzw. für neu erkannte und noch zu diskutierende Ensemblebereiche erstellt. Die Schnellinventarisierung konnte bereits 2002 abgeschlossen werden, 52.000 Gebäude wurden erfasst und bewertet. Phase 3 – Basisinventarisierung: Die erhaltenswerten Gebäude in den bestehenden Schutzzonen werden in der Basisinventarisierung mittels Daten aus dem jeweiligen Bauakt umfassend erfasst, analysiert, die vorhandene Bewertung eventuell korrigiert und vorhandene Gestaltungsspielräume aufgezeigt. Die Basisinventarisierung der inneren Bezirke, vor allem jene der Kern- und Pufferzone des Weltkulturerbegebietes, ist nahezu abgeschlossen und wurde beginnend mit dem Jahr 2006, für die äußeren Bezirke fortgesetzt. Zur Statistik ist in diesem Zusammenhang festzuhalten: Die Zahl der Schutzzonen in Wien beträgt 135 und umfasst insgesamt ca. 24.640 Einzelobjekte. Hiervon wurden ca. 16.740 Objekte als erhaltenswert (A bzw. B – Objekte) evaluiert. Die schützenswerte Anzahl von Einzelobjekten in Schutzzonen beträgt daher ca. 10 % des gesamten Gebäudebestandes in Wien. Nachdem der Kulturgüterkataster derzeit über etwa 60.000 Einzelobjekte verfügt, zeigt dies, dass die Zahl der Eintragungen weit über die Zahl der in Schutzzonen liegenden Objekte hinausgeht. Verwendete Datensysteme: Die EDV-technische Realisierung des Schutzzonenmodells beinhaltet drei Datensysteme: - MS-ACCESS-Datenbank Die Eingabe und Bearbeitung der Sachdaten erfolgt mittels MS-ACESS. Entsprechende Formblätter in MS-ACESS greifen über ODBC mittels SQL-Statements auf die ORACLE-Datenbank zu. - ORACLE-Datenbank Herzstück des Schutzzonenmodells ist aus EDV-technischer Sicht die ORACLE- Datenbank. In ihr werden sämtliche Sachinformationen zu den einzelnen Objekten gespeichert. Die ORACLE-Datenbank ist auf einem UNIX-Server installiert, der ebenfalls das GIS beinhaltet. - Vienna GIS Geographisches Informationssystem der Stadt Wien.
804 MANFRED WEHDORN
___________________________________________________________________________
Vienna-GIS ist eine Geodateninfrastruktur, die – entwickelt und betrieben von der
Magistratsabteilung 14 - ADV – dafür sorgt, dass Verwaltungsverfahren durch die
Verknüpfung mit Geoinformation in der Qualität gesteigert und im Ablauf beschleunigt
werden können, sodass die Geoinformationen der Stadt Wien, die bisher eher einem "elitären"
Kreis zugänglich waren, in Zukunft weit barrierefreier bereitgestellt werden können.
Ermöglichst wird dies durch eine weltweite Norm zum Austausch von Geodaten, nämlich die
Webservice-Schnittstellen des Open GIS Konsortiums, welche auch von Vienna-GIS bereits
unterstützt werden. Geoinformationen, die gemäß der OGC-Schnittstelle bereitgestellt
werden, können – sofern es die Zugriffsrechte zulassen – weltweit genutzt, verschnitten und
ausgetauscht werden.
Neben den technologischen Herausforderungen bedarf es transparenter Bestimmungen für
den Zugang zur Geoinformation. Die PSI (public sector information) Richtlinie sowie das
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) schaffen den gesetzlichen Rahmen, um
Geoinformation auch tatsächlich jedem Bürger, jeder Bürgerin, nicht zuletzt aber der
"Wirtschaft" im Allgemeinen, zugänglich zu machen.
Abb. 3: Auszug aus dem Schutzzonen –
Informationssystem der Stadt Wien (©
Stadt Wien, MA 19)DIE KULTURGÜTERDATENBANK DER STADT WIEN 805 ___________________________________________________________________________ 3. Applikationen zur Kulturgüterdatenbank der Stadt Wien Der Franziszeische Kataster Kaiser Franz I. von Österreich gelang es, die gesetzlichen und technischen Hindernisse wegzuräumen und einen vollkommenen Wandel in der Steuerpolitik des Habsburgerreiches zu schaffen. Durch sein Grundsteuerpatent vom 23. Dezember 1817 hat er im wahrsten Sinn des Wortes den Österreichischen Grundkataster gestiftet; die Leitlinien dieses Patents gelten im Wesentlichen auch heute noch. Kataster wird nach seinem Schöpfer auch = der franziszeischer oder stabiler Kataster genannt. Stabil deshalb, weil die für die Steuerbemessung maßgeblichen Reinertragssätze – ohne Rücksicht auf etwaige höhere Ergiebigkeit bei besonderem Fleiß – unveränderlich sein sollten, es sei denn, dass durch Naturereignisse die Fruchtbarkeit des Bodens ganz oder teilweise verloren ging. Die Franziszeische Katastralvermessung sollte auf geodätischen, also wissenschaftlichen Grundlagen erstellt werden. Infolge der Erdkrümmung können praktisch nur Teile des Meeresspiegels im Durchmesser von 25 – 30 km als eben angesehen werden (Fischer, 1995, S. 39f). Durch die Digitalisierung des Kartenmaterials können die stadtstrukturellen Veränderungsschritte noch besser nachvollzogen werden. Bevor nun dieser Kataster digitalisiert und transformiert wurde, wurde seine Genauigkeit überprüft. Die Aufgabenstellung lautete, eine Genauigkeitsanalyse und eine Transformation des franziszeischen Katasters für den 3. Wiener Gemeindebezirk zu erstellen. Im Sommer 1996 wurde eine Transformation des franziszeischen Katasters für den 1. Bezirk durchgeführt. Auf Grund der hohen Anzahl an identen Objekten konnte dort eine Transformation "Haus für Haus" durchgeführt werden. Nicht idente Bereiche wurden mit identen Objekten mit transformiert. Ident bedeutet hier noch heute vorhandene Objekte, die auch schon zur Zeit des franziszeischen Katasters existiert haben und planlich dargestellt wurden.
806 MANFRED WEHDORN
___________________________________________________________________________
Abb. 4: Ausschnitt aus dem digitalisierten
franziszeischen Kataster
(© Stadt Wien, ViennaGIS)
Zur Zeit der historischen Planerstellung standen verständlicherweise andere
Vermessungsmethoden als heute zu Verfügung, die nicht zu einem so exakten Ergebnis wie
heute führten.
Dennoch kann man nicht von einem ungenauen Katasterplan sprechen, vielmehr ist zu
bewundern, wie präzise die damals durchgeführte planliche Darstellung Wiens mit diesen
Methoden ist. Von einer stückweisen Transformation wurde daher abgesehen, um die
Geometrie des alten Kartenwerkes zu wahren. Zur Bestimmung des Maßstabes wurde nach
der Methode von Mekenkamp vorgegangen, die Transformation der identen Punkte nach
Helmert. Zunächst wurde für den Katasterplan eine willkürliche Blatteinteilung nach Zonen
und Kolonnen vorgenommen, um eine eindeutige Identifikation der Passpunkte zu
gewährleisten.
Bei der Methode nach Mekenkamp werden idente Koordination sowohl durch Digitalisieren
des franziseischen Katasters, als auch dem digitalen heutigen Stadtplan der Stadt Wien,
entnommen. Danach werden jeweils getrennt für beide Kartenwerke alle möglichen Strecken
zwischen den Punkten berechnet. Es werden Matrizen aufgestellt und sodann wird eine
durchschnittliche Maßstabzahl berechnet. Auch lässt sich für jeden Punkt eine in Prozent
ausgedrückte Standardabweichung berechnen. Mit dieser Methode wurden grobe Ausreißer in
den Identpunkten aufgefunden.DIE KULTURGÜTERDATENBANK DER STADT WIEN 807 ___________________________________________________________________________ Die Helmertransformation ist eine Transformation von einem Koordinatensystem in ein anders Koordinatensystem, bei mehreren identischen Punkten. Bei der Lösung der Aufgabe ist zwischen den beiden Koordinatensystemen eine Verschiebung, eine Verdrehung und eine mittlere Maßstabsänderung zu berechnen. Die Helmertransformation arbeitet nach dem Prinzip der Ausgleichsrechnung. Forschungsergebnisse der Stadtarchäologie Einen wichtigen kulturhistorisch-geschichtlichen Beitrag im Kulturgüterkataster bilden die Datenerhebungen der Stadtarchäologie. Neben den archäologischen Fundpunkten mit Informationen zu den Fundplätzen und Funden, sowie den archäologischen Detailplänen, die mit dem heutigen digitalen Stadtplan überlagert sind, entsteht für den Fachmann, aber auch für den interessierten Laien schrittweise ein schärferes Bild der historischen Stadtentwicklung sowie deren evidenten Spuren. "Im Jahre 1493 wurden bei einer "Schatzsuche" zwei Altäre für die Gottheit Sarapis in der Wipplingerstraße 10 im 1. Bezirk entdeckt". Das ist die älteste bekannte Fundmeldung, die in der Fundortdatenbank aufgenommen wurde. Im Kulturgüterkataster ist diese Fundstelle mit einem grünen Dreieck markiert. Derzeit befinden sich alle derzeit bekannten Fundstellen im System, die danach laufend mit neuen ergänzt werden. Auch die Informationen sollen ausgebaut werden und durch weiterführende Links, sowie durch grafische Daten, Fotos, Rekonstruktionszeichnungen und Modelle ergänzt werden. Bei der Darstellung und der laufenden Erweiterung im Kataster werden die Zeitstufen auf verschiedenen Layern, jetzt in verschiedenen Farben, dargestellt. Abb. 5: Auszug aus der Fundortdatenbank der Wiener Stadtarchäologie (© Stadt Wien, Rathaus)
808 MANFRED WEHDORN ___________________________________________________________________________ Abb. 5: Auszug aus der Fundortdatenbank der Wiener Stadtarchäologie (© Stadt Wien, Rathaus) Eine große Menge an archäologischen Funden stammt aus dem Zeitraum zwischen 1895 und 1920. Nach dem Abbruch der Basteien (ab 1860) setzte in Wien ein riesiger Bauboom ein. Im Jahre 1895 kam der aus Polen stammende Josef Hilarius Nowalski de Lilia nach Wien. Unermüdlich besuchte er Baustelle um Baustelle, sammelte Funde, notierte und skizzierte deren Fundlage auf Karteikarten, die zu einem großen Teil erhalten geblieben sind und eine wertvolle Arbeitsgrundlage für die Stadtarchäologie bilden. Bei seiner Vermessung verwendete er die Hausecken als Einmesspunkte. Da viele dieser Gebäude heute nicht mehr vorhanden sind, war es notwendig eine Plangrundlage zu finden, die die Stadt Wien noch vor dem großen Bauboom ab 1860 darstellt. Diese wurde im franziszeischen Kataster gefunden, der vektorisiert, transformiert und mit der heutigen digitalen Stadtkarte (Mehrzweckstadtkarte der Stadt Wien) überlagert wurde. Durch diese Datengrundlage ist es möglich, wenn auch nur in einem gewissen Rahmen, aus archäologischer Sicht schützenswerte Zonen zu erstellen. Diese Methode versucht auf der Grundlage von bekannten Parametern von Siedlungsräumen, wie und wo wurde in einer bestimmten Zeitstufe gesiedelt, z. B. in Hanglage, an Bachläufen, auf Lössböden usw., und statischen Auswertungen von Fundregionen, ein Modell zu erstellen, wo man Fundplätze erwarten kann. Man könnte dies vielleicht mit der Erstellung eines negativen und positiven Katasters vergleichen. Der Positivkartierung wird eine sogenannte Bodeneingriffskartierung (Negativkartierung) gegenübergestellt, die alle Bodeneingriffe wie Kellereinbauten, Kanalisation, Ver- und Entsorgungsleistungen, kurz alle Bereiche enthält, die aus archäologischer Sicht vollständig bzw. teilweise zerstört worden sind.
DIE KULTURGÜTERDATENBANK DER STADT WIEN 809 ___________________________________________________________________________ Diese archäologischen Verlustzonen werden für Wien auch mit Hilfe von Luftbildern aus den Jahren 1938, 1945 und 1956 erweitert, die Bodeneingriffe wie alte Schottergruben, aufgelassene Müllplätze usw. aufzeigen. Positiv- und Bodeneingriffskartierung bilden eine der Grundlagen für archäologische Schutzzonen. In der Verbindung mit den georeferenzierten Fundpunkten und den archäologischen Plangrundlagen ist es dann möglich, ein Modell zu erstellen und gezielt Grabungen anzusetzen. 4. Weiterführende Projekte des Kulturgüterkatasters. Ein Ausblick Neben der laufenden Erweiterung der vorhandenen Applikationen muss zumindest auf drei Ergänzungen des Kulturgüterkatasters hingewiesen werden. "Bürger schreiben Geschichte" Mit dem Bürgerbeteiligungsprojekt "Bürger schreiben Geschichte" soll für geschichtsinteressierte Bürger Wiens, aber auch für Auslandswiener die Möglichkeit geschaffen werden, ihre geschichtlichen Kenntnisse und ihr Wissen zu und über Plätze, Gebäude und Gartenanlagen der Stadt Wien einem breiten Publikum im Internet zu präsentieren. Der Wert des Projekts liegt in der zukunftsorientierten Ausweitung der Profilierung Wiens als Stadt gelebter und gehegter Kultur, die sich damit nun auch des historischen Erbes ihrer Bürger bewusst wird. So wie tagtäglich Kulturschätze zerstört werden, so gehen auch tagtäglich Erinnerungen an die Vergangenheit verloren. Neben geschriebenen Texten sollen auch alte Fotografien, Planzeichnungen, aber auch Tondokumente integriert werden. "Wiens (vergessene) historische Gärten" Im Rahmen dieses Projektes sollen die im Bereich des Stadtgebietes ehemals vorhandenen Gartenanlagen mit Hilfe eines Geografischen Informationssystems (GIS) erfasst, erkundet und dokumentiert werden. Die Stadt Wien kann sich damit nun auch ihres Erbes auf dem bisher vielleicht wenig oder zu wenig beachteten Grünsektor bewusst werden. Damit kann zukünftig vorteilhafter der bisherige Verlust wertvoller Grünflächen dokumentiert werden und andererseits lässt sich bei zukünftigen Vorhaben deren Schutzwürdigkeit besser unterstreichen. Für die Stadtplanung und Stadterneuerung ergeben sich durch die GIS- gestützte Inventarisierung von bestehenden und verschwundenen Grünobjekten leichter absehbare Entscheidungsgrundlagen bei Neu- und Umplanung, wobei sich insbesondere die historisch gewachsenen, stadtspezifischen Strukturen berücksichtigen lassen. Beispielsweise können so Grünflächen mit einem noch vorhandenen unmittelbaren Konnex zu einem (schutzwürdigen) Gebäude klarer definiert bzw., falls dieser schon verloren gegangen ist, leichter Strategien zu dessen Wiederherstellung gefunden werden.
810 MANFRED WEHDORN
___________________________________________________________________________
Die Aufgabenstellung erstreckt sich auf die Bereiche der Recherche von vorhandenen und
schon verschwundenen Garten- bzw. kultivierten Grünflächen im dynamischen
Spannungsfeld ihrer historischen Entwicklung, deren nachfolgender Georeferenzierung und
Datenimplementierung in ein GIS, sowie der abschließenden Datenanalyse und -
-auswertung, sowie der nachfolgenden Einbindung in den Kulturgüterkataster der Stadt Wien.
Der Katalog ortstypischer Elemente ("Leitdetails")
Eine bemerkenswerte Ergänzung zur Altstadtinventarisation wurde erst im Jahre 2009 in
Zusammenhang mit den Bemühungen im Rahmen der "Initiative Leitbild Grinzing"
entwickelt:
Vorauszuschicken ist zunächst, dass es die Bauordnung für Wien ermöglicht,
charakteristische Bauelemente im Sinne von Leitdetails als Bestandteil der
Schutzzonencharakterisierung festzulegen.
Unter dem Begriff der ortstypischen Elemente sind hierbei alle jene Bauelemente zu
verstehen, welche als bestimmende Teile des charakteristischen Ortsbildes anzusehen sind. In
diesem Sinn umfasst der Katalog systematisch alle Straßenbild wirksamen Baudetails, wie
Fensterumrahmungen und -konstruktionen, Gesimsausbildungen, Holzverschalungen,
Dachdeckungen, Kaminköpfe, Hauszeichen und vieles anderes mehr. Aus dieser Aufzählung
geht bereits hervor, dass die ortstypischen Elemente nicht nur nach ihrer formalen Gestaltung,
sondern ebenso nach Konstruktion und Material bewertet und – soweit dies möglich war –
auch mit den Entstehungsperioden verknüpft wurden.
Insgesamt umfasst der Katalog ortstypischer Elemente für Grinzing ca. 2.500 Einzeldetails.
Für deren Verwaltung wurde von Wehdorn Architekten eine eigene Software entwickelt,
welche es zum Beispiel ermöglicht, alle Kaminkopfdetails von Grinzing, die noch in ihrer
Form in die Barockzeit zurückgehen, "auf Knopfdruck" auszuwerfen.
Derzeit ist der Katalog Bestandteil des amtsinternen Kulturgüterkatasters im Magistrat der
Stadt Wien. Nach Prüfung des Datenschutzes soll auf den Katalog in entsprechender Auswahl
auch ein öffentlicher Zugriff ermöglicht werden. In der derzeitigen Form ermöglicht der
Katalog die rasche und objektive Beurteilung von Bauprojekten in Hinblick auf deren
Detailausbildungen, wie Toreinfahrten, Fensterausbildungen und anderes mehr. In weiterer
Sicht könnte der Katalog auch für alle Revitalisierungen, Rekonstruktionen und Erneuerungen
von Baudetails im historischen Ensemble von Grinzing herangezogen werden.
Wien 3-D
Ein weiterer Arbeitsbehelf, der im gegebenen Zusammenhang unbedingt Erwähnung bedarf,
ist das Projekt "Wien 3-D".
Diese Geodaten stellen eine detaillierte Beschreibung der Oberfläche des Wiener
Stadtgebietes dar. Mehrzweckkarte, Geländemodell und das dreidimensionale (3-D)DIE KULTURGÜTERDATENBANK DER STADT WIEN 811 ___________________________________________________________________________ Stadtmodell sind wichtige Pfeiler einer modernen Stadtplanung. Darüber hinaus sind die Geodaten Ausgangsbasis für Analyse und Darstellung raumbezogener Inhalte vieler anderer Fachbereiche. Insbesondere für die Simulation geplanter Bauvorhaben sowie für die Berechnung von Sichtbarkeiten und Abschattungen werden digitale 3-D-Modelle erfolgreich eingesetzt. Das digitale 3-D-Stadtmodell von Wien ist für das gesamte Stadtgebiet verfügbar und wird laufend aktualisiert. Für das historische Zentrum von Wien (Kernzone des Gebietes Weltkulturerbe Wiener Innenstadt) existiert darüber hinaus auch ein detailliertes Modell der Dächer Die Verwendung eines eindeutigen Adressbegriffs für die Verspeicherung der einzelnen 3-D- Gebäudemodelle ermöglicht die Kombination des 3-D-Stadtmodells mit vielen anderen in Wien vorhandenen gebäudebezogenen Sachdaten. Abb. 6: Ausschnitt aus dem Wien-3-D-Dachmodell, 1. Bezirk, Oper – Albertina Platz (© Stadt Wien, MA 41) Dieses 3-D-Stadtmodell ist zum Beispiel auch Grundlage, um Auswirkungen von Neubauprojekten auf den "Outstanding Universal Value" des Weltkulturerbes Wien zu prüfen.
812 MANFRED WEHDORN ___________________________________________________________________________ 5. Schlusswort Die Kulturgüterdatenbank der Stadt Wien ist de facto eine Sammlung wissenschaftlicher Untersuchungen zur Geschichte der Stadt Wien; Sie sind – nicht zuletzt – dank des Graphischen Informationssystems der Stadt Wien – miteinander verknüpft und – soweit dies der Datenschutz ermöglicht – auch von allen Bürgerinnen und Bürgern abrufbar. Im Sinne der laufenden wissenschaftlichen Vertiefung ist die Kulturgüterdatenbank aber stets als "work in progress" anzusehen. Quellenangabe BUNDESDENKMAL WIEN, KULTURAMT WIEN (Hrsg.): Atlas der historischen Schutzzonen in Österreich, Bd. 2: Wien, Wien 1974. MAGISTRAT DER STADT WIEN, MAGISTRATSABTEILUNG 19 (Hrsg.): Wien – Innere Stadt Weltkulturerbe und lebendiges Zentrum / The Historic Centre of Vienna. World Cultural Heritage and Vibrant Hub, Wien 2009. PAL DIETER, WEHDORN MANFRED: Schutzzonen in Wien, Rückblick und Perspektiven, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Bd.: XLVI Jg. 78, Wien 1992, S. 173-179. STADTENWICKLUNG WIEN, MAGISTRATSABTEILUNG 19 (Hrsg.): Wien, Weltkulturerbe. Der Stand der Dinge / Vienna, World Heritage. The State of the Art, Wien 2006 STADTPLANUNG WIEN, MA 18, MA 19 (Hrsg.): Schutzzonen Wien, 1.-23. Bezirk, 8 Bde., Wien 2005. WEHDORN MANFRED: Wien. Das historische Zentrum: Weltkulturerbe der UNESCO / Vienna, The Historical Centre: UNESCO World Heritage Site, Wien 2004.
Sie können auch lesen