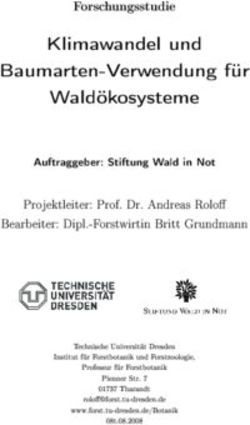Klimawandel - Überlegungen zu waldbaulichen Strategien - Sven Wagner, Tharandt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gliederung
• Umweltveränderungen und Probleme für die Wälder
• Unsicherheit von Prognosen für Umweltfaktoren, zur Vitalität der
Baumarten und zu Konkurrenzsituationen zwischen den Baumarten
• Strategien bei Unsicherheit
• Funktionsumbau
• Nachhaltsumbau
• Dynamische Überführung
• Zusammenfassung/Schlußfolgerungen
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauUmweltveränderungen und Probleme für die
Wälder
• Die prognostizierten Umweltveränderungen (Erwärmung, weniger
Niederschlag) treffen auf etablierte Waldökosysteme.
• Kommt es zu Störungen, die "nicht akzeptabel" sind gemessen an
den Bewirtschaftungszielen?
• Reicht die Fähigkeit zur Regeneration aus?
• Es stellt sich die Frage nach Möglichkeiten, vorsorgend aktiv zu
werden.
• Dies – eine vorsorgende Bewirtschaftung – wird erschwert durch
vielfältige Unsicherheit
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauUnsichere Prognosen für die Umweltfaktoren (I)
• Auch wenn zunehmend sichere Vorhersagen erscheinen, bleiben
Auswirkungen auf Extremereignisse in Intensität und Häufigkeit
offen und Wechselwirkungen mit weiteren wesentlichen
dynamischen Umweltfaktoren unklar (N-Immissionen).
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauUnsichere Prognosen für die Umweltfaktoren (II)
• Es darf aber diese Unsicherheit über wichtige Details nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es Veränderungen schon gibt. Mindestens
diese Veränderungen müssen berücksichtigt werden.
• Die Anpassung von Klimagliederungen an die bereits gegebenen
Veränderungen (= Aktualisierung) ist zwingend.
Verändert aus:
Gemballa u.
Schlutow, 2007
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauUnsichere Prognosen zur Vitalität der Baumarten (I)
• Eine einzige Arbeit (Rehfeldt et al., 2001) zur Klimasensitivität mit
russischen Kiefernherkünften lässt das Reaktionsmuster der
Baumarten erkennen.
13Jahres-Höhenzuwachs und
Klima unterschiedlicher Standorte
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau
– als Dauer der Vegetationszeit –
für zwei Kiefernherkünfte.Unsichere Prognosen zu neuen
Konkurrenzsituationen zwischen den Baumarten (I)
• Die Vorhersage der
Konkurrenzsituation
ist schwierig, weil
Analysen der
Vergangenheit die
Grundlage bilden.
?
Aus: Thomasius, 1991
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauUnsichere Prognosen zu neuen
Konkurrenzsituationen zwischen den Baumarten (II)
• In der Zukunft sind neue
Kombinationen von
Umweltfaktoren möglich, für
die es bisher keine
Erfahrungen gibt Das
Beispiel zeigt die gesteigerte
Fruktifikation der Buche in
den letzten 20 Jahren. Die
Ursache dafür ist nicht
geklärt: Klimawandel? N-
Einträge?
Schmidt, 2006
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauZwischenbilanz
• Bei allen erwähnten Unsicherheiten sind sich die Experten darüber
einig, dass
– es in den meisten Gebieten wärmer und trockener werden wird,
Extremereignisse (Trockenperioden, Stürme) häufiger und
ausgeprägter auftreten können. Beides wird standortsabhängig
sehr unterschiedlich schwere Folgen haben
– das Tempo dieser Veränderungen Bäume und Bestände in ihrer
Anpassungsfähigkeit überfordern kann.
– die Baumarten sehr unterschiedlich von diesen Veränderungen
betroffen sein werden, namentlich
• die Fichte zur Problembaumart werden kann (Standorte!)
• Baumarten mit großer Klimaamplitude wahrscheinlich
robuster sein werden (z.B. Stieleiche, Sandbirke oder
Douglasie)
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauStrategien bei Unsicherheit
• Man kann drei Strategien unterscheiden:
– (1) Maßnahmen, um klar definierte Leistungen der Wälder im
nächsten Jahrhundert zu erreichen
– (2) Maßnahmen, um die Unsicherheiten abzufangen
– (3) Dynamische Überführungsstrategien
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau(1) Maßnahmen, um klar definierte Leistungen der
Wälder im nächsten Jahrhundert zu erreichen
• Bei einer Veränderung der Standortsbedingungen (=Klimawandel)
und dem Wunsch nach Beibehaltung aktueller Waldfunktionen (z.B.
Holzerträge) sind ggf. Maßnahmen des Waldumbaues erforderlich
Funktionsumbau.
• 1. Bestehende Bestockungen anpassen
– Verringerung der Wasserverfügbarkeit Bestockungsgrade neu
optimieren, Durchforstungsart anpassen.
– Verringerung der Risiken in älteren (=höheren) Beständen
Verkürzung der Produktionszeiträume .
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau(1) Maßnahmen, um klar definierte Leistungen der
Wälder im nächsten Jahrhundert zu erreichen
• 2. Bestockungen über
Verjüngungsmaßnahmen langfristig Douglasie/Fichte
anpassen
– Gerichtete Klimaveränderung
Anteil angepasster Arten erhöhen.
– Bei abnehmender Vitalität einer
Baumart vermag eine andere, ggf.
Zuwachsverluste abzufangen.
– Dies könnte genutzt werden, indem
Mischungen oder Reinbestände mit
anderer Baumart etabliert werden.
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauZwischenbilanz „Funktionsumbau“ (I)
• Die Entlastung, der für die Waldfunktion wichtigsten
Bestandesglieder von Wasserkonkurrenz durch Nachbarn, könnten
durch eine Absenkung der Bestockungsgrade erfolgen. Hoch- oder
Niederdurchforstungen gleichwertig?
• Aber: Bestockungsgradabsenkungen können weit reichende
Nebenwirkungen haben: Zuwachsverluste, Sturmgefährdung,
Vergrasung
• Mischungen könnten zur Kompensation von Zuwachsverlusten
beitragen.
• Aber: Mischungen sind schwieriger zu steuern,
Vermarktungsprobleme?
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauZwischenbilanz „Funktionsumbau“ (II)
• Der Funktionsumbau ist bei flächigem Baumartenwechsel eine
radikale Möglichkeit der Anpassung.
• Bei den gegebenen Unsicherheiten, ist dieser Schritt – der flächige
Baumartenwechsel – sicherlich der problematischste.
• Allerdings ist die Forderung bei Verjüngungsmaßnahmen, alle
derzeit verfügbaren Informationen einer Standortserkundung zu
nutzen, unbedingt zu berücksichtigen (Neue Klimagliederung
Sachsens Fichtenanbau?).
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau(2) Maßnahmen, um die Unsicherheiten
abzufangen
• Die aufgezählten Unsicherheiten (Klimaentwicklung, Reaktion der
Baumarten, Zunahme von Störungen, Holzmarkt) könnten mit einer
eigenen Strategie, die auf Nachhaltigkeit gerichtet ist, abgefangen
werden.
• Erhalt oder Wiederherstellung
– der Produktivität der Standorte
– der biologischen Diversität (insbesondere von Schlüsselarten)
– der (Natur-) Verjüngungsfähigkeit der Bestände
– der Vitalität von Bäumen und Beständen
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauProduktivität der Standorte
• Standortsgerechte
Baumartenwahl – insbesondere
tief wurzelnde Arten und
Mischungen
• flächig vorhandene, leicht
zersetzliche Streu - durch Wahl
der Hauptbaumart oder durch
Mischung (Trupp-
Gruppenmischungen)
• krautige Begleitvegetation –
keine Dunkelwirtschaft
Laubstreuverteilung um Einzelbäume
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauBiologische Diversität (insbesondere von Schlüsselarten)
• Berücksichtigung von Standortsunterschieden, Etablierung
verschiedener Baumarten als Initiale, Vielfalt der Waldpflege- und
Erntemaßnahmen, Totholz
• Beteiligung von Pionieren (Birken, Aspe, Kiefer), Eichen und
Douglasie, sowie von Arten, die auf warm-trockene Standorte
spezialisiert sind (z.B. Winterlinde, Robinie).
• Horizontale Mischungsformen (Trupp bis Gruppe) gewährleisten die
Pufferwirkung beim Zuwachs und mindern Konkurrenzprobleme
zwischen ökologisch verschiedenen Baumarten
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau(Natur-) Verjüngungsfähigkeit der Bestände
• extensive Beteiligung von
Pionierbaumarten (z.B.
Sandbirke). Erhöhung der Präsenz
von Baumarten mit beschränkter
Ausbreitungspotenz (z.B.
Winterlinde).
• Erhalt des Genflusses zwischen
Individuen durch Einhalten von
Maximalabständen Dichte der Samen in Abhängigkeit von der
Entfernung zum Mutterbaum
(Normierung auf jeweils maximale Dichte:
• Anwendung artgerechter (Ernte-) Linde = 50/m², Birke = 1500/m²)
Hiebsmaßnahmen Vielfalt!
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauVitalität von Bäumen und Beständen
• Standortswahl und richtige Herkünfte, wobei erhebliche
Unsicherheiten bei den Herkünften bestehen
• Beschränkung des Anbaus von Arten mit atlantischem
Verbreitungsschwerpunkt (Fichte).
• Waldpflege zur Kronenpflege (rechtzeitige und intensive
Hochdurchforstungen)
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauZwischenbilanz „Nachhaltsumbau“ (I)
• Ganz anders als radikaler Funktionsumbau, ist der soeben
beschriebene Nachhaltsumbau zweifellos sinnvoll und kaum mit
ökonomischen Risiken behaftet.
• Ein Nachhaltsumbau ist in Sachsen seit etwa 15 Jahren vielerorts
gängige Praxis. Dieser sollte mit einer Ausrichtung auf den
Klimawandel weiter fortgeführt werden.
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau(3) Dynamische Überführungsstrategien
• Die Dynamik der Umweltfaktoren ist allein mit Maßnahmen, die
statisch wirken, nicht aufzufangen. Doch selbst dann muss
entschieden werden, für welchen Zeitraum geplant wird.
•Aus: Profft u.
Frischbier,
2008
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau(3) Dynamische Überführungsstrategien
• Als unmittelbaren Erfolg versprechend können genannt werden:
– Vorwald (Birke über Eichen, Erle über Buche)
– Voranbau (Eichen unter Kiefer, Buche unter Fichte)
– Naturverjüngung unter Altbestand (Eiche, Vogelbeere unter Kiefer)
– Zeitmischung (Fichte in Buche)
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauIV. Schlussfolgerungen
• Ob es öfter zu „nicht akzeptablen“ Störungen kommt und ob die Fähigkeit zur
Regeneration „ausreicht“, ist vor dem Hintergrund der Erfüllung von
Funktionalität zu beurteilen.
• Beim Funktionsumbau wird es notwendig sein, die Baumartenwahl an die
bekannten Klimaszenarien anzupassen. Namentlich die Fichte wird den in sie
gesetzten Erwartungen an die Holzproduktion in Zukunft wahrscheinlich nicht
mehr überall gerecht werden (Zuwachsreduktion, Verkürzung der
Lebensdauer der Bestände). Somit hat die Suche nach klimatoleranten,
leistungsfähigen Baumarten begonnen (Douglasie, Eichen).
• Waldpflege – Mischungsregulierungen, Bestockungsgradregulierungen und
Förderung der leistungsfähigsten Individuen – bleibt aktuell. Ggf. müssen
neue Zielvorgaben entwickelt werden.
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauIV. Schlussfolgerungen
• Ein Nachhaltsumbau ist seit langem erforderlich, läuft in vielen Betrieben
bereits seit geraumer Zeit und muss überall dort, wo die „Umbaueuphorie“
abebbt, nun mit neuer Begründung (Klimawandel) angemahnt werden.
• Geschlossene und rasche Stoffkreisläufe, der Erhalt und die Förderung der
biologischen Vielfalt, sowie die Naturverjüngungsfähigkeit und die Vitalität der
Bäume sind stabilisierende Elemente einer Strategie bei Unsicherheit
(ökologisch wie ökonomisch).
• Bezogen auf die Baumartenwahl bedeutet dies eine Beteiligung ökologisch
unterschiedlicher Arten am Bestandesaufbau Mischbestände mit Pionieren
und klimatoleranten Arten.
• Der „Nachhaltsumbau“ kann ggf. deutlich extensiver ausfallen, als ein
„Funktionsumbau“ zur Optimierung einer aktuell gewünschten Waldleistung.
TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und WaldbauVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! TU Dresden, 02.10.2008 Klimawandel und Waldbau
Sie können auch lesen