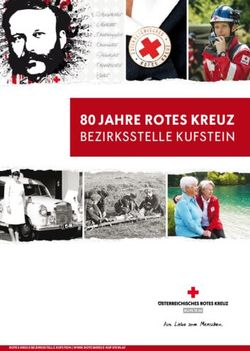Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2017/18 Fach Kunstgeschichte, FB III, Universität Trier - Version: 4.0 N.D.d.V.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 2017/18
Fach Kunstgeschichte, FB III, Universität Trier
Version: 4.0
N.D.d.V.
1Vorwort
Liebe Kommilitonen/Innen,
das vorliegende kommentierte Vorlesungsverzeichnis (KVV) zum Wintersemester 2017/18
gibt einen Überblick über die am Fach Kunstgeschichte angebotenen Veranstaltungen und soll
euch zugleich als Orientierungshilfe dienen. Wir hoffen, dass es euch bei der Wahl und
Belegung eurer Seminare, Kolloquien, Exkursionen etc. behilflich ist. Bei Rückfragen wendet
euch bitte an die jeweiligen Dozierenden. Bitte beachtet, dass für die An- und Abmeldung zu
den Veranstaltungen stets die Eintragung über das PORTA-System erforderlich ist.
Da Änderungen bzw. Nachträge kommen können bitten wir darum, auf die jeweilige
Aktualisierung/Version der Dokumente zu achten. Der Aufbau der einzelnen Module kann dem
jeweiligen Modulhandbuch entnommen werden, die Modulzuweisung einzelner
Veranstaltungen muss von euch auf PORTA vorgenommen werden. Die im KVV angegebenen
Nummern entsprechen den Veranstaltungsnummern in PORTA.
Bitte beachtet, dass im WS 2017/18 neue Studiengänge eingeführt werden – die
Verlaufspläne werden in aktueller Form auf der Homepage eingestellt.
Ein gutes und erfolgreiches Semester!
Das Fach Kunstgeschichte
2Inhaltsverzeichnis
Vorwort ...................................................................................................................................... 2
Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................... 3
Stundenplan ............................................................................................................................... 5
Stundenplan für das Wintersemester 2017/2018 ..................................................................... 5
Vorlesungen ............................................................................................................................... 7
Kunst und Wissenschaft in England 1660-2006 ................................................................. 7
Virtuelle Räume vom Mittelalter bis in die Moderne ...................................................... 10
Das Goldene Jahrhundert. Rembrandt und die holländische Malerei ............................ 13
Veranstaltungen im Studiengang Bachelor of Arts .................................................................. 14
How “The Vikings” became Christians? Die norwegischen Stabkirchen ......................... 14
Niederländische Stilllebenmalerei 1550-1700 ................................................................. 16
Das Martinskloster in Trier - Von der Klosteranlage zum Studierendenwohnheim ........ 17
Im Rhythmus der Maschine. Arbeit als Motiv in der Kunst der Moderne ....................... 18
Vom Bild zum Wort: Schreiben und Sprechen über Kunst. ............................................. 20
Mittelalterrezeption in Architektur und Kunsthandwerk ................................................ 23
des Historismus in Trier .................................................................................................... 23
Der Trierer Dom - Grundlagen, Perspektiven, Methoden und neuere Forschungen ...... 24
Gegenstandssicherung: (Historische) Bauforschung und Inventarisierung ..................... 25
Veranstaltungen im Studiengang Master of Arts..................................................................... 27
[Zusammen]Schau des Heiligen: Studentisches Buchprojekt zum Trierer Domschatz .. 27
Architektur im Film - Stadt der Zukunft oder Disneyland? .............................................. 29
Baugeschichte und Grundlagen des Projektierens im historischen Kontext ................... 34
Die ‚Logik der Bilder’ ........................................................................................................ 36
Propädeutika ............................................................................................................................ 39
Propädeutikum I: Grundlagen und Arbeitstechniken ...................................................... 39
Propädeutikum II: Einführung in die Bildkünste .............................................................. 40
Propädeutikum II: Einführung in die Bildkünste .............................................................. 41
Kolloquien................................................................................................................................. 42
Neue Forschungen zur Kunstgeschichte .......................................................................... 42
Präsentation von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten .............................................. 43
BA- / MA-Abschlusskolloquium ........................................................................................ 44
3Lehrexkursionen ....................................................................................................................... 45
Exkursion: Museen in Köln ............................................................................................... 45
Exkursion zu den Propädeutika ........................................................................................ 45
Verlaufspläne für die Studiengänge am Fach Kunstgeschichte ............................................... 46
Bachelor of Arts im Hauptfach ............................................................................................. 46
Bachelor of Arts im Nebenfach ............................................................................................ 47
Master of Arts im Hauptfach ................................................................................................ 47
Master of Arts im Nebenfach ............................................................................................... 47
Bachelor of Arts im Hauptfach ab WS 2013/14 ................................................................... 48
Bachelor of Arts im Nebenfach ab WS 2013/14 .................................................................. 48
Master of Arts im Hauptfach ab WS 2013/14 ...................................................................... 49
Master of Arts im Nebenfach ab WS 2013/14 ..................................................................... 49
Modulkürzel ............................................................................................................................. 50
Modulkürzel ab WS 2013/14 .................................................................................................... 51
4Stundenplan
Stundenplan für das Wintersemester 2017/2018
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
8
-
12 Kerscher Kerscher Gehring Gehring Brakensiek
- BA-/MA-Kolloquium: BA-PV, Einführung in BA-/MA-V, Kunst und MA-S, Die Logik der BA-PV, Einführung in die
14 (Einzelveranstaltung) Grundlagen und Wissenschaft in Bilder Bildkünste
Präsentation und Arbeitstechniken England 1660-2006 A 246 (Propädeutikum II)
Diskussion von (Propädeutikum I) HS 8, Gebäude D A 9/10
Bachelor-, Master- B 20 von Ahn
und Doktorarbeiten BA-S, How „The Tacke
A 246 Vikings“ became BA-PV, Einführung in die
Christians? Die Bildkünste
norwegischen (Propädeutikum II)
Stabkirchen A 246
A142
Groß-Morgen
Sammlungsobjekten
A 142 (oder im Museum)
14 Lehrauftrag Kerscher Tacke Tacke
- Frauenförderung BA-S, Die GREMIENARBEIT BA-/MA-K/M.A., BA-/MA-V, Das Goldene
16 BA-S, Thema folgt Gegenstandssicherun DES Kolloquium: Neue Jahrhundert. Rembrandt
A 124 g: (Historische) FB III wie des Fachs Forschungen zur und die holländische
Bauforschung und KG Architektur und Malerei
Inventarisierung Bildenden Kunst (vom HS 1
A 246 Fachstudienberatun Mittelalter bis zur
Diederichs
BA-S, Im Rhythmus
der Maschine. Arbeit
als Motiv in der Kunst
der Moderne
A 142
516 Brakensiek Günther Kerscher Brakensiek et al.
- BA-S, Das BA-S, BA-/MA-V, Virtuelle BA-/MA-E, Vorbereitung
18 Martinskloster in Trier Schreibwerkstatt Räume der Lehrexkursionen
– Von der Generator HS 7 (vierzehntäglich,
Klosteranlage zum A 246 wechselweise nach
Studierenden- Absprache für alle
Wohnheim. Ein Exkursionsleiter/-innen
Dokumentations- und verfügbar
Ausstellungsprojekt in A 246
Kooperation mit dem
Studiwerk Trier
A 142
18 Gehring
- BA-/MA-Kolloquium:
20 Neue Forschungen
zur Kunst der
Moderne [und der
Gegenwart]
6Vorlesungen
Kunst und Wissenschaft in England 1660-2006
(Schwerpunkt Moderne)
Nr. 13702320
Dozent/In Prof. Dr. Ulrike Gehring
Zeit Mittwoch, 12 bis 14 Uhr
Raum HS 8 (Gebäude D)
Veranstaltungsform Vorlesung
Inhalt
In vielen Gebieten der Wissenschaft und Technik war England Ende des 17. Jahrhunderts
führend. In der Malerei setzte es auf ‚Importe’ namhafter Künstler des europäischen
Kontinents. Hans Holbein, Peter P. Rubens oder Anthonis van Dyck prägten so das ‚englische’
Portrait, Willem van de Velde und Isaac Sailmaker die aufkeimende Marinemalerei.
Eine Wende zeichnete sich erst Mitte des 18. Jahrhunderts ab, ausgelöst durch zwei einander
bedingende Ereignisse: die Institutionalisierung der Kunst in einer nach französischem Vorbild
organisierten Kunstakademie (1768) sowie das Aufbegehren einer zunehmend zahlreicher in
London lebender Künstler gegen den Alleinvertretungsanspruch eben dieser neu gegründeten
Royal Academy of Art. Gemeinsam war beiden rivalisierenden Lagern der Wunsch, eine
nationale, englische Kunst aus der Taufe zu heben, die den Qualitätsansprüchen des
Festlandes in Nichts nachstand. Uneins war man sich darüber, wie dieses Ziel zu erreichen sei.
Joshua Reynolds, der erste Akademiepräsident, sah die Lösung im idealisierten
Historienportrait und einer allegorisch-emblematischen Bildsprache. Dagegen opponierten
William Hogarth und Joseph Wright of Derby mit einer bedingungslosen Wirklichkeitstreue,
die sich vor allem in Alltagsszenen entfaltete. Zum inhaltlichen und formalen Dissens kam der
Protest einiger «Sektierer», jene Künstler, die von den Jahresausstellungen der Akademie in
großer Zahl ausgeschlossen und in privat organisierten Atelierausstellungen die Ablösung des
Künstlers vom institutionellen Auftraggeber weiter vorantrieben. Rückblickend waren es
insbesondere George Stubbs und Thomas Gainsborough sowie später J. M. W. Turner und 8
7John Constable, die in ihrer antiakademischen Grundhaltung die Herausbildung eines
individuellen, vom freien Farbauftrag geprägten Malstils, ermöglichten.
Methodisch ist die Vorlesung von einem bildwissenschaftlichen Interesse geleitet. Sie geht
damit von einem erweiterten Bildbegriff aus und bezieht auch wissenschaftliche Zeichnungen,
politische Karikaturen und in Formaldehyd eingelegte Tierpräparate der Young British Artists
mit in die Analyse der englischen Kunst ein.
Themenübersicht (vorläufig)
18.10.2017 Einführung in die Thematik und Methode
25.10.2017 Christopher Wren: Anatom und Baumeister des ‚modernen’ Londons
01.11.2017 Feiertag
William Hogarth & James Gillray: Moral und Politik in der englischen
08.11.2017
Bildsatire
Zwei Seiten des englischen Portraits: Thomas Gainsborough & Joshua
15.11.2017
Reynolds
22.11.2017 Farbe als Bedeutungsträger in der englischen Vormoderne
29.11.2017 Newtons Einfluss auf die Kunst: Wright of Derby & William Blake
06.12.2017 Künstler auf ‚Bildungsreise’: Motive der Grand Tour
13.12.2017 Der englische Landschaftsgarten
20.12.2017 Technik & Arbeit in der Kunst zur Zeit der Industriealisierung
Jahreswechsel
10.01.2018 Gemalte Wissenschaft: Alexander Cozens‘ Landschaftsportraits im 19. Jh.
17.01.2018 William Turner & John Constable: Aufruhr der Elemente
24.01.2018 Von Götzen und Dämonen: Präraffaeliten & Symbolisten im England.
31.01.2018 Aus den Schlachthöfen der Moderne: Francis Bacons’ deformierte Körper
Wissenschaft als Sensation: Damien Hirst’s Natural History im Kontext der
07.02.2018
YBA
8Einführende (nicht monographische) Literatur
- Boase, Thomas S. R.: Englisch Art 1800-1870, Oxford 1959.
- Broeker, Holger (Hrsg.): Blast to freeze. Britische Kunst im 20. Jahrhundert; AK Kunstmuseum
Wolfsburg, Ostfildern 2000.
- Buck, Louisa: Moving Targets. A User’s Guide to British Art Now 2. London 2000.
- Burke, Joseph: English Art, 1714-1800, Oxford 1976.
- Burn, Gordon: Sex and Violence, Death & Silence. Encounters with Recent Art. London 2009.
- Busch, Werner: Joseph Wright of Derby. Das Experiment mit der Luftpumpe: eine heilige
Allianz zwischen Wissenschaft und Religion, Frankfurt am Main 1986.
- Busch, Werner: Die englische Kunst des 18. Jahrhunderts, in: ders. (Hrsg.), Funkkolleg Kunst.
Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen, Bd. 2, München 1987, S. 703-729.
- Busch, Werner: Die englische Kunst des 18. Jahrhunderts, in: ders./Peter Schmoock (Hrsg.):
Kunst. Die Geschichte ihrer Funktionen, Weinheim und Berlin 1987, S. 637-673.
- Busch, Werner: Das sentimentalische Bild. Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die
Geburt der Moderne, München 1993 (Studienausgabe 1997).
- Busch, Werner: Das unklassische Bild. Von Tizian bis Constable und Turner, München 2009.
- Busch, Werner: Englishness. Beiträge zur englischen Kunst des 18. Jahrhunderts von Hogarth
bis Romney, München/Berlin 2010.
- Buttlar, Adrian von: Der englische Landsitz 1715-1760. Symbol eines liberalen Weltentwurfs,
Mittenwald 1982.
- Buttlar, Adrian von: Der englische Landschaftsgarten, Köln 1989.
- Compton, Susan (Hrsg.): Englische Kunst im 20. Jahrhundert: Malerei und Plastik, AK
Staatsgalerie Stuttgart 1987/Royal Academy of Arts London 1987, München 1987.
- Gaunt, William: A Concise History of English Painting, London 1964.
- Hammerschmidt, Valentin/Wilke, Joachim: Die Entdeckung der Landschaft. Englische Gärten
des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1990.
- Hearn, Karen (Hrsg.): Dynasties. Painting in Tudor and Jacobean England 1530-1630, AK
London, Tate Gallery 1995, New York 1995.
- Hoock, Holger: The King's artists: the Royal Academy of Arts and the politics of British culture
1760 - 1840, Oxford 2003.
- Meyer, Laure: Englische Landschaftsmalerei. Von der Renaissance bis heute, Paris 1993.
- Miller, Norbert: Strawberry Hill. Horace Walpole und die Ästhetik der schönen
Unregelmäßigkeit, München, Wien 1986.
- Muir, Gregor: Lucky Kunst. The Rise & Fall of Young British Art, London 2009.
- Paulson, Ronald: Emblem and Expression. Meaning in English Art of the Eighteenth Century,
London 1975.
- Pevsner, Nikolaus: The Englishness of English Art, Harmondsworth 1986.
- Rosenberg, Lela Capri: The Meaning of Sensation: Young British Art in the nineties, Diss.,
Duke University, Michigan 2008.
- Saatchi Collection (Hrsg.) Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection, AK
Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Berlin1998/99, Ostfildern-Ruit 1999.
- Summerson, John: Architecture in Britain 1530-1830, New Haven, London 1993.
- Pointon, Marcia: Hanging the Head: Portraiture and Social Formation in Eighteenth-Century
England, New Haven 1993.
- Pries, Christine (Hrsg.): Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn,
Weinheim 1989.
- Solkin, David H.: Painting for money, The visual arts and the public sphere in eighteenth-
century England, London/New Haven 1993.
- Wagner, Monika: Industrielandschaft in der englischen Malerei, Frankfurt am Main 1979.
- Waterhouse, Ellis: Painting in Britain 1530-1790, London/New Haven 1994.
9Virtuelle Räume vom Mittelalter bis in die Moderne
(Schwerpunkt Mittelalter)
Nr. 13702332
Dozent/In Prof. Dr. Gottfried Kerscher
Zeit Donnerstag, 16 bis 18 Uhr
Raum Hörsaal 7
Veranstaltungsform Vorlesung
Inhalt
In der Kunst, in der Rezeption und nicht zuletzt in der Interpretation der Kunstwerke können
auf den ersten Blick nicht sicht- oder bewertbare Dinge eine große Rolle spielen. Das trifft z.B.
zu für bestimmte Attribute oder Accessoires in der Malerei oder etwa kompositorische bzw.
symmetrische oder auf dem Goldenen Schnitt beruhende Größenverhältnisse in Bauwerken,
Stadträumen oder selbstverständlich auch in bildnerischen Werken (Skulptur, Malerei, Design
usw.). Die Rezeption von Kunstwerken, also ihre Verarbeitung im Gehirn, ist gesteuert von
bestimmtem Vorwissen und dem Rezeptionsvorgang - dem Sehen, dem Erkennen, der
Nutzung und vielem mehr.
Philosophisch nennt man diesen Vorgang Konstruktivismus – man „konstruiert“ also aus den
einzelnen Elementen, die man verstehen und zuordnen kann, ein „neues“ oder individuelles
Objekt.
Inception, Christopher Nolan, 2010
In welchem Maße, in welchem Umfang ein solches konstruktivistisches Verständnis nicht
dargestellter „Sachverhalte“ vorkommt, das will diese Vorlesung in 15 Beispielen aus ver-
10schiedenen Epochen zwischen Mittelalter und Moderne/Gegenwart zeigen. Dabei ist ent-
scheidend, dass das Virtuelle nicht zwingend seine Gestalt zeigen muss, wie das z.B. im Filmstill
aus Inception (Christopher Nolan, 2010, oben) vorgibt, sondern dass ein größerer Teil der Re-
konstruktion des Virtuellen dem menschlichen Denken, unter anderem der Vorstellungskraft
zugestanden ist.
So fragt sich beispielsweise, inwiefern der Papstpalast in Avignon (um 1350)
Illuminationen des Papstpalastes 2016
die Stadt Rom repräsentieren konnte, ja tatsächlich ein virtuelles Rom darstellte oder warum
im Film Stalker (Andrei Tarkowski, 1979)
Filmstills aus Stalker (Blick aus dem „Zimmer“ und in das „Zimmer“: links)
niemand den Raum betreten wollte, der schlicht und einfach „das Zimmer“ hieß, warum in
Sam Taylor-Woods (jetzt Sam Taylor-Johnson) Installation „Atlantic“,
Sam Taylor-Wood, Atlantic, Installation 1997
präsentiert auf der Biennale in Venedig 1997, die drei Leinwände der Installation einen
virtuellen Raum darstellen oder in Mies van der Rohes Barcelona Pavillon (1929)
11Mies van der Rohe, Barcelona Pavillon
verschiedene Raumebenen sich zu einem virtuellen Raum zusammenschließen. Beispiele sind
aus allen Zeiten vorstellbar, denkbar und werden in einer Auswahl besprochen, in der deutlich
wird, dass das Virtuelle keineswegs auf die Moderne zu begrenzen ist.
Literatur
Gottfried Kerscher, Kopfräume, Kiel 2000.
Oliver Grau, Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart. Visuelle Strategien, Berlin 2001.
12Das Goldene Jahrhundert. Rembrandt und die holländische Malerei
(Schwerpunkt Frühe Neuzeit)
Nr. 13702293
Dozent/In Prof. Dr. Dr. Andreas Tacke
Zeit Freitag, 14 bis 16 Uhr
Raum Hörsaal 1
Veranstaltungsform Vorlesung
Inhalt
Sich mit Rembrandt beschäftigen zu wollen, bedarf nicht der näheren Begründung; er ist DER
holländische Künstler der Vormoderne. Das „Goldene Zeitalter“ bezeichnet hier das 17.
Jahrhundert, in dem das unabhängig gewordene Holland (genauer die sieben nördlichen
Provinzen der Niederlande) einen unvergleichlichen kulturellen und wirtschaftlichen
Aufschwung erlebte, der mit der Blütezeit der Malerei einherging.
Exemplarisch werden Fragestellungen untersucht, die allgemein den methodischen Weg zur
Beschäftigung mit der holländischen (und flämischen) Malerei aufweisen: Das
Themenspektrum reicht von der Ausbildung und sozialen Stellung des Künstlers über die
Werkstattpraxis bis hin zu Fragen nach Nobilitierungsstrategien von Künstlern und
Auftraggebern sowie der auch bei Rembrandt kontrovers diskutierten Frage der
Konfessionalisierung der Kunst im 17. Jahrhundert.
Literatur
Schwartz, Gary: Rembrandt, Sämtliche Gemälde in Farbe. (Holländische 1. Ausg. 1984)
Darmstadt 1987.
Schama, Simon: Überfluß und schöner Schein, Zur Kultur der Niederlande im Goldenen
Zeitalter. (Englische 1. Ausg. 1988) München 1988.
(unter Vorbehalt) Schama, Simon: Rembrandts Augen. (Englische 1. Ausg. 1999) Berlin 2000.
(nach wie vor der beste – und preiswerte – Kurzüberblick) Tümpel, Christian: Rembrandt, mit
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (rororo-Monographien). 9. Aufl., Reinbeck bei
Hamburg 2002.
13Veranstaltungen im Studiengang Bachelor of Arts
How “The Vikings” became Christians? Die norwegischen Stabkirchen
Nr. 13702364
Dozent/In Dr. des. Jürgen von Ahn M.A.
Zeit Freitag, 10 bis 12 Uhr
Raum A142
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Die große Epoche mittelalterlichen
Kirchenbaus ist in der Kunstgeschichte geprägt
von den eindrucksvollen romanischen und
gotischen Steinbauten Mittel-, Süd und
Westeuropas. Im Schatten der prachtvollen
gotischen Kathedralen stehen jedoch bis
heute ihre kleineren skandinavischen
Schwestern, die Stabkirchen. Die
Kunstgeschichtsschreibung bliebe jedoch
unvollständig, würde man diese bedeutenden
Gesamtkunstwerke außer Acht lassen.
Vergleichbar den Fresken und dem Skulpturenschmuck besagter Steinkirchen, haben sich an
und in ihnen – trotz des Siegeszuges des römisch geprägten Christentums – eine mythische
Bilderwelt erhalten, welche zum Besucher eine ganz anders geartete Sprache spricht. Es ist
ein mystischer Kosmos des nordischen Kulturkreises, welcher sich in einer um die christliche
Symbolik erweiterten geschnitzten Edda widerspiegelt.
Die hölzernen Stabkirchen stammen meist aus dem 12. bis 13.
Jahrhundert, also aus jener Zeit, als die Wikinger christlich wurden.
Ihre Architektur ist ebenso einzigartig, wie die eigenwillige
Ornamentik der Schnitzereien, welche durch ihren Formenreichtum
bestechen und durch ihren gelebten Synkretismus aus nordischer
und christlicher Religion bis heute beeindrucken.
Ziel des Bachelor-Seminares ist es, den Teilnehmern zunächst einen
Überblick, über die wenigen - von einst hunderten - noch heute
erhaltenen Stabkirchen zu geben. Für diese sollen im weiteren
Verlauf die Architektur, Baugeschichte und Ausstattung im Fokus
stehen. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Einführung in die
nordische sowie christliche Mythologie/Theologie und deren
Ikonografie gelegt sein.
14Literatur
- Bödl, Klaus: Der Mythos der Edda : nordische Mythologie zwischen europäischer Aufklärung
und nationaler Romantik, Tübingen 2000.
- Bugge, Gunnar: Stabkirchen in Norwegen. Einführung und Übersicht, Brumunddal 1984.
- Bugge, Gunnar; Mezzanotte, Bernadino: Stabkirchen. Mittelalterliche Baukunst in Norwegen,
Regensburg 1994.
- Distler, Edda und Flemming: Die Rätselbilder der Stabkirchen. Norwegens geistiges Erbe,
Dornach 2002.
- Kummer, Bernhard: Die Lieder des Codex Regius (Edda) und verwandte Denkmäler. Band I und
II., 1959.
- Lindholm, Dan: Stabkirchen in Norwegen. Drachenmythos und Christentum in der
altnorwegischen Baukunst, Stuttgart 1968.
- Sakuma, Yasuo; Storsletten, Ola: Die Stabkirchen Norwegens. Meisterwerke nordischer
Baukunst, Freiburg im Breisgau 1993.
15Niederländische Stilllebenmalerei 1550-1700
Nr. 13702327
Dozent/In Dr. Stephan Brakensiek
Zeit Montag, 10 bis 12 Uhr
Raum A246
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Etwa zeitgleich zur Landschaftsmalerei
entsteht in der Mitte des 16. Jahrhunderts
das Stillleben als eigene Gattung. Von nun
an rücken unbelebte Gegenstände nicht
nur aufgrund von in ihnen enthaltenen
Bedeutungen sondern auch aufgrund ihrer
besonderen, die Maler in ihrer Kunst
herausfordernden Objektoberflächen in
den Fokus einer ganzen Gruppe von
Künstlern. Mit Namen wie Jan Brueghel
d.Ä., Jan Davidsz. de Heem, Pieter Aertsen
oder Joachim Beuckelaer ist in der
Kunstgeschichte heute die Epoche des
Goldenen Zeitalters der niederländischen Stilllebenmalerei verbunden.
Ziel des Seminars ist es, mit den unterschiedlichen Positionen und Ansprüchen des Stilllebens
in der Frühen Neuzeit bekannt zu machen, Fragen seiner inhaltlichen Interpretierbarkeit zu
diskutieren und den Aspekten seiner Wertschätzung von dem Hintergrund der
zeitgenössischen Kunsttheorie nachzuspüren. Dabei wollen wir im Seminar sowohl
ikonographisch vorgehen als wir auch den Versuch unternehmen wollen, uns mit den
maltechnischen Besonderheiten etwa der Darstellung von Gläsern oder Schmetterlingsflügeln
auseinanderzusetzen.
Und schließlich steht die Frage im Raum: wer hat überhaupt diese Bilder gesammelt, was hat
man mit ihnen gemacht und in welchem Zusammenhang steht ihre Popularität zu den
kulturgeschichtlichen Besonderheiten ihrer Entstehungszeit.
16Das Martinskloster in Trier - Von der Klosteranlage zum Studierendenwohnheim
Ein Dokumentations- und Ausstellungsprojekt in Kooperation mit dem Studiwerk Trier
Nr. 13702284
Dozent/In Dr. Stephan Brakensiek
Zeit Montag, 16 bis 18 Uhr
Raum A142
Veranstaltungsform Projektseminar
Inhalt
Das Studiwerk Trier plant für das Jahr 2010 den
Teilneubau der Wohnanlage »Martinskloster«
(Martinsufer). Dort, auf dem Gelände des
ehemaligen, in der Spätantike gegründeten
Klosters gleichen Namens, sollen etwa 130 neue
Einheiten für studentisches Wohnen entstehen,
die in einen inhaltlichen Zusammenhang mit der
Geschichte des Ortes gebracht werden sollen.
Ziel dieses Seminar ist es, ein museologisches
Konzept für diese Aufgabe zu entwickeln und in
Kooperation mit dem Studiwerk umzusetzen. Dabei sollen sowohl theoretisch durch die
Lektüre von wissenschaftlichen Texten als auch praktisch durch die Analyse vor Ort von
Präsentationskonzepte in den letzten Jahren in der Region errichteten oder
neukonzeptionierten Museen die Grundlagen gelegt werden, um ein eigenes museologisch
begründetes Konzept zu erarbeiten. Dabei soll das Martinskloster kein Museum werden. Aber
Aufgabe ist es, Momente des Ausstellens und Vermittelns von Aspekten der ortsspezifischen
Kunst- wie Kulturgeschichte von der Antike bis ins 20. Jahrhundert in das Konzept eines
Studierenden Wohnheims auf innovative Art und Weise einzuflechten und so den Ort zu
einem des Wohnens und Lebens mit der Geschichte zu machen.
17Im Rhythmus der Maschine. Arbeit als Motiv in der Kunst der Moderne
Nr. 13502261
Dozent/In Dr. Andrea Diederichs
Zeit Donnerstag, 14 bis 16 Uhr
Raum A142
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Heroisierung, Armut oder Revolte sind nur einige Darstellungsmodi von Arbeitern in der Kunst.
Im Seminar soll beleuchtet werden, welche Typen von Arbeitern es gibt, wann diese auftreten
und welche künstlerischen Intentionen sich hinter diesen verschiedenen Arten der
Präsentation verbergen. Zudem sollen exemplarisch Werke untersucht werden die zeigen, wie
sich verschiedene Phasen der Industrialisierung auf das Arbeitsfeld des Individuums
auswirken: Wie werden die Folgen von einer im beständigen Wandel begriffenen Arbeitswelt
und die damit einhergehenden politischen, technologischen sowie ökonomischen
Transformationen von Künstlern dargestellt? Was bedeuten veränderte Anforderungen wie
beispielsweise gesteigerte Warenproduktion (Massenproduktion), Standardisierung,
Arbeitsteilung oder der erhöhte Einsatz von Maschinen für den Arbeiter und dessen
Darstellung? Wie begegnen Künstler dem totalen Zusammensturz ökonomischer Systeme und
deren politischen Implikationen?
Auch im Hinblick auf das Karl-Marx-Jahr 2018 soll analysiert werden, wie produktionsbedingte
Umbrüche und Neuerungen sowie deren Konsequenzen für das Individuum seit 1850 in
Malerei, Fotografie und Wandbild dargestellt wurden.
Künstler (Auswahl): Gerd Arntz, Thomas Hart Benton, Ford Maddox Brown, Walker Evans,
Andreas Gursky, Lewis Hine, Arthur Kampf, Dorothea Lange, Adolph Menzel, Francois Millet,
Jacob Riis, Diego Rivera, August Sander, Franz Wilhelm Seiwert, Charles Sheeler, Willi Sitte,
Walter Womacka
18Literatur (Auswahl)
- Anreus, Alejandro, Robin Adele Greeley und Leonard Folgarait (Hrsg.). Mexican Muralism. A
Critical History. Berkeley: UCP, 2012.
- Brannan, Beverly W. und Gilles Mora. FSA - the American vision. New York: Abrams, 2006.
- Charles Sheeler: Paintings and Drawings. Ausst.Kat. Museum of Fine Arts, Boston, Carol
Troyen und Erica E. Hirshler (Hrsg.), Boston: Little, Brown, and Company, 1987.
- Charles Sheeler: The Photographs. Ausst.Kat. Museum of Fine Arts, Boston, Theodore E.
Stebbins und Norman Keyes, Jr. (Hrsg.), Boston: Little, Brown, and Company, 1987,
- Frizot, Michel (Hrsg.). Neue Geschichte der Fotografie. Köln: Könemann, 1998.
- Herding, Klaus. »Industriebild und Moderne. Zur künstlerischen Bewältigung der Technik im
Übergang zur Großmaschinerie (1830-1890).« Art social und art industriel. Funktionen der
Kunst im Zeitalter des Industrialismus. Helmut Pfeiffer, Hans Robert Jauß und Françoise
Gaillard (Hrsg.). München: Wilhelm Fink Verlag, 1987, S. 424-468.
- Holländer, Hans (Hrsg.). Erkenntnis, Erfindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte von
Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Berlin: Gebr. Mann,
2000.
- Koschatzky, Walter. Die Kunst der Photographie: Technik, Geschichte, Meisterwerke.
Salzburg et al: Residenz, 1984.
- Kunst und Technik in den 20er Jahren. Neue Sachlichkeit und Gegenständlicher
Konstruktivismus. Ausst.Kat. Städtische Galerie im Lehnbachhaus München, Helmut Friedel
(Hrsg.), München: Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1980.
- Rubin, James H. Impressionism and the Modern Landscape. Productivity, Technology, and
Urbanization from Manet to van Gogh. Berkeley, Los Angeles und London: UCP, 2008.
- Sander, Gunther (Hrsg.). Menschen des 20. Jahrhunderts: Portraitphotographien 1892 -
1952. München: Schirmer, 1980.
- Stumberger, Rudolf. Klassen-Bilder. Bd. [1]. 1900 - 1945. Konstanz: UVK, 2007.
- Tenfelde, Klaus (Hrsg.). Bilder von Krupp: Fotografie und Geschichte im Industriezeitalter.
München: Beck, 22000.
- The Rouge. The Image of Industry in the Art of Charles Sheeler and Diego Rivera. Ausst. Kat.
The Detroit Institute of Arts, Detroit. Detroit: The Detroit Institute of Arts, 1978.
- Türk, Klaus. Mensch und Arbeit: 400 Jahre Geschichte der Arbeit in der bildenden Kunst.
Milwaukee: MSOE Press, 2003.
- Türk, Klaus. Bilder der Arbeit : eine ikonografische Anthologie. Wiesbaden: Westdeutscher
Verlag, 2000.
- Türk, Klaus (Hrsg.). Arbeit und Industrie in der bildenden Kunst. Stuttgart: Franz Steiner,
1997.
19Vom Bild zum Wort: Schreiben und Sprechen über Kunst.
Begleitender Workshop zur Ausstellung im >> generator.medienkunstlabor Trier
Nr. 13702339
Joeressen + Kessner: inKUBATOR. Entwurf für eine Licht- Klanginstallation im >> generator. Medienkunstlabor Trier, 2017
Dozent/In Andrea Günther M.A.
Zeit Dienstag, 16 bis 18 Uhr
Raum A 246
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Ohne Betrachter keine Kunst. Jedes Werk der Bildenden Kunst entwickelt seine Bedeutung
und sein Potential erst in der Rezeption. Dies gilt umso mehr im Rahmen einer Ausstellung, da
diese sich explizit an ein Publikum wendet, welchem sie ausgewählte Kunstwerke zeigen will.
Eine Ausstellung kann so Verständnis für Kunst erzeugen und sie kann zugleich unterhalten,
kann neue Perspektiven aufzeigen und Neugier wecken. Den vielfältigen Erwartungen und
Vorkenntnissen der Besucher gerecht zu werden, und auch das Anliegen und die Aussagen der
Kunst angemessen zu vermitteln ist dabei oft eine Graswanderung. Für die verschiedensten
Berufsfelder der Kunstgeschichte stellt daher die Kunstvermittlung eine zentrale Fähigkeit dar.
Die Ausstellung im >> generator 2017 wartet erneut mit einer in-situ Lichtkunstinstallation
auf, die diesmal ergänzt wird durch namhafte Videokunst des 21. Jahrhunderts. Die
Installation „InKUBATOR“ des Künstlerduos Joeressen und Kessner erzeugt Licht- und
Klangsequenzen in Echtzeit: fortwährend neu kombinierte Motive und Lichterscheinungen
verändern die Wahrnehmung der historischen Architektur der Heizkraftzentrale in einem
mäandernden Lichtfluss. Diese Form der Medienkunst lässt sich nicht mehr mit
herkömmlichen kunsthistorischen Begriffen beschreiben. Das Seminar vermittelt darum neue
Zugriffe auf die Medienkunst und ihre Vermittlung.
Die Veranstaltung bietet in Form einer Schreibwerkstatt die Möglichkeit, verschiedene
Vermittlungs-formen einzuüben. Angeschlossen an die kommende Ausstellung im >>
generator.Medienkunstlabor der Universität Trier, sollen im Rahmen des Seminars
verschiedene Texte zur Vermittlung der Licht- und Videokunst erprobt und umgesetzt werden.
Zum einen geht es um die schriftliche Vermittlung von Licht- und Medienkunst: Welche
Textsorten gibt es in einer Ausstellung? Was sind ihre Charakteristika? Wir fertigen
20Katalogtexte, Ausstellungs-/ Wandtexte, Ankündigungen und Pressetexte. In diesem Projekt-
Seminar werden gemeinsam die Katalogbeiträge zur diesjährigen >> generator-Ausstellung
erarbeitet und publiziert. Die Seminarteilnehmer können sich hier mit unterschiedlichen
Textformaten einbringen. Zum anderen erarbeitet das Seminar verschiedene Konzepte zur
mündlichen Vermittlung von Licht- und Videokunst, zugeschnitten auf die diversen
Zielgruppen und heterogenen Besuchergruppen (von der Kinder-Uni, über die Schulklasse, bis
hin zu Senioren) des universitären Ausstellungsraumes, die den Besuchern die ausgestellten
Werke kenntnisreich vermitteln und kontextualisieren.
Die Seminarleistung besteht aus verschiedenen Textbeiträgen und einem
Vermittlungskonzept, welche bereits im laufenden Semester eingereicht und unmittelbar
praktisch erprobt werden.
Literatur
- ARGE schnittpunkt (Hg.): Handbuch Ausstellungstheorie und –praxis. Böhlau: Wien
2013.
- Joeressen+kessner: close encounter. Transmediale-Echtzeitinstallation. Ausst.-Kat.
Galerie Noack, Wegberg 2010.
- Klotz, Heinrich; Horst Bredekamp; Ursula Frohne: Kunst der Gegenwart. Museum für
Neue Kunst ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Prestel:
München, New York 1997.
- Lüth, Nina; Sabine Himmelsbach (Hgg.): medien kunst vermitteln. Edith-Ruß-Haus für
Medienkunst. Berlin 2011.
- Martin, Sylvia: video Art. Hg.: Uta Grosenick, Taschen: Köln 2006.
- Still bewegt: Videokunst und alte Meister. Ausst.-Kat. Museum Sinclair-Haus, Bad
Homburg 2013/2014, Hirmer: 2013.
- Werber, Niels: Medium/Form: Zur Herkunft und Zukunft einer Unterscheidung. In:
Kritische Berichte, Bd. 36, Nr. 4, 2008, S. 64-70.
- Paul, Christiane (Hg.): New media in the White Cube and beyond: curatorial models
for digital art. University of California Press Berkeley 2008.
Termine
17.10.2017 Einführung (Vermittlungskonzept; Führungen; Katalogtexte; Begleitprogramm)
TEIL 1: Vermittlung
24.10.2017 Sprechen über Kunst (Lektüre?)
31.10.2017 Reformationstag: frei
07.11.2017 Klassische Führung
14.11.2017 Wie gehe ich auch besondere Besuchergruppen ein? (Lektüre)
21.11.2017 Begleitprogramm Planung und Umsetzung
28.11.2017 Begleitprogramm Planung und Umsetzung
21TEIL 2: Katalog
05.12.2017 Textsorten: Beispiele (Lektüre?)
12.12.2017 Themenfindung und Recherche
19.12.2017 erste Entwürfe
Weihnachtsferien
09.01.2018 Schreibwerkstatt
16.01.2018 Schreibwerkstatt
23.01.2018 Lektorat
30.01.2018 Layout
06.02.2018 Resümee
22Mittelalterrezeption in Architektur und Kunsthandwerk
des Historismus in Trier
Nr. 13702388
Dozent/In Lukas Huppertz M.A.
Zeit Donnerstag, 10 bis 12 Uhr
Raum A 246
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Trier ist bekanntlich voll von mittelalterlichen Bau-
und Kunstwerken. Ähnlich reich ist der lokale
Bestand an historistischer Kunst aller Gattungen,
die sich auswählend und kommentierend auf
dieses (?) mittelalterliche Erbe bezieht. Im Seminar
wollen wir am Beispiel Trier untersuchen, welches
Bild des Mittelalters die Kunst des Historismus
prägt. Dabei wird uns neben der Architektur auch
die sogenannte angewandte Kunst beschäftigen.
Es ist geplant, das Seminar in ein
Ausstellungsprojekt münden zu lassen, in dem wir
Bewohnern und Besuchern der Stadt Trier einzelne
Facetten dieses Mittelalterbilds vorstellen.
Literatur
Zur Einführung in die Kunst des Historismus empfehle ich
- Eva-Maria Landwehr: Kunst des Historismus, (UTB) Köln/ Weimar/ Wien 2012, sowie
- Hermann Fillitz (Hrsg.): Ausst. Kat. Der Traum vom Glück. Die Kunst des Historismus
in Europa, Wien / München 1996.
Eine erste Orientierung über die Baudenkmäler des Historismus in Trier bieten die
einschlägigen Beiträge in
- Jens Fachbach, Stefan Heinz, Georg Schelbert, Andreas Tacke (Hrsg.):
Architekturführer Trier, Petersberg 2015.
23Der Trierer Dom - Grundlagen, Perspektiven, Methoden und neuere
Forschungen
Nr. 13702283
Dozent/In Prof. Dr. Gottfried Kerscher
Zeit Dienstag, 10 bis 12 Uhr
Raum A 246
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Zusammen mit dem Bauforscher Dominik Jelschewski und der Kunsthistorikerin Nicole
Fleckinger werden wir Fragen zum Trierer Dom sowie die neuesten Forschungsergebnisse
diskutieren - nicht nur im Hörsaal, sondern auch im Dom - selbstverständlich. Zu sehen, zu
erkennen und nicht zuletzt zu beurteilen sind die verschiedenen Bauphasen des Domes in
seiner 1700-jährigen Geschichte. Ziel dieses von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanzierten Projektes der TU München und der Uni Trier ist die Klärung der hochkomplexen
Baugeschichtemit unter anderem den Methoden der Bauforschung. Hierbei gibt es
Untersuchungen der Steine, der Putze, der Bauformen – zum Einsatz kommen modernste
High-Tech-Vermessungen wie ein 3D-Laserscan oder eine Kameradrohne. Alle diese Mittel
und ihre Ergebnisse werden diskutiert und ihr Zweck erörtert. Neue Befundergebnisse und
Forschungsfragen werden diskutiert.
Screenshots: Website Fach Kunstgeschichte und Institut für Bauforschung TU-München
(http://www.baufo.ar.tum.de/en/research/current-projects/der-trierer-dom/)
24Gegenstandssicherung: (Historische) Bauforschung und Inventarisierung
Nr. 13702294
Dozent/In Prof. Dr. Gottfried Kerscher
Zeit Dienstag, 14 bis 16 Uhr
Raum A 246
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Die Gegenstandssicherung ist zwingender Beginn der Beschäftigung mit einem Kunstwerk.
Ohne, dass der Zustand, eventuelle Veränderungen o.ä. festgestellt sind, kann eine
sachgerechte Beurteilung nicht erfolgen, Interpretationen hängen in der Luft. Die
Gegenstandssicherung ist in der Malerei genauso vorzunehmen wie in der Architektur, der
Skulptur und jedem Kunstwerk, egal, ob es sich um Landart, um Action Painting oder eine
andere Art der Form bzw. Beschaffenheit handelt.
Ein Beispiel:
Vor wenigen Tagen hat die berühmte und hoch
geschätzte (z.B. Leibniz-Preis) Kunsthistorikerin
Bénédictine Savoy (TU Berlin) die derzeit
geplante, künftig museale Darbietung des
Humboldt-Forums in Berlin als unsachgemäß
erklärt (SZ 20.7.2017: „Das Humboldt-Forum ist
wie Tschernobyl“), weil die Exponate nicht
genügend erforscht seien; zum Beispiel sei nicht
geklärt, was ihre Herkunft ist, wem die Exponate
„entwendet“ (Beispiel rechts: „geschenkt“)
wurden, in welcher Form sie zu uns gekommen
sind usw. Für die Exponate des künftigen
Humboldt-Museums, so Savoy sinngemäß,
existiere also keine Gegenstandssicherung ... Genannter Artikel in der SZ vom 20.7.2017
Ob Einführung in die Kunstgeschichte oder Bénédictine Savoy in der SZ: Zustand und
Vorgeschichte von Kunstwerken sind unter Umständen ebenso wichtig wie ihr Zustand,
Bedingungen der Entstehung oder andere wichtige Informationen. Im Seminar soll geklärt
werden, was Gegenstandssicherung sein kann und wozu sie dient; dabei stehen die
Historische Bauforschung und die Inventarisierung im Zentrum der Überlegungen; es werden
aber auch andere Beispiele diskutiert. Sie fragen sich jetzt möglicherweise, warum die
Exponate dennoch und trotz fehlender Gegenstandssicherung in das berühmte Humboldt-
Museum wandern werden. Das fragen sich andere ebenfalls, und es gehört auf den
„Abfallhaufen“ aktueller Politik, zusammen mit Dieselskandal & co.
Sie sollen aber hier in Trier zumindest so ausgebildet werden, dass Sie solche Fehler nicht
machen.
25Literatur
- Kunstgeschichte: eine Einführung, hrsg. v. H. Belting u.a., Berlin 1986 (vor allem: W.
Sauerländer, Gegenstandssicherung allgemein; U. Schießl, Materielle
Befundsicherung an Skulptur und Malerei; D. von Winterfeld, Befundsicherung an
Architektur; W. Sauerländer, Alterssicherung, Ortssicherung und Individualsicherung)
- G. Ulrich Großmann, Einführung in die historische und kunsthistorische
Bauforschung, Darmstadt (WBG) 2010.
- T. Busen, M. Knechtel, C. Knobling, E. Nagel, M. Schuller, B. Todt, Bauaufnahme,
Münster 2015.
- Oskar Spital-Frenking (Hochschule Trier, BDA, Architekt und Stadtplaner in Dortmund
und Lüdinghausen):
- "Grundsätze der modernen Denkmalpflege - Ergänzungen an historischen
Bauwerken" Ein Forum für das Simeonstift, Sonderdruck aus dem Neuen Trierischen
Jahrbuch 2002
- "Grundsätze der Sanierung und Instandsetzung, Gedanken zur Pflege und zum Erhalt
historischer Bausubstanz" BundesBauBlatt Heft, 4/2001
- "Umgang mit bestehender Bausubstanz - Chance für eine besondere Identität" bank
objekte 1/2001
- "Architektur und Denkmal; Der Umgang mit bestehender Substanz; Entwicklungen,
Positionen, Projekte", Buch 175 Seiten Verlagsanstalt Alexander Koch GmbH,
Leinfelden-Echterdingen
26Veranstaltungen im Studiengang Master of Arts
[Zusammen]Schau des Heiligen: Studentisches Buchprojekt zum
Trierer Domschatz
Nr. 13702291
Dozent/In Dr. des. Jürgen von Ahn M.A. zusammen mit Kirstin Mannhardt
M.A. (Museum am Dom)
Zeit Freitag, 10 bis 12 Uhr
Raum A142
Veranstaltungsform Seminar
Inhalt
Die hohe Domkirche zu Trier besitzt aus ihrer fast 2000jährigen Geschichte – trotz größerer
Verluste durch Raub und Säkularisation – immer noch einen der umfangreichsten
Kirchenschätze Deutschlands. Einige der
Goldschmiedearbeiten zählen zu den ältesten
erhaltenen Werken ihrer Art überhaupt. Besondere
Reliquien und die kostbare Ausstattung machen den
Trierer Domschatz sowohl im materiellen als auch
im theologischen Sinne zu etwas ganz
Außergewöhnlichem. Abgesehen von den
mittelalterlichen Stücken, kommt eine Vielzahl von
bedeutenden Kunstwerken des 18. und 19.
Jahrhunderts hinzu. Die letzte umfassende
Publikation zu Stücken des Domschatzes stammt aus dem Jahre 1984 und wurde anlässlich
einer Ausstellung mit dem Namen „Schatzkunst Trier“ von Prof. Dr. Franz Ronig
herausgegeben. Ein moderner Kunstführer jedoch, welcher auch dem interessierten Laien die
unterschiedlichen Produkte verschiedenster Kunstgewerke zugänglich macht und diese in
ihren religiösen sowie kulturellen Kontext einbindet, fehlt bis heute.
Ziel des in zwei Stufen gestaffelten Praxisseminars ist es,
diesen »Schatz« einmal in adäquater Form als
populärwissenschaftliches Buch zu präsentieren. In
Zusammenarbeit mit Kirstin Mannhardt (Museum am
Dom) sollen im ersten Schritt (MA-Seminar) mit den
Studierenden der Masterstudiengänge ein Konzept
erarbeitet werden, wie und in welcher Form der
Kunstführer konzipiert werden soll. Aufbau, Struktur und
Inhalt, sowie Auswahl der zu präsentierenden Stücke
stehen im Zentrum der Bearbeitung. Darüber hinaus sollen zentrale Themen, den Trierer
Domschatz betreffend sowie theologische Hintergrundinformationen zum (Trierer) Heiligen-
und Reliquienkult, als Referat vorgestellt werden, welche dann im Anschluss als Essays auch
27in das Buchprojekt einfließen sollen. Die Teilnehmer/Innen erhalten so die Möglichkeit von
Anbeginn die Konzeption – also vom Brainstorming bis zum fertigen Konzeptpapier – eines
solchen Buchprojektes zu begleiten und selbst daran aktiv mitzuarbeiten. In einem weiteren
Seminar (BA-Seminar SoSe 2018) werden von den Bachelorstudenten/Innen die einzelnen
Texte der vorgestellten Stücke erarbeitet werden. Alle Autoren sollen bei einer
Veröffentlichung des Buches auch namentlich genannt werden. Ortstermine im Trierer Dom
und dem Museum am Dom sind vorgesehen. Studierende anderer Fächer und im Besonderen
der Katholischen Theologie sind herzlich willkommen.
28Architektur im Film - Stadt der Zukunft oder Disneyland?
Nr. 13702326
Das Fünfte Element –Metropolis –Blade Runner
Dozent/In Prof. Dr. Gottfried Kerscher
Zeit Mittwoch, 12 bis 14 Uhr
Raum A 246
Veranstaltungsform Seminar
Die vorläufige Filmliste:
Fritz Lang, Metropolis, 1927
Robert Wiene, Das Kabinett des Dr. Caligari (1920)
François Truffaut, Fahrenheit 451 (1966) (spielt ca. 70er Jahre 20.Jh.)
Jaques Tati,Playtime (1967) (Paris u.a. 60er Jahre 20.Jh.)
Ridley Scott, Blade Runner (1982) (LA [2019!])
Luc Besson, Das Fünfte Element (1997)
Enki Bilal, Immortal – New York 2095: Die Rückkehr der Götter (2004) (NY
2095)
Alex Proyas, Dark City (1998)1
Christopher Nolan, Inception (2010)
Christopher Nolan, Interstellar (2014) (2050)
Alex Proyas, I, Robot (2004) (Chicago 2035)
Steven Spielberg, Minority Report (Washington 2054)
Karyn Kusama, Aeon Flux (2005) (Bregna 2415, Berlin usw.)
Byung-cheon Min, Natural City (2003) („Natural City“ 2080)
George Lucas, Star Wars (1977 ff.) (Coruscant)2
Paul Verhoeven/Len Wiseman, Total Recall (1990/2012) (2084)
Tom Tykwer/Andrew Wachowski/Lana Wachowski, Cloud Atlas (2012)
(1849/1936/1973/2144)
1
N. Katherine Hayles, The Slipstream of Mixed Reality: Unstable Ontologies and Semiotic Markers in The
Thirteenth Floor, Dark City, and Mulholland Drive. (Department of English and Design/Media Arts Nicholas
Gessler Department of Geography and Design/Media Arts University of California, Los Angeles)
(https://people.duke.edu/~ng46/cv-pubs/03slipstream.pdf 27.7.2017)
2
Coruscant: http://jedipedia.wikia.com/wiki/Coruscant
29Weitere Filme: Guntram Vogt, Mitarbeit Philipp Sanke, Die Stadt im Film. Deutsche
Spielfilme 1900 - 2000, Marburg 2001 (sowie internationale Filmpresse, IMDB,
Zweitausendeins Lexikon des internationalen Films usw.)
Kommentar/Ankündigung:
In den Tagen, in denen dieses Seminarskript verfasst wurde, kam Luc Bessons Valerian – City of Alpha in die
Kinos.
City of Alpha (2017)
Inhalt
In den Städten der Zukunft scheint es vor allem Lichtmangel zu geben – geradezu wie in Dark
City, wie das schon der (Film-) Name sagt, aber auch im Los Angeles in Blade Runner. Es
könnte sich um ein filmhistorisches Argument handeln – oder um die Tatsache, dass man
nicht alles genau zeigen / sehen lassen wollte / konnte.
Bei Jacques Tati hingegen waren die Städte durchsichtig-undurchsichtige Moloche, in denen
man sich nicht nur verlaufen, sondern seine Geschäftspartner stets sehen, jedoch nie
erreichen konnte.
Tatis Playtime
Seit dem Kino der zehner und zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurden nicht
grundsätzlich verschiedene zeitgenössische Stadtutopien und Dystopien geschaffen, sei es,
30dass sie nachgebaut wurden, sei es, dass sie als Modelle abgefilmt wurden, sei es, dass man
in ihnen zu leben schien. Ihre Formen waren der zeitgenössischen Kunst entlehnt, wie etwa
in „Das Kabinett des Dr. Caligari“ von Robert Wiene oder Fritz Langs „Metropolis“, in dem
aus der zeitgenössischen Stadtentwicklungs-Debatte das Nebeneinander von Mensch, Auto
und Flugzeug (siehe oben) übernommen wurde. Dazu gibt es bereits entsprechende
Fachliteratur und Filme.
Weniger bekannt sind hingegen die Lebenswelt-Utopien, die in „Fahrenheit 451“ von
François Truffaut für die damalige Zukunft (jetzt schon Vergangenheit) entwickelt und
erfunden oder avisiert wurden. Trafen sie zu?
Fahrenheit 451
Ähnlich entwarf man in „Blade Runner“ von Ridley Scott ein Los Angeles von 2019 – es sollte
also schon in zwei Jahren so aussehen, wie dort imaginiert. Und entsprechend dachte man in
„Das Fünfte Element“ (Garderobe: Jean Paul Gaultier) oder in „Immortal“ an horizontale und
vertikale Stadträume.
„Dark City“, „Inception“, „Total Recall“, „Cloud Atlas“ und „Interstellar“ arbeiten mit
bekannten neben utopischen Stadträumen sowie -formen, während in „Coruscant“ (Star
Wars) nichts mehr dem gleicht, was wir heute unter Architektur und Stadtlandschaft
kennen. Gleiches gilt für „Matrix“, „Herr der Ringe“ oder Computer-gestützten
Stadtmodellen in Spielen.
Charakterisieren Sie anhand eines Films die städtebauliche Utopie/Dystopie; gehen Sie
dabei filmhistorisch vor, das heißt, qualifizieren Sie Fortschritt, Rückbezug, Innovation der
Stadtdarstellung (Darstellung des Lebensraumes etc.) im Film und suchen Sie in der
(zeitgenössischen) Fachliteratur oder in Literatur zur Architektur nach Ähnlichem
hinsichtlich der dort antizipierten Lebensweisen oder Formen.
Neben einem angemessenen Umgang mit Film (zur Einführung: Bildtheorie und Film oder
z.B. Wie interpretiert man einen Film?) und dessen Technik bzw. der Möglichkeit, Szenen
und Screenshots zu präsentieren (bitte bemühen Sie sich selbst darum, Film angemessen zu
präsentieren; Ihnen wird aber bei rechtzeitiger Anfrage gerne geholfen) wird erwartet, dass
Sie unterschiedlichste Sujets des Films und seiner „Requisiten“ (die Stadt und deren
„Ausstattung“) recherchieren. Zur „Interpretation“ dieser Werke, der generellen
Vorgehensweise und den entsprechenden Optionen werden wir zu Beginn des Seminars
einige Beispiele diskutieren.
31Sie stellen in Ihrem Referat den Film kurz vor (Liste oben; Abweichungen von der Liste nur
nach Absprache - wohl sind aber Vergleiche mit anderen Filmen nicht nur möglich, sondern
erwünscht), benennen dann die signifikanten Szenen und Filmstills. Charakterisieren Sie auf
diese Weise wichtige Elemente des Films, also seine Aussage und seiner Bilder (genaue Zeit
sowie Teil, Abschnitt, Thema, in das diese Szenen „eingebaut“ sind); überlegen Sie sich (und
konsultieren dabei selbstverständlich die Fachliteratur), welche Rolle diesem Ausschnitt
zukommt und wie signifikant dies für den Film, für die Szene, für die Handlung usw. ist. Mit
anderen Worten: Sie verstehen Film nicht als Kommunikation in der Art eines Textes,
sondern als eine Synthese von Text und Bild (über den Ton müssten wir separat sprechen).
Verlauf des Seminars
1. Theorie der Stadt; 2. Theorie des Films; 3. Filme
Literaturauswahl
Erwin Panofsky, Stil und Medium im Film, in: Die ideologischen Vorläufer des Rolls-Royce-
Kühlers & Stil und Medium im Film, Frankfurt 1993, 17-51.
Thomas Koebner / Thomas Meder (Hgg.): Bildtheorie und Film, München 2006.
Rez: Bildtheorie und Film: http://www.sehepunkte.de/2007/06/12949.html
Thomas Meder, Produzent ist der Zuschauer. Prolegomena zu einer historischen
Bildwissenschaft des Films, Berlin 2006.
ders., Vom Sichtbarmachen der Geschichte. Der italienische "Neorealismus," Rossellinis
PAISÀ und Klaus Mann, 1993.
ders., Warum wir ins Kino gehen und dort lachen und weinen (wird als pdf zur Verfügung
gestellt).
Thomas Koebner (Hg.), Filmklassiker, 5 Bde. Stuttgart (bis 2006).
Jürgen Müller, Filme der 20er …. bis 2000er Jahre. Köln: 2002ff.
Peter Beicken, Wie interpretiert man einen Film?, Stuttgart 2004.
James Monaco, Film verstehen, Reinbeck 2009 (4. Aufl. 2015).Stadtbaukunst und
Stadtansichten:
Allgemein, Überblick, Auszug, Literaturhinweise: http://www.uni-
muenster.de/Staedtegeschichte/portal/einfuehrung/stadttypen/idealstadt_planstadt.html
Mittelalter (Auswahl):
Boockmann, Hartmut, Die Stadt im späten Mittelalter, München 1986.
Braunfels, Wolfgang, Abendländische Stadtbaukunst: Herrschaftsform u. Baugestalt, Köln
1976.
ders., Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlin 1951.
32Marvin Trachtenberg, Dominion of the Eye. Urbanism, Art, and Power in Early Modern
Florence, Cambridge 1997.
Frühe Neuzeit/Moderne (Auswahl):
Breidecker, Volker, Florenz oder »Die Rede, die zum Auge spricht«. Kunst, Fest und Macht im
Ambiente der Stadt, München 1990 (http://digi20.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00040894_00001.html).
Sabbioneta: https://www.youtube.com/watch?v=8ful2NKmiqA und http://arch.rwth-
aachen.de/cms/Architektur/Forschung/Verbundforschung/Cultural-
Heritage/~cqcn/Sabbioneta/
Gerrit Confurius, Sabbioneta oder Die schöne Kunst der Stadtgründung, Frankfurt am Main
1991.
Le Corbusier, La construction des villes : (Le Corbusiers erstes städtebauliches Traktat von
1910/11) / hrsg. von Christoph Schnoor, Zürich 2008.
Fallstudien:
Klaus Krüger, Bildlicher Diskurs und symbolische Kommunikation, in: Text und Kontext.
Fallstudien und theoretische Begründungen einer kulturwissenschaftlich angeleiteten
Mediävistik, hrsg. von Jan-Dirk Müller, München 2007, S. 123-162.
Hans Belting, Das Bild als Text. Wandmalerei und Literatur im Zeitalter Dantes, in: Malerei
und Stadtkultur in der Dantezeit, hrsg. von Hans Belting und Dieter Blume, München 1989, S.
23-64.
Guntram Vogt, Mitarbeit Philipp Sanke, Die Stadt im Film. Deutsche Spielfilme 1900 - 2000,
Marburg 2001.
Jacob, Frank-Dietrich, Historische Stadtansichten, Leipzig 1982.
33Baugeschichte und Grundlagen des Projektierens im historischen Kontext
Fachrichtung Architektur, Fachhochschule Trier, Fachbereich Gestaltung
Dozent/In Dr. Georg Breitner und Prof. Oskar Spital-Frenking
Zeit Dienstag, 17:20 – 18:50 Uhr
Raum D 110, Schneidershof
Inhalt
Denkmalpflege in Denkmalpflege in Historische
Theorie und Theorie und Praxis (FH Bauforschung –
Praxis (FH I)_________________ Denkmalpflege in
I)______ historischem
Umfeld
1 Seminar m. Übung (FH II)
(Bestandsaufnahme _______________
2 3 kultureller Objekte) 2 3
1 Seminar/1
Vorlesung Prüfungsleistung 2 3
1 Seminar
(Geschichte und
Theorie der 1 Exkursion (ca. 3
Denkmalpflege) Tage) 2
Prüfungsvorleistung 2 2 Portfolio-Prüfung
5
Der Verlaufsplan des Master-Moduls zeigt den Studienschwerpunkt
Denkmalpflege/Bauforschung. Er umfasst drei Semester und sieht, wie im KVV
wiedergegeben, im ersten Semester eine Vorlesung mit verschiedenen Schwerpunkten
der Denkmalpflege und der Bauforschung vor. (Nebenbemerkung: In der Archäologie
werden diese Inhalte selbstverständlich ebenfalls gelehrt und gelernt!)
Die Prüfungsvorleistung ist mit den Veranstaltern abzusprechen.
Im zweiten Semester dieses Moduls wird im Team eine Objektaufnahme vorgenommen,
die Kunsthistoriker/innen Basics vermitteln soll: Gegenstandssicherung,
Bestandsaufnahme usw.
Im dritten Semester werden die aufgenommenen Objekte einer weiteren Untersuchung
unterzogen und präsentiert; sie werden historisch sowie in ihrem Bestand nochmals
untersucht, und zwar hinsichtlich ihrer aktuellen Beschaffenheit – Was repräsentieren
sie? Wie ist der aktuelle Zustand? Was gibt es über diesen zu sagen? Und wenn man alles
aufgenommen hat, historische Zeugnisse, (alte) Fotos, Quellen, auch Archivmaterial (z.B.
über Restaurierungen, Veränderungen usw.), könnte man fragen, wie ist dies zu
interpretieren? Was sagt es über seine Zeit aus und andere Fragen.
34Sie können auch lesen