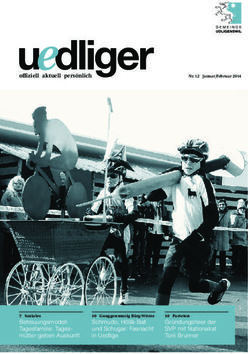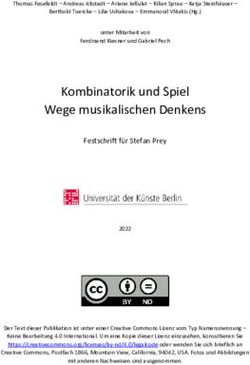Laureshamensia - Kloster Lorsch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Laureshamensia
Forschungsberichte des
Experimentalarchäologischen
2019
Ausgabe 02
Freilichtlabors Karolingischer
Herrenhof Lauresham
Das Experimentalarchäologische Freilichtlabor
Lauresham ist seit 2014 ein integraler Bestandteil
der neuen Gesamtkonzeption der UNESCO DIE DÜRRE DES JAHRES 2018
Welterbestätte Kloster Lorsch. Als idealtypische (Re)
Laureshamensia 02 | 2019
Konstruktion eines karolingerzeitlichen Herrenhofes
fungiert das Freilichtlabor dabei als Ort, in dem auf an-
schauliche Weise frühmittelalterliche Grundherrschaft,
(RE)KONSTRUKTION EINER
Landwirtschaft oder auch Handwerk vermittelt und FRÜHMITTELALTERLICHEN SPATHA
erforscht werden kann. Das Forschungsmagazin
Laureshamensia fungiert dabei als wichtiges Mittel,
die in Lauresham oder auch andernorts im Bereich der
Experimental- oder Siedlungsarchäologie gemachten
„LOCH AN LOCH UND HÄLT DOCH”
wissenschaftlichen Erkenntnisse Fachkollegen und
der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Nicht zuletzt
dadurch soll die Relevanz und allgemeine Bedeutung
der Experimentellen Archäologie für das Verständnis
unserer Vergangenheit und Gegenwart verdeutlicht
und gestärkt werden.
9 *ukdohq#,v- vb*
Schutzgebühr 5,- €
RECONSTRUCTION OF A ROUNDHOUSE
FROM EARLY MEDIEVAL IRELANDInhalt
DIE DÜRRE DES JAHRES 2018 AUS DER PERSPEKTIVE MITTELALTERLICHER
SUBSISTENZWIRTSCHAFT. ERSTE ERFAHRUNGEN AUS DEM
EXPERIMENTALARCHÄOLOGISCHEN FREILICHTLABOR LAURESHAM
6
Claus Kropp
ANMERKUNGEN ZUR (RE)KONSTRUKTION EINER FRÜHMITTALTERLICHEN
SPATHA AUS MANNHEIM 18
Claus Kropp und Frank Trommer
RAUMKLIMA IN FRÜHMITTELALTERLICHEN HÄUSERN 28
Jens Schabacker
WÄRMEISOLATION FRÜHMITTELALTERLICHER KLEIDUNG 44
Jens Schabacker
HANDWERK, WISSENSCHAFT UND VERMITTLUNG – EXPERIMENTELLE
ARCHÄOLOGIE IN ARCHÄOLOGISCHEN FREILICHTMUSEEN AM BEISPIEL
DES MUSEUMSDORFES DÜPPEL
48
Julia Heeb
„LOCH AN LOCH UND HÄLT DOCH“ – NEUE INTERPRETATIONSANSÄTZE
ZU KONSTRUKTIONSELEMENTEN IN FRÜHMITTELALTERLICHEN
GRUBENHÄUSERN IN MANNHEIM 56
Klaus Wirth
GRUBENHÄUSER UND IHRE (RE)KONSTRUKTION. ERFAHRUNGEN AUS
EINEM SCHULISCHEN KOOPERATIONSPROJEKT DES FREILICHTLABORS
LAURESHAM MIT DER HEINRICH-METZENDORF-SCHULE IN BENSHEIM
66
Angela Forberg und Claus Kropp
TAG DER EXPERIMENTELLEN ARCHÄOLOGIE 72
Claus Kropp
AN EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGICAL RECONSTRUCTION
OF A ROUNDHOUSE FROM EARLY MEDIEVAL IRELAND
74
Aidan O’Sullivan und Brendan O’Neill
Laureshamensia 02 | 2019 5RAUMKLIMA IN FRÜHMITTELALTERLICHEN HÄUSERN Jens Schabacker Abstract The living conditions in the Carolingian period were examined using a reconstructed house. Participants lived in the house and used equipment typical for the period. Indoor and outdoor climate (e.g. temperature, humidity) was continuously measured during the experiment. When the house is not heated, the indoor and outdoor conditions are comparable. Due to the compensatory effect of the building, however, indoor values generally follow outdoor values muted and with a delay. Average temperature was only 3,7°C above outside when the house was heated by two open fireplaces in winter. People in the house prefer the surroundings of the fireplace and perceive warmth mainly by radiated heat. Heated air and smoke accumulate under the roof and mostly leaves through the gable holes. Smoke removal efficiency depends on weather conditions. However, carbon monoxide concentrations measured in the living area were all below the occupational exposure limit of 30 ppm. The average amount of wood used for heating was 45 kg per day (+ 15 kg for cooking). Assuming that a fire for heating was lit only at temperatures below 10°C, annual wood consumption was calculated as 7.8 t for one heating period. 28 Laureshamensia 02 | 2019
Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern
Einführung
Von frühmittelalterlichen Gebäuden ist heute in aller
Regel nur noch ein „Bodenabdruck“ erhalten (erkennbar
zum Beispiel an Bodenverfärbungen der Pfostenlöcher).
An diesem lassen sich mit archäologischen Methoden
viele Einzelheiten zu einem Gebäude ablesen. So mar-
kiert die Lage der Pfosten die Größe des Hauses und
mögliche Raumaufteilungen. Feuerstellen sind an ge-
branntem Ton und Holzkohleresten erkennbar. Weitere
Funde können Hinweise auf die Nutzung des Gebäudes
als Speicher oder Werkstatt geben1. Aber auch wenn
sich so viele Einzelheiten zu einem Gebäude erschließen
lassen, sind die Befunde in der Regel zu unvollständig,
als dass sie ausreichen, ein Gebäude zu rekonstruie-
ren. Noch schwieriger ist es, anhand der Überreste eine
Vorstellung darüber zu gewinnen, wie das Leben in ei-
nem solchen Haus einmal ausgesehen haben mag.
(Re)Konstruktionen frühmittelalterlicher Häuser ma-
chen historische Gebäude wieder erfahrbar. Über
die Erkenntnisse beim Bau hinaus bieten sie eine
Möglichkeit, die Funktionalität eines Gebäudes zu tes-
ten und dabei die Lebensbedingungen vergangener
Zeiten zu untersuchen. Insofern ist die Rekonstruktion
Abb. 1 „Haus der Hörigen I“ im eines Hauses nicht Endpunkt der Arbeit, sondern
Experimentalarchäologischen Freilichtlabor Lauresham ein Ausgangspunkt bei der Erforschung historischer
(Blick aus Nord). Lebensumstände.
1 Zimmermann 2015.
Laureshamensia 02 | 2019 29Fragestellung Methoden
Das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham Die Experimente zum Raumklima fanden zu verschie-
in Lorsch ist eine idealtypische Rekonstruktion eines ka- denen Zeiten im Winter 2017/18 und 2018/19 statt.
rolingischen Herrenhofes. Alle Gebäude in Lauresham Im Januar 2018 (Thementag Winter in Lauresham
haben archäologische Vorbilder und gelten damit als 19. – 21.1.) zogen Studenten des Instituts für Ur-
typisch für Süddeutschland im 9. Jahrhundert. Die und Frühgeschichte der Universität Heidelberg in
Häuser werden seit einigen Jahren besonders in der das Haus ein. Diese waren modern gekleidet und
Sommersaison genutzt, und so weiß man, wie es sich un- benutzten eine moderne Ausrüstung. Im Februar
ter warmen Bedingungen in ihnen leben lässt. Weniger 2018 (Raumklimawoche 14. – 18.2.) und Januar 2019
Erfahrung hat man bisher damit, wie bewohnbar die (Thementag Winter in Lauresham 25. – 27.1.) wurde das
Häuser im Winter sind. Daher haben wir uns die Frage Haus von jeweils 4-8 Personen bewohnt, die Erfahrungen
gestellt, wie sich das Leben in den Gebäuden im Winter mit „Living History“ Veranstaltungen an Museen haben
gestaltet. Wie entwickelt sich die Raumtemperatur, wie und eine an frühmittelalterliche Verhältnisse angelehn-
sind die Luft- und Lichtverhältnisse in den Gebäuden, te Ausstattung benutzten. Zusätzlich stehen Ergebnisse
wenn es draußen ungemütlich kalt und dunkel wird? zur Verfügung, die während eines Thementages im März
Ein frühmittelalterlicher Herrenhof war auch eine weit- 2018 (Saisonstart 17. – 18.3.) aufgezeichnet wurden. An
gehend autarke Wirtschaftseinheit. Daher interessieren diesem Wochenende war das Haus von Mitgliedern der
auch die „Betriebskosten“, das heißt der Holzverbrauch Living History Gruppe „Familia Carolina“ bewohnt.
beim Heizen und Kochen in den einzelnen Häusern und
auf dem gesamten Hof. Geographische Lage und Klima
Lauresham stellt das fiktive Zentrum eines Grund-
Experimentelle Herangehensweise
herrschaftsverbandes im Bereich des Klosters Lorsch
Das Ziel der Versuche war, die Wohnbedingungen in ei- dar. Geographisch liegt der Herrenhof damit west-
nem der Häuser zu untersuchen. Die Versuchsteilnehmer lich des Odenwalds in der Oberrheinischen Tiefebene.
sollten für mehrere Tage im Haus wohnen, dabei kochen Geschützt durch den Odenwald zeichnet sich die Region
und heizen und somit eine bewohnte Situation schaf- durch ein warmgemäßigtes Klima aus. Die Gegend ist
fen, wie sie in karolingischer Zeit hätte herrschen kön- geprägt durch einen frühen Frühlingsbeginn, warme
nen. Bei einem solchen kontextbezogenen Experiment Sommer und milde Winter3.
(contextual experiment)2 gibt es viele Parameter, die
gleichzeitig die Ergebnisse beeinflussen. Ein Teil dieser Wohnverhältnisse im Herrenhof Lauresham
Einflüsse (zum Beispiel das Wetter, Feuer zum Kochen Der zentrale Herrenhof besteht aus verschiedenen
oder Heizen) können dabei nur erfasst aber nicht kon- Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie den dazugehö-
trolliert werden. Ziel musste es also sein, die jeweilige rigen Wirtschaftsflächen. In einer ersten Versuchsreihe
Situation so detailliert wie möglich aufzunehmen und zu sollten die Wohnverhältnisse anhand einer der
beschreiben. Hausrekonstruktionen, dem sog. „Haus der Hörigen I“,
untersucht werden (Abb. 1).
3 http://www.klima.org/regionen/b/bergstrasse/
2 Rasmussen 2001, 6, Beck u.a. 2007, 138. (Letzter Zugriff :15.01.2019)
Abb. 2 Grundriss und Rekonstruktion (später ohne Querverstrebungen realisiert) des Gebäudes 102 der Siedlungsphase II von
Kelheim Kanal I mit möglicher Innenaufteilung (1 = Wohnraum; 2 = Küche; 3 = Vorbau) (ergänzter Grundriss; nach Meier 2008).
30 Laureshamensia 02 | 2019Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern
Das Haus tes Hilfsmittel. Sie werden zum Beispiel im Brevium
Das Haus ist in Anlehnung an einen Hausbefund aus Exempla5 und im Capitulare de villis6 bei den Inventaren
dem 9. Jhd. aus der frühmittelalterlichen Siedlung der Herrenhöfe aufgezählt. In Ermangelung von Funden
Kelheim entstanden4. Aus dem Bodenbefund (Abb. 2) aus der Karolingerzeit orientieren sich die verwendeten
ergibt sich eine Grundfläche von 10,8 auf 5,4 m mit einer Feuerböcke an der einfachen Form einer Querstange
möglichen Innenaufteilung in zwei Räume sowie einem (50 cm) auf 4 Beinen (8 cm Höhe).
2,3 m breiten Vorbau.
Kleidung und Ausstattung
Das rekonstruierte Gebäude steht innerhalb der Um die Lebensbedingungen auf einem karolingerzeit-
den Hof umgebenden Palisade mit den Giebeln in lichen Hof im Winter weitgehend authentisch zu erfas-
Nord-Süd-Richtung. Die Außenwände bestehen aus sen, sollten möglichst viele Faktoren einer akzeptierten
Lehmflechtwerk (ca. 20 cm). Als Dacheindeckung wur- Interpretation frühmittelalterlicher Lebensbedingungen
den Reet (ca. 25 cm) für das Haus und Holzschindeln für entsprechen. Das gilt besonders für Faktoren, die auf die
den Vorbau verwendet. Bei einer für das Reetdach benö- gemessenen Werte einen Einfluss haben können (zum
tigten Dachneigung von 55° ergibt sich eine Firsthöhe Beispiel die Kleidung, die Gestaltung der Schlafstätten
von 5,8 m. Zwischen Wand und Dacheindeckung findet (empfundene Wärme), Mahlzeiten (Wärmeabgabe,
sich ein offener Spalt von ca. 25 cm. Holzverbrauch bei der Zubereitung).
Das Haus hat vier Fenster (ca. 68 x 65 cm), zwei auf Die Bewohner waren daher zeitgemäß in Leinen
der Ostseite und je eins in den Giebelseiten, die sich und Wolle gekleidet. Auch bei der Ausstattung der
mit Holzläden verschließen lassen. Die Holzläden wa- Schlafstätten wurde versucht, historischen Vorgaben
ren während der Versuchstage in der Regel geschlos- zu folgen. Eine Idee davon, wie die Ausstattung der
sen und die Spalten mit Schafwolle abgedichtet. Nur Schlafgelegenheiten in karolingischer Zeit ausgese-
das Südfenster in der Küche war tagsüber zeitweise hen hat, vermitteln verschiedene ikonographische
zur Beleuchtung einer Arbeitsfläche geöffnet. In den (Stuttgarter Psalter)7 und textliche Quellen (Capitulare
Giebeln finden sich auf jeder Seite dreieckige Öffnungen de villis)8. Als Auflagen von Bett und Sitzbänken wur-
unterhalb der Firste. Diese Giebellöcher (ca. 1 m breit, den verschiedene Lagen aus Stroh, Wolldecken und
1 m hoch) dienen als Rauchabzug und Sturmschutz. Schaffellen verwendet. Wolldecken oder ein mit
Das Haus hat drei Zugänge. Als Haupteingang dient die Leinen bezogenes Federbett dienten als Zudecke. Die
Tür (1,02 x 1,77 m) unter dem offenen Vorbau auf der Verpflegung orientierte sich an Gerichten (Getreidebreie
Ostseite. In der nördlichen und südlichen Giebelwand und Eintöpfe), die mit den im Frühmittelalter bekannten
findet sich jeweils ein weiterer Zugang (0,8 x 1,95 m). Nahrungspflanzen und Küchenutensilien hätten ge-
Der Fußboden ist ein Lehm-Trampelboden. kocht werden können9. Bei der Zubereitung interessier-
In Lauresham wird das Haus als „Wohn- und Küchen- ten weniger die Rezepte als mehr der Holzverbrauch,
haus“ für den Herrenhof angesehen. Im südlichen Raum der für das Kochen gesondert ermittelt wurde. Es konn-
(2) befindet sich ein großer Herd mit Rauchfang. Der te jedoch nicht Ziel der Versuche sein, karolingisches
nördliche Raum (1) dient als Schlaf- und Wohnraum Leben auf einem Herrenhof in seiner ganzen Vielfalt
(Abb. 2). Hier befindet sich in der Mitte eine bodennahe nachzubilden.
Feuerstelle. Die eine Hälfte des Raumes über dem Feuer
ist bis zum Reetdach offen, die andere in 2 m Höhe mit
einem Zwischenboden gedeckt. Umlaufend an den
Wänden erstrecken sich breite Bettbänke (50 cm über
dem Boden). Die beiden Räume sind durch eine Wand
getrennt und mit einer Tür verbunden.
Heizquelle und Kochstelle
5 Brevium exempla, Inventar des Königshofs Annappes:
Zum Heizen und Kochen wurden die beiden offenen Feuerbock (andedam) 254.
Feuerstellen des Hauses benutzt. Der Holzverbrauch 6 Capitulare de Villis, Kapitel 42, Inventar der
wurde für jeden Raum zeitgenau notiert (Anzahl der Lagerräume: Feuerböcke (andedos) 61
Scheite, Gewicht, Holzfeuchtigkeit). Die Größe der 7 Stuttgarter Psalter fol. 72v: Bett mit Kissen,
Scheite wurde mit einem Lochbrett (5; 7,5; 10 cm Matratze und Zudecke: http://digital.wlb-stuttgart.
Durchmesser) festgehalten. Das Feuer sollte möglichst de/sammlungen/sammlungsliste/
rauchfrei betrieben werden. Daher wurde nur trocke- werksansicht/?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=1343&tx_
nes Holz von Laubbäumen verwendet. Des Weiteren dlf%5Bpage%5D=148 (letzter Zugriff 09.03.2019)
kamen eiserne Feuerböcke zum Einsatz. Feuerböcke 8 Capitulare de Villis, Kapitel 42, Inventar der
Lagerräume: Bettdecken (lectariam), Matratzen
waren in der Karolingerzeit ein durchaus bekann-
(culcitas), Federkissen (plumatias), Betttücher
(batlinias), […], und Bankkissen (bancales) 60f.
4 Meier 2008 (unveröffentlicht). 9 Gross 1996, 668 - 671, Rösch 1997, 323-330.
Laureshamensia 02 | 2019 31Standort Höhe Distanz zum Feuer Kommentar
Küche 80 cm 3,0 m Tisch an der Westwand
Schlafbank 80 cm 2,5 m Über der Schlafbank an der Ostwand
Zwischenboden 400 cm 3,0 m Über Raum 1
Tisch 80 cm 2,5 m Raum 1, unterhalb des Zwischenbodens
Boden 5 cm 4,0 m Auf Holzbalken im Durchgang zur Küche
Draußen 138 cm - Unter dem Vordach
Tabelle 1 Standorte für die Messungen des Innenraumklimas (TFA Nexus, mit Datenspeicherung alle 30 min).
Messparameter Messgeräte (außen)
Niederschläge Regenmesser (+/- 0,2 mm) (1m Höhe)
Sonneneinstrahlung Solar Radiation Sensor (1m Höhe)
Temperatur/Luftfeuchte Temperatursensor (+/- 0,5 °C) und Feuchtigkeitssensor (+/- 3%), (1m Höhe) (aktiv belüfteter
Strahlenschutz)
Windrichtung/-stärke Windrichtungs- und Geschwindigkeitssensor (+/- 3 km/h), (6 m Höhe)
Luftdruck Basisstation (+/- 1,7 hPa)
Tabelle 2 Messungen der lokalen Wetterbedingungen (ca. 65 m Luftlinie zum Haus) (Davis Vantage Pro II,
mit Datenspeicherung alle 60 min).
Messungen Innenraumklima und Wetterbedingungen Ergebnisse
Im Rahmen des Projekts sollte das Raumklima in ei-
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im unbeheizten Haus
nem bewohnten frühmittelalterlichen Haus erfasst
werden. Faktoren, die das Raumklima beeinflussen, In den Zeiten, in denen das Haus nicht beheizt wird,
sind die Luft- und Oberflächentemperaturen (Wände, ist das Raumklima weitgehend identisch mit den
Möbel), die Luftfeuchtigkeit, die Luftzusammensetzung herrschenden Außenbedingungen. Die über Tag
und die Lichtverhältnisse im Raum. Das Haus ist seit und Nacht gemittelten Unterschiede von Innen- und
Sommer 2017 mit Sensoren ausgestattet, die an ver- Außentemperatur betragen sowohl im Sommer als auch
schiedenen Stellen kontinuierlich die Temperatur und im Winter weniger als ±1,5°C. Auch die Unterschiede der
Luftfeuchtigkeit messen (Tab. 1). Als Referenz für die Luftfeuchtigkeit fallen mit ±5% gering aus.
Außenbedingungen ist ein weiterer Sensor außen un- Bei den täglichen Temperaturschwankungen spürt
ter dem Vorbau angebracht. Die lange und kontinuier- man allerdings die ausgleichende Wirkung des
liche Laufzeit der Messanlage ermöglicht Vergleiche Gebäudekörpers. Die Innenwerte folgen den
zwischen bewohnten und unbewohnten Situationen zu Außenwerten verzögert und deutlich abgeschwächt. So
verschiedenen Jahreszeiten. ist es im Haus tagsüber (Sommer bis zu 4°C, Winter bis
Während der Wohnexperimente wurden zu ver- zu 2°C) kühler. Nachts hält das Haus die tagsüber gespei-
schiedenen Tageszeiten die Lichtverhältnisse cherte Wärme, sodass die Nachttemperaturen im Haus
(Beleuchtungsstärke) mit einem Luxmeter (PeakTech (ca. + 1°C) über den Außentemperaturen liegen. Eine
ähnlich dämpfende Wirkung des Gebäudes stellt man
5165) gemessen. Messungen der Kohlenmonoxid-
bei der Luftfeuchtigkeit fest.
Konzentrationen waren während der Versuchstage
im Januar 2018 und 2019 mit einem Gasmessgerät Für die Sommerverhältnisse sind hier die Bedingungen
(GfG Microtector II G460) möglich. Daneben stand einer Juniwoche (2. – 8.6.2018) dargestellt (Abb. 3). Die
eine Wärmebildkamera (InfraTec VarioCAM) zur Außentemperaturen lagen im Mittel zwischen 28°C am
Verfügung um die Temperaturverteilung auf Flächen Tag und 19°C in der Nacht. Im Haus war es mit 25°C
und Gegenständen sichtbar zu machen. Im Gegenlicht tagsüber etwas kühler und nachts mit 20°C nur wenig
eines 400 Watt Halogenstrahlers konnte nachts die wärmer (Tischhöhe). Die Werte auf dem Zwischenboden
Rauchfahne des Hauses und der Rauchabzug foto- zeigen die höchste Temperaturschwankung; durch die
grafisch dokumentiert werden. Seit Sommer 2017 isolierende Wirkung des Reetdaches bleiben sie aber
betreibt das Freilichtlabor auch eine automatische immer unter den Außenwerten. Die Temperaturen
Wetterstation (Davis Vantage Pro 2), die die lokalen auf Bodenhöhe zeigen aufgrund der ausgleichen-
Wetterbedingungen aufzeichnet (Tab.2). den Wirkung des Lehmbodens die niedrigsten
32 Laureshamensia 02 | 2019Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern
Ϯϵ͕Ϭ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌΣ
Ϯϳ͕Ϭ
Ϯϱ͕Ϭ
Ϯϯ͕Ϭ
Ϯϭ͕Ϭ
ϭϵ͕Ϭ
ϭϳ͕Ϭ
ƵĨƚĨĞƵĐŚƚŝŐŬĞŝƚй
ϴϱ͕Ϭ
ϴϬ͕Ϭ
ϳϱ͕Ϭ
ϳϬ͕Ϭ
ϲϱ͕Ϭ
ϲϬ͕Ϭ
ϱϱ͕Ϭ
ϱϬ͕Ϭ
ϰϱ͕ϬSchwankungen. Messstellen in Bank- und Tischhöhe sich, dass es innerhalb der Palisade in Lauresham etwas
(Küche, Wohnraum) oder an der Außenwand und in wärmer ist. Der Februar 2018 war mit 0,4°C in Lauresham
der Raummitte zeigen zueinander wenig Unterschiede. kälter als im Mittel und sorgte in seinen letzten Tagen für
Der Unterschied zwischen Boden und Bettbank zeigt Kälterekorde11 (-10,5°C am 28.2. in Lauresham). Während
aber den Vorteil einer erhöhten und damit wärmeren der Versuchstage (14. – 18.2.) war das Wetter wechsel-
Schlafstätte. Die Sonneneinstrahlung auf das Gebäude haft. Die Temperaturen lagen unter dem Vordach des
erwärmt tagsüber zuerst die Ostwand, am Nachmittag Hauses bei 3,5°C (-3.1 – 9.8°C). Die geschützte Lage in-
die Westwand. Bereiche in der Raummitte (Tisch) blei- nerhalb der Palisade sorgte wiederum für etwas gemä-
ben etwas kühler. ßigte Bedingungen. Auf dem freien Feld lag die tiefste
Die Luftfeuchtigkeit lag in der Woche außen zwischen Temperatur bei -5,6°C. Der Januar 2019 war nieder-
52% und 79% (Abb. 4). Die inhäusigen Werte machen schlagsreich und kalt (bis - 8°C). An den Versuchstagen
den Verlauf des Referenzsensors unter dem Vordach (25. – 27.1.) lagen die Außentemperaturen vor dem Haus
zeitversetzt mit, ohne dessen Extreme zu erreichen. Es bei durchschnittlich 3,5°C (-2,3 – 9,2°C) im Vergleich zu
bleibt zu den Zeiten der Wärmemaxima am Nachmittag 2,3°C (-3,2 – 7,9°C) außerhalb der Palisade. Allgemein
im Haus etwas feuchter (und kühler). Auffällig ist die lässt sich folgern, dass der Raum innerhalb der Palisade
stark ausgleichende Wirkung des Lehmbodens. ein etwas milderes Mikroklima bietet.
Die sommerlichen Bedingungen im Haus sind auch für Raumklima im Winter
moderne Menschen durchaus als wohnlich zu bezeich- An den Versuchstagen brannte in der Küche tagsüber
nen. Die ausgleichende Wirkung des Gebäudes wird an durchgängig ein kleines Feuer, das zum Kochen weiter
heißen Tagen als angenehm kühl, in kühleren Nächten angefacht wurde. Im Wohnraum wurde ein Feuer zum
als warm empfunden. Heizen in der Regel um 7:00 Uhr entfacht und bis etwa
22:30 Uhr unterhalten. Im Januar 2018 wurde das Feuer
Heizperiode
durchgängig über die Nacht geführt.
Anhand der seit Sommer 2017 aufgenommenen
Wetterbedingungen in Lauresham lässt sich abschätzen, Für moderne Gebäude gilt eine Luftfeuchtigkeit von
wann sich die Notwendigkeit ergibt, das Gebäude zu be- 40-60% und eine Raumtemperatur von 18-23°C als
heizen. Im Jahresverlauf wäre etwa ab Mitte September, ein gutes Raumklima. Diese Werte ließen sich im un-
wenn die Temperaturen im Haus unter 20°C fallen, tersuchten Haus nicht erreichen. Die Feuer haben in
für heutige Menschen die Zeit gekommen zu heizen. allen Versuchsperioden zwar den Innenraum erwärmt
Raumtemperaturen um 20°C waren für die Menschen (Abb. 5, Tab. 3), die mittlere Temperaturerhöhung im
des Frühmittelalters wahrscheinlich nicht üblich, man Wohnbereich ist aber mit durchschnittlich +3,7°C ge-
kann aber davon ausgehen, dass bei weiterem Absinken genüber dem Außenbereich gering. Wetteränderungen
der Temperaturen im Laufe des Oktobers, wenn die sind im Haus direkt zu spüren. Während einer Belebung
Temperaturen regelmäßig unter 10°C fallen, auch für die des Museums im März (Saisonstart 2018) fiel die
Menschen der Karolingerzeit der Punkt gekommen war, Temperatur während eines Kälteeinbruchs um 10°C. Das
an dem man ein Feuer zum Heizen entzündet hat. Feuer konnte diesen Temperatursturz im Haus nicht auf-
fangen (Abb. 5).
Unter dieser Annahme ergibt sich für den Winter
2017/18 eine Heizperiode von etwa Oktober bis März. Damit unterscheiden sich die Messungen in Lauresham
Erst im April lagen in Lauresham die Temperaturen wie- nicht von anderen ähnlichen Versuchen in historischen
der deutlich über 10°C. Verglichen mit den aktuellen kli- Gebäuden. Temperaturen in Häusern, die mit offenen
matischen Bedingungen lagen die Temperaturen in der Feuern beheizt werden, sind generell niedrig und liegen
karolingischen Periode vermutlich unter den heutigen in der Regel im Innenbereich nur wenige Grad (4 – 10 °C)
Durchschnittswerten10. Somit war die Anzahl der Tage über den Außenwerten12.
mit einer Temperatur unter 10°C wahrscheinlich etwas Als Beispiel für die Winterbedingungen werden die Werte
höher als heute. aus dem Februar 2018 (14. – 18.2.) (Abb. 6, 7) und Januar
2019 (25. – 27.1.) dargestellt (Tab. 3). Vergleicht man die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im beheizten Haus
einzelnen Messstandorte, so sieht man, dass die Werte
Wetterbedingungen an den Versuchstagen im beheizten Haus an fast allen Messpunkten über den
Der Winter 2017/18 war mit einer Durchschnitts- Außenwerten liegen (Abb. 6). Die Temperatur variiert mit
temperatur von 3,6°C in Lorsch vergleichsweise mild. der Größe des Feuers und der Aktivität der Bewohner. Die
Auf einen trüben Dezember folgte ein nasser Januar höchste Erwärmung des Innenraums findet man abends
mit durchschnittlich 6,4°C in Lauresham. An den zu einer Zeit, wenn die Türen geschlossen waren und die
Versuchstagen (19. – 21.1.) lagen die Außentemperaturen Bewohner um das Feuer saßen (Tab. 3).
unter dem Vordach des Hauses bei durchschnittlich 4,3°C
(3,2 – 5,8°C). Vergleicht man diese Werte mit denen der
Wetterstation auf dem Feld (niedrigster Wert 0,7°C), zeigt 11 https://de.climate-data.org/europa/deutschland/
hessen/lorsch-23224/ (Letzter Zugriff : 27.2.2019)
12 Beck u.a. 2007, 143, Kaiser 2008, 36, Christensen/Ryhl-
10 Moberg u.a. 2005, 613. Svendsen 2015, 333, Zimmermann 2015, 23.
34 Laureshamensia 02 | 2019Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern
Zeitraum Differenz zu außen Kommentar
0-8 Uhr + 1,4°C Feuer aus, Türen und Fenster geschlossen, Bewohner schlafen
8-16 Uhr + 3,6°C Hohe Aktivität der Bewohner, Türen oft geöffnet
16-24 Uhr + 5,2°C Geringe Aktivität, Bewohner sitzen am Feuer, Türen geschlossen
Tabelle 3 Mittlere Differenz der Raumtemperatur zur Außentemperatur unter dem Vordach während des Raumklimaexperiments
im Januar 2019 im bewohnten „Haus der Hörigen I“.
Ϯϱ͕Ϭ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŝŶΣ
ZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŝŶŵŽĚĞƌŶĞŶ ,ćƵƐĞƌŶ͗ϭϴͲ ϮϯΣ
ϮϬ͕Ϭ
>ĂƵƌĞƐŚĂŵŝŵtŝŶƚĞƌ ZĂƵŵŬůŝŵĂǁŽĐŚĞϮϬϭϴ ^ĂŝƐŽŶƐƚĂƌƚϮϬϭϴ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶnjnjƵĂƵƘĞŶ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶnjnjƵĂƵƘĞŶ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶnjnjƵĂƵƘĞŶ
ϯ͕ϱΣ ϯ͕ϯΣ ϰ͕ϰΣ
ϭϱ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ
ϱ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
ƵƘĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
/ŶŶĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
ͲϭϬ͕Ϭ
ϭϱͲϭ ϮϮͲϭ ϮϵͲϭ ϱͲϮ ϭϮͲϮ ϭϵͲϮ ϮϲͲϮ ϱͲϯ ϭϮͲϯ ϭϵͲϯ ϮϲͲϯ
ĂƚƵŵϮϬϭϴ
Abb. 5 Außentemperaturen (blau) Januar bis März und Innentemperatur (rot) im bewohnten „Haus der Hörigen I“.
Die Wärmewirkung des Feuers ist sehr ungleichmä- Stunde13. Dagegen gilt als Faustregel für heutige Bauten
ßig im Haus verteilt (Abb. 6). Die heiße Luft über dem eine Luftwechselrate von 0,5 bis 1 als erstrebenswert14.
Feuer steigt auf und sammelt sich unter dem Dach.
Der Bereich um den Tisch mitten im Wohnraum ist
Daher werden auf dem Zwischenboden die höchs-
tagsüber etwas wärmer als die wandnahen Bettbänke.
ten Temperaturen gemessen (10-12°C), während die
Diese sind aber immer um 1 – 2°C wärmer als der
Temperatur im Wohnbereich zwischen 6 und 9°C
Boden und damit als Schlafplatz besser geeignet. Das
schwankte. Auf dem Zwischenboden ist auch die
Winterexperiment bestätigt, dass eine 10 – 15 cm dicke
höchste Temperaturschwankung zu finden. Deutlich
Strohmatratze und mehrere Wolldecken, bzw. ein einfa-
sind die Zeiten der Nahrungszubereitung zu erkennen,
ches leinenbezogenes Federbett ausreichen, um selbst
wenn in der Küche ein weiteres Feuer betrieben wurde.
bei Nachttemperaturen von -1°C (neben dem Bett)
Die Temperatur unter dem Dach fällt dagegen rasch,
gut zu übernachten. Die erhöhte Nachttemperatur auf
wenn das Feuer erlischt. Dies ist ein Hinweis darauf,
der Schlafbank in Abb. 6 ist auf die Wärmeabgabe der
wie zugig das Haus gerade im Dachbereich ist. Die
Personen zurückzuführen, die direkt unter dem Sensor
Giebelöffnungen sorgen für eine hohe Luftwechselrate.
geschlafen haben.
Untersuchungen in Dänemark an ähnlichen, wikinger-
zeitlichen Häusern ergaben 10 – 13 Luftwechsel pro
13 Christensen/ Ryhl-Svendsen 2015, 335.
14 Eine Luftwechselrate von 1 bedeutet, dass die Luft ein
Mal pro Stunde komplett ausgetauscht wird.
Laureshamensia 02 | 2019 35ϭϰ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌΣ
ϭϮ
ϭϬ
ϴ
ϲ
ϰ
Ϯ
ƵĨƚĨĞƵĐŚƚŝŐĞŬŝƚй
ϴϱ
ϴϬ
ϳϱ
ϳϬ
ϲϱ
ϲϬ
ϱϱRaumklima in frühmittelalterlichen Häusern
a b
Abb. 8 Wirkung der Wärmestrahlung in Abhängigkeit der Entfernung zum Feuer. (Holzklötze mit Abstand a: 25 cm, b: 50 cm).
Im Bild b wurde die Empfindlichkeit der Kamera erhöht (Farbskala: warm zu kalt - weiß, rot, gelb, grün, blau).
a b c
Abb. 9 Die thermische Umgebung wird von der direkten Strahlungswärme des Feuers beherrscht, wurde aber im Allgemeinen
von den Bewohnern als akzeptabel eingestuft (Farbskala warm zu kalt: weiß, rot, gelb, grün, blau).
Die Luftfeuchtigkeit lag in der Winterwoche außen Die Wirkung der Wärmestrahlung nimmt aber mit
bei 80%. Die Werte im beheizten Haus lagen im Mittel zunehmender Entfernung zur Quelle rasch ab15.
nur etwa 8-10% darunter (Abb. 7). Die ausgleichen- Mit der Wärmebildkamera ließ sich die Wirkung der
de Wirkung des Lehmbodens bei der bodennahen Wärmestrahlung in Abhängigkeit der Entfernung zum
Messstelle ist auffällig. Feuer demonstrieren (Abb. 8). Man sieht, dass die re-
gistrierbare Wärmestrahlung nur etwa 1,5 – 2 m in den
Wärmestrahlung Raum hineinreicht. Um den bevorzugen Aufenthaltsort
Da das Haus gerade im Dachbereich sehr undicht ist der Bewohner zu dokumentieren, wurde morgens
(offener Spalt zwischen Wand und Dacheindeckung, die Position der vom Vorabend stehengelassenen
Rauchlöcher im Giebel), entweicht die vom Feuer er- Sitzgelegenheiten um den Feuerplatz vermessen. Die
wärmte Luft zu einem großen Teil im Dachbereich. meisten benutzen Hocker waren in einem Abstand von
Damit befördert sie auch den Rauch nach draußen. Da weniger als 1 m um die Feuerstelle zu finden.
die Konvektionswärme über die Rauchlöcher abge- Personen, die sich am Feuer aufhalten, nehmen die
führt wird, trägt sie nur sehr wenig zum Erwärmen des Wärme hauptsächlich über die direkte Wärmestrahlung
Raumes bei. war. Der subjektive Eindruck, dass die Wärme von vor-
Trotz der geringen Raumtemperaturen empfanden ne kommt, und der Rücken kalt bleibt, lässt sich mit der
die Teilnehmer die Temperaturen im Haus aber nicht Wärmebildkamera abbilden (Abb. 9).
als kalt und ungemütlich. Bewohner, die sich im Haus Das Wärmesignal der vorderen Körperhälfte (Abb. 9a)
aufhielten, bevorzugten allerdings die unmittelbare stammt von der Wirkung des Feuers. Am Rücken zeigt
Umgebung des Feuers. Ein offenes Feuer erzeugt einen sich die isolierende Wirkung des Wollmantels (Abb. 9b).
Teil (schätzungsweise 20%) seiner nutzbaren Energie in Im Vergleich mit dem Bild eines Mannes mit Wolltunika
Form von Strahlungswärme, von der der Raum um das aber ohne Mantel zeigt sich, dass ein Mantel aus Wolle
Feuer erwärmt wird. Wo die Strahlung auf Gegenstände sehr gut gegen den Wärmeverlust am Rücken hilft (Abb.
trifft, wird sie absorbiert und in Wärme umgewan- 9c). In karolingischen Bilderhandschriften (zum Beispiel
delt. Somit wird die Umgebung des Feuerplatzes Stuttgarter Psalter) ist der einfache Rechteckmantel
(Steinkreis, Mobiliar) erwärmt und sorgt für zusätzliche als wärmendes Kleidungsstück auch bei Personen in
Wärmeabstrahlung.
15 Die Leistungsdichte der Wärmestrahlung sinkt
quadratisch mit dem Abstand zur Strahlungsquelle.
Laureshamensia 02 | 2019 37Häusern zu sehen16. Unter den gegebenen raumklimati-
schen Verhältnissen, bei denen die Strahlungswärme die
hauptsächliche Wärmequelle ist, ist der Mantel auch im
Haus ein nützliches Kleidungsstück.
Lichtverhältnisse
Im Haus ist es bei geschlossenen Fensterläden und Türen
sehr dunkel. Ist der Himmel bedeckt (5460 – 12970 lx)17 ,
misst man im Haus nur etwa 0 – 5 lx. Die Lichtverhältnisse
entsprechen somit etwa dem natürlichen Dämmerlicht
(1–3 lx)18 oder einer Orientierungsbeleuchtung an
Arbeitsstätten (5 lx)19. Das durch die Rauchöffnungen
im Dach und durch die Lücke zwischen Dach und
Wand einfallende Licht reicht an trüben Tagen also ge-
rade aus, sich im Haus zu orientieren, kaum aber für an-
spruchsvollere Tätigkeiten. An einem sonnigen Wintertag
(76800 lx) ist es im Haus merklich heller, man misst aber
trotzdem nur maximal 24 lx im einfallenden Licht unter
den Rauchöffnungen.
Das Licht des Bodenfeuers verbessert die
Beleuchtungssituation im Raum; der Raum ist insgesamt Abb. 10 Arbeitsplatz in der Küche an einem sonnigen Tag.
heller. Durch den ungünstigen Winkel (Feuer am Boden)
und die entstehenden Schatten ist aber die einheitliche
Beleuchtung einer Arbeitsfläche (zum Beispiel ein Tisch)
nicht gegeben. Für feinere Handarbeiten muss man sich Feuer und Rauch:
in der unmittelbaren Nähe einer Beleuchtungsquelle Da der Großteil der erzeugten Wärme das Haus durch die
(Feuer, Kerze) aufhalten. Durch Kerzen auf dem Tisch er- Öffnungen im Dachbereich verlässt, ist die Heizleistung
reicht man je nach Anzahl und Standort etwa 13 lx bis eines offenen Feuers begrenzt. Ein im Inneren eines
40 lx (bei 4 – 6 Bienenwachskerzen oder Talglichtern). Hauses betriebenes Feuer benötigt diese Öffnungen
Obwohl die Helligkeitsunterschiede nicht besonders aber, um den Rauch abführen zu können. Problematisch
hoch sind, können bei dieser Beleuchtung schon ein- sind die im Raum verbleibenden Verbrennungsabgase.
fache, automatisch ablaufende Handarbeiten wie zum Sie belästigen die Bewohner nicht nur durch den Qualm,
Beispiel Spinnen durchgeführt werden. Die Augen pas- sondern sind in entsprechenden Konzentrationen ge-
sen sich der jeweiligen Lichtsituation an (Erweiterung sundheitsschädlich. Durch die geringe Brenntemperatur
der Pupillen, Empfindlichkeit der Lichtsinneszellen). und die nicht dosierbare Luftzufuhr sind die Emissionen
Zum Vergleich: 20 lx sind in etwa die Grenze, bei der eines offenen Holzfeuers höher als bei geschlossenen
Gesichtszüge von Menschen noch unterschieden werden Brennräumen 21.
können20. Bis 50 lx wirkt Licht gedimmt und gemütlich.
Erste, orientierende Messungen der Kohlenmonoxid-
In der Küche ergibt sich durch die Öffnung des Fensters Konzentration im Haus (stündliche Messungen in
nach Süden ein sehr gut beleuchteter Arbeitsplatz der Zeit, in der das Feuer betrieben wurde) zeigen,
am Fenster (Abb. 10). An einem sonnigen Tag misst dass der CO-Gehalt der Innenraumluft deutlich über
man hier 3800 lx auf der Tischoberfläche unter dem den Außenwerten (0 ppm) liegt, sobald ein Feuer im
geöffneten Fenster. Durch die Wärmestrahlung des Haus brennt. Im Wohnbereich (Raummitte, 2,5 m zum
Kochfeuers im Rücken ist die Küche dabei trotz niedriger Feuer) lagen die gemessenen Werte in der Regel um
Raumtemperaturen nicht kalt. 10–20 ppm (Mittelwert 15,2 ± 6,1 ppm), kurzzeitig aber
mit bis zu 31 ppm, in der Höhe des derzeit geltenden
Arbeitsplatzgrenzwertes22. Direkt am Feuer (Abstand
1 m) war man mit im Mittel 21,5 ± 13,7 ppm einer
16 Stuttgarter Psalter fol. 79v: http://digital.wlb-stuttgart. höheren CO-Konzentration ausgesetzt. Auf dem
de/sammlungen/sammlungsliste/ Zwischenboden lagen die Werte noch deutlich höher
werksansicht/?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=1343&tx_
(Mittelwert 31,5 ± 17,3 ppm, Spitzenwerte bis 71 ppm).
dlf%5Bpage%5D=164 (letzter Zugriff 09.03.2019)
Der kurzfristige WHO-Leitwert zur Vermeidung von
17 Zum Vergleich: Die Beleuchtungsstärke des
natürlichen Lichtes unter freiem Himmel variiert
nach Witterung, Tages- und Jahreszeit zwischen
3.000 lx (trüber Wintertag) und > 100.000 lx (direktes 21 Naeher u.a. 2007.
Sonnenlicht), Seidelmann 1992, 490 ff. 22 TRGS 900. Arbeitsplatzgrenzwert Kohlenstoffmonoxid
18 Seidelmann 1992, 490 ff. 30 ml/m3 (ppm) = max. Konzentration eines Stoffes,
19 DIN EN 12464-1 bis zu dem die Gesundheit exponierter Arbeitnehmer
20 Ganslandt / Hofmann 1992, 75. nicht beeinträchtigt wird.
38 Laureshamensia 02 | 2019Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern
Abb. 11 Der Weg des Rauches aus dem Haus (Blick aus Nordwesten). Der Rauch ist gegen den dunklen Nachthimmel im
Gegenlicht des Scheinwerfers sichtbar.
Gesundheitsschäden von 100 mg/m³ (81,1 ppm)23 für Das verwendete Holz war bis auf wenige Ausnahmen
einen Zeitraum von 15 Minuten wurde bei den bishe- trocken (Holzfeuchtigkeit < 15%). Scheite mit einer
rigen Messungen an keinem Messort überschritten. Feuchtigkeit von 15 – 20% wurden vor dem Verbrennen
Dass die CO-Werte im Haus nicht noch höhere Werte er- am Feuer nachgetrocknet. Um ein schwelendes Feuer
reichen, liegt mit darin begründet, dass das Haus nicht zu verhindern, wurden weiterhin nur Holzstücke kleiner
winddicht und insgesamt sehr zugig ist. Langfristige bis mittlerer Größe (Durchmesser < 7,5 cm) verwendet.
Messungen sind aber nötig, um die Schadstoffbelastung Die Feuerböcke sorgten für einen größeren Abstand
und gesundheitlichen Risiken beim Wohnen im Haus be- des Holzes zur Glut und damit für eine verbesserte
werten zu können. Es ist zu vermuten, dass zum Beispiel Sauerstoffzufuhr und einen effizienteren Abbrand. Trotz
Personen beim Kochen höheren CO-Konzentration aus- dieser Bemühungen war die Rauchbelastung im Haus
gesetzt sind. während der Versuchstage sehr unterschiedlich.
Während der Versuchstage sollten die Feuer möglichst Eine rauchfreie Atmosphäre war zu keiner Zeit zu er-
raucharm betrieben werden. Dass auch frühmittelal- reichen. Der aufsteigende Rauch sammelt sich in ei-
terliche Menschen auf ein raucharmes Feuer Wert ge- ner Schicht unter dem Dach. Diese ragt unterschied-
legt haben, ist nicht unwahrscheinlich. Unabhängig lich tief in den Raum darunter. Oft war es allerdings
von den langfristigen gesundheitlichen Konsequenzen so raucharm, dass der Rauch kaum unangenehm auf-
wie Atemwegserkrankungen, sorgt ein qualmendes fiel. Verglichen mit früheren, sehr verrauchten, Tagen
Feuer auch akut für Unwohlsein (brennende Augen, scheint der Einsatz der Feuerböcke die Rauchsituation
Kopfschmerzen). Insofern kann man vermuten, dass insgesamt spürbar verbessert zu haben. Zu manchen
man Entdeckungen, die die Rauchsituation im Haus ver- Zeiten stand der Rauch aber dennoch tief und unange-
bessert haben, tradiert hat. nehm im Raum. Und damit stellt sich die Frage, was den
Rauchabzug zu diesen Zeiten behindert hat.
23 WHO 2010, 86 – 87.
Laureshamensia 02 | 2019 39Rauchabzug
Im Gegenlicht eines Scheinwerfers konnte beobachtet
werden, dass der meiste Rauch durch beide Giebellöcher
des Hauses herausströmte. Nur ein geringer Teil ent-
weicht über die Fläche des Reetdachs (Abb. 11). Der unter
dem Dach stehende Rauch wird also durch die weitere
Wärmezufuhr von unten aus den Firstlöchern gedrückt.
Die Aufzeichnungen der Wetterstation ermöglichen
es, die Rauchsituation mit den jeweils herrschenden
Wetterbedingungen zu vergleichen. Es zeigt sich,
dass die Effektivität des Rauchabzugs stark von den
Wetterbedingungen abhängig ist. Bei leichtem Wind
(um 2 m/s) aus östlichen oder westlichen Richtungen,
der an den nach Norden oder Süden geöffneten Giebeln
entlang streicht, war die Rauchsituation im Haus generell
besser. An bedeckten Tagen mit Niederschlägen und fal-
lendem Luftdruck oder ungünstigen Windverhältnissen
war es dagegen schwieriger, einen raucharmen
Innenraum zu erhalten. Veränderungen am Feuer durch
zum Beispiel kleinere Holzscheite oder eine größere
Grundglut brachten nur kurzfristige Erfolge. Allein die
regelmäßige Feuerführung konnte hier Verbesserungen
bringen. Ein Anblasrohr (hohler Holunderast), wie es vor
den Blasebälgen verbreitet war24, leistet gute Dienste,
rauchende Holzteile wieder zu entflammen.
Querlüften verbesserte zwar die Rauchsituation, hat-
te aber eine deutlich reduzierte Raumtemperatur zur
Folge. Dadurch ergab sich ein Luftzug, der den Rauch
mitnahm, die Verbrennung anfachte, aber auch einen
erhöhten Funkenflug (Feuergefahr) verursachte.
Da die heiße, aufsteigende Luft den Rauch aus dem
Haus entfernt, ist die Menge der aufsteigenden Luft
und damit die Größe des Feuers ein für die Entfernung
des Rauchs wichtiger Faktor. Zukünftige Versuche sol-
len zeigen, ob ein größeres Feuer bei ungünstigen
Wetterbedingungen den Rauch effektiver aus dem
Haus befördern kann.
Böige Winde aus nördlichen und südlichen Richtungen
blasen direkt in die nach Norden und Süden liegen-
den Rauchöffnungen und verhindern einen effektiven
Rauchabzug (Abb. 12). Die offenen Giebel lassen bei
ungünstigen Windrichtungen auch Niederschläge in
das Haus. Im März (Saisonstart 2018) kam zum Beispiel
bei Wind aus Nord bis Nordwest (5,5 m/s) Schnee durch
Abb. 12 Nördliches Giebelloch von innen (17.2., 13 Uhr). das nördliche Giebelloch, der die darunterliegende
Windböen (4–5 m/s) dringen durch das nördliche Firstloch Schlafgelegenheit unbenutzbar machte. Hier wäre es
und verursachen Turbulenzen, die den Rauchabzug aus eine praktikable Lösung, die Giebellöcher mit Klappen
dieser Öffnung stören. Unter diesen Bedingungen war die verschließbar zu machen, um bei ungünstigem Wind
Rauchsituation im Haus insgesamt schlecht. die Luke schließen zu können. Dies könnte auch die
Rauchsituation im Haus bei ungünstigem Wind positiv
beeinflussen.
24 Heute noch traditionell in den Alpen, im französischen
Zentralmassiv und in den Pyrenäen verwendet (als
Bouffadou, Bofador, boheta, canon bezeichnet).
40 Laureshamensia 02 | 2019Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern
Holzverbrauch beim Heizen und Kochen Infokasten: Hochrechnung des jährlichen Heiz-
Im Rahmen der Raumklima-Experimente wurde der Holzbedarfs
Holzverbrauch beim Heizen und Kochen ermittelt.
Während der Versuchstage im Januar 2018 wurde das
Die Datenlage zum Holzverbrauch ist aufgrund der kur-
Feuer durchgehend in der Nacht gehütet. Bei einer
zen Versuchsperioden derzeit noch sehr eingeschränkt
durchschnittlichen Holzmenge von 2,9 kg/h in dieser Zeit
und mit vielen Unsicherheiten behaftet. Weitere Ver-
ergibt sich ein Holzverbrauch von 69,9 kg in 24 Stunden.
suchstage, die für eine größere Datenbasis sorgen, sind
Während der Raumklimawoche im Februar 2018 wurde
deshalb sehr wünschenswert. Dennoch soll eine erste
kein Feuer in der Nacht unterhalten. Der Holzverbrauch
Hochrechnung gewagt werden, um aus den bisherigen
ist daher mit 45,3 kg pro Tag geringer. Die durchschnitt-
Daten auf einen ungefähren jährlichen Heiz-Holzbedarf
lich verbrauchte Holzmenge in den Stunden, in denen
für den Herrenhof zu schließen.
das Feuer brannte, lag mit 3,0 kg/h aber nicht höher als im
Januar. Während der Versuchstage im Januar 2019 wur- Für das Modell gehen wir davon aus, dass die Feuer zum
den durchschnittliche 3,3 kg/h aufgelegt. In dieser Zeit Heizen erst bei einer Temperatur von unter 10°C ange-
ergibt sich ein Holzverbrauch von 49,3 kg pro Tag. Damit zündet wurden und dass rund 45 kg Holz pro Tag ver-
liegt der Holzverbrauch in der Größenordnung ähnli- braucht werden. Setzt man eine Heizgrenztemperatur
cher Wohnexperimente in dänischen Freilichtmuseen. von 10°C an, kann man für die Region unter den heuti-
Bei diesen lag der Holzverbrauch mit 39 — 55 kg/Tag in gen klimatischen Verhältnissen von etwa 174 Heiztagen
wikingerzeitlichen Häusern und 74 kg/Tag in eisenzeit- ausgehen27.
lichen Häusern25. Wenn 174 Tage lang jeweils 45 kg Holz im Haus der
Dass der Holzverbrauch trotz der zum Teil kälteren Hörigen 1 verbrannt werden, werden nur zum Heizen
Temperaturen im Februar 2018 nicht höher lag als im ca. 7,8 t Brennholz benötigt. Geht man für den gesam-
Januar desselben Jahres, liegt zum Teil darin begrün- ten Herrenhof von 3 bis 4 derart beheizten Häusern aus,
det, dass es zwar kalt aber zeitweise sehr sonnig war. besteht insgesamt ein Holzbedarf von 23 bis 31 t für
Niedrige Temperaturen sind in zeitgenössischer Woll- eine winterliche Heizperiode.
und Leinenkleidung gut zu ertragen, wenn es sonnig Um sich diese Menge besser vorstellen zu können, wird
und windstill ist26. Ein wärmendes Feuer wird dann nicht das Gewicht in Raummeter (Würfel von 1 m Kantenlänge)
benötigt. Im Januar 2019 hat dagegen kaltes und nie- umgerechnet. Kaminholz mit einer Restfeuchte von 20%
derschlagreiches Wetter den höheren Holzverbrauch wiegt ca. 500 kg/rm28. Dabei sind Luftzwischenräume
bestimmt. Mit der abgeschätzten Heizperiode (s.o.) und zwischen den gespalteten, geschichteten Stämmen
dem täglichen Brennholzverbrauch kann man den jähr- oder Rundhölzern mitgerechnet. Damit entspricht
lichen Holzbedarf errechnen (siehe Infokasten). der jährliche Heiz-Holzbedarf für den Herrenhof ei-
Der tägliche Bedarf an Holz in der Küche zum Kochen lag nem Holzstoß von rund 48 bis 62 m Länge. Da man bei
im Januar 2018 bei 17,0 kg. Im Februar 2018 und Januar Brennholz wegen der benötigten Trocknungszeit etwa
2019 wurden zum Kochen zeitgenössischer Gerichte drei Jahre im Voraus planen muss, wären drei solcher
(wie Breie und Eintöpfe) und Erhitzen von Wasser für Holzstöße für den Herrenhof zu erwarten.
zum Beispiel Tee 14,2 kg bzw. 12,5 kg pro Tag benötigt Der Ochsenkarren, der in Lauresham zu besichtigen ist,
(bei 2-3 Kochzeiten pro Tag, 4 — 6 bzw. 2 — 4 Personen fasst etwa 1,5 rm. Bei einem jährlichen Heiz-Holzbedarf
pro Mahlzeit). Für die Zubereitung der Eintöpfe wur- für den Herrenhof von 48 bis 62 rm wären 32 - 41
den ca. 3 — 4 kg pro Mahlzeit benötigt. Hier ist klei- Ochsenkarrenladungen nötig, die man aus dem nahen
neres Holz (DurchmesserAbschließende Bemerkungen Der Mensch ist in der Lage, sich mit Hilfe von Kleidung,
Verhalten und entsprechenden Gebäuden an sehr un-
Vorstellungen über die Wohnbedingungen in mittelal-
terschiedliche Umgebungstemperaturen anpassen zu
terlichen Gebäuden haben oft den Unterschied zur heu-
können. Ein interessanter Aspekt dabei ist, wie sich der
tigen Wohnsituation im Blick. Verglichen mit Heute wird
Anteil der Wärmeisolation, der dem Faktor Kleidung
das Wohnen im Mittelalter als kalt, feucht und schmutzig
oder der Wohnsituation (Raumtemperatur) geschul-
empfunden. Dementsprechend zeigen Historienfilme
det ist, über die Zeit verändert hat. Während wir heu-
oft das Klischee verdreckter Menschen, die in zugi-
te den Großteil unseres thermischen Wohlbefindens
gen Hütten hausen. Aus heutiger Wohnperspektive
Mechanismen überlassen, die die Raumtemperatur
(mit innerhäuslichem T-Shirt-Wetter zu bezahlbaren
beeinflussen (Hausisolation), hat man sich in früheren
Heizkosten) ist diese Vorstellung sicher nachvollziehbar.
Zeiten vermutlich eher wärmer angezogen.
Bei der Erforschung historischer Lebensbedingungen ist
sie aber nicht zielführend. Menschen wärmen sich seit tausenden von Jahren
am offenen Feuer. Daraus kann man aber nicht schlie-
Historische Wohnsituationen zu simulieren ist ein
ßen, dass man Holzrauch gefahrlos einatmen kann.
Unterfangen, bei dem man von vorneherein weiß, dass
Holzscheite verbrennen wegen ihrer Struktur un-
man die realen historischen Bedingungen schwerlich
vollständig. Besonders an offenen Feuerstellen ent-
wird jemals erreichen können. Man sollte es daher als
stehen deshalb viele Schadstoffe. Neben harmlo-
einen Prozess verstehen, bei dem man sich schrittwei-
sen Verbrennungsprodukten wie Kohlendioxid und
se der realen Situation nähert. Die Erfahrungen, die
Wasser(dampf ), enthält der Holzrauch Feinstaub,
man dabei sammelt, liefern wertvolle Informationen.
Gifte wie Kohlenmonoxid und die krebserregenden
Diese kommen zum einen der didaktischen Arbeit des
Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe, die
Museums zugute, indem aktuelle Ergebnisse zu den lo-
an Rauchpartikeln kleben29. Das Leben in einer Hütte,
kalen Objekten ermittelt werden, zum anderen liefern sie
die mit einem offenen Feuer beheizt wurde, war also
praktische Erfahrungen mit den Rekonstruktionsbauten
nicht gesund! Schadstoffmessungen sollen in Zukunft
und Hinweise für die Interpretation neuer Funde.
zeigen, unter welchen gesundheitlichen Problemen die
Nach den winterlichen Wohnversuchen in Lauresham Bewohner dieser Häuser eventuell zu leiden hatten.
muss man sich einen karolingischen Herrenhof mit einer
nicht unerheblichen Holzbevorratung vorstellen. Eine Danksagungen
ungefähre Dimension lässt sich aus dem ersten Modell
erschließen. Neue Daten zum Holzverbrauch in ande- Ein großer Dank geht an alle Teilnehmer: Felix Backs,
ren Häusern oder zu einzelnen Tätigkeiten werden das Felix Böttcher, Birgit Diehl, Petra Koitzsch, Niels Mertens,
bisherige Modell verbessern. Aus dem sich ergebenden Lilly Schabacker, Patrick Scheurer, Gerald A. Terry und
Bild lassen sich weitere Vorstellungen dazu entwickeln, Ulrike Vendel und an den Leiter des Freilichtlabors
wieviel Arbeit und Ressourcen auf einem Hof allein in Lauresham Claus Kropp, der das Unterfangen möglich
die jährliche Versorgung mit Brennholz geflossen sind. gemacht hat. Die Wärmebildkamera wurde von der
Firma RIFCON GmbH (Hirschberg) zur Verfügung ge-
Die Untersuchungen testen auch Entscheidungen, stellt. Für das Gasmessgerät danken wir der Freiwilligen
die man während der Rekonstruktion getroffen hat. Feuerwehr Lorsch insb. Stadtbrandinspektor Franz-Josef
So gibt die Rauchentwicklung und das Eindringen Schumacher und Markus Stracke.
von Niederschlägen bei nördlichen und südliche
Windrichtungen Anlass zu der Überlegung, ob die
Giebelöffnungen für den Rauchabzug nicht mit Klappen
ausgestattet werden sollten. Die Abhängigkeit des
Rauchabzuges von den Windverhältnissen regt dazu an,
die Ausrichtung von Hausfunden anhand der vorherr-
schenden Windrichtung zu untersuchen. 29 Naeher u.a. 2007.
Quellen
Capitulare de Villes: http://www.mdz-nbn-resolving.de/
urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10552273-1
(Letzter Zugriff : 03.01.2019)
Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et
fiscales, in: MGH Capitularia regum Francorum Bd. 1, hg.
von Alfred Boretius (Hannover 1883).
42 Laureshamensia 02 | 2019Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern
Literatur Rösch 1997
Rösch, Manfred: Ackerbau und Ernährung. Pflanzenreste
Beck u.a. 2007
aus alamannischen Siedlungen. In: Archäologisches
Beck, Anna Severine / Christensen, Lehne Mailund /
Landesmuseum Baden-Württemberg (Hrsg.), Die
Ebsen, Jannie / Larsen, Rune Brandt / Larsen, Dyveke
/ Møller, Niels Algreen / Rasmussen, Tina / Sørensen, Alamannen (Stuttgart 1997) 323 - 330.
Lasse / Thofte, Leonora: Reconstruction – and then Seidelmann 1992
what? Climatic experiments in reconstructed Iron Seidelmann, P. Kenneth (Hrsg.): Explanatory Supplement
Age houses during winter. In: Rasmussen, Marianne to the Astronomical Almanac. University Science Books
(Hrsg.): Iron Age houses in flames. Testing house (Mill Valley 1992). https://archive.org/
reconstructions at Lejre. Studies in Technology and details/131123ExplanatorySupplementAstronomical
Culture, 3. (Lejre 2007), 134 – 173. Almanac/page/n259 (letzter Zugriff 09.03.2019)
Christensen/Ryhl-Svendsen 2015 Skov/ Fenger 2008
Christensen, Jannie Marie / Ryhl-Svendsen, Morten: Skov, Hendrik / Fenger, Jes: Air pollution from fireplaces
Household air pollution from wood burning in two – From the Iron Age to Modern Times. Probleme der
reconstructed houses from the Danish Viking Age. Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet Bd. 32
Indoor Air. 2015, vol 25, issue 3, 329 - 340. (2008), 27 - 32.
DIN EN 12464-1 TRGS 900
DIN EN 12464-1 „Beleuchtung von Arbeitsstätten – TRGS 900 (Technische Regel für Gefahrstoffe)
Arbeitsstätten in Innenräumen“ (August 2011) offizielle Arbeitsplatzgrenzwerte. BArBl. Heft 1/2006, 41 – 55.
DIN-Website. https://www.din.de/de. (letzter Zugriff :20. zuletzt geändert und ergänzt: GMBl 2018, 542-545 vom
Juli 2017). 07.06.2018 [Nr. 28] https://www.baua.de/DE/Angebote/
Ganslandt / Hofmann 1992 Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/
Ganslandt, Rüdiger / Hofmann, Harald: Handbuch der pdf/TRGS-900.pdf?__blob=publicationFile
Lichtplanung https://www.heinze.de/media/60189/ (Letzter Zugriff : 23.02.2019)
pdf/15230933px595x841.pdf (Letzter Zugriff: 15.01.2019) WHO 2010
Gross 1996 WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected
Gross, Uwe: Die Ernährung. In: Die Franken, Wegbereiter Pollutants: Carbon monoxide. World Health
Europas. (Vol. 2), Reiss-Museum Mannheim (Hrsg.) Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen,
(Mainz 1996), 668 – 671. 2010. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/
0009/128169/e94535.pdf (Letzter Zugriff : 23.02.2019)
Kaiser 2008
Kaiser, Hermann: Temperaturverhältnisse und Zimmermann 2015
Wärmehierarchie im Bauernhaus zwischen Weser und Zimmermann, Haio W.: Miszellen zu einer Archäologie
Ems. Probleme der Küstenforschung im südlichen des Wohnens. Archäologie in Niedersachsen 8 - 26,
Nordseegebiet Bd. 32, 2008, 33 – 43. (Oldenburg 2015) 166 - 169.
Meier 2008
Meier Thomas: Sozialstruktur und Wirtschaftsweise
Abbildungsrechte
im frühmittelalterlichen Südbayern. Das Beispiel VSG
der Siedlung Kelheim-Kanal I und Unterigling- (Abb. 2)
Loibachanger. Habilitationsschrift an der
Jens Schabacker
Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-
(Abb. 1, 8, 9,10,11,12 sowie alle Tabellen
Universität zu Kiel, 2008 (unveröffentlicht).
und Grafiken)
Moberg u.a. 2005
Moberg, Anders / Sonechkin, Dmitry M. / Holmgren,
Karin / Datsenko, Nina M. / Karlén, Wibjorn: Highly
variable Northern Hemisphere temperatures
reconstructed from low- and high-resolution proxy
data. Nature 433, 2005, 613.
Naeher u.a.2007
Naeher, Luke P. / Brauer, Michael / Lipsett, Michael /
Zelikoff, Judith T. / Simpson, Christopher D. / Koenig, Autoreninfo
Jane Q. / Smith, Kirk R.: Woodsmoke Health Effects: A Dr. Jens Schabacker
Review. Inhalation Toxicology. 19 (2007), 67 – 106. Gertrud von Sickingen Weg 2
Rasmussen 2001 74931 Lobbach
Rasmussen, Marianne: Experiments in Archaeology: E-Mail:
view from Lejre, an ”old” experimental centre. Zeitschrift jens.schabacker@online.de
für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte
2001, 58/1, 3 – 10.
Laureshamensia 02 | 2019 43Sie können auch lesen