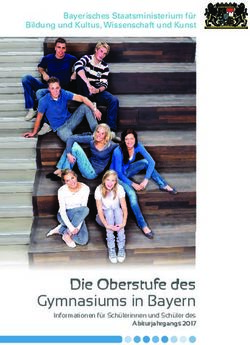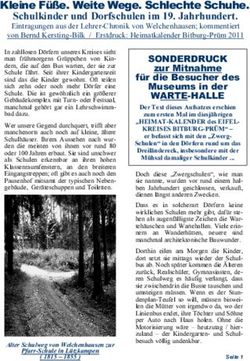Leitfaden Datenschutz - der Volksschule Appenzell Ausserrhoden
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Leitfaden Datenschutz der Volksschule Appenzell Ausserrhoden Bericht zur Schulqualität in den extern evaluierten Schulen 1
Impressum Departement Bildung und Kultur Amt für Volksschule und Sport Regierungsgebäude 9102 Herisau www.volksschule.ar.ch Verfasser Amt für Volksschule und Sport Abteilung Volksschule August 2019 Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 2
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung .................................................................................................................................................. 4
1.1. Zweck und Ziel .................................................................................................................................. 4
1.2. Adressaten ........................................................................................................................................ 4
2 Rechtliche Grundlagen zum Datenschutz ................................................................................................ 4
2.1 Allgemeingültige Grundsätze ............................................................................................................. 4
2.2 Bundesverfassung und eidgenössisches Datenschutzgesetz ........................................................... 5
2.3 Datenschutz-Grundverordnung .......................................................................................................... 5
2.4 Rechtliche Grundlagen Appenzell Ausserrhoden .............................................................................. 5
2.5 Grundlagen zur Datensicherheit an Schulen ..................................................................................... 5
3 Begrifflichkeiten ........................................................................................................................................ 5
4 Datenbeschaffung, -erstellung und -bearbeitung ..................................................................................... 7
5 Auskünfte und Datenweitergabe an Dritte ................................................................................................ 8
6 Datenaufbewahrung, Archivierung und Datenvernichtung ....................................................................... 9
7 Umgang mit Daten: Emails, Lehreroffice, Internet, Social Medias, Clouds etc. ..................................... 10
8 Abkürzungen .......................................................................................................................................... 13
9 Bibliographie ........................................................................................................................................... 14
9.1 Gesetzliche Grundlagen................................................................................................................... 14
9.2 Literatur ............................................................................................................................................ 14
Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 31 Einleitung 1.1. Zweck und Ziel Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, ist jede Schule darauf angewiesen, personenbezogene Daten von Lernenden, deren Eltern und dem Lehrpersonal zu bearbeiten. Nebst weniger sensiblen Daten wie bei- spielsweise Namen und Adressen werden in der Schule auch Daten bearbeitet, die gesetzlich als beson- ders schützenswert bezeichnet werden. Darunter fallen beispielsweise Angaben über die Religion, die Ge- sundheit oder fürsorgerische und vormundschaftliche Massnahmen (DSG AR Art. 2 Abs. 3). Technische Bearbeitungs- und Verbreitungsmittel wie Computer, Mobiltelefone und Internet ermöglichen eine einfache Datenerhebung und einen schnellen Datenaustausch. Dabei haben Schulen die geltenden Datenschutzbestimmungen zu beachten und umzusetzen und dem Grundrecht auf Datenschutz entspre- chend Rechnung zu tragen. Ziel dieses Leitfadens ist es, einen Überblick über die schulrelevanten Geset- zesgrundlagen zum Datenschutz sowie deren konkreten Umsetzungen im Schulalltag zu geben. 1.2. Adressaten Dieser Datenschutzleitfaden richtet sich an Lehrpersonen, Schulleitungen und Behördenmitglieder der Volksschulen in Appenzell Ausserrhoden. 2 Rechtliche Grundlagen zum Datenschutz 2.1 Allgemeingültige Grundsätze Es ist generell den allgemeinen Grundsätzen des Datenschutzes Rechnung zu tragen: dem Grundsatz der Rechtmässigkeit, dem Grundsatz von Treu und Glauben und Transparenz, dem Grundsatz der Verhältnis- mässigkeit der Datenbearbeitung, dem Zweckbindungsprinzip sowie auch dem Grundsatz der Datensicher- heit. Der Grundsatz der Rechtmässigkeit verlangt, dass jede Bearbeitung von Personendaten die geltende Rechtsordnung einhalten muss. Das Beschaffen von Daten ist rechtswidrig, wenn dabei gegen gesetzliche Bestimmungen, wie beispielsweise die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs (Herausgabe von Daten unter Drohung, Arglist oder Gewalt) verstossen wird. Der Grundsatz von Treu und Glauben oder der Transparenz verlangt unter anderem, dass die betroffene Person weiss oder erkennen kann, welche Daten beschafft werden und zu welchem Zweck. Das heimliche Beschaffen von Daten verstösst gegen diesen Grundsatz. Beispiel: Das Einholen von Auskünften bei Dritten (Referenzen) ohne das Wissen der potenziellen Arbeit- nehmenden widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit sieht vor, dass nur Daten beschafft und bearbeitet werden, die geeignet und objektiv gesehen erforderlich sind, um ein legitimes Ziel zu erreichen. Dabei müssen bei der Bearbeitung der Daten das verfolgte Ziel und die verwendeten Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zuei- nander stehen. Das Zweckbindungsprinzip schreibt vor, dass Daten nur zu dem Zweck bearbeitet werden dürfen, der bei deren Beschaffung angegeben wird, gesetzlich vorgesehen oder aus den Umständen ersichtlich ist. Die beschafften Daten müssen dazu geeignet sein den Zweck des gesetzlichen Auftrags zu erfüllen. Datensicherheit: Personendaten müssen mittels geeigneter organisatorischer und technischer Massnah- men vor jeder rechtswidrigen Bearbeitung geschützt werden. Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 4
2.2 Bundesverfassung und eidgenössisches Datenschutzgesetz
In der Schweizerischen Bundesverfassung steht, dass jede Person Anspruch auf Schutz vor Missbrauch
ihrer persönlichen Daten hat (BV; SR 101; Art. 13 Abs. 2). Dadurch erhält das Individuum das Recht, selbst
zu bestimmen, wer wann welche seiner persönlichen Daten zu welchem Zweck bearbeiten darf und wem
diese bekannt gegeben werden dürfen. Der Datenschutz schützt somit nicht die Daten an sich, sondern die
Persönlichkeitsrechte der Person.
Das eidgenössische Datenschutzgesetz (DSG; SR 235.1) regelt Datenschutzanliegen privater und juristi-
scher Personen. Wie die Bundesverfassung dient es als Grundlage.
2.3 Datenschutz-Grundverordnung
Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU ist seit dem 25. Mai 2018 in Kraft. Diese Ver-
ordnung findet unter ganz bestimmten Voraussetzungen Anwendung, z.B. sobald Personendaten durch
einen Auftragsbearbeitenden mit Sitz in der EU bearbeitet werden, kann die Verordnung angewendet wer-
den.
2.4 Rechtliche Grundlagen Appenzell Ausserrhoden
In Appenzell Ausserrhoden sind allgemein folgende rechtlichen Grundlagen für den Datenschutz an Schu-
len von Relevanz:
Gesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz; bGS 146.1; 18.06.2001).
Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz; bGS 411.0; 24.09.2000).
Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung (Schulverordnung bGS 411.1; 26.03.2001) und darin
insbesondere Art. 28 Berufsauftrag Abs. 4c: Bei der Erfüllung des Berufsauftrags sind alle Lehrenden
verpflichtet mit vertraulichen Informationen (Daten) nach den Regeln des Datenschutzrechts umzuge-
hen.
Verordnung über die Anstellung der Lehrenden an den Volksschulen (Anstellungsverordnung Volks-
schule; bGS 412.2; 02.06.2008) und darin insbesondere der Art. 42 Datenschutz und Datenbearbeitung
Abs. 1: Der Arbeitgeber bearbeitet Personendaten, soweit diese für Begründung, Durchführung und
Beendigung des Arbeitsverhältnisses notwendig sind. Das Datenschutzgesetz findet Anwendung.
Weisungen zur Art der Beurteilung der Lernenden (Weisungen zur Beurteilung gestützt auf Art. 23 Abs.
3 des Gesetzes über Schule und Bildung (bGS 411.0; 28.08.2001).
2.5 Grundlagen zur Datensicherheit an Schulen
Wichtig für die Volksschulen von Appenzell Ausserrhoden sind auch die folgenden Grundlagen:
LCH, Datensicherheit an Schulen, Trinationaler Leitfaden1
educa.ch, Schule, ICT und Datenschutz2
Konzept Medien und Informatik3
Jugend und Medien4
3 Begrifflichkeiten
Personendaten: Personendaten sind Angaben über eine bestimmte oder bestimmbare Person. Personen-
daten, die im Schulalltag eine Rolle spielen, sind beispielsweise Name, Adresse, Telefonnummer von Ler-
nenden, Erziehungsberechtigten oder Lehrpersonen, Noten und Bewertungen oder Angaben über Lehrbe-
fähigungen und Besoldungen von Lehrpersonen. Besonders schützenswerte Personendaten sind Daten
über religiöse, weltanschauliche oder politische Ansichten und Tätigkeiten, die Intimsphäre, die Gesundheit
oder die ethnische Zugehörigkeit sowie fürsorgerische, vormundschaftliche oder strafrechtliche Verfahren
1
https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Verlag_LCH/Leitfaden_Datensicherheit_Web_DEF.pdf
2
https://www.educa.ch/
3
https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung_Kultur/Amt_fuer_Volksschule/Medien_und_Informatik/Konzept_Medien_und_Informatik.pdf
4
Jugend und Medien https://www.jugendundmedien.ch/de.html
Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 5und Massnahmen (DSG AR; bGS 146.1; Art. 2 Abs. 3). Ein Persönlichkeitsprofil ist eine Zusammenstellung
von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt
(DSG AR; bGS 146.1; Art. 2 Abs. 4).
Datensammlung: Eine Datensammlung ist eine Sammlung von Personendaten (DSG AR; bGS 146.1; Art. 2
Abs. 6). Nicht ausdrücklich oder offensichtlich auf eine Person bezogene Informationen sind dann Perso-
nendaten, wenn indirekt (z.B. aufgrund der Umstände) auf die betroffene Person geschlossen werden kann.
Datensicherheit / Informationssicherheit: Die Aspekte „Zutrittsschutz“ (Schloss an der Tür), „Zugangs-
schutz“ (Passwort / Schlüssel), „Zugriffsschutz“ (Berechtigung, eine Datei öffnen zu dürfen) und die Trans-
portsicherheit (Verschlüsselung) definieren im Wesentlichen die Datensicherheit. Informationen müssen
durch die Schule mit angemessenen organisatorischen und technischen Massnahmen geschützt werden.
Es gilt die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Zurechenbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleis-
ten.
Datenschutz: Schutz der Persönlichkeit beinhaltet primär den Bezug auf den Umgang mit deren persönli-
chen beziehungsweise personenbezogenen Daten. Der Datenschutz regelt die Bearbeitung von Personen-
daten. Zweck des Datenschutzes ist jedoch nicht der Schutz der Daten, sondern der Schutz der Persön-
lichkeit und der Persönlichkeitsrechte der Person.
Zivilrechtliche Persönlichkeit und Persönlichkeitsrecht:
Persönlichkeitsrechte: Die Persönlichkeit umfasst alle Eigenschaften und Rechte, die der Person kraft
ihres Daseins zustehen. Verschiedene rechtliche Regelungen und Bestimmungen schützen die Per-
sönlichkeit vor ungerechtfertigten Verletzungen. Die Persönlichkeitsrechte gelten nicht absolut. Nach
Art. 28 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) sind Beschränkungen der Persön-
lichkeit rechtmässig, wenn der oder die Betroffene einwilligt (Beispiel: Piercing machen lassen), das öf-
fentliche oder private Interesse überwiegt (Beispiel: Medienbericht über Prominenten) oder eine gesetz-
liche Grundlage vorhanden ist (Beispiel: Schulpflicht).
Urteilsfähigkeit: Urteilsfähig ist, wer vernunftgemäss handeln kann (ZGB; SR 210 Art. 16). Bei Unmün-
digen ist die Urteilsfähigkeit immer in Bezug auf die entsprechende Rechthandlung und die konkrete
Person des Unmündigen zu beurteilen. Beispiel: Ein achtjähriges Kind kann hinsichtlich des Kaufs ei-
ner Glace im Schwimmbad durchaus urteilsfähig sein. Für den Kauf einer Liegenschaft wird die Urteils-
fähigkeit bei diesem Kind jedoch nicht gegeben sein. Im Sinne einer Faustregel sind im Allgemeinen
12 – 14 Jahre alte Kinder urteilsfähig.
Handlungsfähigkeit: Wer handlungsfähig ist, kann nach Art. 12 des ZGB durch seine Handlungen
Rechte und Pflichten eingehen (z.B. einen Vertrag abschliessen). Handlungsfähigkeit setzt Mündigkeit
(ab 18 Jahren) und Urteilsfähigkeit voraus (ZGB; SR 210 Art. 13). Unmündige können im Grundsatz
nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter Rechte und Pflichten begründen (ZGB; SR 210 Art.
19 Abs. 1). Eine Ausnahme besteht für unentgeltliche Vorteile (z.B. Entgegennahme einer Schenkung)
und die Ausübung höchstpersönlicher Rechte (z.B. Einwilligung in einen operativen Eingriff).
Einwilligung der betroffenen Person: Die Einwilligung der betroffenen Person ist ein Rechtfertigungs-
grund für eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Die Einwilligung der betroffenen Person stellt im
Zweifelsfall die einfachste Möglichkeit zur Beschaffung oder Herausgabe von Daten dar. Sofern die
Einwilligung höchstpersönliche Rechte betrifft, z.B. Veröffentlichung eines Bildes im Internet unter Na-
mensnennung, ist die Einwilligung bei urteilsfähigen Jugendlichen von diesen selber zu erteilen, in allen
anderen Fällen müssen die Erziehungsberechtigten einwilligen. Die Einwilligung der Betroffenen ist an
keine Form gebunden und kann auch mündlich oder stillschweigend erfolgen. In heiklen Fällen ist zu
empfehlen, dass sie schriftlich eingeholt wird. Ohne schriftlichen Beleg befindet sich eine Lehrperson
im Streitfall in einer ungemütlichen Lage, weil sie den Beweis der Einwilligung – wenn überhaupt – nur
schwer erbringen kann.
Amtsgeheimnis: Nach Art. 320 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) macht sich
eine Person strafbar, die ein Geheimnis offenbart, das ihr in ihrer Eigenschaft als Mitglied einer Behörde
Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 6oder als beamtete Person anvertraut worden ist oder das sie in ihrer amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat. Nach Art. 320 Ziff. 2 StGB ist die betroffene Person nicht strafbar, wenn sie das Ge- heimnis mit schriftlicher Einwilligung ihrer vorgesetzten Behörde offenbart hat. Lehrpersonen an öffentlichen Schulen gelten als Beamte im Sinne von Art. 320 StGB und unterstehen dem Amtsgeheimnis. Amtsge- heimnisse sind alle Tatsachen, von denen im Rahmen der Ausübung des Lehrberufes Kenntnis erlangt wird, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und an deren Geheimhaltung ein legitimes Geheimhaltungsinteresse und ein Geheimhaltungswillen bestehen. Bei Informationen über Lernende (Ver- halten, Lernfortschritte, schulische Leistungen usw.) ist grundsätzlich von einem Geheimhaltungsinteresse auszugehen. Für Personen, die dem Amtsgeheimnis unterstehen, gibt es in Appenzell Ausserrhoden im Gegensatz zu anderen Kantonen keine generelle Ermächtigung beispielsweise als Zeuge oder Zeugin vor der Jugendanwaltschaft auszusagen. Die betreffende Person muss bei der vorgesetzten Behörde (bei den Volksschulen ist dies die Schulbehörde, bei kantonalen Schulen das Departement Bildung und Kultur) eine Ermächtigung einholen. 4 Datenbeschaffung, -erstellung und -bearbeitung Die Beschaffung von Daten muss grundsätzlich für die betroffene Person erkennbar sein. Diese Anforde- rung muss nicht erfüllt sein, wenn die betroffene Person ihre Daten allgemein zugänglich gemacht hat oder die Erkennbarkeit die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe vereiteln würde (DSG AR; bGS 146.1; Art. 7 Abs 1 und Abs. 2 lit. a lit. b). In der Regel gilt, keine Daten auf Vorrat zu beschaffen. Checkliste 1 konkrete Anwendungen AR. Die Bearbeitung von Personendaten beinhaltet jeglichen Umgang mit Daten wie die Beschaffung, Aufbe- wahrung, Verwendung, Veränderung, Bekanntgabe oder Vernichtung (DSG AR; bGS 146.1; Art. 2 Abs. 5). Die Schule darf nur Personendaten bearbeiten, die sie für ihre gesetzliche Aufgabenerfüllung benötigt. Als Rechtsgrundlage dienen Gesetze, Verordnungen, Weisungen und Reglemente. Siehe Kapitel 2. Durch die Schulverwaltungssoftware Scolaris werden Daten von den Lernenden sowie ihren Erzie- hungsberechtigten, die auf dem Einwohneramt der Gemeinde hinterlegt wurden, den Schulsekretariaten der jeweiligen Gemeinden zugänglich gemacht. Klassenlehrpersonen erhalten vom Schulsekretariat das Klassenverzeichnis mit den nötigen administrativen Daten. Name, Adresse und Telefonnummer der Lernenden sowie der Lehrpersonen dürfen zusammengetra- gen werden. Die Liste darf unter den Aufgeführten zirkulieren. Sie dient dazu, um über wichtige Klassener- eignissen zu orientieren. Am Ende des Schuljahres ist die Liste von den Lehrpersonen zu löschen. Fotos von Lernenden dürfen nur mit ihrer Einwilligung oder derjenigen der Erziehungsberechtigten aufge- nommen und veröffentlicht werden. Es gilt das Recht am eigenen Bild. Empfehlung für Lehrpersonen: Auf einem Formular geben die Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung ab. Dieses Formular wird den Eltern am ersten Elternabend im Schuljahr vorgelegt. Siehe dazu auch Kapitel 7 „Umgang mit Daten“. Beurteilung von Lernenden: Zu den Aufgaben von Lehrpersonen gehört die Beurteilung von Lernenden. Beurteilt werden Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten sowie die Fachleistungen. Diese gesammelten Daten gehören in den Bereich der besonders schützenswerten Daten. Schulpsychologische Berichte: Der erstellte Bericht des Schulpsychologischen Dienstes zuhanden der Schulleitung, der zuständigen Lehrpersonen, weiteren involvierten Fachpersonen und der Eltern ist eine komprimierte Version der ausführlichen Informationen, die der Schulpsychologische Dienst erhoben hat. Diese Informationen gehören in den Bereich der besonders schützenswerten Daten. Im Bericht werden jene Informationen zusammenfassend dargestellt, die die Schule benötigt, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Die Massnahmen, die durch den Schulpsychologischen Dienst empfohlen werden, werden vorerst einzig der Fachstelle Sonderpädagogik mitgeteilt. Siehe auch Kapitel 5. Sonderpädagogische Massnahmen: Sonderpädagogische Massnahmen sind Fördermassnahmen für Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 7
Lernende mit besonderen Bedürfnissen. Diese Daten, welche in Lernberichten, Protokollen, in Dokumenten der schulischen Standortgespräche, schulpsychologischen Abklärungsberichten und in Berichten der För- derplanung erhoben, bearbeitet und bekannt gegeben werden, sind besonders schützenswert. Werden diese Informationen für die Aufgabenerfüllung an Schulorgane und Fachpersonen zur Umsetzung der Mas- snahmen weiter oder bekannt gegeben, ist darauf zu achten, dass dies nur die für die Aufgabenerfüllung geeigneten und erforderlichen Daten sind.5 Entscheide der Schulleitung: Die Schulleitung entscheidet über früheren oder späteren Schuleintritt, über Einsprachen, Klassenwiederholungen, Überspringen von Klassen, Klasseneinteilungen, Einteilung Sekun- darschule, besondere Förderung, Verweise usw. Dabei dürfen die für den Entscheid nötigen Daten erhoben werden. 5 Auskünfte und Datenweitergabe an Dritte Die Herausgabe von Daten ist dann zulässig, wenn ein gesetzlicher Rechtfertigungsgrund besteht, die Be- troffenen eingewilligt haben, ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder eine Ermächtigung der vorgesetzten Behörde besteht. Die ungerechtfertigte Herausgabe von Personendaten stellt eine Verletzung der Persönlichkeit und des Amtsgeheimnisses dar (vgl. Kap. 3). Herausgabe von Daten an Lernende und Erziehungsberechtigte: Die Betroffenen haben das Recht auf Information und Einsicht in die sie betreffenden Daten. Dies gilt auch für alle Informationen, welche für die Schülerbeurteilung gesammelt werden. Geschiedene oder getrennt lebende Elternteile, können bei Lehr- personen in gleicher Weise Auskünfte einholen wie der sorgeberechtigte Elternteil (ZGB Art. 275a), wenn keine behördliche Einschränkung vorliegt. Getrennt lebende Elternteile, die beide sorgeberechtigt sind, haben je Anspruch auf die Zustellung von Informationen, die ihr Kind betreffen und per Post verschickt werden. Bei Informationen, die den Lernenden mit nach Hause gegeben werden, beispielsweise Einladun- gen, Elternbriefe, Zeugnisse, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der andere Elternteil informiert wird. Bestehen jedoch konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Kommunikation zwischen den beiden Erziehungsberechtigten beeinträchtigt ist, müssen wichtige, über den Schulalltag hinausgehende, Informationen beiden zugestellt werden. Werden dem nicht sorgeberechtigten Elternteil Auskünfte erteilt, muss weder im Vor- noch im Nachhinein der sorgeberechtigte Elternteil informiert werden. Auch braucht es keine Zustimmung des sorgeberechtig- ten Elternteils. Erziehungsberechtigte haben das Recht, jederzeit die Daten ihres Kindes oder ihre eigenen einzusehen und können kostenlos Kopien der schriftlichen Unterlagen verlangen. Dazu gehören Prüfungen, verschie- dene Texte und andere Leistungsbewertungen oder Aufgabenstellungen. Datenbekanntgabe bei Übertritten, Klassen- oder Schulwechsel: Als Faustregel kann festgehalten werden, dass je grösser schulische und persönliche Probleme der/des betreffenden Lernenden sind, desto eher kann ein Austausch für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben notwendig werden. Datenaustausch mit Behörden: Im Verhältnis zu anderen Behörden gilt für die Schulen, dass diejenigen Daten ohne weiteres weitergegeben werden dürfen, welche die empfangende Behörde für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben benötigt (DSG AR; bGS 146.1; Art. 8 Abs. 1 lit. b). Daten, welche eine Behörde zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe nicht zwingend benötigt, dürfen nur dann weitergegeben werden, wenn ein anderer spezieller Rechtfertigungsgrund (konkrete Einwilligung der Betroffenen, überwiegendes öffentliches Interesse, Ermächtigung der vorgesetzten Behörde) vorliegt. Besonders schützenswerte Daten dürfen nur bekannt gegeben werden, wenn das verantwortliche Organ aufgrund einer klaren Rechtsgrund- lage dazu verpflichtet oder ermächtigt ist (DSG AR; bGS 146.1; Art. 8 Abs. 2 lit. a). Auskunft an Behörden: Lehrpersonen können von gemeindlichen und kantonalen Amtsstellen sowie Ge- 5 Für weitere Informationen siehe Fachbereich Sonderpädagogik: https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/abteilung- volksschule/sonderpaedagogik/ Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 8
richtsbehörden aufgefordert werden, Personendaten von Lernenden bekannt zu geben. Soweit eine Amts- stelle wie die KESB oder eine behördliche Dienststelle wie der SPD dazu einen gesetzlichen Auftrag hat und eine gesetzliche Grundlage für die Datenweitergabe besteht, müssen Lehrpersonen Auskunft erteilen. Umfang, Inhalt und Form richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. In Verfahren der Zivil- und Strafrechtspflege (Staatsanwaltschaft, kantonale Gerichte) können Akten oder Personendaten verlangt werden. In Appenzell Ausserrhoden müssen Lehrpersonen vorgängig eine schriftliche Einwilligung (Entbin- dung vom Amtsgeheimnis) von der Schulbehörde einholen. Informationen und Auskünfte an Lehrmeisterinnen und Lehrmeister: Für die Weitergabe von Informa- tionen der Oberstufenlehrpersonen an die potentiellen Lehrbetriebe besteht keine gesetzliche Grundlage. Das Amt für Volksschule und Sport empfiehlt zur Schaffung der nötigen Transparenz vorgängig sicherzu- stellen, dass die Lehrperson im Bewerbungsschreiben als Referenz angegeben wurde. Dies gilt umso mehr, wenn die erteilten Auskünfte nicht geeignet sind, dass die lernende Person die potenzielle Lehrstelle erhält. Zentrum für Schulpsychologie und therapeutische Dienste: Die Daten, welche an das Zentrum für Schulpsychologie und therapeutische Dienste (ZEPT) übermittelt werden, sind regelmässig besonders schützenswerte Personendaten. Für diese Kategorie von Daten gilt, dass sie Dritten nur weitergegeben werden dürfen, wenn die Empfängerin oder der Empfänger dazu ermächtigt ist oder aufgrund einer klaren Rechtsgrundlage eine Verpflichtung gegenüber der Empfängerin/dem Empfänger besteht oder die Daten im Einzelfall zur Erfüllung einer rechtlichen klar umschriebenen Aufgabe unentbehrlich sind (DSG AR; bGS 146.1; Art. 8 Abs. 1 lit. a). Die Schulgesetzgebung regelt, dass der Kanton für die Abklärung und Beratung bei Lernenden mit verstärkten Massnahmen im Bereich der Sonderschulung verantwortlich ist (vgl. Schul- gesetz; bGS 411.0; Art. 11a Abs. 1). Somit besteht eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Daten von Lernenden an die zuständigen Stellen. Zur Schaffung der nötigen Transparenz ist zu emp- fehlen, dass die Betroffenen vorgängig über den Informationsaustausch informiert und um das Einver- ständnis gebeten werden (bei Urteilsfähigkeit die Kinder oder Jugendlichen selber/ bei Urteilsunfähigkeit der Kinder oder Jugendlichen die Erziehungsberechtigten). Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehör- den erhalten die Informationen, welche für die Ausübung ihres Auftrages nötig sind. Wechselt ein Kind zu einem anderen Schulträger, ist dieser für eine adäquate Beschulung zuständig. Unter Umständen ist er auf Berichte angewiesen. Diesem Sachverhalt ist Rechnung zu tragen. Multiprofessioneller Pool: In SchARm (Schule Appenzell Ausserrhoden – miteinander) wird dargestellt, dass für eine optimale Förderung der Lernenden Ressourcen aus dem multiprofessionellen Pool eingesetzt werden können. Eine Lehrperson darf sämtliche Informationen weitergeben, welche für die Aufgabenerfül- lung der Fachperson aus dem multiprofessionellen Pool notwendig sind. Ebenso darf die Fachperson aus dem multiprofessionellen Pool die Lehrperson über Beobachtungen, Berichte etc. informieren, auf welche die Lehrperson zur Erfüllung ihrer Aufgabe angewiesen ist. 6 Datenaufbewahrung, Archivierung und Datenvernichtung Bei der Archivierung und der Vernichtung von Daten ist die Verordnung über das Archivwesen (bGS 421.11, abgekürzt ArchivV) zu beachten. Für die von den Gemeinden getragenen Schulen gelten die Vor- schriften über die Gemeindearchive (ArchivV; bGS 421.11; Art. 7 ff.), für die kantonalen Schulen die Best- immungen über das Kantonsarchiv (ArchivV; bGS 421.11; Art. 1 ff.). Für alle Archive gilt, dass Daten, wel- che zur Rechtssicherung oder aus historischen Gründen dauernd aufbewahrt werden müssen, nicht ver- nichtet werden dürfen. Eine Datenvernichtung kann erst nach einer Absprache mit dem zuständigen Archiv (bei den Volksschulen der Gemeinden mit der Gemeindearchivarin resp. dem Gemeindearchivar [i.d.R. Gemeindeschreiberin oder Gemeindeschreiber], bei den kantonalen Schulen mit der Staatsarchivarin resp. dem Staatsarchivar) erfolgen. Checkliste 2 Datenaufbewahrung und -vernichtung. Datenrückgabe an Lernende und Erziehungsberechtigte: Arbeiten der Lernenden, wie beispielsweise Schülerordner, Hefte, Arbeitsblätter oder Zeichnungen sowie Prüfungen, Lernkontrollen nach Ablauf allfälli- Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 9
ger Rechtsmittelfrist (Rekursfrist von 20 Tagen, siehe E-Handbuch Stichwort Rechtsmittelbelehrung6), Tests (Ausnahme Standardaufgaben), Orientierungsaufgaben und Selbsteinschätzungen müssen bei der Abgabe einer Klasse an die Lernenden zurückgegeben werden. An die Erziehungsberechtigten erfolgt die Rückga- be von Zeugnissen und Lernberichten. Diese Ausführungen gelten sowohl für Papierunterlagen als auch für elektronisch gespeicherte Daten. Datenvernichtung: Alle handschriftlichen Daten über Lernende (betrifft nicht die Einträge in LehrerOffice), die nicht abgegeben werden müssen, sollen, sofern sie eine Rechtsmittelfrist enthalten, nach Ablauf dieser vernichtet werden: papierene Daten per Aktenvernichter, elektronische Daten auf den Geräten. Für die Vernichtung von Daten über Lehrende gelten die gleichen Bestimmungen. Scheidet eine Lehrperson aus dem Schuldienst aus, müssen die betreffenden Unterlagen der Lehrperson zurückgegeben, zentral abge- legt oder vernichtet werden. Zeugnisse: Die einzelnen Leistungsbewertungen während des Semesters oder Schuljahres bilden eine Grundlage für das Zeugnis. Da diese Leistungsbewertungen durch die Erziehungsberechtigten allenfalls angefochten werden können, kommt ihnen eine Beweisfunktion zu. Lehrpersonen müssen deshalb die Grundlagen für die Leistungsbewertungen (Notizen, Bemerkungen usw.) aufbewahren, damit die Bewer- tung begründet werden kann. Eine definitive Rückgabe von relevanten Prüfungsunterlagen vor Zeugnisab- gabe an die Lernenden ist nicht zulässig. Ist das Zeugnis abgegeben und die Rekursfrist verstrichen, benö- tigen Lehrpersonen die einzelnen Leistungsbewertungen nicht mehr. Da diese in aller Regel nicht archiviert werden, können sie den Lernenden auf deren Verlangen zurückgegeben werden. Verzichten diese auf die Rücknahme, so sind die Unterlagen zu vernichten. Die in LehrerOffice erstellten Zeugnisdaten werden nach einem Zeugnislauf von den Applikations- Administratoren im pdf-Format in die Dokumentenverwaltung von Scolaris (Schulverwaltungssoftware) eingelesen. Verliert eine lernende Person ein Zeugnis, kann es nachgedruckt werden. Lehrperson und Schulleitung haben keine Kopien von Zeugnisdokumenten der Primarstufe zu archivieren. Nach Absolvie- rung der Schulpflicht beziehungsweise nach dem Schulaustritt wird das Zeugnis den Erziehungsberechtig- ten abgegeben. Die Schulleitung ist für die Archivierung von Kopien der Zeugnisse aus dem letzten Schul- jahr während fünf Jahren zuständig (Weisung zur Beurteilung Art. 17 Abs. 4 und 5). 7 Umgang mit Daten: Emails, Lehreroffice, Internet, Social Medias, Clouds etc. Datenaustausch per Email: Der Austausch von Daten über eine unverschlüsselte E-Mail ist ungefähr so sicher wie der Versand einer Postkarte. Der Absender kann nicht kontrollieren, wer auf dem Weg zum Emp- fänger Einsicht in die E-Mail hat. Daher sind E-Mails mit schützenswerten Personendaten, die über das Internet versandt werden, entweder zu verschlüsseln oder zu anonymisieren. Unbedenklich ist der Aus- tausch von schützenswerten Personendaten mittels einer E-Mail innerhalb eines geschützten Intranets. Office 365 wird durch ARI an allen Schulen in Appenzell Ausserrhoden bis Ende 2020 installiert. Bleibt somit eine E-Mail innerhalb der Verwaltung oder der Schulen in Appenzell Ausserrhoden, wird sie sicher versendet, Ausnahmen bilden externe Geräte, beispielweise der Versand über Mobiltelefone. Internet: Wird im Internet über Ereignisse aus der Schule berichtet (z.B. Rangliste Schulsporttag oder Be- richt über eine Schulreise), so sind diese Informationen weltweit schrankenlos abrufbar und weiter bear- beitbar, ohne dass die Betroffenen Kenntnis haben und der Betreiber einer Internetseite die Benützung kontrollieren kann. Die Herausgabe von Informationen über das Internet ist nur zulässig, wenn ein Rechtfer- tigungsgrund vorliegt. Angesichts des grossen Adressatenkreises kommt bei Daten über Lernende nur der Rechtfertigungsgrund der Einwilligung der Betroffenen in Betracht. Arbeiten mit LehrerOffice7: Die Daten in LehrerOffice sind vertraulich zu behandeln. Nebst Leistungsbe- wertungen können in LehrerOffice Daten zum Verhalten, zu spezifischen Massnahmen etc. erfasst werden. 6 https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/ehandbuch-volksschule/#c46633 7 Da mit LehrerOffice auch sensible Daten bearbeitet werden, stellt das Unternehmen höchste Anforderungen an die Datensicherheit. LehrerOffice arbeitet mit dem spezialisierten Schweizer Hostingpartner 'Nine AG' zusammen. Für mehr Details siehe: https://www.lehreroffice.ch/lehreroffice-db-hosting/praxisbeispiele/. Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 10
LehrerOffice bietet eine mit einem Passwort gesicherte Umgebung an. Für das Arbeiten mit LehrerOffice gelten die erläuterten Datenschutzbestimmungen. Umgang mit LehrerOffice. Office 365 Education: Für Schweizer Schulen existiert eine spezielle Zusatzvereinbarung für den daten- schutzkonformen Einsatz von Office 365. Die Zusatzvereinbarung wurde von privatim, der Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbeauftragten, mit Microsoft speziell für den Schulbereich ausgehandelt. Office 365 kann somit in den Schulen datenschutzkonform für die Bearbeitung von Personendaten genutzt wer- den. Das Amt für Volksschule und Sport von Appenzell Ausserrhoden unterzeichnete die Beitrittserklärung. Office 365 Education kann somit von den Schulen in vollem Umfang genutzt werden. Wenn ein erhöhtes Schutzbedürfnis besteht, sind sicherheitssteigende Möglichkeiten wie Multi-Factor-Authentication vorhan- den. Ohne diese Rahmenbedingungen können diese Dienstleistungen nur zum Bearbeiten von Sachdaten genutzt werden, beispielsweise für die Ablage von Arbeitsblättern. Die Schule soll für eine strukturierte Dateiablage sowie Dateifreigaben (Einsicht für Berechtigte) auf OneDrive und auf SharePoint verbindliche Regelungen im Sinne des Datenschutzes umsetzen. Weiterführende Angaben zu Office 365 Leitfaden des Kantons Zürich. Fotografieren: Je nachdem, wer zu welchem Zweck fotografiert, gelten die Datenschutzbestimmungen des Bundes oder jene des Kantons. Ebenso muss zwischen dem Fotografieren und dem Veröffentlichen unter- schieden werden. Für die Veröffentlichung von Fotos von Lernende ist immer eine Einwilligung einzuholen. Dies gilt für die Veröffentlichung im Internet wie auch für die Publikation beispielsweise in einer Schülerzei- tung. Lehrpersonen dürfen im Unterricht zu Schulungszwecken fotografieren, wenn diese keiner weiteren Person zugänglich gemacht werden. Ansonsten gelten die Datenschutzbestimmungen zur Datenbekannt- gabe (Einwilligung). Das Material ist zu vernichten, sobald es für den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt wird. Fotografieren Medienvertretende während des Unterrichts an internen Schulanlässen oder auf dem Schulareal, müssen die Lernenden respektive die Erziehungsberechtigten vorgängig informiert werden und in die Aufnahmen einwilligen (siehe Empfehlung Kapitel 4, „Fotos“). Die Fotos dürfen nur im Rahmen dieser Berichterstattung verwendet werden. Fotografieren Lehrpersonen, Eltern oder Medienver- tretende im Freien oder an öffentlichen Anlässen der Schule, dürfen sie dies grundsätzlich ohne Einwilli- gung der Betroffenen. Wer sich in der Öffentlichkeit aufhält, muss in Kauf nehmen, auf einem Bild als eine unter mehreren Personen fotografiert zu werden. Die Schule kann von Amtes wegen über Tätigkeiten von allgemeinen Interessen informieren. Aufbau, Zu- ständigkeiten, Schulprogramme oder Ansprechpersonen mit geschäftlichen Telefonnummern, Funktionen und E-Mail-Adresse von beispielsweise Lehrpersonen oder Schulbehördenmitgliedern gehören dazu. Pri- vate Kontaktangaben oder Fotos dürfen nur mit der Einwilligung der Betroffenen zum im Voraus bestimm- ten Zweck veröffentlicht werden. Clouds: Werden Daten in einer Cloud gespeichert oder bearbeitet, ist dies eine Auslagerung. Oft fehlt es an Transparenz, wo und wie die Daten bearbeitet werden. Die Kontrolle über die Daten geht verloren. Pro- dukte wie Microsoft Office 365, Dropbox, Google Drive, Lehrer Office und Evernote, die Informationen in der Cloud bearbeiten, müssen deshalb sorgfältig auf die Anforderungen überprüft werden. In Appenzell Ausserrhoden wird Microsoft Office 365 verwendet. Die dazugehörenden Clouds gelten als sicher. Siehe weitere Erläuterungen beim Stichwort „Microsoft Office 365“. Produkte, bei denen die datenschutzrechtli- chen Anforderungen nicht erfüllt sind, können nur für das Bearbeiten von nicht sensiblen Daten eingesetzt werden. Ausgetauscht werden können beispielsweise Unterrichtsmaterialien, Arbeitsblätter und Fotos. Ver- schiedene Texte, in denen persönliche Erlebnisse beschrieben werden, dürfen nicht mit diesen Produkten bearbeitet werden. Weitere nutzbare Cloud-Dienste sind beispielsweise antolin.ch für die Leseförderung, quizlet.com als Lerntools und Karteisysteme, typewriter als Tastatur-Trainingsprogramm, dis donc! als Französisch-Lernplattform, doodle.ch für Umfragen oder Terminfindungen. Mobiltelefon: Vor allem in der Sekundarschule verfügen fast alle Lernenden über ein eigenes Mobiltelefon, das sie immer mit sich führen. Ob – und allenfalls wie und wann – die Nutzung des Mobiltelefons in der Schule zulässig ist, kann die Schule regeln. Wird gegen die aufgestellten Regeln verstossen, können Lehr- Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 11
personen ein Mobiltelefon während des Unterrichts einziehen. Allerdings steht es den Lehrpersonen nicht zu, ein Mobiltelefon ohne Zustimmung des Lernenden zu «durchsuchen». Von gespeicherten Fotos, Vi- deos, SMS, Whatsapp-Nachrichten, Snapchats oder Mails dürfen Lehrpersonen somit keine Kenntnis er- langen. Unzulässig ist ebenfalls, ein Mobiltelefon nach Schulschluss zurückzubehalten. Schulwebseite: Informationen ohne personenbezogene Angaben zu Lernenden sind unproblematisch. Namen oder Angaben wie Adressen, Telefonnummern oder Email zu Lernenden dürfen nicht im Internet veröffentlicht werden. Ebenso soll bei der Veröffentlichung von Fotos auf eine Namensnennung gänzlich verzichtet werden. Fotos, Video- und Tonaufnahmen dürfen nur gemacht werden, wenn die Betroffenen vor der Aufnahme über die Verwendung informiert werden. Bei urteilsfähigen Lernenden muss die Einwilligung vom betroffenen Jugendlichen selber, bei urteilsunfähigen von den Erziehungsberechtigten eingeholt wer- den. Adressliste für Klassentreffen: Adresslisten für das Organisieren eines Klassentreffens können durch die Schulverwaltung bekannt gegeben werden, aber müssen nicht. Zudem muss durch Rückfragen sicherge- stellt werden, dass die Informationen nur für diesen Zweck bearbeitet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann von einer stillschweigenden Einwilligung der Betroffenen ausgegangen werden. Die Be- kanntgabe von Adresslisten zu kommerziellen Zwecken ist nicht gestattet. Soziale Medien: Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, für schulische Zwecke soziale Medien (Facebook, Ins- tagam, Snapchat, Twitter usw.) zu nutzen. In aller Regel werden die Daten im Ausland gespeichert und die Betreiber behalten sich vor, diese für beliebige Zwecke auszuwerten. Die Daten lassen sich nicht löschen. Vertragsbestimmungen sind nicht verhandelbar und können vom Anbieter jederzeit einseitig abgeändert werden. Übrigens: Freundschaftsanfragen über soziale Medien von Lernenden sollten Lehrpersonen nicht annehmen. Whatsapp8: Bei der Nutzung von Whatsapp übermitteln die Nutzenden fortlaufend die Kontaktdaten ihres Mobiltelefon-Adressbuches an Whatsapp. Die Daten werden beim Herunterladen der App bekanntgegeben, aber auch später, wenn das Adressbuch verändert wird. Dabei werden auch Kontaktdaten von Personen weitergeleitet, die Whatsapp nicht nutzen und somit keine Einwilligung vorliegt. Alle Daten, nicht nur die Kontaktdaten, werden in die USA weitergeleitet und dort gespeichert. Nutzen Lehrpersonen oder andere schulische Mitarbeitende Whatsapp, um untereinander oder mit den Lernenden Informationen auszutau- schen, müssten, um einen rechtmässigen Umgang mit den Daten zu garantieren, alle Betroffenen, also alle Personen, die im Adressbuch verzeichnet sind, eingewilligt haben. Die Nutzung von Whatsapp durch Lehrpersonen und die anderen schulischen Mitarbeitenden ist nicht rechtmässig, da es solche voll- ständigen Einwilligungen praktisch nicht gibt. Das Mindestalter für die Nutzung wurde vom Messaging- Dienst auf 16 Jahre erhöht. Andere datenschutzkonforme Lösungen sind erhältlich. An der Schulleitungsta- gung vom Juni 2018 wurde empfohlen, WhatsApp nicht zu verwenden und eine sichere Alternative zu wäh- len, siehe Liste (Liste Chats AR). 8 Whatsapp gehört zu den sehr verbreiteten Chat-Apps. „Chatten“ ist für viele Menschen heutzutage eine häufig genutzte Form der Kommunikation. Gerade bei Jugendli- chen ist diese Form des Informationsaustauschs besonders beliebt. In der Volksschule ist im Lehrplan verankert, dass ein mündiger Umgang mit diesen Medien gelernt wird, z.B. Chancen und Risiken erarbeitet werden, aber auch beispielsweise im „dialogischem Schreiben“, bei Klassenlagern oder als mögliche Form des Erlernens von Fremdsprachen genutzt werden kann. Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 12
8 Abkürzungen
AR Appenzell Ausserrhoden
ARI Appenzell Ausserrhoden Informatik
BV Bundesverfassung
BYOD Bring Your Own Device
Die Lernenden dürfen ihre privaten Geräte mitbringen und im Unterricht einsetzen.
DSG AR Datenschutzgesetz Appenzell Ausserrhoden
DSG Bund Datenschutzgesetz der eidgenössischen Bundesverwaltung
educa.ch ICT und Bildung
EU Europäische Union
LCH Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
LP 21 Mit diesem ersten gemeinsamen Lehrplan für die Volksschule setzten die 21 deutsch-
und mehrsprachigen Kantone den Artikel 62 der Bundesverfassung um, die Ziele der
Schule zu harmonisieren. Jeder Kanton entscheidet/entschied gemäss den eigenen
Rechtsgrundlagen über die Einführung im Kanton. Vom Lehrplan 21 gibt es eine Vorla-
ge sowie die kantonalen Versionen.
Scolaris Schulverwaltungsprogramm
StGB Strafgesetzbuch
ZGB Zivilgesetzbuch
Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 139 Bibliographie 9.1 Gesetzliche Grundlagen Bundesverfassung, 18. April 1999; SR 101 Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992; SR 235.1 Kanton AR: Gesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz) vom 18. Juni 2001; bGS 146.1 Kanton AR: Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz) vom 24. September 2000; bGS 411.0 Kanton AR: Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung (Schulverordnung) vom 26. März 2001; bGS 411.1 Kanton AR: Verordnung über das Archivwesen Archivgesetz vom 22.03.2010; bGS 421.11 Kanton AR: Anstellungsverordnung Volksschule vom 2. Juni 2008; bGS 412.21 Weisungen zur Art der Beurteilung der Lernenden (Weisungen zur Beurteilung) vom 28. August 2001 ge- stützt auf Art. 23 Abs. 3 des Gesetzes über Schule und Bildung; bGS 411.0 9.2 Literatur Bildungsdepartement Kanton St. Gallen / Amt für Volksschule (2016): Orientierungshilfe Datenschutz an Volksschulen Datenschutzbeauftragter Kanton Zürich: Datenschutzlexikon Volksschule Leitfaden; https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/bildung_und_forschung/volksschule.html (abgerufen am 23. Dezember 2018) Datenschutzbeauftragter Kanton Zürich: Office 365 – Dienste für die Schule; https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/bildung_und_forschung/volksschule.html (abgerufen am 23. Dezember 2018) Datenschutzstelle des Kantons Zug in Zusammenarbeit mit der Direktion für Bildung und Kultur des Kan- tons Zug (2017): Datenschutz-Leitfaden für die gemeindlichen Schule https://www.zg.ch/behoerden/datenschutzstelle/services/leitfaeden Departement Bildung und Kultur Appenzell Ausserrhoden / Amt für Volksschule und Sport (2017): Lehrplan 21 – Medien und Informatik: Bedeutung und Zielsetzungen; http://ar.lehrplan.ch/index.php?code=e|10|2 (abgerufen am 23. Dezember 2018) Departement Bildung und Kultur Appenzell Ausserrhoden / Amt für Volksschule und Sport (2015): Daten- schutz-Leitfaden für die Schule Departement Bildung und Kultur Appenzell Ausserrhoden / Amt für Volksschule und Sport (2015): Konkrete Empfehlungen zum Umgang mit Daten im Schulalltag Erziehungsdirektion des Kantons Bern / Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (2009): Daten- schutz in den Volksschulen des Kantons Bern Leitfaden (Nachschlagewerk) Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB): https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html (abgerufen am 17. Februar 2019) Jugend und Medien https://www.jugendundmedien.ch/de.html (abgerufen am 17. Februar 2019) Staatskanzlei Kanton Thurgau (2018): EU Datenschutz-Grundverordnung: Auswirkungen auf Volksschulen im Kanton Thurgau. Ein erster Überblick Menzi, Oliver (2018): Datenschutzleitfaden der Schule Teufen VBE / GÖD / LCH (2015): Leitfaden Datensicherheit für Lehrpersonen und Schulleitungen Leitfaden Datenschutz Volksschule Appenzell Ausserrhoden 14
Sie können auch lesen