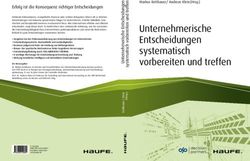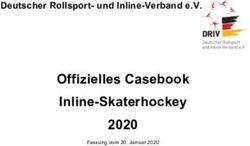Leitfaden für das Verfahren der Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehe-sachen gemäß 107 FamFG - Justiz in Sachsen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stand: August 2021
Leitfaden
für das Verfahren der Anerkennung
ausländischer Entscheidungen in Ehe-
sachen gemäß § 107 FamFG
beim Präsidenten des Oberlandesgerichts
Dresden
Anschrift: Der Präsident
des Oberlandesgerichts Dresden
Referat IV.3
Schloßplatz 1
01067 Dresden
Telefon: 0351 446-1351 Frau Fritsch
Herr Lorenz
0351 446-1352 Frau Lippert
Telefax: 0351 446-1529
E-Mail: scheidungsanerkennung@olg.justiz.sachsen.de2 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 2. Antragstellung 3. Übersetzungen der Urkunden 4. Identität- und Staatsbürgerschaftsnachweis 5. Vorlage der ausländischen Urkunden und Unterlagen 6. Beglaubigung ausländischer Urkunden und Unterlagen 7. Dauer des Verfahrens 8. Kosten des Verfahrens 9. Arten der Scheidung 9.1. Staatliche Scheidungen 9.2. Privatscheidungen 9.3. Heimatstaatentscheidungen 10. Scheidungen der EU-Mitgliedsstaaten
3 1. Einführung Grundsätzlich sieht die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland keine automatische Anerkennung ausländischer Gerichts- und Behördenentscheidungen vor. Entscheidungen, durch die im Ausland eine Ehe für nichtig erklärt, aufgehoben, dem Bande nach oder unter Aufrechterhaltung des Ehebandes geschieden oder durch die das Bestehen oder Nichtbestehen einer Ehe zwischen den Parteien festgestellt ist, werden nur anerkannt, wenn die Landesjustizverwaltung festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für die Aner- kennung vorliegen. Grundlage der förmlichen Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen bildet § 107 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - FamFG. Im Freistaat Sachsen wurde die Aufgabe der Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden gemäß § 107 Absatz 3 FamFG übertragen. Es können nur ausländische Entscheidungen anerkannt werden, die im Entscheidungsstaat formelle Rechtskraft erlangten, d. h. die Entscheidung muss endgültig sein und es darf kein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung mehr gegeben sein. In den Staaten, in denen für die Rechtswirksamkeit der Scheidung im Entscheidungsstaat die Eintragung der Scheidung in ein behördliches Register Voraussetzung ist, ist der Nachweis der Registereintragung zu führen. Die Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen oder nicht vorlie- gen, ist für alle Gerichte und Behörden in Deutschland bindend, § 107 Absatz 9 FamFG. Mit Entscheidung über die Anerkennung gilt die Ehe rückwirkend auf den Zeitpunkt der Auflösung der Ehe im Entscheidungsstaat als aufgelöst. Die Entscheidung über die Anerkennung gemäß § 107 FamFG umfasst ausschließlich die Auflösung der Ehe. Sämtliche weitere, ggf. in der ausländischen Entscheidung getroffenen Regelungen zu Scheidungsfolgesachen wie z.B. Festlegungen zu Unterhalt, Sorge- bzw. Umgangsrecht oder Versorgungsausgleich werden nicht berührt.
4 2. Antragstellung Die Entscheidung über die Anerkennung einer ausländischen Scheidung ergeht nur auf Antrag (§ 107 Absatz 4 FamFG). Örtlich zuständig für die Entscheidung eines solchen Antrags ist die Justizverwaltung des Bundeslandes in dem ein Ehegatte der geschiedenen Ehe seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 107 Absatz 2 FamFG). Hat keiner der ehemaligen Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, so ist die Justizverwaltung des Bundeslandes zuständig, in dem eine neue Ehe geschlossen werden soll. Hat keiner der Ehegatten der geschiedenen Ehe seinen Aufenthalt in Deutschland und soll hier auch keine Ehe geschlossen werden, ist für die Anerkennung die Senatsverwaltung für Justiz in Berlin zuständig. Da im Freistaat Sachsen die Zuständigkeit der Entscheidung über Anträge auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen von der Landesjustizverwaltung dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden übertragen wurde, ist, sofern ein Ehegatte der geschiedenen Ehe seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen hat oder im Freistaat eine neue Ehe geschlossen werden soll, für die Entscheidung über einen solchen Antrag der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden zuständig. Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen kann stellen, wer ein rechtliches Interesse an der Anerkennung glaubhaft macht. Neben den ehemaligen Ehe- gatten ist stets auch zukünftigen Ehegatten ein rechtliches Interesse gegeben. Auch bei Beurkundung außerhalb einer Ehe geborener Kinder oder zur Klärung des Perso- nenstands Verstorbener ist die Anerkennung ausländischer Entscheidungen von Bedeutung. Antragsberechtigt können neben den ehemaligen Ehegatten oder späteren Ehegatten (Heiratswilligen) oder Lebenspartner, dann auch z. B. Erben oder Rentenversicherungsan- stalten sein. Gegen die Entscheidung der Landesjustizverwaltung, hier: der Verwaltungsabteilung des Oberlandesgerichts, kann, sofern ein rechtliches Interesse besteht, beim zuständigen Zivil- senat des Oberlandesgerichts Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden (§ 107 Absatz 5 bis 7 FamFG). Die Entscheidung des Senats des Oberlandesgerichts ist endgültig.
5 Das für die Antragstellung erforderliche Formular (Nr.: 16/101) „Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen gemäß § 107 FamFG" halten im Freistaat Sachsen die Standesämter bereit. Zwecks Antragstellung wird empfohlen bei dem zuständigen Standesamt vorzusprechen. Die Standesbeamten werden beim ordnungsgemäßen Ausfüllen des Antrags mitwirken und auf die Vollständigkeit der benötigten Urkunden und Unterlagen achten. Der Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen wird von den Standesbeamten mit den vollständigen Unterlagen dem Präsidenten des Oberlandesgerichts zur Entscheidung vorgelegt. Durch effektive Mitarbeit des Standesamtes beim Vorbereiten des Antrags auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen und Zusammenführen der für die Anerkennung erforderlichen Urkunden und sonstiger Unterlagen, ist i. d. R. zeitaufwändi- ges Nachfragen bzw. Nachfordern von Dokumenten durch das Oberlandesgericht entbehrlich. Alternativ ist eine Antragstellung unter zur Hilfenahme des, auf der Internet-Seite des Oberlandesgerichts im Abschnitt Scheidungsanerkennung eingestellten Antragsformulars möglich. 3. Übersetzungen der Urkunden Fremdsprachige Dokumente sind grundsätzlich mit einer deutschen Übersetzung vorzulegen. Diese muss von einem in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union öffentlich bestellten und allgemein beeidigten Übersetzer gefertigt sein. Das Original der Urkunde (oder eine durch den Übersetzer gefertigte Kopie) soll durch ein Siegel fest mit der Übersetzung verbunden sein. Sämtliche Übersetzungen müssen direkt von der Originalurkunde (ohne Zwischen- übersetzungen in eine dritte Sprache) gefertigt sein. Internationale Urkunden, die nach entsprechenden Abkommen ausgestellt wurden, bedürfen in der Regel keiner zusätzlichen Übersetzung. Sollten allerdings in der Rubrik „Vermerke“ Eintragungen vorhanden sein, deren Inhalt ohne Übersetzung nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, muss diese Passage übersetzt werden. Ausnahmen: Von Behörden eines EU-Mitgliedsstaates ausgestellte öffentliche Urkunden, denen ein mehrsprachiges Formular gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2016/1191 beigefügt ist, benötigen keine Übersetzung.
6 Im nicht europäischen Ausland gefertigte Übersetzungen werden ausnahmsweise anerkannt, wenn deren Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit durch einen Konsularbeamten der deutschen Auslandsvertretung des Herkunftslandes oder durch einen in Deutschland zugelassenen Übersetzer direkt auf der Übersetzung mit Siegel und Unterschrift bestätigt werden. Außerdem können ausnahmsweise Auslandsübersetzungen von Urkunden mit geringerem Beweiswert (z. B. Meldebescheinigungen) vorgelegt werden. 4. Identitäts- und Staatsbürgerschaftsnachweis Als Nachweis der Identität und Staatsbürgerschaft ist zur Anerkennung der ausländischen Entscheidung in Ehesachen eine Kopie des gültigen Reisepasses bzw. ggf. des deutschen Reiseausweises des Antragstellers einzureichen. Bei deutschen Antragstellern bzw. Antragstellern aus EU-Mitgliedstaaten ist die Vorlage einer Kopie des Personalausweises ausreichend. Von Bürgern, die im Aufnahmeverfahren als sog. „Spätaussiedler" auf der Grundlage des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) einreisten, ist für die Prüfung im Rahmen des Antrages gemäß § 107 FamFG, welche Staatsbürgerschaft der Antragsteller zum Zeitpunkt der Scheidung besaß, zusätzlich eine Bescheinigung nach § 15 BVFG (Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge – Bundesvertriebenengesetz) vorzulegen. 5. Vorlage der ausländischen Urkunden und Unterlagen Das für die Antragstellung erforderliche Formular (Nr.: 16/101) „Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen nach § 107 FamFG" halten im Freistaat Sachsen die Standesämter bereit und ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit den zur Anerkennung erforderlichen Dokumenten und Unterlagen einzureichen. Alternativ ist eine Antragstellung unter zur Hilfenahme des eingestellten Antragsformulars möglich. Ausländische Urkunden sind stets im Original vorzulegen. Dem vollständig ausgefüllten Antragsformular sind folgende Unterlagen beizufügen:
7
1. Gültiger Reisepass, Personalausweis oder Reiseausweis als Nachweis der Staats-
bürgerschaft
2. Scheidungsurteil:
Vollständige Ausfertigung der ausländischen Entscheidung im Original, mit Tatbestand
und Entscheidungsgründen und mit Rechtskraftvermerk bzw. Nachweis der Endgültig-
keit der Entscheidung.
Der Nachweis der Endgültigkeit der Entscheidung kann entweder als Rechtskraftver-
merk auf dem Urteil, oder in den Staaten, in denen die Registrierung der Scheidung
Wirksamkeitsvoraussetzung ist, einer zusätzlichen, gesonderten Urkunde, einem Aus-
zug aus dem Scheidungsregister oder durch Beischreibung im Personenstandsregister
geführt werden (siehe Länderteil Scheidungsanerkennung).
oder
Scheidungsurkunde:
Wenn die Ehe durch das Standesamt oder einen Notar geschieden wurde, ist die ent-
sprechende Scheidungsurkunde im Original beizufügen (siehe Länderteil
Scheidungsanerkennung).
3. Heiratsurkunde:
Ggf. Familienbuchauszug oder Auszug aus dem Heiratsregister, im Original.
Von einer Vorlage der Heiratsurkunde kann nur bei den Staaten abgesehen werden, die
diese Urkunde bei Scheidung einziehen (siehe Länderteil Scheidungsanerkennung).
Grundsätzlich wird auf die Beglaubigung des Nachweises der Eheschließung
(Heiratsurkunde) mit Apostille, Legalisation oder inhaltlichen Prüfung im Rahmen
einer Vor-Ort-Ermittlung verzichtet.
4. Einkommensnachweis (Nettoeinkommen) des Antragstellers. Falls Leistungen nach
den Sozialgesetzbüchern oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen werden, ist
der aktuelle Bewilligungsbescheid vorzulegen. Freiberufler belegen ihre
Einkommensverhältnisse durch den letzten Steuerbescheid. Sollte dabei lediglich ein
Verlust ausgewiesen sein, wird um Angabe gebeten, wovon der Antragsteller dann
seinen Lebensunterhalt bestreitet und welche Mittel ihm dafür monatlich zur Verfügung
stehen.8
5. Aufenthaltsbescheinigung des Antragstellers als Nachweis seines Wohnsitzes bzw.
des gewöhnlichen Aufenthalts. Sollte der Antragsteller weder seinen Wohnsitz noch
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen haben, jedoch im Freistaat
Sachsen eine Ehe eingehen wollen, ist eine Kopie der Anmeldung der Niederschrift zur
Eheschließung beizufügen.
6. Beglaubigung ausländischer Urkunden und Unterlagen
Jede Urkunde ist grundsätzlich nur zur Verwendung in dem Staat bestimmt, in dem sie errichtet
wurde. Von einem anderen ausländischen Staat werden diese Urkunden nur anerkannt, wenn
sie eine bestimmte Form der Beglaubigung bzw. Echtheitsbestätigung aufweisen, die der Staat
der die Urkunde anerkennen soll, durch Übereinkommen mit dem Staat in dem die Urkunde
erstellt wurde, vereinbart hat.
Da den hiesigen Behörden und Gerichten weder die Behördenstruktur noch die vorgeschrie-
bene Form der ausländischen Urkunden des jeweiligen ausländischen Staates in dem die
Urkunde erstellt wurde, bekannt sind, (u. a. sind auch Siegel- und Unterschriftsproben der
ausländischen Beamten hier nicht vorhanden) ist eine Beglaubigung bzw. Bestätigung der
ausländischen Urkunde durch die deutsche Auslandsvertretung des ausländischen Staates in
dem die Urkunde errichtet wurde, erforderlich.
Diese Art der Beglaubigung einer öffentlichen, ausländischen Urkunde nennt sich
„Legalisation" oder „Apostille". Auch ausländische Entscheidungen in Ehesachen können mit
Legalisation oder Apostille vorgelegt werden (Weiteres: siehe Ehefähigkeitsverfahren:
Legalisation und Apostille).
Legalisation
Mit der Legalisation durch die Deutsche Botschaft oder ein deutsches Generalkonsulat wird
die Echtheit einer ausländischen öffentlichen Urkunde bestätigt. Nach § 13 des Konsularge-
setzes (Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse vom 11.09.1974;
BGBl. I S. 2317) gibt es die Legalisation im engeren und im weiteren Sinn. Mit Legalisation im
engeren Sinn nach § 13 Abs. 2 KonsularG, wird die Echtheit der Unterschrift, die Eigenschaft
in welcher der Unterzeichner der Urkunde gehandelt hat und ggf. die Echtheit des Siegels mit
dem die Urkunde versehen ist, bestätigt.
Die Legalisation im weiteren Sinn nach § 13 Abs. 4 KonsularG umfasst den Umfang der
Beglaubigung wie in Abs. 2 des Konsulargesetzes, jedoch wird zusätzlich bestätigt, dass der
Aussteller zur Aufnahme der Urkunde berechtigt war und die Urkunde in der den Gesetzen9
des Ausstellungsortes entsprechenden Form aufgenommen worden ist. Die Legalisation wird
durch die Konsularbeamten der deutschen Botschaften und Konsulate vorgenommen und auf
der Urkunde ein Legalisationsvermerk aufgebracht, der von dem Beamten gesiegelt und
unterschrieben wird.
Bevor die deutsche Auslandsvertretung eine ausländische Urkunde legalisieren kann, ist diese
i. d. R. durch die jeweiligen ausländischen Behörden mit einer Vor- und ggf. einer
Überbeglaubigung zu versehen. In den meisten Staaten ist u. a. eine Beglaubigung durch das
Außenministerium des Ausstellerstaates erforderlich.
(Weiteres: siehe Ehefähigkeitsverfahren: Legalisation und Apostille).
Apostille
Nach dem „Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von
der Legalisation vom 5. Oktober 1961" tritt an die Stelle der Legalisation eine Apostille.
Scheidungsunterlagen oder Urkunden aus den Staaten, die Mitglied dieses Übereinkommens
sind, werden somit durch die Vertragsstaaten gegenseitig akzeptiert, wenn sie mit einer
Apostille versehen sind. Die „Haager Apostille" bestätigt die Echtheit einer öffentlichen
Urkunde, die dazu im Original vorgelegt werden muss.
Gegenüber dem Beitritt einiger Staaten zu diesem Übereinkommen hat die Bundesrepublik
Deutschland seinen Vorbehalt dahingehend eingelegt, dass die Bundesrepublik aus be-
stimmten Staaten die Dokumente ausschließlich mit Legalisationsvermerk akzeptiert.
Jeder Vertragsstaat hat seine Behörden festgelegt, die die Apostillen erteilen. Wobei die aus-
ländische Behörde, die die Urkunde erstellt hat, i. d. R. Kenntnis von der zuständigen Behörde
hat, wo die Apostille erteilt wird.
Alle Urkunden sind deshalb grundsätzlich mit Legalisation oder Apostille auf der
Originalurkunde bzw. dem Scheidungsbeschluss oder Scheidungsurteil vorzulegen. Bezüg-
lich der konkreten Anforderungen für die Urkunden aus den einzelnen Ländern wird auf den
Länderteil Scheidungsanerkennung verwiesen.
Ausnahmen: siehe Ehefähigkeitsverfahren: Internationale Urkunden.
Inhaltliche Prüfung
Einige Auslandsvertretungen haben feststellen müssen, dass in ihrem Amtsbezirk die
Voraussetzungen für die Legalisation der ausländischen Urkunden nicht mehr gegeben sind.10 Mit Billigung des Auswärtigen Amtes wurde in diesen Staaten die Legalisation bis auf weiteres eingestellt. Sollte eine deutsche Behörde jedoch für eine Amtshandlung wie z. B. die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung, für eine Eheschließung oder Anlegung eines Familienbuchs Urkunden aus diesen Staaten benötigen, kann diese deutsche Behörde im Rahmen der Amtshilfe ein entsprechendes Ersuchen stellen. Auf Antrag der deutschen Behörde werden Urkunden aus diesen Ländern einer inhaltlichen Prüfung unterzogen (siehe auch: Ehefähigkeitsverfahren: Vor-Ort-Ermittlung und Merkblätter). Die Urkunden sind von der ersuchenden, deutschen Behörde über den Kurierdienstweg des Auswärtigen Amtes an die jeweilige Auslandsvertretung zu senden. Der amtliche Kurierweg des Auswärtigen Amtes (Auswärtiges Amt, Kurierstelle für die Deutsche Botschaft/ das deutsche Generalkonsulat in - z.B. Colombo / Sri Lanka-, 11013 Berlin) kann ausschließlich von Behörden und Gerichten, jedoch nicht von Privatpersonen benutzt werden. 7. Dauer des Verfahrens Die Dauer der Bearbeitung hängt wesentlich davon ab, ob die geforderten Unterlagen voll- ständig eingereicht werden und ob im Antrag alle notwendigen Angaben zur Vorehe, der Auflösung der Ehe und der ehemaligen Ehegatten gemacht wurden. Erst danach kann die abschließende Prüfung der eingereichten Dokumente erfolgen. Im Anerkennungsverfahren wird dem früheren Ehepartner rechtliches Gehör zur beabsichtigten Entscheidung gewährt. Bei einer Frist zur Anhörung von in der Regel 3 bis 6 Wochen ist bis zur abschließenden Entscheidung über die Anerkennung mit einer Erledigungszeit von ca. 2 bis 3 Monaten zu rechnen. Unvollständige Unterlagen oder unzureichende Angaben im Antrag, sowie ggf. notwendige Ermittlungen zur Wirksamkeit der anzuerkennenden Auflösung der Ehe können das Verfahren über den oben angegebenen Zeitrahmen hinaus verlängern.
11 8. Kosten des Verfahrens Für die Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung vorliegen oder nicht vorliegen, wird gemäß § 1 Abs.1, Abs. 2 Ziff. 2 und § 4 Abs. 1, 2 JVKostG - Justizverwaltungskostengesetz - eine Gebühr von 15,00 EUR bis 305,00 EUR erhoben. Bei Rücknahme des Antrags wird nach § 1 Abs.1, Abs. 2 Ziff. 2 und § 4 Abs. 1,2,4 JVKostG - Justizverwaltungskostengesetz - eine halbe Gebühr der, für die Feststellung veranschlagten Gebühr, mindestens jedoch 15,00 EUR erhoben. Für die Festsetzung der Gebühr ist es erforderlich, dass dem Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen eine Verdienstbescheinigung beigefügt wird, mit der das Nettoeinkommen des Antragstellers nachgewiesen ist. Sollte der Antragsteller Einkommen in einer ausländischen Währung beziehen, ist sein Net- toeinkommen umgerechnet in Euro anzugeben. Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz sind durch Vorlage eines aktuellen Bewilligungsbescheides nachzuweisen. Freiberufler legen als Einkommensnachweis ihren letzten Steuerbescheid oder eine aktuelle BWA vor. Sollte dieser Bescheid lediglich Verlust ausweisen, möge der Antragsteller angeben wovon er seinen Lebensunterhalt bestreitet und welche Mittel ihm dafür monatlich zur Verfügung stehen. Angaben zu den Einkommensverhältnissen sind freiwillig. Ohne Vorlage von Nachweisen zum Einkommen des Antragstellers wird jedoch die Höchst- gebühr festgesetzt. In diesem Fall ist im Antrag bzw. dem Anschreiben anzugeben, dass der Antragsteller entsprechend darüber belehrt wurde. Die Entscheidung des Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden über die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen wird neben den eingereichten Unterlagen, dem einreichenden Standesamt zur Aushändigung an den Antragsteller zurückgegeben. Für eine vereinfachte Entrichtung der Gebühr ist dem Bescheid über die Anerkennung ein entsprechender Überweisungsträger in der Höhe der festgesetzten Gebühr beigefügt.
12 Die Aushändigung des Anerkennungsbescheids und der Unterlagen an den Antrag- steller erfolgt erst nach Begleichung der festgelegten Gebühr. 9. Arten der Scheidung Neben Entscheidungen von ausländischen Gerichten oder Behörden bedürfen auch sog. „Privatscheidungen", d. h. Auflösung der Ehe durch Rechtsgeschäfte, kirchliche Gerichte, ggf. durch Beteiligung von nichtstaatlichen Stellen der Anerkennung gemäß § 107 FamFG. Nach § 107 FamFG unterliegen der Anerkennung nur Entscheidungen in Ehesachen, die vollständig im Ausland ergangen sind. Dabei ist der Begriff „im Ausland" territorial zu verste- hen, d. h. außerhalb des Staatsgebietes der Bundesrepublik. Scheidungen die z. B. vor aus- ländischen Konsulaten oder vor religiösen Gerichten eines fremden Staates im Bundesgebiet vollzogen wurden, sind keine im Ausland ergangenen Entscheidungen. Dasselbe gilt für Privatscheidungen die zum Teil oder vollständig im Bundesgebiet vollzogen wurden. Auch diese Entscheidungen gelten nicht als im Ausland ergangene Scheidungen, da die gesamte Entscheidung im Ausland vollzogen sein muss. Im Bundesgebiet kann eine Ehe nach § 1564 BGB nur durch ein deutsches Gericht geschieden werden. Es ist dabei unerheblich, dass der ausländische Staat diese im Bundesgebiet vollzogene Scheidung anerkennt. 9.1 Staatliche Scheidungen Staatliche Entscheidungen, stellen Hoheitsakte ausländischer, staatlicher „Gewalt" dar. Es kann sich dabei um ein ausländisches Urteil, einen Beschluss des ausländischen Gerichts oder den Bescheid einer ausländischen Behörde handeln. Der Anerkennung unterliegen nur ausländische Entscheidungen, die im Entscheidungs- staat formelle Rechtskraft erlangten und damit nach dem ausländischen Recht wirksam geworden sind. Gegen die Entscheidung über die Auflösung der Ehe darf nach dem aus- ländischen Recht kein Rechtsmittel mehr gegeben sein. Die Anerkennung staatlicher, ausländischer Entscheidungen in Ehesachen richtet sich nach §§ 98, 109 FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) oder Staatsverträge, soweit die Bundesrepublik diesen beigetreten ist.
13 Gemäß § 109 Abs. 1 Nr. 1 FamFG ist die Anerkennung der ausländischen Entscheidung davon abhängig, ob das ausländische Gericht oder Behörde international zuständig war. Paragraf 98 FamFG ist dabei „spiegelbildlich" anzuwenden. Die internationale Zuständigkeit der ausländischen Gerichte und Behörden ist z. B. dann ge- geben, wenn mindestens einer der ehemaligen Ehegatten entweder bei Eheschließung oder im Zeitpunkt der Scheidung die Staatsangehörigkeit des Staates besaß oder noch besitzt, dessen Gericht oder Behörde die Scheidung ausgesprochen hat. Auch wenn mindestens ein ehemaliger Ehegatte zum Zeitpunkt der Scheidung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im betreffenden Staat, wo die Scheidung erging, hatte oder noch hat, ist die internationale Zuständigkeit des ausländischen Entscheidungsgerichts gegeben. Nach § 109 Abs. 1 Nr. 2 FamFG ist für die Anerkennung erforderlich, dass dem Scheidungs- gegner (Beklagten) in dem ausländischen Verfahren rechtliches Gehör gewährt worden ist. Dem Scheidungsgegner muss das verfahrenseinleitende Dokument (Scheidungsantrag) nach dem Recht des Entscheidungsstaates unter Berücksichtigung geltender Staatsverträge, ggf. Rechtshilfeverträge, ordnungsgemäß zugestellt werden. Dem Scheidungsgegner müssen dabei die entsprechenden Schriftstücke so rechtzeitig zugestellt worden sein, dass er sich in dem ausländischen Verfahren äußern konnte. Wenn der Scheidungsgegner im Rahmen des Anerkennungsverfahrens vorträgt, dass ihm die verfahrenseinleitenden Dokumente (Scheidungsantrag) nicht ordnungsgemäß oder nicht so rechtzeitig zugestellt worden sind, dass er sich verteidigen konnte, ist die Anerkennung dieser ausländischen Entscheidung in Ehesachen zu versagen. Wenn das anzuerkennende ausländische Urteil mit einem hier in der Bundesrepublik er- lassenen oder einem anzuerkennenden früheren, ausländischen Urteil oder wenn das ihm zugrunde liegende Verfahren früher hier rechtshängig gewordenen Verfahren unvereinbar ist, ist die Anerkennung der ausländischen Entscheidung gemäß § 109 Abs. 1 Nr. 3 FamFG ausgeschlossen. In der Praxis wird das beim deutschen Familiengericht früher anhängige Scheidungsverfahren oftmals bis zur Entscheidung im Anerkennungsverfahren gemäß § 107 FamFG ausgesetzt und bei Anerkennung der Scheidungsantrag beim hiesigen Familiengericht zurückgenommen. Würde die Anerkennung der ausländischen Entscheidung in Ehesachen gemäß § 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG zu einem Ergebnis kommen, die mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts, insbesondere mit den Grundrechten nicht vereinbar ist, wäre die Anerkennung ausgeschlossen. Ein Verstoß gegen die wesentlichen Grundsätze des deutschen Rechts
14 („ordre public") kann im Inhalt der ausländischen Entscheidung in Ehesachen, als auch verfahrensrechtlichen Mängeln liegen. Um einen Verstoß gegen wesentliche Grundsätze des deutschen Prozessrechts aus verfah- rensrechtlicher Sicht dürfte es sich handeln, wenn z.B. dem Scheidungsgegner im ausländi- schen Verfahren kein rechtliches Gehör gewährt wurde bzw. er das verfahrenseinleitende Schriftstück nicht rechtzeitig oder in einer Art und Weise zugestellt bekam, dass er sich nicht verteidigen konnte. Zum Beispiel dürfte ein solcher Verstoß gegen die Grundprinzipien des deutschen Verfahrensrechts auch darin zu sehen sein, dass das ausländische Gericht den Einwendungen des Beklagten nicht nachgegangen ist, ggf. ihm keine Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu dem Beweisergebnis gegeben wurde. 9.2 Privatscheidungen Unter einer Privatscheidung versteht man die Auflösung einer Ehe aufgrund eines privaten Rechtsgeschäfts mit oder ohne Beteiligung einer ausländischen, staatlichen Behörde. Es kann sich dabei um einen einseitigen Akt eines Ehegatten oder um einen Vertrag zwischen beiden Ehegatten zur Auflösung der Ehe handeln. Dem Verfahren auf Anerkennung gemäß § 107 FamFG unterliegen nur die Privatschei- dungen, die im Ausland unter Mitwirkung einer ausländischen, staatlichen Behörde oder einem ausländischen Gericht zustande gekommen bzw. registriert worden ist. Als privatrechtlichen Gestaltungsakt rechtsgeschäftlicher Natur unterliegen diese Privat- scheidungen im Anerkennungsverfahren nach § 107 FamFG dem Internationalen Privatrecht. Ist einer der Ehegatten Doppelstaatsbürger und besitzt neben einer ausländischen Staatsbürgerschaft auch die deutsche Staatsbürgerschaft, so ist nach Art. 5 Abs. 1 EGBGB die deutsche Staatsbürgerschaft maßgebend. Bei Doppelstaatsbürgern, die mehrere ausländische Staatsangehörigkeiten besitzen, wird auf ihre sog. effektive Staatsangehörigkeit abgestellt. Eine Privatscheidung ist nur dann anerkennungsfähig, wenn der, die Ehe auflösende Akt (konstitutiver Akt) im Ausland stattgefunden hat. Dieser konstitutive Akt kann z. B. in dem Ausspruch der Verstoßung der Ehefrau durch den Ehemann bestehen. Weitere länder- spezifische Regelungen sind im Länderteil Scheidungsanerkennung zu finden. Dieser Akt der Auflösung der Ehe wird dann durch die zuständige ausländische Behörde oder Gericht registriert.
15 Da in der Bundesrepublik gemäß § 1564 Abs. 1 BGB die Ehe ausschließlich durch ein ge- richtliches Urteil aufgelöst werden kann (Scheidungsmonopol deutscher Gerichte), ist eine Privatscheidung bei welcher der Scheidungsakt in der Bundesrepublik und nicht im Aus- land erfolgte, nicht für den deutschen Rechtsbereich anerkennungsfähig. Auch die Registrierung solcher Scheidungen in den ausländischen Heimatregistern führt nicht dazu, dass Privatscheidungen, bei denen der Akt der Scheidung im Bundesgebiet stattfand, im Verfahren nach § 107 FamFG anerkennungsfähig sind. Aus diesem Grund ist auch die Anerkennung von Entscheidungen konsularischer und diplomatischer Vertretungen oder religiöser Gerichte des Auslands in der Bundesrepublik nicht möglich. Auch bei der Anerkennung von Privatscheidungen ist grundsätzlich zu prüfen, ob mit Anerkennung der ausländischen Scheidung ein Verstoß gegen die wesentlichen Grundsätze des deutschen Rechts nach Art. 6 EGBGB („ordre public") vorliegen könnte. Nach Art. 6 EGBGB ist ein ausländisches Gesetz dann nicht anzuwenden, wenn die Anwendung zu einem Ergebnis führt, das mit den Grundrechten nicht vereinbar ist. 9.3 Heimatstaatentscheidungen Hat bei ausländischen Entscheidungen in Ehesachen ein Gericht oder eine Behörde des Staates entschieden, dem beide Ehegatten zum Zeitpunkt der Scheidung ausschließlich angehörten, so ist nach § 107 Abs. 1 Satz 2 FamFG keine förmliche Anerkennung notwendig. Es handelt sich dann um eine sog. „Heimatstaatentscheidung". Falls einer der ehemaligen Ehegatten erneut eine Ehe eingehen will, können „Heimatstaatentscheidungen" für Antragsteller im Rahmen des Verfahrens der Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses gemäß § 1309 BGB als inzident (nebenbei anfallende) Entscheidung anerkannt werden. Näheres ist dazu in Ehefähigkeitsverfahren: Punkt 17 a) aufgeführt. Allerdings müsste dann der ehemalige Ehepartner in dem Verfahren der Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses, seine Staatsangehörigkeit, die er zum Zeitpunkt der Scheidung innehatte, nachweisen. Sollte die Staatsangehörigkeit des ehemaligen Ehe- partners nicht aus dem Scheidungsdokument zu entnehmen sein, wäre diese durch andere geeignete Dokumente (z.B. Kopie des zum Zeitpunkt der Scheidung gültigen Reisepasses oder Personalausweises), zu belegen. Bei Unmöglichkeit dieses Nachweises wäre die förm- liche Anerkennung gemäß § 107 FamFG zwingend erforderlich.
16 Sofern ein rechtliches Interesse an einer Anerkennung gemäß § 107 FamFG besteht, kann stets auch für den Fall, dass eine Heimatstaatentscheidung vorliegt, Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen beim Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden gestellt werden. Aufgrund der bundesweiten Geltung (§ 107 Abs. 9 FamFG) der Entscheidung über die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen ist zur Klärung des Per- sonenstands der ehemaligen Ehegatten oder sonstiger Berechtigter, z. B. bei Scheidungs- folgesachen, Erbschaftsangelegenheiten, ggf. aus melde- oder steuerrechtlichen Gründen, ein rechtliches Interesse stets gegeben. Ebenso ist für den Heiratswilligen, der im Verfahren der Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses gemäß § 1309 BGB beim Oberlandesgerichts Dresden kein Antragsteller im hiesigen Befreiungsverfahren ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen hat und durch eine „Heimatstaatentscheidung im Ausland geschieden wurde, ein rechtliches Interesse an der förmlichen Anerkennung gem. § 107 FamFG aus zeitlichen Gründen gegeben. Der Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen wird in solchen Fällen zeitgleich mit dem Befreiungsantrag gemäß § 1309 BGB bearbeitet und entschieden (Näheres dazu in Ehefähigkeitsverfahren: Punkt 17 a) Wenn einer der ehemaligen Ehegatten zum Zeitpunkt der Scheidung eine weitere Staats- angehörigkeit besaß (Doppelstaatsbürger) oder z. B. als Asylberechtigter, ggf. als Inhaber eines Traveldokuments oder ggf. mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, zum Zeitpunkt der Scheidung einem anderen Personenstatut als dem Recht des Entscheidungsstaates unterlag, liegt keine Heimatstaatentscheidung vor. In diesen Fällen ist die förmliche Anerkennung der ausländischen Entscheidung in Ehesachen gemäß § 107 FamFG zwingend erforderlich.
17 Grundsätzlich ist das Anerkennungsverfahren durchzuführen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass einer der ehemaligen Ehegatten zum Zeitpunkt der Scheidung eine weitere oder eine andere Staatsangehörigkeit als die des Entscheidungsstaates besessen hat. In diesen Zweifelsfällen, wo die Feststellung der Staatsbürgerschaft der ehemaligen Ehegat- ten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durch den Standesbeamten geklärt werden kann, sind diese Fälle zur Anerkennung gemäß § 107 FamFG dem Oberlandesgericht vorzulegen. Zweifelsfälle ergeben sich oft bei Personen, die nach dem Bundesvertriebenengesetz in das Bundesgebiet einreisten sowie bei Personen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft, ggf. bei Personen die, statt Inhaber eines gültigen Reisepasses, lediglich im Besitz eines Reiseaus- weises sind. 10. Scheidungen der EU-Mitgliedsstaaten Ausländische Entscheidungen in Ehesachen aus EU-Mitgliedsstaaten werden unter bestimmten Voraussetzungen ohne weitere Förmlichkeit gegenseitig anerkannt. Am 1. März 2001 ist die „Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten" in Kraft getreten. Seit 1. März 2005 gilt die „Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000". Unabhängig von der Staatsangehörigkeit der ehemaligen Ehegatten zum Zeitpunkt der Scheidung werden Entscheidungen der Mitgliedsstaaten nach Artikel 21 dieser Verordnung in den anderen Mitgliedsstaaten ohne ein besonderes Verfahren anerkannt. Da Dänemark nach dem Zusatzprotokoll zum Vertrag von Amsterdam an Gemeinschaftsakten der Europäischen Union auf dem Gebiet der Justiz- und Innenpolitik derzeit nicht teilnimmt, gelten die obigen EG-Verordnungen nicht für Dänemark.
18
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (mit Ausnahme: Dänemark) sind: Belgien,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich,
Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich,
seit 1. Mai 2004:
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische
Republik, Ungarn, Zypern,
seit 1. Januar 2007:
Bulgarien, Rumänien
seit 1. Juli 2013:
Kroatien
Ausländische Entscheidungen in Ehesachen aus den Mitgliedsstaaten Belgien, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal,
Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich, die seit dem 1. März 2001 ergangen sind, gelten
ohne Anerkennungsverfahren nach § 107 FamFG unmittelbar in sämtlichen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
Für die später zur Europäischen Union beigetretenen Staaten gilt:
Ausländische Entscheidungen in Ehesachen, die in den später zur Europäischen Union bei-
getretenen Mitgliedsstaaten seit dem Datum ihres Beitritts ergangen sind, gelten ohne
Anerkennungsverfahren nach § 107 FamFG unmittelbar in sämtlichen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union.
Folgende Unterlagen sind als Nachweis der Scheidung vorzulegen:
eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt
und
• eine Bescheinigung nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 bzw. Artikel 39
der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003, Anhang I bis ggf. Anhang IV.
Eine Apostille oder Legalisation ist nicht erforderlich.19
Soweit eine Entscheidung in einem Versäumnisverfahren ergangen ist, muss zusätzlich
die Urschrift oder die beglaubigte Abschrift der Urkunde, aus der sich ergibt, dass das
verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück der Partei, die sich
nicht auf das Verfahren eingelassen hat, zugestellt wurde
oder
eine Urkunde, aus der hervorgeht, dass der Antragsgegner mit der Entscheidung eindeutig
einverstanden ist,
vorgelegt werden.
Hinweis:
Nach wie vor ist die förmliche Anerkennung gem. § 107 FamFG bei Entscheidungen der
Mitgliedsstaaten Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich, die vor dem
1. März 2001 (Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000) ergangen sind, erforderlich.
Für die Staaten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik, Slowenien,
Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, die seit dem 1. Mai 2004 der Europäischen Union
beigetreten sind, sowie Bulgarien, Rumänien seit 1. Januar 2007, und Kroatien zum
1. Juli 2013, gelten die erleichternden Anerkennungsvoraussetzungen erst ab Beitritt. Das
heißt, Entscheidungen aus Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik,
Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, die vor dem Beitritt am 1. Mai 2004
bzw. aus Bulgarien und Rumänien, die vor dem Beitritt am 1. Januar 2007 ergangen sind
sowie Entscheidungen aus Kroatien vor dem Beitritt am 1. Juli 2013 bedürfen somit der
förmlichen Anerkennung nach § 107 FamFG.
Unabhängig davon, ob von dem zuständigen Gericht des jeweiligen Mitgliedsstaates der
Europäischen Union die rechtskräftige Entscheidung in Ehesachen mit der Bescheinigung
nach Artikel 39 der EG-Verordnung versehen wurde, ist bei Entscheidungen aus Mit-
gliedsstaaten aus Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich, die vor dem
1. März 2001 (Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000) ergangen sind sowie bei
Entscheidungen aus Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik,
Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, vor dem Beitritt am 1. Mai 2004, aus20 Bulgarien und Rumänien, vor dem Beitritt am 1. Januar 2007 und aus Kroatien vor dem Beitritt am 1. Juli 2013, die förmliche Anerkennung solcher Entscheidungen nach § 107 FamFG erforderlich. Näheres ist im Länderteil Scheidungsanerkennung zu finden.
Sie können auch lesen