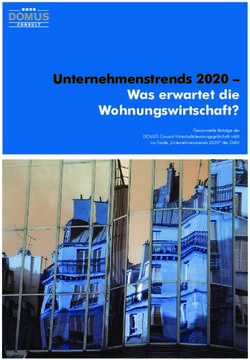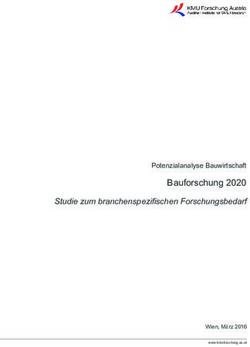LUNGENFUNKTION UND EXHALIERTES STICKSTOFF-MONOXID BEI VERWENDUNG VON TAUCHGERÄTEN MIT VOLLMASKE UND MUNDSTÜCKGARNITUR
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Universitätsklinikum Ulm
Klinik für Anästhesiologie
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. Michael Georgieff
LUNGENFUNKTION UND EXHALIERTES STICKSTOFF-
MONOXID BEI VERWENDUNG VON TAUCHGERÄTEN
MIT VOLLMASKE UND MUNDSTÜCKGARNITUR
Dissertation zur Erlangung des
Doktorgrades der Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm
vorgelegt von
Yannick Peter Lungwitz
aus Sindelfingen
2018Amtierender Dekan: Prof. Dr. med. Thomas Wirth
1. Berichterstatter: Prof. Dr. med. Claus-Martin Muth
2. Berichterstatter: Priv.-Doz. Dr. med. Alexandre Serra
Tag der Promotion: 26. Juni 2020Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................... III
1 Einleitung ............................................................................................................ 1
1.1 Physiologische Vorbemerkungen .......................................................................... 2
1.2 Verschiedene Tauchgeräte ..................................................................................... 3
1.3 Festlegung der medizinischen Ziele der Studie ................................................... 4
2 Material und Methoden ...................................................................................... 5
2.1 Probandenauswahl und Voruntersuchungen ....................................................... 5
2.2 Studienprotokoll ...................................................................................................... 7
2.3 exspiratorisches Stickstoffmonoxid .................................................................... 11
2.4 Spirometrie ............................................................................................................. 14
2.5 Datenanalyse und Statistik ................................................................................... 17
3 Ergebnisse ........................................................................................................ 19
3.1 eNO ......................................................................................................................... 19
3.2 Spirometrie ............................................................................................................. 22
4 Diskussion ........................................................................................................ 36
4.1 eNO ......................................................................................................................... 39
4.2 Spirometrie ............................................................................................................. 41
4.3 Einschränkungen und Limitationen der Studie .................................................. 42
4.4 Tauchen und Asthma ............................................................................................ 43
5 Zusammenfassung........................................................................................... 48
6 Literaturverzeichnis ......................................................................................... 50
7 Bildnachweis .................................................................................................... 58
8 Anhang .............................................................................................................. 59
8.1 Abbildungsverzeichnis ......................................................................................... 59
8.2 Tabellenverzeichnis .............................................................................................. 60
8.3 Danksagung ........................................................................................................... 61
8.4 Curriculum vitae .................................................................................................... 62
IIAbkürzungsverzeichnis
BMI Body-Mass-Index
EIB Exercise-induced bronchoconstriction – Belastungsinduzierte
Bronchokonstriktion
eNO Exspiratorisches Stickstoffmonoxid
FEF Forced expiratory flow – Fluss während der Exspiration
FEV1 Forced expiratory volume in 1 second – forciertes exspiratorisches
Volumen in einer Sekunde
FVC Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität
GINA Global Initiative for Asthma – Organisation zur Bekämpfung von Asthma
hPa Hektopascal – Einheit für Druck, 1 hPa = 1 mbar
ICS Inhalative Corticosteroide
MMEF Maximum midexpiratory flow – der durchschnittliche Fluss in den
mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung, also von 25% bis
75% der FVC
MPa Megapascal – Einheit für Druck (1 Pa = 1 N / m2)
NO Stickstoffmonoxid
PEF Peak expiratory flow – maximaler Ausatemfluss
ppb Parts per billion – Teile pro Milliarde
ü. NN über Normal Null – bezieht sich auf Höhenangaben
III1 Einleitung
„Taucher sind Männer großer Muskelkraft, mit gesunden Organen. [...] Taucher
sind Männer hoher geistiger Kraft, von Verstand und einwandfreier Moral [91].“
So beschreibt es Hermann Stelzner, der damalige Direktor der Drägerwerke
Lübeck, in seinem Buch im Jahre 1931. In den vergangenen 80 Jahren haben sich
nicht nur geschlechtliche Rollenbilder, sondern auch die Umstände, unter denen
getaucht wird, stark verändert. So ist das Tauchen mit von der atmosphärischen
Umgebungsluft unabhängigen Tauchgeräten in den letzten Jahrzehnten zu einer
populären Freizeitbeschäftigung für Männer und Frauen mit sehr unterschiedlichen
Konstitutionen geworden.
Mit der steigenden Anzahl an Freizeittauchern hat auch die Anzahl an
Tauchinteressierten mit Erkrankungen, die das Tauchen und die Tauchtauglichkeit
einschränken (z.B. Asthma), zugenommen. Heute wird im Rahmen einer
taucherärztlichen Untersuchung allerdings nicht nur das tauchbedingte Risiko für
den Taucher selbst, sondern auch jenes für dessen Partner, den sog. Buddy
abgewogen [87]. Dieser kann wegen eines durch eine vorbestehende Erkrankung
ausgelöstes plötzliches Problem des Tauchpartners unter Wasser ebenfalls
gefährdet sein. Noch in den 1970er und 1980er Jahren stellte eine
Asthmaerkrankung wie auch viele andere chronische Erkrankungen eine absolute
Kontraindikation für die Ausübung des Tauchsports dar [65, 92]. Inzwischen sind
die Leitlinien zum Umgang mit Asthma bei Tauchinteressierten zunehmend liberaler
geworden, so dass heute auch Tauchinteressierte mit einer leichten
Asthmaerkrankung, solange diese kontrolliert ist, zum Tauchen zugelassen werden
können [101]. Besonders aufgrund dieser neueren, liberaleren Empfehlungen,
welche die Tauchtauglichkeit mit Asthma betreffen, üben heute mehr Menschen,
die unter Asthma leiden, den Tauchsport aus [2, 101]. Das Vorliegen von Asthma
scheint aber mit einer höheren Anfälligkeit für Tauchunfälle assoziiert zu sein [24].
Auch in der Presse wird das Thema Tauchen mit Asthmaerkrankung bzw. mit einem
Asthmaanfall unter Wasser bereits aufgegriffen [66].
Weil Gas seine Dichte und damit auch seine Viskosität bei Druckerhöhungen
verändert, ist die Lunge als gasaustauschendes Organ beim Tauchen besonders
1gefordert. Somit hat die Pulmologie und die Untersuchung der Lungenfunktion einen
besonderen Stellenwert für die Tauchmedizin. Es findet aber nicht nur Transfer von
Wissen aus der Pulmologie statt, sondern ursprünglich für das Tauchen genutzte
Erkenntnisse finden umgekehrt ihren Weg in die Pulmologie [102]. Außerdem steigt
die Prävalenz und Inzidenz von Asthma weltweit (in manchen Ländern der
westlichen Welt bereits Prävalenzen von über 15%) [68].
Dies bot auch der vorliegenden Promotionsschrift Anlass, sich mit dem Thema
auseinander zu setzen. Sie beschäftigt sich mit der Wirkung von Atemluft aus
verschiedenen Tauchgeräten auf die Lungenfunktion bei gesunden Personen,
sowie bei Personen, die an Asthma bronchiale erkrankt sind. In diesem Kapitel
werden zunächst einleitend einige physiologische Vorbemerkungen gemacht und
dann verschiedene Tauchgeräte eingeführt. Zuletzt werden die wissenschaftlichen
Fragestellungen dieser Arbeit formuliert.
1.1 Physiologische Vorbemerkungen
Es ist bekannt, dass bestimmte Reize, wie kalte und besonders trockene [9], oder
auch sehr feuchte [19, 84] Luft sowie auch Allergene zu bronchialer
Hyperreagibilität und Bronchokonstriktion führen können. Möglich ist, dass diese,
wenn sie unter Wasser auftreten, zu ernsthaften gesundheitlichen
Beeinträchtigungen oder sogar zum Tode führen können. Die Atemluft zum
Tauchen hat allerdings den Vorteil, dass sie beim Befüllen der Druckgasbehälter
mit Hilfe eines für Atemluft zugelassenen Kompressors mehrere Filter und einen
Trocknungsprozeß durch Entzug der Luftfeuchtigkeit durchläuft. Auf diese Weise ist
die Atemluft aus dem Tauchgerät sehr trocken und in hohem Maße frei von
Allergenen wie Pollen oder tierischen Proteinen.
Zwei Faktoren müssen in einer Diskussion über Bronchialasthma berücksichtigt
werden: 1. Die Entzündung der kleinen Luftwege als pathophysiologisches
Grundgeschehen und 2. die Bronchokonstriktion, die zur Asphyxie, oder innerhalb
kürzester Zeit zum Einschließen von Luft in den kleinen Atemwegen, dem so
genannten „Air trapping“, führen kann, was bei Atmung von Luft im Überdruck und
einer Druckreduktion beim Auftauchen durch Anwendung des physikalischen
2Gesetzes von Boyle und Mariotte zu einer Überblähung der Lunge mit
möglicherweise fatalen Folgen führen kann.
1.2 Verschiedene Tauchgeräte
Ein übliches Drucklufttauchgerät besteht heute aus einer oder zwei
Druckluftflaschen, dem Druckminderer (1. Stufe), der den Flaschendruck auf einen
konstanten Mitteldruck im Bereich von 4 bis 15 hPa über dem jeweiligen
Umgebungsdruck reduziert, und dem Lungenautomaten (2. Stufe), der den Druck
weiter bis leicht oberhalb des jeweiligen Umgebungsdruckes reduziert. Die Geräte
werden dabei noch um Mess- und Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel
Warngeräte für einen zur Neige gehenden Luftvorrat, ergänzt [4].
Inzwischen ist die Nutzung von Vollmasken, bei denen das gesamte Gesicht vom
Maskenkörper umschlossen ist, beim Tauchen im Wasserrettungsdienst, bei der
Feuerwehr und beim technischen Hilfswerk alltäglich. Es wird langsam und
besonders im Winter sowie beim Betauchen kalter Gewässer auch bei
Freizeittauchern zunehmend populärer, als der Gebrauch eines Atemreglers mit
Mundstückgarnitur in Kombination mit einer normalen Tauchermaske, bei der nur
die Augenpartie und die Nase umschlossen sind. Die Atmung erfolgt hierbei
ausschließlich über den Mund, eine Atmung über die Nase ist bei der
Konventionellen Kombination aus Tauchermaske und Atemregler nicht möglich. Bei
der Nutzung einer solchen, das gesamte Gesicht inklusive Mundbereich
umschließenden Vollmaske ist es dem Taucher hingegen möglich, durch die Nase
zu atmen, wodurch die Atemluft angefeuchtet und erwärmt wird. Damit werden die
für Asthmatiker potentiell gefährlichen Stimuli reduziert. Dadurch, dass sie einen
großen Teil des Gesichts umschließt, besteht ein weiterer Nutzen darin, dass das
Gesicht des Tauchers vor kaltem oder verschmutztem Wasser geschützt wird.
Asthmatiker sind gegenüber den oben genannten Auslösern (kalte und trockene
Atemluft) vulnerabler und können dadurch eher zur Bronchokonstriktion
und -obstruktion neigen [86]. Daher könnten sie besonders von einer Reduktion
dieser Stimuli durch Vollmasken profitieren.
31.3 Festlegung der medizinischen Ziele der Studie
Das allergische Asthma beruht auf einer Entzündung der Mucosa innerhalb der
Bronchien [25]. Erhöhte Entzündungswerte im Sinne erhöhter exspiratorischer
Stickstoffmonoxid-Anteile [31] und kompromittierte Ergebnisse in der Spirometrie
[17] sind Anzeichen für eine Verschlechterung einer vorliegenden
Asthmaerkrankung.
Dabei bietet das Niox MINO als relativ neues Gerät eine handliche und schnelle
Lösung zur Messung des eNO im Sinne einer point-of-care-Diagnostik, also einer
Diagnostik, direkt am Ort und zum Zeitpunkt des Entstehens. Der Goldstandard
Bestimmung des eNO, die Messung über das Chemolumineszenzverfahren, wurde
ebenfalls in die Überlegungen zur Studie mit einbezogen [46].
Ziel der Studie ist es, zu evaluieren, ob die unterschiedlichen Typen des
Atemanschlusses eine Auswirkung auf eosinophile Atemwegsentzündungen und
Bronchokonstriktion haben. Dabei werden Atemregler mit Mundstückgarnitur und
Vollmaske als Atemanschluss betrachtet.
Damit sollen vor allem drei Fragestellungen beantwortet werden:
Kann es durch die kalte und trockene Luft zu einer Verschlechterung der
vorliegenden Entzündungssituation kommen?
Ist es im Hinblick auf die Entzündungssituation und Obstruktion für
Asthmatiker oder gesunde Probanden von Vorteil, einen bestimmten
Atemanschluss-Typ zu nutzen?
Kann allein die Atemluft aus dem Tauchgerät für klinisch relevante Effekte im
Hinblick auf Entzündungssituation und Lungenfunktion verantwortlich sein?
42 Material und Methoden
2.1 Probandenauswahl und Voruntersuchungen
Die vorliegende Studie wurde von der Ethikkommission der Universität Ulm unter
dem Aktenzeichen 90/11 im Mai 2011 genehmigt. In die Studie wurden nur
freiwillige und mindestens Probanden aufgenommen. In den folgenden Abbildungen
1 und 2 sind die Ein- und Ausschlusskriterien der Probandenauswahl aufgeführt.
Einschlusskriterien:
- Alter: 18 – 55 Jahre
- Männliches Geschlecht
- Unauffällige Einschlussuntersuchung
- Grundsätzliche Tauchtauglichkeit
Abb. 1:
Einschlusskriterien für die Probandenauswahl
Ausschlusskriterien:
- Allergien, die kein Asthma bronchiale verursacht haben
- Allergisches Asthma bronchiale „teilweise oder nicht kontrolliert“ [44]
- Belastungsinduziertes Asthma bronchiale
- Allergische Rhinitis / Sinusitis
- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung
- Regelmäßiges Rauchen innerhalb der letzten zehn Jahre.
- Zustand nach pulmonalem Barotrauma beim Tauchen
- Zustand nach thoraxchirurgischem Eingriff
- Sonstige pulmonale Erkrankungen
Abb. 2:
Ausschlusskriterien für die Probandenauswahl
Die Probanden wurden über eine Informationskampagne an der Universität Ulm und
in den lokalen Tauchclubs und -vereinen in und um Ulm rekrutiert. Alle Probanden
mussten sich vor ihrer Teilnahme an der Studie einer medizinischen Untersuchung
unterziehen. Die Untersuchung bestand aus der Auskultation von Herz und Lunge,
der Erhebung der Werte für Puls, Blutdruck und Sauerstoffsättigung des peripheren
Blutes sowie einer otoskopischen Untersuchung des Trommelfells und der
5Ableitung eines Ruhe-Elektrokardiogramms. Ein bekanntes und vom Probanden als
kontrolliert eingestuftes allergisches Asthma bronchiale (als gut kontrolliert nach
den GINA-Kriterien [44], in Tabelle 1 dargestellt, eingestuft) führte zur Zuordnung in
die Gruppe der Asthmatiker. Die Zuordnung zur Asthmagruppe erfolgte dabei nach
anamnestischen Angaben der Probanden.
Tabelle 1:
Status der Asthmakontrolle nach GINA (Global Initiative for Asthma) [44]:
Hatte der Patient in den letzten 4 Wochen: Asthma gut Asthma teilweise Asthma nicht
kontrolliert kontrolliert kontrolliert
Häufiger als 2-mal pro Woche Symptome
tagsüber
Jemals nächtliches Aufwachen wegen Asthma Keines der 1 bis 2 der 3 bis 4 der
Häufiger als 2-mal pro Woche Notwendigkeit genannten genannten genannten
für bronchialerweiternden Notfallspray Symptome Symptome Symptome
Jemals Aktivitätseinschränkungen wegen
Asthma
Eine solche anamnestische Aufteilung ist auch bei real durchgeführten
Tauchtauglichkeitsuntersuchungen gängige Praxis zusätzlich zur obligaten
spirometrischen Untersuchung [40]. Die Einschlussuntersuchung entsprach somit
dem in Deutschland empfohlenen Vorgehen bei der
Tauchtauglichkeitsuntersuchung [79]. Die Asthma-Gruppe bestand aus fünf und die
Kontrollgruppe aus neun Probanden. Alle Probanden wurden ausführlich schriftlich
und mündlich über die Studie, deren Zielsetzung und mögliche Risiken aufgeklärt.
Die Dokumentation erfolgte durch die Unterschrift der Einverständniserklärung. Die
Teilnahme an der Studie war freiwillig. Es erfolgten weder
Aufwandsentschädigungen noch eine Vergütung der entstandenen Fahrtkosten.
Die Rekrutierung der Probanden erfolgte ab Juni 2011. Die Messreihen fanden im
Zeitraum zwischen Juni 2011 und Januar 2012 statt. Die Messungen erfolgten in
den Räumen der Anästhesie-Ambulanz der Klinik für Anästhesiologie im Bereich
Safranberg am Universitätsklinikum Ulm. Die täglichen Atemprovokationen wurden
von den Probanden selbständig zu Hause durchgeführt. Die Probanden wiesen
bezüglich der demographischen Daten und der Anzahl der bisherigen Tauchgänge
die in Tabelle 2 aufgeführten Werte auf.
6Tabelle 2:
Probandendaten (Mittelwerte ± Standardabweichung (Spannweite), BMI: Body-Mass-Index) –
Messungen zu Beginn der Testreihen am Universitätsklinikum Ulm (4.7.2011 – 5.12.2011)
Probandendaten Asthma-Gruppe Kontrollgruppe Gesamt
Anzahl der
5 9 14
Probanden
Alter in Jahren 25,2 ± 2,4 (22 – 28) 28,9 ± 5,8 (23 – 42) 27,6 ± 4,9 (22 – 42)
Größe in cm 185 ± 7,1 (179 – 197) 183 ± 4,6 (175 – 191) 184 ± 5,4 (175 – 197)
Gewicht in kg 83 ± 10,1 (70 – 95) 77 ± 10,0 (64 – 97) 79,0 ± 10,1 (64 – 97)
BMI in kg/m2 24,2 ± 2,6 (20,5 – 26,9) 23,0 ± 2,8 (19,8 – 29,3) 23,5 ± 2,7 (19,8 – 29,3)
Anzahl der
bisherigen 4,2 ± 6,8 (0 – 16) 274 ± 343,2 (0 – 1000) 177,6 ± 300,9 (0 – 1000)
Tauchgänge
2.2 Studienprotokoll
Jeder Proband führte zwei Testreihen in randomisierter Reihenfolge durch: Rein
nasale Atmung über eine Vollmaske und rein orale Atmung über einen
Lungenautomaten mit direkt Mundstückgarnitur. Jede Provokationsserie erfolgte an
fünf aufeinanderfolgenden Tagen. An jedem dieser fünf Tage atmeten die
Probanden am späten Nachmittag oder am frühen Abend einstündig über den
jeweiligen Atemanschluss-Typ bei Atmosphärendruck, also normobaren
Umgebungsverhältnissen. Die Probanden hatten in den zwei Wochen vor jeder
Provokationsserie und während der Provokationsserie Tauchverbot. Die Einhaltung
wurde bei jedem Termin abgefragt. Außerdem wurden die Probanden zu Hause
besucht, um evtl. auftretende Probleme bei der Handhabung der Geräte unmittelbar
zu lösen. Hierbei kam es allerdings zu keinem nötigen Eingriff, da alle Probanden
gut mit der Benutzung der Tauchgeräte zurechtkamen.
Der Aufbau eines üblichen und hier verwendeten Tauchgerätes lässt sich der
folgenden Abbildung 3 entnehmen.
7Abb. 3:
Schematischer Aufbau eines Tauchgerätes (MPa: Megapascal, Einheit für Druck)
Die Provokation erfolgte einerseits mit einem gewöhnlichen Atemregler mit
Mundstückgarnitur (Poseidon Cyklon 5000, Poseidon Diving Systems AB, Västra
Frölunda, Schweden, Abb. 4).
8!
!
/GGL+WF++
D$#+(:!;4(&$=4#!NV+,4#:!I-#=()18+!
a2T='-8+!.$)!0'&-#=,$83&'!@&#&3.$5-#5!%4#!2#='&?(!M-'()\!",.c!
B1' =$&! ;'4%4+?)$4#! .$)! =&'! S4,,.?(+& E-'=&! &#)E&=&'! &$#& U#)&'(Z$'4! 9$%?)4'!
>?(+&!aU#)&'(Z$'4!2M\!K*TV\!F83E&=&#\!2TT?(+&! a9'*5&'! F?0&)V! 2@\! D1T&8+\! 9&-)(83,?#=\! 2TT/UUU!?#5&(83,4((&#!aU#)&'(Z$'4!2M\!K*TV\!F83E&=&#c;?c! 5&#-)7)$#$!S&')$+-(!UUU\!M?-&'!N4.Z\!>1#83&#\!9&-)(83,?#=c!
E$&=&'! ?-05&01,,)Abb. 5:
Interspiro Divator Vollmaske (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Firma Aqualung GmbH,
Singen)
Abb. 6:
Dräger Panorama Nova Dive Vollmaske (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Firma
Aqualung GmbH, Singen)
Die Abkühlung der Atemluft wurde durch den Joule-Thomson-Effekt ausgelöst. Der
Joule-Thomson-Effekt besagt, dass ein Gas, welches sich ausdehnt, abkühlt. Die
10einzelnen Moleküle haben nach einer Ausdehnung des Gases eine höhere Freiheit
und dadurch wird kinetische Energie in potentielle Energie umgewandelt. Durch den
Verlust an kinetischer Energie wird weniger Energie auf ein Thermometer oder auf
Gegenstände übertragen und das Gas besitzt damit eine niedrigere Temperatur
[51].
Die folgenden Untersuchungen wurden vor jeder Testreihe und innerhalb einer
Stunde nach Abschluss der Testreihe durchgeführt. Dabei wurde zuerst die Fraktion
an exhaliertem Stickstoffmonoxid (eNO) gemessen. Dies dauerte etwa 5 Minuten.
Direkt im Anschluss wurde die Spirometrie durchgeführt, was ebenfalls einen
Zeitaufwand von ca. 5 Minuten bedeutete. Die dabei erhobenen Messergebnisse
wurden für die Studie analysiert.
2.3 exspiratorisches Stickstoffmonoxid
Die Fraktion an exhaliertem Stickstoffmonoxid (eNO) wurde durch ein portables
Gerät, Niox MINO (Aerocrine AG, Solna, Schweden) gemessen. Das Niox MINO
misst über ein elektrochemisches Verfahren, das erst seit einigen Jahren genutzt
wird, die eNO-Konzentration. Im Vergleich zur etablierten Methode, die auf
Chemolumineszenz basiert, wird das Gerät als ausreichend genau angesehen, um
die eNO-Konzentration bei Asthmatikern und Patienten, die einen Verdacht auf ein
allergisches Asthma bronchiale haben, zu quantifizieren [15, 47]. Der Patient muss
zur Messung des eNO mit einem konstanten Ausatemfluss von ca. 50 ml / s in das
Niox MINO ausatmen. Zur Veranschaulichung dient hier Abb. 7.
11Abb. 7:
Niox MINO in der Anwendung (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Firma Circassia AG,
Bad Homburg)
Mit dem Niox MINO wurden jeweils zwei Messungen durchgeführt, die bei einem
Unterschied von nicht mehr als drei ppb gemittelt wurden. Lag der Unterschied über
drei ppb wurden zwei weitere Messungen durchgeführt, um dann die Messungen
ohne Ausreißer zu mitteln. Zur Übersicht der erhaltenen Werte dient die folgende
Tab. 3.
12Tabelle 3:
eNO-Werte in ppb (Parts per billion) und Interpretation bei erwachsenen Patienten zum Management
von Asthma [95] (ICS: inhalative Corticosteroide)
eNO- Eosinophile Interpretation und Therapievorschläge
Werte Entzündung der Symptomatisch Asymptomatisch
Atemwege
< 25 Unwahrscheinlich Differentialdiagnosen: • bei Einnahme von
• Neutrophiles Asthma inhalativen
• Angst / Hyperventilation Corticosteroiden (ICS):
• Stimmbanddysfunktion Gute Compliance, Dosis
• Gastro-ösophagealer kann reduziert werden
Reflux oder bei geringen Dosen
könnte die ICS-
Behandlung komplett
abgesetzt werden.
25-50 Vorhanden, aber • Infektion als Ursache der Keine Änderung der ICS-
leichtgradig Verschlechterung Dosis
• Hohe Allergen-Exposition
• Ansetzen einer weiteren
Therapie (z.B. lang-
wirksamer β-Agonist)
• Erhöhen der ICS-Dosis
> 50 Signifikant • Inadäquate ICS- Keine Änderung der ICS-
Behandlung: Dosis
1. Compliance
2. Schlechte
Inhalationstechnik
3. Zu geringe ICS-Dosis
• Dauerhaft hohe Allergen-
Exposition
• Bevorstehende
Exazerbation oder Rückfall,
je nach
Patientengeschichte, eher
ohne ICS-Medikation
132.4 Spirometrie
Nach der eNO-Messung wurde die Bronchokonstriktion mit einer Spirometrie
gemessen (Jaeger Master Scope TP, Höchberg, Deutschland). Der hierbei
verwendete Pneumotachograph funktioniert nach dem
Siebpneumotachographsystem, das eine Abwandlung von Lilly [63] des 1925 von
Fleisch erstbeschriebenen Gerätes ist [37]. Dabei atmet der Proband die Luft durch
ein Sieb, welches als Widerstand innerhalb eines laminaren Luftstroms angebracht
ist. Vor und hinter dem Sieb wird der Druck gemessen. Durch den Widerstand des
Siebs, der bekannt ist, kommt es zu einem Druckabfall. Aus diesem kann auf die
Flussgeschwindigkeit der Luft geschlossen werden. So werden über weitere
Berechnungen des angeschlossenen Computers die Luftmengen ermittelt. Der
Computer zeigt dem Anwender dann schlussendlich eine Fluss-Volumen-Kurve mit
entsprechenden Messwerten. Aus der Kombination von Kurve und Messwerten
kann dann eine Aussage über die Lungenfunktion des Patienten getroffen werden
[22].
14Abb. 8:
Spirometrie mittels Jaeger Master Scope TP (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Firma
Vyaire GmbH, Höchberg)
Die Spirometrie wurde in stehender Position mit einer Nasenklammer durchgeführt
(Abb. 8). Das Spirometer wurde vor jeder Messung nach Eingabe von Meereshöhe
(m ü. NN), Luftdruck (hPa) und Temperatur (°C) mittels einer Kalibrationspumpe mit
einem bekannten Volumen (3 l) kalibriert. Die Messungen wurden nach der
europäischen Leitlinie für die Spirometrie durchgeführt [72]. Als Standardwerte
wurden die Werte der europäischen Gesellschaft für Kohle und Stahl genutzt, die
nach Größe, Gewicht, Geschlecht und Alter des Probanden justiert sind [80].
Die folgenden Parameter wurden für weitere Analysen aufgezeichnet: Forcierte
Vitalkapazität (FVC), also die Kapazität, die dem Probanden während der forcierten
Exspiration zur Verfügung steht. Das forcierte exspiratorische Volumen in einer
Sekunde (FEV1), also das Volumen, das der Proband innerhalb der ersten Sekunde
des Exspirationsvorganges maximal ausatmen kann. Der Tiffeneau-Quotient
FEV1/FVC, der Aufschluss über eine mögliche Obstruktion der Atemwege gibt und
der maximale Luftfluss während der Ausatmung (PEF). In Abb. 9 wird ein einfaches
15und am Tauchplatz mitführbares Gerät gezeigt, dass nur den PEF misst. Dieses
Gerät ist ohne Strom und damit ohne besondere Voraussetzungen an die
Umgebung nutzbar.
Abb. 9:
Vitalograph Peak Flow Meter (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Firma Vitalograph
GmbH, Hamburg)
Außerdem wurde der mittlere exspiratorische Fluss nach 25%, 50% und 75% der
exspirierten FVC (FEF25, FEF50, FEF75) sowie der maximale mittlere
exspiratorische Fluss (MMEF) aufgezeichnet. Letzterer berechnet sich aus der
halben FVC, geteilt durch die Zeit zwischen der Ausatmung von 25% und 75% des
Volumens. Es wurden insgesamt mindestens fünf Spirometriemanöver
durchgeführt. Im Falle von stark fluktuierenden Werten wurde leitlinienkonform
weiter gemessen, bis sich verwertbare Ergebnisse zeigten (max. acht Versuche).
Nach jeder Messung wurde der Beste aus drei direkt aufeinander folgenden
Versuchen genutzt, wobei sich FVC und FEV1 innerhalb dieser Versuche um nicht
mehr als 5% unterscheiden durften. Ein Beispiel einer Fluss-Volumen-Kurve aus
einer spirometrischen Untersuchung zeigt die Abbildung 10.
16Abb. 10
Beispiel einer Spirometrie - Fluss-Volumen-Kurve (Normalbefund - durchgezogene Linie und
Obstruktion der Atemwege - gestrichelte Linie) PEF: Peak exspiratory flow – maximaler
Ausatemfluss; FVC: forced vital capacity – forcierte Vitalkapazität
2.5 Datenanalyse und Statistik
Für die statistische Analyse wurden Microsoft Excel 2011 (Microsoft Inc. Redmond,
Washington, USA) und SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) (IBM
Inc., Armonk, New York, USA) auf einem Apple Macintosh (OS X 10.9) genutzt.
Die körperlichen Daten der Probanden, die Anzahl der Tauchgänge sowie alle
weiteren Variablen wurden für die Durchführung parametrischer Testverfahren auf
eine Normalverteilung innerhalb der Gruppen mithilfe des Kolmogorov-Smirnov-
Tests untersucht. Dieser Test ist besonders für die Testung kleinerer Stichproben
(hier mit einer Fallzahl von n = 14) geeignet [45]. Normalverteilte Variablen wurden
durch gepaarte und unabhängige T-Tests untersucht. Es wurden sowohl die
absoluten (post - prä) als auch die relativen ((post - prä) / prä) Differenzen
berechnet.
Ein gepaarter t-Test wurde über die prä-Provokationswerte (Vollmaske vs.
Atemregler mit Mundstückgarnitur), die absoluten und relativen Differenzen jeder
17Messung selbst (prä-Provokationem vs. post-Provokationem) und über die post-
Provokationswerte durchgeführt. Ein unabhängiger t-Test wurde über die jeweiligen
Werte (prä-Provokationem, post-Provokationem, prä- vs. post-Provokationem)
durchgeführt, um Unterschiede in der Spirometrie und im eNO-Wert zwischen
Asthmatikern und gesunden Probanden zu detektieren.
Im Falle einer Nicht-Normalverteilung wäre der Wilcoxon-Test zum Einsatz
gekommen. Es konnte jedoch in allen Fällen von einer Normalverteilung
ausgegangen werden.
Bei allen o.g. Tests wurde von einem Signifikanzniveau von 5% ausgegangen,
somit wurde ab einem p < 0,05 also von einer statistischen Signifikanz
ausgegangen.
183 Ergebnisse
Nach dem Abschluss der Voruntersuchungen konnten von den 15 Bewerbern
letztlich 14 Bewerber als Teilnehmer der Studie die Atemreihen und Messungen
durchführen. Der Proband, der ausgeschlossen werden musste, zeigte ein nach
GINA nicht kontrolliertes Asthma bronchiale, mit Asthmaanfällen bereits während
der Einschlussuntersuchung. Dadurch kam seine weitere Teilnahme nicht in Frage.
Bei einem Probanden fiel ein Herzgeräusch auf, das aber bereits bekannt und
kardiologisch abgeklärt war und als rein funktionell gewertet wurde. Alle 14
Probanden führten die beiden Atemreihen durch. Somit konnten alle klinischen
Daten ausgewertet werden. Kein Proband zeigte Anzeichen einer
Gesundheitsschädigung durch die Provokationen. Während der Durchführung der
Studie kam es zweimal zu Störungen der Versuche. Ein Proband hatte das
Tauchverbot missverstanden und am Vortag der Atemreihe einen Tauchgang
durchgeführt. In dem anderen Fall fiel das Niox MINO aus. Hier wurden die Termine
jeweils verschoben und die Messungen noch einmal komplett von Beginn an und
dann ohne Probleme durchgeführt.
Die körperlichen Daten und die Anzahl der Tauchgänge der Probanden waren
normalverteilt und zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen
Gruppen. Auch alle Parameter der Messungen waren gemäß einer Analyse mittels
Kolmogorov-Smirnov-Tests normal verteilt.
3.1 eNO
Die Probanden in der Asthma-Gruppe zeigten erwartungsgemäß vor den
Testreihen eine signifikant höhere eNO-Konzentration als die Kontrollgruppe. Die
Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 4 dokumentiert.
19Tabelle 4:
eNO (Exspiratorisches Stickstoffmonoxid) - Werte in ppb (Parts per billion) der Asthma- und
Kontrollgruppe vor den Atemreihen. Messungen zwischen 4.7.2011 und 20.1.2012 am
Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung (Spannweite))
p-Wert
Asthmagruppe Kontrollgruppe Asthma vs.
Kontrollgruppe
Vor Vollmaske 27 ± 15,6 (11 – 52) 14 ± 3,2 (11 – 21) < 0,05
Vor Atemregler mit
32 ± 15,2 (17 – 52) 14 ± 2,2 (12 – 17) < 0,05
Mundstückgarnitur
Gesamt 29 ± 14,7 (11 – 52) 14 ± 2,7 (11 – 21) < 0,05
Nach den Atemreihen ergab sich ein ähnliches Bild, dargestellt in Tabelle 5. Auch
hier lagen die eNO-Konzentrationen in der Asthmagruppe signifikant höher als in
der Kontrollgruppe.
Tabelle 5:
eNO (Exspiratorisches Stickstoffmonoxid) - Werte in ppb (Parts per billion) der Asthma- und
Kontrollgruppe nach den Atemreihen. Messungen zwischen 4.7.2011 und 20.1.2012 am
Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung (Spannweite))
p-Wert
Asthmagruppe Kontrollgruppe Asthma vs.
Kontrollgruppe
Nach Vollmaske 29 ± 16,0 (16 –55) 13 ± 2,5 (8 – 16) < 0,05
Nach Atemregler mit
36 ± 19,1 (16 –57) 14 ± 3,4 (11 – 22) < 0,05
Mundstückgarnitur
Gesamt 33 ± 17,0 (16 –57) 13 ± 3,0 (8 – 22) < 0,05
Die Gegenüberstellung der Werte vor und nach der Provokation zeigte in der
Asthmagruppe einen nicht signifikanten Anstieg der eNO-Konzentration jeweils
nach beiden Provokationen. Die Kontrollgruppe wies nach Atmung aus beiden
Atemanschlüsse jeweils einen nicht signifikanten Abfall der eNO-Konzentration auf.
In Tabelle 6 sind die berechneten absoluten Unterschiede während der Atemreihen,
unterschieden zwischen den beiden Gruppen und den verschiedenen
Atemanschlüssen dargestellt.
20Tabelle 6:
Absolute Differenzen der eNO (Exspiratorisches Stickstoffmonoxid) - Werte in ppb (Parts per billion)
der Asthma- und Kontrollgruppe. Messungen zwischen 4.7.2011 und 20.1.2012 am
Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung (Spannweite))
Asthmagruppe Kontrollgruppe p-Wert
Asthma vs.
Kontrollgruppe
Vollmaske 1,7 ± 2,5 (-1,5 – 5,0) -1,7 ± 1,9 (-4,5 – 1,5) < 0,05
Atemregler mit
4,6 ± 13,1 (-2,5 – 28,0) -0,7 ± 3,7 (-6,5 – 3,0) 0,26
Mundstückgarnitur
p-Wert Vollmaske
vs. Atemregler mit 0,67 0,50
Mundstückgarnitur
Es zeigte sich, dass es bei der Nutzung der Vollmaske zwischen den beiden
Gruppen zu einem signifikanten Unterschied der absoluten Differenzen der eNO-
Werte kommt.
Die relativen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bzw. zwischen den
beiden untersuchten Atemanschlüssen waren nicht signifikant. (Tabelle 7).
Tabelle 7:
Relative Differenzen der eNO (Exspiratorisches Stickstoffmonoxid) - Werte in % der Asthma- und
Kontrollgruppe nach den Atemreihen. Messungen zwischen 4.7.2011 und 20.1.2012 am
Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung (Spannweite))
p-Wert
Asthmagruppe Kontrollgruppe Asthma vs.
Kontrollgruppe
Vollmaske +9,9 ± 20,0 (-0,0 – 45,0) -10,0 ± 13,0 (-30,0 – 13,0) 0,09
Atemregler mit
+15,6 ± 45,0 (-0,0 – 96,0) -3,0 ± 23,0 (-30,0 – 29,0) 0,42
Mundstückgarnitur
p-Wert Vollmaske vs.
Atemregler mit 0,83 0,40
Mundstückgarnitur
Es sind auch hier Unterschiede zwischen den verschiedenen Atemanschlüssen
innerhalb der Gruppen sichtbar, allerdings ist sowohl der Unterschied zwischen den
21Atemanschlüssen innerhalb der Asthmagruppe als auch innerhalb der
Kontrollgruppe wieder nicht signifikant.
3.2 Spirometrie
Wie in Tabelle 8 dargestellt, gibt es im Bereich der spirometrischen Werte vor der
Atemreihe mittels Vollmaske keine signifikanten Unterschiede.
22Tabelle 8:
Werte der Spirometrie vor der Atemreihe mittels Vollmaske. Messungen zwischen 4.7.2011 und
16.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung) (FVC: Forced vital
capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second – forciertes
exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler Ausatemfluss,
FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC, FEF50: Forced
exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced exspiratory flow 75
– forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory flow – der
durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Vollmaske
p-Wert Asthma-
Präprovokation
Präprovokation
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Wert:
vs.
FVC in l 6,00 ± 0,86 6,04 ± 0,67 0,933
FEV1 in l 4,56 ± 0,40 5,05 ± 0,73 0,14
FEV1/FVC
73,7 ± 8,89 82,5 ± 5,32 0,09
in %
PEF in l/s 9,60 ± 1,57 10,6 ± 2,06 0,29
FEF25 in l/s 7,55 ± 2,40 9,84 ± 2,20 0,12
FEF50 in l/s 4,87 ± 1,79 6,06 ± 1,39 0,241
FEF75 in l/s 1,96 ± 0,79 2,35 ± 0,71 0,40
MMEF in l/s 4,01 ± 1,61 5,18 ± 1,28 0,21
23Tabelle 9 zeigt, dass sich vor der Atemreihe mit Mundstück keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Gruppen bezüglich der spirometrischen Werte ergeben.
Tabelle 9:
Werte der Spirometrie vor der Atemreihe mittels Atemregler mit Mundstückgarnitur. Messungen
zwischen 4.7.2011 und 16.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung)
(FVC: Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second
– forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler
Ausatemfluss, FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC,
FEF50: Forced exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced
exspiratory flow 75 – forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory
flow – der durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Atemregler mit Mundstückgarnitur
p-Wert Asthma-
Präprovokation
Präprovokation
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Wert:
vs.
FVC in l 6,01 ± 0,91 5,94 ± 0,64 0,87
FEV1 in l 4,56 ± 0,28 4,96 ± 0,66 0,14
FEV1/FVC
75,2 ± 10,25 81,6 ± 4,96 0,24
in %
PEF in l/s 8.84 ± 1,59 9,9 ± 2,39 0,33
FEF25 in l/s 7,75 ± 2,30 9,11 ± 2,17 0,31
FEF50 in l/s 4,80 ± 1,45 5,67 ± 1,15 0,29
24Atemregler mit Mundstückgarnitur
p-Wert Asthma-
Präprovokation
Präprovokation
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Wert:
vs.
FEF75 in l/s 2,02 ± 0,68 2,33 ± 0,50 0,40
MMEF in l/s 4,29 ± 1,31 4,99 ± 0,96 0,33
Ebenso weisen die spirometrischen Werte nach den Atemreihen mittels Vollmaske
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen auf (Tabelle 10).
25Tabelle 10:
Werte der Spirometrie nach der Atemreihe mittels Vollmaske. Messungen zwischen 8.7.2011 und
20.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung)
(FVC: Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second
– forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler
Ausatemfluss, FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC,
FEF50: Forced exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced
exspiratory flow 75 – forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory
flow – der durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Vollmaske
p-Wert Asthma- vs.
Postprovokation
Postprovokation
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Wert:
FVC in l 5,88 ± 0,57 6,00 ± 0,68 0,736
FEV1 in l 4,64 ± 0,46 5,06 ± 0,71 0,204
FEV1/FVC
78,42 ± 6,78 82,0 ± 5,68 0,349
in %
PEF in l/s 9,56 ± 1,76 10,91 ± 2,06 0,227
FEF25 in l/s 8,16 ± 2,19 9,71 ± 2,31 0,245
FEF50 in l/s 4,90 ± 1,74 5,96 ± 1,33 0,276
FEF75 in l/s 2,03 ± 0,67 2,40 ± 0,74 0,356
MMEF in l/s 4,33 ± 1,31 5,29 ± 1,29 0,257
26Gleiches zeigt sich nach Provokation mit dem Mundstück (in Tabelle 11). Hier treten
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen auf.
Tabelle 11:
Werte der Spirometrie nach der Atemreihe mittels Atemregler mit Mundstückgarnitur. Messungen
zwischen 8.7.2011 und 20.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ± Standardabweichung)
(FVC: Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second
– forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler
Ausatemfluss, FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC,
FEF50: Forced exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced
exspiratory flow 75 – forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory
flow – der durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Atemregler mit Mundstückgarnitur
p-Wert Asthma- vs.
Postprovokation
Postprovokation
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Wert:
FVC in l 5,96 ± 0,62 5,95 ± 0,59 0,98
FEV1 in l 4,63 ± 0,40 5,01 ± 0,73 0,23
FEV1/FVC
74,3 ± 9,10 82,0 ± 5,22 0,14
in %
10,79 ±
PEF in l/s 8,91 ± 2,04 0,11
1,93
FEF25 in l/s 8,26 ± 1,83 9,73 ± 2,45 0,23
FEF50 in l/s 4,80 ± 1,56 5,96 ± 1,45 0,21
27Atemregler mit Mundstückgarnitur
p-Wert Asthma- vs.
Postprovokation
Postprovokation
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Wert:
FEF75 in l/s 2,13 ± 0,65 2,32 ± 0,77 0,64
MMEF in l/s 4,22 ± 1,22 5,07 ± 1,31 0,26
Beim Vergleich der spirometrischen Werte vor und nach den Atemreihen zeigt sich
ein signifikanter Anstieg des PEF nach der Atmung durch das Mundstück in der
Kontrollgruppe. Wie Tabelle 12 zeigt, ergeben sich keine weiteren signifikanten
Änderungen der spirometrischen Werte.
28Tabelle 12:
p-Werte der Vergleiche vor und nach den Atemreihen. Messungen zwischen 4.7.2011 und
20.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm:
(FVC: Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second
– forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler
Ausatemfluss, FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC,
FEF50: Forced exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced
exspiratory flow 75 – forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory
flow – der durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Atemregler mit
Vollmaske
Mundstückgarnitur Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Asthmagruppe
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
Gesamt
Gesamt
Wert:
FVC in l 0,80 0,73 0,94 0,53 0,67 0,41
FEV1 in l 0,49 0,44 0,27 0,28 0,83 0,40
FEV1/FVC
0,48 0,67 0,99 0,15 0,55 0,32
in %
PEF in l/s 0,84 < 0,05 0,05 0,90 0,38 0,56
FEF25 in l/s 0,32 0,17 0,07 0,20 0,62 0,56
FEF50 in l/s 1,00 0,25 0,29 0,48 0,20 0,28
FEF75 in l/s 0,74 0,92 0,86 0,79 0,76 0,66
29Atemregler mit
Vollmaske
Mundstückgarnitur
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Asthmagruppe
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
p Post vs. Prä
Gesamt
Gesamt
Wert:
MMEF in l/s 0,83 0,70 0,86 0,36 0,84 0,37
Aus Tabelle 13 wird ersichtlich, dass die absoluten und relativen Änderungen, die
während der Atmung durch das Mundstück aufgetreten sind, sich nicht signifikant
zwischen der Asthma- und der Kontrollgruppe unterscheiden.
30Tabelle 13:
Absolute (Δabs) und relative (Δrel) Änderungen während der Atmung durch den Atemregler mit
Mundstückgarnitur. Messungen zwischen 4.7.2011 und 20.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm.
(Mittelwert ± Standardabweichung)
(FVC: Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second
– forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler
Ausatemfluss, FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC,
FEF50: Forced exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced
exspiratory flow 75 – forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory
flow – der durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Atemregler mit Mundstückgarnitur
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Asthmagruppe
p- Wert Δabs
Asthma- vs.
Asthma- vs.
p-Wert Δrel
Δabs
Δabs
Δrel
Δrel
Wert:
-0,05 -0,02 -0,00 -0,00
FVC in l 0,724 0,801
± 0,38 ± 0,16 ± 0,05 ± 0,03
0,07 0,06 0,02 0,01
FEV1 in l 0,889 0,861
± 0,22 ± 0,21 ± 0,05 ± 0,04
FEV1/FVC -0,89 -0,48 -0,01 0,01
0,400 0,479
in % ± 2,51 ± 3,18 ± 0,04 ± 0,04
-0,07 0,85 -0,00 0,10
PEF in l/s 0,124 0,098
± 0,69 ± 1,08 ± 0,08 ± 0,13
0,50 0,62 0,10 -0,07
FEF25 in l/s 0,848 0,794
± 0,99 ± 1,22 ± 0,20 ± 0,15
0,00 0,29 0,01 0,05
FEF50 in l/s 0,397 0,567
± 0,52 ± 0,70 ± 0,13 ± 0,12
0,11 -0,02 0,13 -0,02
FEF75 in l/s 0,728 0,565
± 0,66 ± 0,51 ± 0,51 ± 0,19
31Atemregler mit Mundstückgarnitur
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Asthmagruppe
p- Wert Δabs
Asthma- vs.
Asthma- vs.
p-Wert Δrel
Δabs
Δabs
Δrel
Δrel
Wert:
-0,06 0,08 0,01 0,01
MMEF in l/s 0,693 0,980
± 0,64 ± 0,61 ± 0,21 ± 0,11
Analog kann aus Tabelle 14 entnommen werden, dass sich die absoluten
Änderungen, die während der Atmung aus der Vollmaske auftreten, zwischen der
Asthma- und der Kontrollgruppe nicht signifikant unterscheiden.
32Tabelle 14:
Absolute (Δabs) und relative (Δrel) Änderungen während der Atmung durch die Vollmaske.
Messungen zwischen 4.7.2011 und 20.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm. (Mittelwert ±
Standardabweichung)
(FVC: Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second
– forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler
Ausatemfluss, FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC,
FEF50: Forced exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced
exspiratory flow 75 – forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory
flow – der durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Kontrollgruppe Vollmaske
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Asthmagruppe
Asthmagruppe
Asthma vs.
Asthma vs.
p Δabs
p Δrel
Δabs
Δabs
Δrel
Δrel
Wert:
-0,12 -0,04 -0,01 -0,01
FVC in l 0,689 0,752
± 0,38 ± 0,25 ± 0,05 ± 0,04
0,08 0,01 0,02 0,00
FEV1 in l 0,448 0,472
± 0,14 ± 0,17 ± 0,03 ± 0,03
FEV1/FVC 4,64 -0,58 0,07 -0,01
0,116 0,034
in % ± 5,79 ± 2,81 ± 0,09 ± 0,03
-0,05 0,21 -0,01 0,02
PEF in l/s 0,583 0,559
± 0,86 ± 0,67 ± 0,08 ± 0,07
0,61 -0,13 0,11 -0,01
FEF25 in l/s 0,158 0,231
± 0,89 ± 0,74 ± 0,19 ± 0,08
0,03 -0,11 0,01 -0,01
FEF50 in l/s 0,240 0,205
± 0,07 ± 0,23 ± 0,02 ± 0,04
0,06 0,05 0,09 0,04
FEF75 in l/s 0,968 0,776
± 0,48 ± 0,48 ± 0,34 ± 0,22
0,32 0,03 0,14 0,01
MMEF in l/s 0.355 0,225
± 0,69 ± 0,44 ± 0,29 ± 0,08
33Tabelle 15 stellt die p-Werte in den Vergleichen der verschiedenen Atemanschlüsse
innerhalb der Asthma- und der Kontrollgruppe dar. Dabei zeigen sich keine
Unterschiede im signifikanten Bereich.
34Tabelle 15:
p-Werte der Vergleiche innerhalb der Asthma- und Kontrollgruppe zwischen den verschiedenen
Atemanschlüssen. Messungen zwischen 4.7.2011 und 20.1.2012 am Universitätsklinikum Ulm.
(FVC: Forced vital capacity – Forcierte Vitalkapazität, FEV1: Forced expiratory volume in 1 second
– forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, PEF: Peak expiratory flow – maximaler
Ausatemfluss, FEF25: Forced exspiratory flow 25 – forcierter Ausatemfluss nach 25% der FVC,
FEF50: Forced exspiratory flow 50 – forcierter Ausatemfluss nach 50% der FVC, FEF75: Forced
exspiratory flow 75 – forcierter Ausatemfluss nach 75% der FVC, MMEF: Maximum midexpiratory
flow – der durchschnittliche Fluss in den mittleren beiden Vierteln der forcierten Ausatmung)
Asthma Kontrolle
Atemregler/Mundstück
Atemregler/Mundstück
Atemregler/Mundstück
Atemregler/Mundstück
vs. Vollmaske
vs. Vollmaske
vs. Vollmaske
vs. Vollmaske
Kontrolle
Kontrolle
Asthma
Asthma
p Δabs
p Δabs
p Δrel
p Δrel
Wert:
FVC 0,09 0,09 0,59 0,92
FEV1 0,96 0,96 0,63 0,96
FEV1/FVC 0,07 0,07 0,39 0,42
PEF 0,80 0,88 0,14 0,48
FEF25 0,75 0,80 0,09 0,33
FEF50 0,92 0,95 0,15 0,99
FEF75 0,82 0,75 0,80 0,72
MMEF 0,08 0,10 0,86 0,74
Insgesamt zeigte sich weder eine klare Bestätigung noch eine klare Widerlegung
der in der Einleitung genannten Fragen.
354 Diskussion
Mit der wachsenden Zahl der Freizeittaucher übt auch eine relevante Anzahl
Asthmatiker den Tauchsport aus, denn jeder 20. Erwachsene und sogar jedes 10.
Kind in der deutschen Bevölkerung leidet an Asthma [2, 57]. Diese Erkrankung
bringt aber ein erhöhtes Risiko für Tauchunfälle mit sich [12]. Asthma und Tauchen
mit komprimiertem Atemgas aus einem Druckgasbehälter werden daher kontrovers
diskutiert [26-28, 43, 50, 64, 71, 93]. Lediglich bei Asthma im kontrolliertem Stadium
(lt. GINA [44]) kann laut der aktuellen Leitlinien eine Tauchtauglichkeit in Erwägung
gezogen werden [2, 90, 101]. Tetzlaff et al. haben in ihrer Zusammenfassung 2002
die typischen Gefahren beim Tauchen mit Asthma aufgezeigt [98]. In einer weiteren
Studie aus dem Jahr 2005 haben Tetzlaff et al. gezeigt, dass Asthma eine der
häufigsten Erkrankungen ist, die bei Freizeittauchern vorliegt [99].
Außerdem ist nach den momentan gültigen Empfehlungen auch eine ausreichend
gute Lungenfunktion vonnöten. Dies bedeutet, dass die Aspiranten während der
Tauchtauglichkeitsuntersuchungen in der Spirometrie in den Messwerten für FEV1,
PEF und FVC jeweils 80% der jeweiligen Sollwerte und einen Tiffeneau-Quotienten
von 0,7 erreichen sollen.
Für Patienten mit Asthma wird zusätzlich empfohlen, ein Peak-Flow-Meter
mitzuführen, und zeitnah zum Tauchen mindestens zweimal täglich den PEF zu
messen. Wenn der PEF dabei vor dem Tauchen mindestens 80% des persönlichen
Bestwertes ergibt, so kann getaucht werden, wobei der PEF auch nach dem
Tauchgang zu messen und zu beobachten ist [101]. Sollte sich der PEF nach dem
Tauchen stark verringern, so ist von weiteren Tauchgängen Abstand zu nehmen.
Das Risiko für Tauchunfälle bei Patienten mit kontrolliertem Asthma erscheint
gering [53]. Eine eigene Einstufung der Aspiranten über die Kontrolle der
Asthmaerkrankung innerhalb der Tauchtauglichkeitsuntersuchung ist als
problematisch anzusehen, da es hierbei immer wieder zu Fehleinschätzungen
kommt [70], wie auch im Falle eines Probanden in der vorliegenden Studie.
Dieser Proband hatte im Aufklärungsgespräch während der
Einschlussuntersuchung sein Asthma als kontrolliert eingestuft. Im Rahmen der
36eNO-Messung und der spirometrischen Untersuchung zeigten sich dann allerdings
Einschränkungen in der Spirometrie bis zu einem Tiffeneau-Quotienten von 38%
und ein akuter klinischer Asthmaanfall. Dies war mit einer weiteren
Studienteilnahme nicht vereinbar, da der Schweregrad des Asthmas dieses
Probanden nach GINA als nicht kontrolliert [44] und nach der deutschen Leitlinie als
schwergradig persistierendes Asthma (Stadium IV) [17] einzustufen war. Dieser
Proband wurde aus der weiteren Studie ausgeschlossen.
Selbst das Tauchen von gesunden Patienten ohne Asthma ist mit einem
potentiellen Absinken der exspiratorischen Flüsse und Volumina assoziiert [77].
Außerdem wird berichtet, dass es nach dem Tauchen zu erhöhten exspiratorischen
NO-Werten kommen kann [60]. Patienten mit Atopie zeigen eher Zeichen einer
bronchialen Hyperreaktivität während eines Tauchgangs, was allerdings mit keinem
signifikantem Absinken der spirometrischen Werte einhergeht [20]. Probanden, die
regelmäßig kalter und trockener Luft während des Trainings oder ihres
(Freizeit-)Sports ausgesetzt sind, z.B. Taucher [96], Eishockeyspieler [61] und
Skilangläufer [58], leiden eher unter bronchialer Hyperreagibilität und
belastungsinduzierter Bronchokonstriktion. Der tatsächliche Ablauf der
Bronchokonstriktion wird von Koskela diskutiert [54].
Die Stimuli während des Tauchgangs, besonders die kalte und trockene Luft,
können potentiell eine belastungsinduzierte Bronchokonstriktion auslösen. Jedoch
ist das Risiko, einen belastungsinduzierten Asthmaanfall zu erleiden, eher gering,
wenn die eNO-Werte der Probanden gering sind [35, 36, 75]. Eine aktuelle Studie
mit italienischen Einsatztauchern zeigt, dass Raucher und ehemalige Raucher
einen signifikant höheren eNO-Wert besitzen, und dass es ab einer Schwelle von
35 ppb zu Einschränkungen in der Spirometrie kommt. Weder Alter, noch BMI,
konnten dabei als Einflussfaktor für die eNO-Differenzen bestimmt werden [67].
Da das Tauchen als potentieller Auslöser von Atemwegsentzündungen und
Bronchokonstriktion [101] im Fokus steht, ist das Ziel der vorliegenden Studie, den
Unterschied zwischen der Atmung über den Mund (Atemregler mit
Mundstückgarnitur) bzw. über Mund und Nase (Vollmaske) während der Atmung
aus einem Tauchgerät zu untersuchen. Jedoch kommt es zu einem nicht
signifikanten, insgesamt nur leichten Abfall der FEV1 nach der Atmung aus dem
37Atemregler mit Mundstückgarnitur. Zu selbigen Ergebnissen gelangten auch
Norfleet et al. [76].
Im sportmedizinischen Bereich wird das sog. Belastungsasthma auch als
belastungsinduzierte Bronchokonstriktion oder englisch exercise-induced
bronchoconstriction (EIB) beschrieben. Diese Einschränkung der Lungenfunktion
kann während, oder häufiger nach sportlichen Belastungen bei entsprechend
prädisponierten Menschen auftreten. Wie diese belastungsinduzierte
Bronchokonstriktion auftritt, ist noch nicht abschließend geklärt.
Auf der einen Seite argumentieren McFadden et al., dass der Wärmeverlust in den
Bronchien der zentrale Auslöser sei [69]. Als Beleg wird von den Befürwortern
dieser Ansicht aufgeführt, dass Hyperventilation zu keinen signifikanten
Änderungen der Osmolarität in den Bronchien führt, und deshalb keine Obstruktion
verursachen kann [55, 56]. Nach der Belastung kommt es durch Normoventilation
zu einer Wiedererwärmung der Atemwege und einer Schwellung der Schleimhaut,
die zu obstruktiven Veränderungen führt [41, 42].
Auf der anderen Seite vertreten S.D. Anderson et al. die Meinung, dass ein Verlust
der Flüssigkeit in den Atemwegen durch Belastung und damit erhöhter Ventilation
zu einer Hyperosmolarität des verbleibenden Sekretes führt. Durch die Kombination
aus Flüssigkeitsverlust und Hyperosmolarität kommt es nun zur Bronchokonstriktion
[7-9].
Sicherlich können sowohl die Trockenheit der Atemluft als auch die Kälte beim
Tauchen ebenfalls eine Rolle spielen. Die Atemluft nach DIN EN 12021 wird bereits
im Kompressor zum Korrosionsschutz der Druckgasbehälter aus Stahl, zum Schutz
des Atemreglers vor innerer Vereisung sowie zum Infektionsschutz durch
Wasserabscheider und Silica-Gel getrocknet [5].
Der Wärmeverlust der Atemluft findet bei Tauchgeräten im Wesentlichen durch den
Druckverlust und die damit verbundene Ausdehnung der Luft innerhalb der 1. und
2. Stufe des Atemreglers statt. Durch den Joule-Thomson-Effekt, der diese
Abkühlung erklärt, würde die Luft aufgrund der Dekompression von 20 MPa in der
Druckluftflasche auf den Atmosphärendruck von 0,1 MPa um etwa 50 K abgekühlt.
Bei einer Umgebungstemperatur der Studie von etwa 20° C würde die Luft sich
38Sie können auch lesen