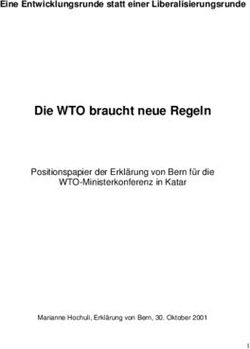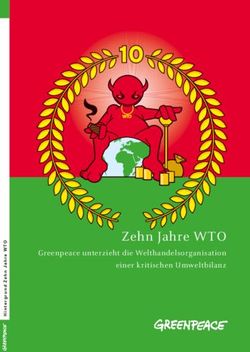MARGARETA E. KULESSA/ JAN A. SCHWAAB - Konzepte zur "Ökologisierung" der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
MARGARETA E. KULESSA / JAN A. SCHWAAB
Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik*
I n der Diskussion über wirtschaftliche Globalisie-
rung und Liberalisierung gewinnen ökologische
Aspekte zunehmend an Bedeutung, was sich u. a.
und 1998; Petschow et al. 1998), werden ähnlich
kontroverse Positionen vertreten:
Die »Harmoniethese« postuliert, dass Umwelt-
in der Forderung niederschlägt, die internationale schutz und Globalisierung uneingeschränkt mit-
Wirtschafts- und Umweltpolitik stärker mitein- einander vereinbar sind. Die Vertreter dieser These
ander zu verzahnen. Das Anliegen dieses Beitrags heben insbesondere den Beitrag der Globalisie-
ist es, konkrete Vorschläge für ihre institutionelle rung zur Bewältigung von Umweltproblemen her-
Verknüpfung zusammenfassend darzustellen und vor, der sich aus der Generierung höherer Ein-
kritisch zu beleuchten. kommen und der Diffusion umweltfreundlicher
Produkte und Technologien und einer verbes-
serten Allokation des Faktors Umwelt ergäbe. Sie
Zur Vereinbarkeit von Globalisierung und favorisieren u. a. aus diesem Grund eine Fortset-
Umweltschutz zung weltwirtschaftlicher Liberalisierung (z. B.
Bhagwati 1994; Gerken / Renner 1996, Pflüger
Die Chancen und Risiken der Globalisierung – 1999; OECD 1997a; Bhagwati / Srinavasan 1996).
verstanden als Zunahme der ökonomischen Inter- Mögliche Konflikte zwischen Umweltschutz und
dependenzen zwischen Staaten und Gesellschaf- ökonomischer Globalisierung seien durch eine
ten (DGvL 1997, 50) 1 – werden bekanntermaßen konsequente Umweltpolitik, die externe Effekte
höchst unterschiedlich eingeschätzt (Hoffmann vollständig internalisiert, zu lösen. Dieser Auffas-
1999). Einerseits erhofft man sich Wohlfahrtsge- sung liegt üblicherweise ein neoklassisch geprägtes
winne, die sich in einer Erhöhung des Wirtschafts- Außenhandelsmodell zu Grunde, in das die Um-
wachstums und damit einhergehend in einer welt als knapper Produktionsfaktor integriert wird
weltweiten Steigerung des Lebensstandards und und das bei knappheitsgerechten Preisen eine
einem Aufholen der Entwicklungsländer nieder- optimale Allokation des Faktors Umwelt impli-
schlagen (z. B. OECD 1997a; Minc 1998). Anderer- ziert. Eine institutionelle Verknüpfung von inter-
seits befürchten Kritiker, dass durch die Globali- nationaler Wirtschafts- und Umweltpolitik wird
sierung u. a. Massenarbeitslosigkeit, Armut und abgelehnt, da sie weder effektiv, noch effizient sei
die Marginalisierung der ärmsten Entwicklungs- (Siebert 1998, 181 ff. u. 214 f.).
länder sowie politische Instabilitäten verschärft Im Gegensatz zur »Harmoniethese« gehen
werden (z. B. Forrester 1997; Martin / Schumann verschiedene Autoren von einer weitgehenden
1997). Vor allem aber wird ein allgemeiner Ver- Inkompatibilität wirtschaftlicher Globalisierung
lust staatlicher Ordnungs- und Steuerungsfähig- mit ökologischen Erfordernissen aus. Entspre-
keit problematisiert, der eine neue Architektur chend wird eine Abkehr von der weltwirtschaft-
der Politik erfordern würde, in der interna- lichen Liberalisierungsstrategie befürwortet (z. B.
tionale Institutionen und Regime kein Flick- Daly / Goodland 1994; Korten 1997; PGA 1999).
werk sind, sondern zentraler Baustein einer »Glo- Zur Begründung wird im wesentlichen angeführt,
bal-Governance-Architektur« (Messner / Nuscheler
1996, 21).
* Unser Dank gilt Anja Altmann für wertvolle Hin-
In der spezielleren Diskussion über Globalisie- weise.
rung und Umweltschutz, die in jüngerer Zeit 1. Zu anderen Definitionen siehe Beisheim / Walter
deutlich intensiviert wurde (z. B. OECD 1997b 1997.
254 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik IPG 3/2000dass Liberalisierung /Globalisierung die Intensität externer Effekte, zu deren spürbarer Reduzierung
und Verbreitung umweltschädlicher Produktions- es multilateraler Vereinbarungen bedarf. Globali-
und Konsummuster verstärken, umweltbelastende sierung macht eine Beschleunigung der Internali-
Transportströme hervorrufen und die wirtschaft- sierungspolitik empfehlenswert, denn »intensified
liche Krisenanfälligkeit der Regionen erhöhen. trade and investment could amplify existing policy
Außerdem verdränge die Liberalisierung insbe- and market failures which underlie an already
sondere in Entwicklungsländern umweltverträg- stressed environment.« (OECD 1997c, 12). Eine
lich wirtschaftende Kleinproduzenten. Vor allem Beschleunigung der Internalisierungsprozesse ist
aber werden der internationale Wettbewerbs- jedoch trotz des merklichen Globalisierungsschubs
druck sowie die Transnationalisierung der Unter- nicht zwingend zu erwarten. Ganz im Gegenteil
nehmen kritisiert, da sie den umweltschutzpoli- besteht sogar die Gefahr, dass sich die Umset-
tischen Handlungsspielraum erheblich reduzieren zungs- und Durchsetzungsprobleme gerade auf
würden. Grund der ökonomischen Globalisierung ver-
Schließlich gibt es eine Reihe von Autoren, die stärken und sich der Internalisierungsprozess
zwar grundsätzlich für eine liberale Weltwirt- somit verlangsamt. Die Gründe für eine Verlang-
schaftsordnung plädieren, damit sich positive samung lassen sich im wesentlichen der Diskus-
Umweltwirkungen der Globalisierung entfalten sion über den Verlust an nationalstaatlicher Ord-
können; aber sie erachten gleichzeitig eine »Öko- nungs- und Steuerungsfähigkeit entnehmen, als
logisierung« der Weltwirtschaftsbeziehungen für dessen Hauptursachen die Transnationalisierung
wünschenswert, um mögliche negative Umwelt- der Unternehmen und der intensivierte Standort-
wirkungen der Globalisierung zu reduzieren (z. B. wettbewerb angesehen werden.
Petschow 1998). In Abgrenzung zu der Harmonie- Es wird erwartet, dass sich die Tätigkeit der
these wird die Auffassung, Globalisierung und Unternehmen angesichts der technischen Ent-
Umweltschutz ließen sich auf dem Weg der wicklung im Kommunikations- und Transportbe-
Internalisierung externer Effekte in vollständigen reich und der weltweiten Öffnung der Märkte
Einklang bringen, als hilfreicher, aber zugleich zunehmend transnationalisiert. 2 Hieraus lässt sich
realitätsferner Ansatz eingestuft. Da die Realität die Befürchtung ableiten, dass einzelstaatliche
deutlich von den zu Grunde liegenden Annahmen Umweltschutzmaßnahmen Wanderungsbewegun-
neoklassischer Prägung abweiche, müsse auch gen der Industrie in Länder mit niedrigeren Um-
von der Ablehnung umweltpolitisch motivierter weltstandards auslösen (UNDP 1997, 111 f.). Das
Beschränkungen der internationalen Wirtschafts- bedeutet wiederum, dass die volkswirtschaftlichen
ströme Abstand genommen werden. Kosten der Abwanderung (Kapitalabbau, Beschäf-
tigungs- und Anpassungsprobleme usw.) in das
politische Entscheidungskalkül eingehen müssen
Begründungen für eine institutionelle Verknüpfung und die Durchsetzbarkeit von Umweltschutzmaß-
von Weltwirtschafts-und Umweltpolitik nahmen verringert wird. Folge ist, dass weniger
hohe Umweltziele gesetzt werden. Bei globalen
Verlangsamung der Internalisierung Umweltproblemen führt die Industrieflucht dar-
über hinaus dazu, dass einzelstaatliche Umwelt-
Es ist nahezu unbestritten, dass im Umweltbereich politik weitgehend ineffektiv wird. Analytische
erhebliche Internalisierungsdefizite bestehen. Ihre Überlegungen und empirische Hinweise sprechen
Beseitigung ist außerordentlich zeitintensiv, da allerdings dafür, dass die Transnationalisierung der
Umweltprobleme und ihre Folgen erforscht sowie Unternehmen systemintern begrenzt ist (Hirsch-
technische Probleme bei der Umsetzung von Um- Kreinsen 1997; Doremus et al. 1998). Ebenso feh-
weltschutzmaßnahmen beseitigt werden müssen. len bislang empirische Belege für die These, dass
Darüber hinaus scheinen Trial-and-error-Prozesse
unumgänglich zu sein. Schließlich und vor allem
bedarf es bekanntlich eines langen Atems, um kon- 2. Zur managementtheoretischen Literatur über die
krete Umweltschutzmaßnahmen politisch durch- verschiedenen Globalisierungsstratgien z. B. Kotler
zusetzen. Dies gilt besonders im Falle globaler (1990), Porter (1983).
IPG 3/2000 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik 255Umweltpolitik zu Industrieflucht führt (Esty/ Globalisierung ihre Umweltverschmutzung expor-
Gentry 1997; Adams 1997; WTO 1998a, 54 f.). Ande- tieren und den Süden als Abfallhalde verwenden,
rerseits sagen die empirischen Studien zur Indus- mag übertrieben sein (Petschow et al. 1998, 238 f.).
trieflucht wenig über zukünftige Entwicklungen Aber auch wenn die Industriegüterproduktion in
aus. Außerdem kann es ungeachtet wissenschaft- den Entwicklungsländern überwiegend für den
licher Erkenntnisse zu Politikversagen im Sinne Verbrauch im Süden selbst bestimmt ist, weist die
einer Paralyse der Umweltpolitik im Standort- These auf verschiedene umweltpolitische Pro-
wettbewerb der Nationen kommen. Umwelt- bleme hin, die der Strukturwandel in Entwick-
schutzziele können systematisch zu Gunsten stra- lungsländern aufwirft. Dazu zählt, dass eine so
tegischer außenwirtschaftspolitischer Ziele geop- intensive Nutzung der Umweltgüter, wie sie die
fert werden (Ulph 1996; Weida 1998, 292 f.). Es Industrieländer betrieben haben, angesichts öko-
wird dann in Kauf genommen, dass sich die logischer Knappheiten nicht auf die gesamte Welt-
Preissignale immer weiter von den tatsächlichen bevölkerung ausgedehnt werden kann. Da aber die
Umweltknappheiten entfernen. In der Dynamik Globalisierung diesen Prozess begünstigt, steigt
könnte diese Politik sogar dazu führen, dass sich die Notwendigkeit des Gegensteuerns.
die Länder gegenseitig durch immer geringere
Umweltschutzanforderungen unterbieten (UNDP
1997, 112). Während ein derartiges »race to the Die Bedeutung außenwirtschaftlicher Vorgänge für die
bottom« u. a. auf Grund des gestiegenen Umwelt- Umweltpolitik
bewusstseins der Bevölkerung eher unwahrschein-
lich ist, mehren sich seit den 80er Jahren die Die Interdependenz zwischen natürlicher Umwelt
Anzeichen für eine Verschleppung und Verwässe- und außenwirtschaftlichen Vorgängen hat infolge
rung von umweltpolitischen Vorhaben (Political der Globalisierung zugenommen. So bedeuten
drag). gestiegene Handelsquoten für das einzelne Land,
dass ein wachsender Teil des produktionsbe-
dingten Ressourcen- und Umweltverzehrs für den
Globaler Strukturwandel zwischen Industrie- Export stattfindet und konsumtiv bedingte Um-
und Entwicklungsländern weltbelastungen zunehmend auf den Verbrauch
importierter Güter zurückzuführen sind. Dadurch
Die sich wandelnde Arbeitsteilung zwischen beeinflussen Weltmarktbedingungen in steigen-
»Nord« und »Süd« ist ökologisch bedeutsam, da dem Maße mittelbar den Zustand der natürlichen
ein großer Teil der verbliebenen Umweltressour- Umwelt im Inland. Umgekehrt gehen vom Pro-
cen im Süden liegt, dessen bis dato geringer duktions- und Konsumverhalten besonders der
Anteil am globalen Ressourcenverbrauch steigt größeren Volkswirtschaften über den Weltmarkt
und die Entwicklungsländer i. d. R. laxere Um- zunehmend Rückwirkungen auf die exterritoriale
weltschutzbestimmungen als der Norden auf- Umwelt aus. Hinzu kommt, dass sich Umweltbe-
weisen (OECD 1997a, 122 f.; Biermann 1998, ff.). lastungen immer schwerer einzelnen Nationen
Gegenwärtig zeichnen sich komplementäre Ten- und Individuen zuordnen lassen. Je verwobener
denzen des Strukturwandels in Nord und Süd die Volkswirtschaften, desto schwieriger ist es,
ab. In den Industrieländern wird der Aufstieg zuverlässige quantitative Aussagen über den »öko-
des Dienstleistungssektors zum vorherrschenden logischen Rucksack« (BUND / Misereor 1996, 133 ff.)
Wirtschaftsbereich beobachtet, während in etlichen der einzelnen Länder bzw. Menschen zu tref-
Entwicklungsländern die Industrialisierung zu- fen. Das weltwirtschaftlich hervorgerufene Zuord-
nimmt. Diese Entwicklung dürfte sowohl Motor nungsproblem macht sich besonders in der
als auch Auswirkung der Globalisierung sein. Für durch Verteilungskämpfe geprägten internatio-
den Fall, dass die Globalisierung weiter anhält, nalen Politik zum Schutz globaler Umweltgüter
ist mit noch stärkeren Tendenzen zur Tertiarisie- bemerkbar (Biermann 1998). Insgesamt wird es
rung und Hochtechnologisierung im Norden angesichts der fortschreitenden wirtschaftlichen
und zur Industrialisierung im Süden zu rechnen. Integration immer schwieriger, die Wirksamkeit
Die These, dass die Industrieländer im Zuge der und die Kosten einzelstaatlicher Umweltschutz-
256 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik IPG 3/2000maßnahmen abzuschätzen, da Reaktionen im Aus- weitere Auffassung von einer ökologisierten Welt-
land in die Analyse einbezogen werden müssen. handelsordnung schließt unilaterale Handelsbe-
Für die nationale Ebene sind mittlerweile eine schränkungen gegen sog. Ökodumping mit ein.
Reihe von Nachhaltigkeitsstrategien konzipiert Damit ist gemeint, dass Länder den Import
worden, die für eine integrative Ökologisierung von Produkten beschränken dürfen, bei deren
von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik plädieren Produktion bestimmte Umweltstandards (Produc-
(Bartmann 1996). Da die Komplexität der Wech- tion and Process Method Standards: PPMS) nicht
selwirkungen zwischen Weltwirtschaftsbeziehun- eingehalten werden (z. B. WWF 1991). Werden hier-
gen und Umweltschutz im Zuge der Globalisie- bei internationale Mindeststandards zu Grunde
rung weiter ansteigen dürfte, werden integrative gelegt, wird dies hier als »Ökoklausel« oder syno-
Ansätze auch auf internationaler Ebene angedacht. nym als die Forderung nach Umweltstandards im
Eine Fusion von internationaler Wirtschafts- und internationalen Handel bezeichnet. Demgegen-
Umweltpolitik ist allerdings gerade auf Grund der über verstehen wir unter Öko-Ausgleichsmaß-
Komplexität der Zusammenhänge nicht prakti- nahmen, dass ein Land den Import von Produk-
kabel. Stattdessen werden Wege gesucht die Kom- ten beschränkt, die unter laxeren PPMS als einhei-
plexität auf eine technisch und politisch prakti- mische Produkte hergestellt wurden.
kable Ebene herunterzubrechen. Konkret wird im
Folgenden zum einen die Integration umweltpoli-
tischer Erfordernisse in die Welthandelsordnung Behindern GATT/ WTO die Umweltpolitik?
und die Gestaltung der internationalen Investiti-
onsbeziehungen diskutiert; zum anderen wird Die Prinzipien von GATT und WTO orientieren sich
die stärkere Berücksichtigung weltwirtschaftlicher an den Postulaten der Handelsliberalisierung und
Zusammenhänge in internationalen Umweltschutz- Nicht-Diskriminierung. Die Freihandelsprinzipien
vereinbarungen beleuchtet. werden jedoch durch mehrere Ausnahmerege-
lungen durchbrochen, um u. a. dem ebenfalls
konstituierenden Prinzip der Souveränität der
Zur »Ökologisierung« der internationalen Mitgliedstaaten zu entsprechen. So wird jedem
Handelsordnung Mitgliedstaat durch Artikel XX(b,g) des GATT
grundsätzlich das Recht zugesichert, nach eige-
Grundsätzliche Vorbemerkungen nem Ermessen das Leben und die Gesundheit
von Mensch, Tier und Pflanze zu schützen sowie
Die aktuelle Diskussion über eine »Ökologisie- erschöpfbare Ressourcen zu erhalten. Dass damit
rung« der Weltwirtschaftsordnung rankt sich im auch der Schutz der Umwelt im weiteren Sinne
handelspolitischen Bereich um das Allgemeine gemeint ist, wird durch die Präambel der WTO
Zoll- und Handelsabkommen (GATT) und die bekräftigt, in der von dem »Ziel einer dauerhaften
Welthandelsorganisation (WTO) (Helm 1995; Knorr Entwicklung ..., die den Schutz und die Erhaltung
1997), die im Jahr 1995 an die Stelle des alten der Umwelt ... umfasst« gesprochen wird. Das
GATT-47 trat. Die WTO-Vereinbarungen regeln außer Souveränitätsprinzip bedeutet aber nicht, dass die
dem internationalen Warenhandel (GATT-94) den Umweltpolitik bzw. Gesundheits- und Verbrau-
Handel mit Dienstleistungen (GATS) und den cherschutzpolitik losgelöst von GATT/ WTO agieren
internationalen Schutz geistiger Eigentumsrechte kann, sondern die multilaterale Handelsordnung
(TRIPS). schränkt den Handlungsspielraum durchaus ein.
Einige Autoren sprechen bereits dann von Im Folgenden werden verschiedene Restriktionen
einer »Ökologisierung« der WTO, wenn das Regel- anhand von Fallbeispielen illustriert.
werk die Vertragsstaaten nicht daran hindert,
Maßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz der
Umwelt notwendig sind (z. B. Kulessa 1995, 281 ff.;
Helm 1995, 121 ff.). Von dieser Seite werden 3. Helm (1995, 84 ff.) diskutiert darüber hinaus eine
sog. Ausnahmeklauseln in den jeweiligen Abkom- »Standardisierung für Standards« und positive Handels-
men als grundsätzlich ausreichend erachtet. 3 Eine anreize.
IPG 3/2000 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik 257EU-Verbot von hormonbehandeltem Rindfleisch luierung der wissenschaftlichen Schriften in ihrem
Sinne bemüht, andererseits erwägt sie, die nord-
In der EU ist der Einsatz bestimmter natürlicher amerikanischen Staaten durch Kompensationen zu
und künstlicher Hormone bei der Rindermast entschädigen. Ungeachtet seines konkreten Aus-
seit Ende der 80er Jahre beschränkt, um Fleisch- gangs macht der Konflikt eines deutlich: Das
konsumenten vor etwaigen gesundheitlichen Risi- SPS-Abkommen eröffnet die Möglichkeit, umwelt-
ken zu schützen. Entsprechend ist der Import von bzw. gesundheitspolitische Ziele in Frage zu
Rindfleisch in die EU verboten, bei dessen Pro- stellen und überträgt handelsrechtlichen Gremien
duktion Wachstumshormone Anwendung finden. die Kompetenz, darüber zu entscheiden, ob
Die USA und Kanada halten das Einfuhrverbot für wissenschaftliche Grundlagen das Ziel rechtfer-
unvereinbar mit den WTO-Vereinbarungen. Sie tigen. Dadurch entstehen Unsicherheiten für die
bestreiten weniger, dass die Importbeschrän- Regierungen, die sie im verbraucher- und umwelt-
kungen notwendig sind, um den bestehenden schutzpolitischen Bereich zögerlicher machen
EU-Standard durchzusetzen. Vielmehr greifen sie dürften, da die Wahrscheinlichkeit eines WTO-
zuvorderst das Hormonverbot an sich an, da es der Konflikts und seiner Folgekosten nunmehr bereits
wissenschaftlichen Grundlage entbehre und eine bei der Zielformulierung in die Kosten-Nutzen-
verschleierte Handelsbeschränkung darstelle. Sie Analyse einfließen werden. Verwässerungstenden-
stützen sich dabei im wesentlichen auf das GATT- zen dieser Art können im Zusammenhang mit
Übereinkommen über sanitäre und phytosanitäre gentechnisch modifizierten Lebensmitteln und
Maßnahmen (SPS). Nach ergebnislosen Verhand- Organismen beobachtet werden. Es geht erneut
lungen zwischen den USA und der EU wurde im um Produkte, deren umwelt- und gesundheits-
Jahre 1996 auf Antrag der USA ein WTO-Schieds- politische Unbedenklichkeit aus US-amerikanischer
panel errichtet. Das Panel erklärte das Importver- Sicht belegt ist, die von der EU-Bevölkerung hin-
bot ein Jahr später aus verschiedenen Gründen für gegen als ökologisch und gesundheitlich riskant
unzulässig;4 u. a. wurde bemängelt, dass sich die eingeschätzt werden.
EU nicht an den (laxeren) internationalen Standard Das SPS-Abkommen der WTO birgt die Gefahr,
des Codex Alimentarius halte, obwohl das SPS- die Durchsetzbarkeit und Umsetzung umwelt-
Abkommen verlange, das sich nationale Schutz- und verbraucherschutzpolitischer Maßnahmen zu
maßnahmen auf internationale Normen stützen erschweren. Die EU mag über die wirtschaftliche
sollen, soweit diese existieren (SPS Art. 3.1). Da- und politische Macht verfügen, um den Vor-
raufhin legte die EU Berufung ein. Die Berufungs- stößen der USA einschließlich potenzieller Han-
instanz stellte klar, das strengere nationale Stan- delssanktionen zu trotzen oder Kompensationen
dards nicht per se WTO-widrig seien. Gleichwohl zu leisten. Im Falle kleinerer Handelspartner ist es
erklärte das Berufungsorgan das Importverbot in hingegen wahrscheinlicher, dass sie im Zweifels-
seinem Bericht (1998) ebenfalls für unzulässig, falle die Konfliktvermeidung dem Vorsorgeprin-
weil die EU keine ausreichenden wissenschaft- zip vorziehen. Internationale Umwelt- und Ge-
lichen Indizien für die Gesundheitsschädlichkeit sundheitsstandards könnten durch die handels-
des hormonbehandelten Rindfleiches vorgelegt politische Hintertür zu »top ceilings« werden.
hätte. 5 Hierzu sei sie aber durch die umwelt- und Zumindest aber wird ein »race to the top«
gesundheitspolitisch heftig kritisierte Umkehr der durch die WTO-Bestimmungen wesentlich unwahr-
Beweislast, die sich aus dem SPS-Abkommen scheinlicher.
ergäbe, verpflichtet (Helm 1995, 139). Nicht die
klagende Partei (USA) müsste die Unschädlichkeit
ihrer Exporte (Fleisch hormonbehandelter Rin-
der) nachweisen, sondern die andere Partei (EU) 4. WTO Dokument WT/ DS26/ R /USA v. 18. August
müsse die Gesundheitsschädlichkeit belegen. 6 1997.
Der »Hormonstreit« zwischen den USA, Kanada 5. WTO Dokument WT/ DS26 / AB/R u. WT / DS48 /
und der EU schwelt weiter. Die USA und Kanada AB / R v. 16. Januar 1998.
6. Ohne ins Detail zu gehen, sei hier angemerkt, dass
haben im vergangenen Jahr Strafzölle verhängt. das SPS-Abkommen die Umkehr der Beweislast allerdings
Die EU wiederum ist einerseits um eine Reva- keineswegs explizit vorsieht.
258 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik IPG 3/2000Der Schutz exterritorialer Ressourcen: Von Thun- asiatischen Staaten (Indien, Malaysia, Pakistan,
fischen und Delphinen, Garnelen und Schildkröten Thailand) bemerkbar. Die USA schreiben einhei-
mischen Schrimpfischern vor, dass sie sog. »turtle
Ein anderer Sachverhalt als beim »Hormonstreit« excluder devices« 8 verwenden. Das ergänzende
liegt vor, wenn Importbeschränkungen nicht zum Importverbot sieht in der Praxis so aus, dass nur
Schutz der Gesundheit der inländischen Bevöl- noch Schrimps aus Ländern eingeführt werden
kerung, sondern zum Schutz exterritorialer Res- dürfen, die in schildkrötenfreien Gewässern fischen
sourcen ergriffen werden und dazu dienen sollen, oder die ihrer Garnelenwirtschaft die gleichen Auf-
das Ausland zu umweltfreundlicheren Produk- lagen vorschreiben wie die USA. Im Jahr 1997
tionsmethoden zu bewegen. Dies war der Fall wurde ein WTO-Panel auf Antrag der genannten
in dem mittlerweile berühmten Thunfischstreit asiatischen Länder errichtet, dem sich verschie-
zwischen Mexiko und anderen auf der einen, und dene afrikanische Länder anschlossen. Der Panel-
den USA auf der anderen Seite zu Beginn der 90er bericht vom Mai 1998 bewertete das Importver-
Jahre. Hintergrund des Streits ist eine amerika- bot als GATT-widrig, da es ausländischen Staaten
nische Vorschrift zum Schutz von Meeressäuge- das US-amerikanische Gesetz mittels Handelssank-
tieren, dass die US-amerikanische Thunfischflotte tionen zu oktroyieren versuche und dadurch
im Ostpazifik nicht mehr als 20.500 Delphine jähr- das multilaterale Handelssystem grundsätzlich
lich töten oder verletzen darf. Da jedoch Mexiko gefährde. 9 Die umweltpolitische Notwendigkeit
und andere Anrainerstaaten keine vergleichbare der Maßnahmen wurde nicht geprüft. Die Beru-
Politik aufwiesen, führten die USA ein Importver- fungsinstanz widersprach im Oktober 1998 diesem
bot für Thunfischprodukte aus diesen Ländern Vorgehen, bewertete das Importverbot im spe-
ein. Das Embargo sollte erst aufgehoben werden, ziellen Fall aber ebenfalls als GATT-widrig, da seine
wenn die jeweiligen ausländischen Flotten ent- konkrete Ausgestaltung dem Nichtdiskriminie-
weder ähnlichen Auflagen unterworfen werden, rungs- und Konsultationsgebot der WTO diametral
oder wenn sie nachweisen konnten, im Durch- zuwiderlaufe. 10 An dem Bericht des Berufungs-
schnitt nicht mehr als die 1,25-fache Zahl an organs ist eines besonders erwähnenswert: Es wird
Delphinen zu töten als Schiffe der US-Flotte. nicht in Frage gestellt, dass die USA berechtigt
Wenig später wurde die Importbeschränkung auf sind, als ultima ratio Handelsbeschränkungen zu
Thunfischeinfuhren aus Ländern ausgedehnt, die ergreifen, die sich gegen Aktivitäten außerhalb
als Zwischenhändler für »Non-dolphin-safe«- des eigenen Hoheitsgebietes richten. Schließlich
Thunfisch gelten, darunter auch EU-Staaten. seien die Meeresschildkröten zeitweilig auch in US-
Zwei aufeinander folgende GATT-Panels (1991 amerikanischem Gewässer unterwegs, wodurch
und 1994) befassten sich mit dem Thunfisch- ein territorialer Bezug zwischen den USA und den
importverbot und kamen jeweils zu dem Ergeb- bedrohten Schildkröten bestünde (Hermanns
nis, dass es GATT-inkonform sei. 7 Die Experten des 1999, 5)
zweiten Panels distanzierten sich indes vom Alles in allem ist die Vereinbarkeit von Han-
ersten Panel insoweit, als sie klarstellten, das delsbeschränkungen zur Abwehr grenzüberschrei-
die GATT-Widrigkeit des US-Importverbots nicht tender Umweltbelastungen mit dem Regelwerk
bedeute, dass produktionsprozessbezogene Han- der WTO nicht eindeutig geklärt. Im Falle globaler
delsbeschränkungen zum Schutz exterritorialer Umweltgüter, bei denen der territoriale Bezug
Ressourcen generell unzulässig seien. Die Pane- nicht oder nur äußerst indirekt gegeben ist,
listen forderten die Staaten auf, diese und andere lässt sich über die WTO-Konformität allenfalls
offene Fragen in Bezug auf das Verhältnis von
(exterritorialem) Umweltschutz und Handelspo- 7. 30 I.L.M. (International Legal Materials) 1594 (1991)
litik zu klären (Jones 1999, 412 f.). Seitdem sind und 33 I.L.M. 839 (1994).
mehr als fünf Jahre verstrichen, ohne dass die 8. Das sind relativ effektive Vorrichtungen, die in die
Bestimmungen des GATT seitens der WTO-Mit- Netze eingebaut werden und es Schildkröten erlauben,
aus den Netzen auszubrechen.
gliedstaaten präzisiert oder gar reformiert wurden. 9. WTO Dokument WT / DS58/R v. 15. Mai 1997.
Dieses Versäumnis machte sich u. a. in dem 10. WTO Dokument WT / DS58 / AB / R v. 12. Oktober
Garnelenstreit zwischen den USA und mehreren 1998.
IPG 3/2000 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik 259spekulieren. Grundsätzlich ist zu bemängeln, dass werden, die Zulässigkeit der Maßnahme in einem
die WTO-Mitglieder bis dato keine umweltpoli- Streitschlichtungsverfahren prüfen zu lassen.
tisch akzeptable Lösung für diese offenen Fragen Das Konzept der Ökoklauseln ist vielfach kriti-
gefunden haben. Angesichts der Verschärfung siert worden (Weida 1997, 291 ff.). So wird u. a.
grenzüberschreitender und globaler Umweltbela- befürchtet, dass sie angesichts ihrer Praktikabi-
stungen sowie der zunehmenden realwirtschaft- litätsdefizite protektionistisch missbraucht werden.
lichen Verflechtung der Länder wächst aber die Außerdem wird bemängelt, dass weltweit ein-
umweltpolitische Notwendigkeit, die Bestimmun- heitliche Umwelt(mindest)standards Handels- und
gen von GATT / WTO zu reformulieren. Reallokationsbarrieren darstellen, die aus umwelt-
ökonomischer Sicht nicht nur entbehrlich, sondern
kontraproduktiv sind. Den erheblichen Problemen
Sind WTO–Ökoklauseln notwendig im Zuge der und Risiken steht die Erwartung gegenüber, dass
Globalisierung? Ökoklauseln möglichen negativen Umweltfolgen
der Globalisierung entgegenwirken können. Ein-
Vor allem verschiedene Umweltschutzverbände schränkend ist jedoch erstens zu berücksichtigen,
plädieren seit längerem für Ökoklauseln in der dass mit Ökoklauseln nur ein kleiner Teil der welt-
WTO und lehnen eine (weiter gehende) Liberalisie- weiten Umweltprobleme erfasst würde. Zweitens
rung des Welthandels ohne eine Verankerung von stellen Ökoklauseln für die internationale um-
Umweltstandards in der Welthandelsordnung ab weltökonomische Arbeitsteilung Barrieren dar, die
(z. B. Greenpeace, WWF). Verschiedene westliche konzeptionell zwar gewollt sind, aber für ein-
Regierungen unterstützen die Integration von zelne Länder den Verzicht auf umweltentlastende
Ökoklauseln in die WTO (z. B. Frankreich, die Effekte der Globalisierung bedeuten können.
USA und Deutschland, Handelsblatt v. 16.3.99). Schließlich ist realistischerweise davon auszu-
Das radikalste Konzept einer Ökoklausel sieht vor, gehen, dass die international »konsensfähigen«
dass alle Länder, die am internationalen Handel handelspolitischen Umweltstandards ein relativ
partizipieren möchten, bestimmte Umweltstan- niedriges Niveau aufweisen werden, das allenfalls
dards bei der Herstellung von Gütern (PPMS) ein- Entwicklungsländer zu einer Erhöhung ihres Um-
halten müssen. Dieser Ansatz ist jedoch nicht nur weltschutzniveaus (im Exportsektor) zwingt. Die
mit erheblichen praktischen Problemen behaftet, Politik des Standortwettbewerbs zwischen den
sondern kaum ein Land dürfte bereit sein, ein Staaten der Triade, innerhalb derer sich die Globa-
derart hohes Maß an umwelt- und ressourcenpo- lisierung bzw. Regionalisierung hauptsächlich
litischer Souveränität an die WTO abzutreten. abspielt und deren Unternehmen primär unterein-
Außerdem ist die Welthandelsorganisation für die ander konkurrieren, dürfte von der Ökoklausel
resultierenden Aufgaben weder konzipiert noch unbeeinflusst bleiben.
geeignet (Jones 1999, 423 ff.).
Am verbreitetsten ist der Vorschlag, die Öko-
klausel auf den originären Bereich der WTO, d. h. Öko-Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der internationalen
den Handel mit Waren zu begrenzen. Das würde Wettbewerbsfähigkeit
bedeuten, dass sich die Mitgliedstaaten der WTO
verpflichten, nur Waren zu exportieren, deren Die Forderung nach Importbeschränkungen zur
Herstellung gewissen Umweltstandards genügt. Abwehr von sog. Ökodumping ist im Laufe der
Das Konzept ist jedoch begrenzt praktikabel. Das Diskussion differenzierter geworden. Anfangs plä-
größte Problem stellt die Festlegung der Standards dierten einzelne Umwelt-, Gewerkschafts- und
dar (wie, was und durch wen). Es entspräche Unternehmensverbände in den Industrieländern
der Funktionsweise der WTO am ehesten, wenn dafür, die Antidumping-Bestimmungen des GATT
eine Ökoklausel Länder dazu ermächtigen würde, soweit auszudehnen, dass Länder den Import von
den Import von Gütern zu beschränken, die den Gütern beschränken können, die unter schlech-
Mindeststandards nicht genügen. In Analogie zum teren als den inländischen Umweltschutzbedin-
bestehenden Streitschlichtungsverfahren müsste gungen hergestellt wurden. Zur Begründung
dem Exportland dann die Möglichkeit eingeräumt wurden der Schutz der einheimischen Produktion
260 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik IPG 3/2000vor umweltpolitisch induzierten Wettbewerbs- wendet wird, um inländische Güter bei der
nachteilen und die Verhinderung eines »race to Ausfuhr von internen Abgaben zu entlasten. Es
the bottom« angeführt (WWF 1991, 13 f.; Gore 1993, ist nahezu unumstritten, dass Importgüter mit
343). Mittlerweile ist diese allgemeine Forderung sämtlichen Produktsteuern, die im Land gelten,
kaum noch anzutreffen, da die Annahme, dass belastet bzw. Exportgüter entlastet werden
unterschiedlich hohe Umweltstandards die – wie dürfen. Mittlerweile herrscht außerdem weitgehend
auch immer definierte – handelspolitische Wettbe- Konsens, dass Produktabgaben an der Grenze tarif-
werbsfähigkeit 11 einer Volkswirtschaft spürbar lich ausgeglichen werden dürfen unabhängig
beeinflussen, theoretisch umstritten ist und einer davon, ob das gleichartige inländische Produkt
empirischen Grundlage entbehrt. Außerdem hat wegen seiner (umweltschädlichen) Eigenschaften
nicht zuletzt die entwicklungspolitische Perspek- oder wegen seiner Herstellung besteuert wird.
tive dazu beigetragen, zum einen die Legitimation Nun ist es aber aus Gründen der ökologischen
umweltpolitisch begründeter Antidumping-Maß- Effizienz und Praktikabilität häufig angezeigt,
nahmen zu hinterfragen und zum anderen das abgabenpolitisch nicht am Endprodukt anzu-
große Missbrauchspotenzial einer Regelung aufzu- setzen, sondern z. B. unmittelbar dort, wo die
zeigen, die es einem Land überlässt, den Import Umweltbelastung entsteht. Entsprechend stellt
von Gütern zu beschränken, die unter (vermeint- sich die Frage, ob Grenzausgleichsmaßnahmen
lich) anderen als den eigenen Umweltschutzbe- auch dann WTO-konform sind, wenn das inlän-
dingungen hergestellt wurden (Wiemann 1992; dische Endprodukt lediglich indirekt durch natio-
Vossenaar / Jha 1997, 21 ff.). Die Definitions- und nale Umweltabgaben belastet wird. Dies können
Messprobleme wären ebenfalls erheblich (Kulessa produktionsprozessbedingte Abgaben sein, die der
1995, 106 ff. u. 248 ff.). Würden Umweltschutz- Produzent direkt zahlen muss oder Abgaben auf
maßnahmen regelmäßig mit der Protektion der Betriebsmittel (z. B. Rohstoffe), die in das Produkt
betroffenen Wirtschaftszweige einhergehen, besteht einfließen. Obwohl die Frage seit längerem auf
außerdem die Gefahr, dass dies der Schrumpfung der Agenda des WTO-Ausschusses »Handel und
umweltintensiver Branchen im Inland entgegen- Umwelt« steht, herrscht nach wie vor Unklarheit
wirkt und der umweltpolitisch an sich gewünschte über die Interpretation der relevanten GATT-Ver-
ökologische Strukturwandel gebremst wird. Außer- einbarungen (WTO 1998b). Während die Diskus-
dem senkt Außenschutz erfahrungsgemäß den sion über den Ausgleich produktionsprozessbe-
Innovationsdruck auf die Unternehmen, so dass dingter Umweltabgaben nicht sonderlich weit
die dynamische Effizienz der Umweltpolitik leidet. fortgeschritten ist, mehren sich die Stimmen, dass
Inzwischen steht vielmehr das Konzept des Abgaben auf Betriebsmittel (»input taxes«) an der
Grenzausgleichs für Umweltabgaben und seine Zollgrenze ausgleichsfähig sein sollten (Jenzen
WTO-Konformität im Mittelpunkt der Diskussion 1998, 332 ff.). In diese Richtung deuten auch
(WWF 1995; WTO 1997; Jenzen 1998, 321 ff.). Grund- diverse Panel-Entscheide des Streitschlichtungs-
gedanke ist, dass auf einheimische Produkte erho- organs von GATT / WTO zum Grenzausgleich. 12 Die
bene Umweltabgaben quasi in die »Bezollung« hier letztlich gemachte Unterscheidung zwischen
importierter Produkte integriert werden. Aus- Inputabgabe und Emissionsabgabe ist aus ökolo-
gangspunkt der Überlegung ist, dass GATT / WTO gischer Sicht allerdings zunächst schwer nachvoll-
zwar eine abgabenrechtliche Schlechterstellung ziehbar, zumal Emissionsabgaben ja gleichgesetzt
ausländischer Produkte gegenüber gleichartigen werden können mit Inputabgaben auf das frag-
inländischen Produkten verbietet, aber nicht zu liche Medium (z. B. saubere Luft, Wasser etc.).
einer Besserstellung verpflichtet. Damit Abgaben, Die Unterscheidung wird jedoch vor dem Hinter-
die im Inland erhoben werden, nicht zu einer
Benachteiligung einheimischer Produkte führen,
bedarf es folglich eines Mechanismus, der eine 11. Zum Begriff der Wettbewerbsfähigkeit siehe z. B.
äquivalente Besteuerung des ausländischen Pro- Trabold (1995).
12. Siehe z.B. den Panel-Bericht zu United Taxes on
dukts ermöglicht. Diese Funktion erfüllt der am Petroleum and Certain Imported Substances v. 17. Juni
Bestimmungsland orientierte Grenzausgleich, der 1987 (GATT Basic Instruments and Selected Readings BISD
– mit umgekehrtem Vorzeichen – ebenfalls ange- 345/36).
IPG 3/2000 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik 261grund verständlich, dass sie nicht speziell für um- Umweltverträglichkeitsprüfung handelspolitischer
weltpolitische Abgabentypen gemacht wurde. Sie Vereinbarungen
soll vielmehr verhindern, dass das liberale Han-
delsregime dadurch ausgehebelt wird, dass die Ein umfassendes Konzept zur institutionellen
Staaten jedwede beliebige nationale Abgaben Integration umweltpolitischer Erfordernisse in
(Einkommen- und Körperschaftsteuer, Sozialab- die Welthandelsordnung stellt der Vorschlag dar,
gaben usw.) in den Grenzausgleich integrieren. 13 alle (neuen) handelspolitischen Abkommen einer
Außerdem wirft die Bestimmung der Höhe des »Umweltverträglichkeitsprüfung« (UVP) zu unter-
Grenzausgleichs in der Praxis erhebliche Zurech- ziehen und ggfs. durch umweltschutzpolitische
nungsprobleme auf, wenn Produktionssteuern Maßnahmen zu flankieren und / oder die Vereinba-
einbezogen werden, die anders als Abgaben auf rungen zu modifizieren (WWF 1998 und 1999).
Inputs nicht in einer einigermaßen festen und Analytisch können zwei Elemente der UVP unter-
quantifizierbaren Relation zum Endprodukt ste- schieden werden: Zum einen interessieren die um-
hen. weltpolitischen Implikationen der institutionellen
Immer mehr Staaten erheben sog. Ökosteuern Regelungen eines Handelsabkommens, und zum
(z. B. CO2-Abgaben) bzw. erwägen ihre Ein- anderen geht es um die wesentlich anspruchsvol-
führung. Somit wächst die Dringlichkeit, die WTO- lere Aufgabe, abzuschätzen, welche ökologischen
Regeln für den Grenzausgleich interner produk- Wirkungen davon ausgehen, dass sich Handels-
tionsprozessbezogener Abgaben klar zu definie- und Produktionsströme auf Grund des Handels-
ren. Die Aufgabe lässt sich jedoch nur bewältigen, abkommens quantitativ und qualitativ verändern. 14
wenn zwischen umwelt- und außenwirtschaftspoli- Ein Beispiel für institutionell bedingte Defizite
tischen Zielsetzungen ein Kompromiss gefunden liefert u. E. das SPS-Abkommen der WTO, dessen
wird. Ein Erfordernis ist, dass die Kriterien für aus- umweltpolitisch hinderliche Wirkung oben im
gleichsfähige Produktionsabgaben auf Umweltab- Zusammenhang mit dem »Hormonstreit« skiz-
gaben im engsten Sinne beschränkt bleiben und ziert wurde. Andererseits enthält das SPS-Ab-
streng eingegrenzt werden, was die Zurechenbar- kommen aber auch umweltpolitisch begrüßens-
keit der Abgabe auf das Endprodukt und die Höhe werte Elemente. So wird explizit festgehalten, dass
des Ausgleichs betrifft. Andernfalls werden einem nationale sanitäre und phytosanitäre Normen, die
abgabenpolitischen Protektionismus Tür und Tor internationalen Standards entsprechen, mit der
geöffnet und die Allokationsgewinne der interna- WTO per se vereinbar sind (SPS Art. 3.2). Damit
tionalen Arbeitsteilung erheblich schrumpfen wird der jeweiligen Fachebene (z.B. Codex-
(Felke 1998, 117 ff.). Im Zusammenhang mit dem Alimentarius-Kommission von FAO / WHO) Vorrang
Grenzausgleich für Exporte (Entlastung) muss vor freihandelspolitischen Postulaten eingeräumt.
zwischen den Wirkungen auf die ökologische Das Übereinkommen über technische Handels-
Effektivität der Abgabe und den Auswirkungen hemmnisse wählt einen ähnlichen Ansatz hinsicht-
auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der lich international vereinbarter technischer Normen
belasteten Unternehmen abgewogen werden. Es (Art. 2.5 des Übereinkommens). Eine quantitativ-
widerspricht der ökologischen Zielsetzung, dass empirisch ausgerichtete UVP ist im Vergleich zu
Schadstoffemissionen bei der Exportgüterproduk- diesem mehr oder weniger abstrakten Abklopfen
tion nicht besteuert werden. Andererseits erleich- von Vertragstexten extrem aufwendig und metho-
tert der Ausgleich die Durchsetzbarkeit von Öko- disch kaum befriedigend zu bewältigen. Die
steuern und dürfte somit einer Paralyse der Um-
weltpolitik entgegenwirken. Allerdings fördert der
13. Bereits im Jahr 1952 entschied ein GATT-Panel, dass
Ausgleich die Exporttätigkeit im allgemeinen und Ausgleichsabgaben zur Kompensation der belgischen
die der umweltintensiv produzierenden Branchen Familienbeihilfen unzulässig waren (GATT BISD 1). Zu
im besonderen. Es ist fraglich, ob die Effekte dem anderen Fällen vgl. Jenzen (1998).
Ziel einer international optimalen (Umwelt-)Allo- 14. In der einschlägigen Literatur wird üblicherweise
unterschieden zwischen a) Regulierungseffekten (Ein-
kation dienlich sind. fluss auf Umweltpolitik und -standards) auf der einen
Seite sowie b) Skalen-, Struktur- und Produkteffekten
auf der anderen Seite (OECD 1994).
262 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik IPG 3/2000Bemühungen der USA und Kanadas, die Wir- Zur »Ökologisierung« internationaler Investitions-
kungen des nordamerikanischen Freihandelsab- und Technologieströme
kommens (NAFTA) auf die jeweils nationale Um-
welt zu untersuchen, zählt zu den ersten umfas- Im Bereich des internationalen Kapital- und Tech-
senderen Ansätzen dieser Art. Die EU hat im ver- nologietransfers steckt die Diskussion über eine
gangenen Jahr eine Studie mit dem Ziel in Auftrag institutionelle Verankerung umweltpolitischer Ele-
gegeben, ein System für die UVP handelspolitischer mente in internationale Wirtschaftsabkommen in
Maßnahmen und Abkommen zu entwickeln und den Kinderschuhen, wenngleich der unverbind-
anzuwenden (Kirkpatrick et al. 1999). Darüber liche Verhaltenskodex der OECD für multinatio-
hinaus haben vor allem UN-Organisationen Län- nale Unternehmen zum Schutz der Umwelt im
derstudien erstellt, in denen sektorale Handelsver- Gastland auffordert. Darüber hinaus wächst seit
einbarungen (z. B. Agrarhandel) im Vordergrund Beginn der 90er Jahre die Zahl der Unternehmen,
stehen (insb. UNCTAD, UNEP). Die vorliegenden die umweltpolitische Selbstverpflichtungen bei
Untersuchungen können den einzelnen Ländern Direktinvestitionen in Entwicklungsländern ein-
bei der Entscheidung helfen, konkreten Liberali- gehen. Es fehlt jedoch eine systematisch herausge-
sierungsabkommen zuzustimmen bzw. auf ihre arbeitete ordnungspolitische Vorstellung darüber,
Modifikation zu drängen. Es besteht aber sowohl wie ein umweltpolitisch akzeptables internatio-
erheblicher Forschungs- als auch politischer Hand- nales Investitionsregime gestaltet werden könnte.
lungsbedarf, bis ein brauchbarer methodischer Ein Grund hierfür ist, dass es im Gegensatz zur
Untersuchungsrahmen für multilaterale Handels- Welthandelspolitik kein multilaterales Abkommen
abkommen entwickelt und umgesetzt sein wird, über Direktinvestitionen gibt. Als jedoch in den
der eine globale UVP ermöglicht. UVPs können Kreisen von Umwelt- und Verbraucherschutzver-
trotz aller Unvollkommenheit dazu beitragen, dass bänden Näheres darüber bekannt wurde, dass die
umweltpolitische Erfordernisse in der internatio- OECD-Staaten seit 1995 über die Errichtung eines
nalen Handelspolitik zukünftig stärker berücksich- Multilateralen Abkommens über Investitionen
tigt werden. Länder- und sektorspezifische UVPs (MAI) verhandelten, setzte eine Ökologisierungs-
führen möglicherweise auch dazu, dass Länder diskussion ein, die jener im Zusammenhang mit
umweltschutzpolitische Sicherheitsplanken parallel GATT / WTO ähnelt (WEED / Germanwatch 1998;
zur außenwirtschaftlichen Liberalisierung imple- Polaris Institute 1998). Mittlerweile wurden die
mentieren. Das setzt wiederum voraus, dass das MAI-Verhandlungen zwar ausgesetzt, da aber eine
Handelsabkommen diese vorsorgende Umweltpo- Wiederaufnahme der Verhandlungen in der OECD
litik nicht behindert. oder ihre Verlagerung in die WTO zu erwarten ist,
stellt sich weiterhin die Frage nach einer Öko-
logisierung eines multilateralen Investitionsab-
Zwischenfazit kommens.
Die Vorschläge für institutionelle Ergänzungen
Die inhaltliche Diskussion über die Integration einer liberalen Weltinvestitionsordnung lassen sich
umweltpolitischer Elemente in die WTO ist ver- im wesentlichen fünf Kategorien zuordnen (Ku-
gleichsweise weit gediehen. Wenngleich das erfor- lessa / Schwaab 1998, 48 f.):
derliche Ausmaß der »Ökologisierung« umstritten Ausnahmeregelungen, die den Regierungen
ist, steht weitestgehend fest, dass Reformbedarf umweltschutzpolitisch notwendige Maßnahmen
besteht. Eine – wie auch immer gestaltete – Öko- ausdrücklich erlauben, auch wenn sie mit den
logisierung der WTO allein reicht jedoch in vielerlei übrigen Regeln einer liberalen Investitionsord-
Hinsicht nicht aus, die internationalen Wirtschafts- nung nicht vereinbar sind;
beziehungen mit umweltschutzpolitischen Erfor- Verpflichtung der Regierungen zur Unterlas-
dernissen in Einklang zu bringen. Ergänzend wird sung umweltschädlicher Investitionsanreize
daher über eine »Ökologisierung« der Direktinve- bzw. Verpflichtung zur Durchführung umwelt-
stitionen diskutiert. schützender (investitionsbezogener) Maßnah-
men, um einem »race to the bottom« bzw.
einer Paralyse der Umweltpolitik vorzubeugen;
IPG 3/2000 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik 263 ökologische Pflichten für Direktinvestoren Somit bestehen gewisse Chancen, dass die
einschließlich solcher Verpflichtungen, die den Staatengemeinschaft der Selbstverpflichtung der
Technologietransfer betreffen (verbindlicher UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
Verhaltenskodex); nachkommt, die Gestaltung weltwirtschaftlicher
Integration ökologischer Elemente in das Streit- Beziehungen an den Erfordernissen nachhaltiger
schlichtungsverfahren; Entwicklung auszurichten. Die Gruppe der Ent-
internationale Haftungsregelungen. wicklungsländer befürchtet jedoch, dass bei der
Ergänzend wird die Einrichtung eines internatio- »Ökologisierung« der Weltwirtschaftsordnung über-
nalen Technologiepools diskutiert, um vor allem sehen wird, dass Nachhaltigkeit der Weltwirt-
ärmeren Ländern den Zugang zu »sauberen« schaftsbeziehungen nicht auf Umweltklauseln und
Technologien zu erleichtern (Petschow et al. 1998, -standards eingeengt werden darf. So schwammig
238 f.) und dadurch zu einer »Ökologisierung« des der Nachhaltigkeitsbegriff auch sein mag, so
globalen Strukturwandels beizutragen. besteht doch mittlerweile Konsens darüber, dass
Die Ansätze sind jedoch konzeptionell noch eine Politik der Nachhaltigkeit neben dem Schutz
nicht derart ausgereift, dass eine abschließende der Ökosphäre zwei andere gleichberechtigte
Bewertung möglich wäre. Daher wird hier auf eine Ziele verfolgen muss, nämlich stabile wirtschaft-
intensivere Diskussion verzichtet und stattdessen liche Entwicklung und Verteilungsgerechtigkeit
auf unsere vorläufige Bewertung des MAI hinge- (Schmitz 1996; Enquete-Kommission 1994, 54 ff.;
wiesen (Kulessa / Schwaab 1998). Agenda 21). Der befürchtete Ökoprotektionismus
des Nordens und die einhergehende Beschnei-
Aussichten für eine »Ökologisierung« multilateraler dung der Handelrechte des Südens widersprechen
Wirtschaftsabkommen jedoch nicht nur dem Recht auf wirtschaftliche
Entwicklung und der gerechten Verteilung von
Innerhalb verschiedener internationaler Organisa- Lebenschancen, sondern würden die Vorausset-
tionen wird an Konzepten zur Integration von zungen für den Umweltschutz im Süden eher ver-
Weltwirtschaft und Umweltschutz gearbeitet und schlechtern als verbessern (Esty 1994, 188).
über sie verhandelt. Die OECD hat zum Beispiel Die Argumentation der Entwicklungsländer
Leitlinien über Handel und Umwelt entwickelt weist auf die erheblichen Gefahren hin, die eine
(1994). Die OECD-Leitsätze für multinationale institutionelle Verankerung von Umweltklauseln
Unternehmen sind momentan in der Überarbei- in die WTO hervorrufen kann. Die Möglichkeit des
tung und auch wenn die bisherigen Vorlagen des protektionistischen Missbrauchs lässt sich nicht
OECD-Sekretariats seitens der Wirtschaft als zu eng von der Hand weisen. Das Risikopotenzial ist u. a.
abgelehnt werden, 15 so dürfte es per saldo u. a. davon abhängig, welcher Ansatz der Ökologisie-
zu einer Konkretisierung der umweltschutzpoliti- rung gewählt wird. Am höchsten ist es sicherlich,
schen Richtlinien für Direktinvestoren kommen. wenn Antidumping-Maßnahmen gegen sog. Öko-
Die Ergebnisse des WTO-Ausschusses Handel dumping zugelassen würde. Am geringsten dürfte
und Umwelt sind zwar vergleichsweise beschei- es im Falle des Ansatzes sein, der in den Abkom-
den. Die heftige Kritik an der Ausschussarbeit, die men über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen
inzwischen selbst seitens etlicher Mitglieder und sowie über technische Handelshemmnisse seit 1995
des ehemaligen Generaldirektors der WTO geübt enthalten ist. Internationale Standards sind nicht
wurde, geben allerdings ebenso wie die »High- verpflichtend, aber sie können ungeachtet ihrer
level«-WTO-Symposien zu Handel und Umwelt handelspolitischen Wirkung im Rahmen der WTO
und die jüngste Erörterung des Vorsorgeprinzips explizit nicht angefochten werden. Die Möglich-
im SPS-Ausschuss Anlass zu der Hoffnung, dass in keit, im Produkt versteckte Umweltabgaben in
den kommenden Jahren konkrete Reformschritte den Grenzausgleich einzubeziehen, birgt bei eng
eingeleitet werden. Dafür spricht auch, dass definierter Zulässigkeit vergleichsweise wenig
u. a. die USA und die EU darauf gepocht hatten,
die umweltpolitischen Dimensionen der WTO auf 15. Aktuelle Informationen zum Überarbeitungspro-
die Agenda der – allerdings gescheiterten – WTO- zess finden sich im Internet unter http: // www.
Ministerkonferenz (Dezember 1999) zu setzen. oecd.org / daf / investment / guidelines / newtext.htm
264 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik IPG 3/2000Missbrauchspotenzial. Allerdings impliziert der schäden ist. Zum anderen kann über die Gestal-
Grenzausgleich von Prozessabgaben, dass insbe- tung der Weltwirtschaftsordnung nur auf einen
sondere die Produzenten von Industrieerzeug- Teil der produktions- und konsumbedingten Um-
nissen in den Entwicklungsländern und/oder ihre weltbelastungen Einfluss genommen werden. Die
Zulieferer Einnahmeeinbußen erleiden werden, ökologische Effektivität des weltwirtschaftspoli-
da ein Teil der Belastung aller Voraussicht nach tischen Ansatzes ist daher nicht eindeutig. Im Ein-
auf sie überwälzt wird. Trotz der hiermit verbun- zelfall kann die Beschränkung der internationalen
denen ungewissen entwicklungspolitischen und Arbeitsteilung so weit gehen, dass neben ihren
ökologischen Wirkung im Süden spricht u. E. aus ökologisch unerwünschten Effekten auch ihre posi-
umweltpolitischer Sicht das Gros der Argumente tiven Umweltwirkungen reduziert werden. Auch
für die Zulässigkeit des Grenzausgleichs. Er kann wenn diese Gefahr durch eine entsprechende Aus-
vor allem dazu beitragen, den »political drag« zu gestaltung der »Ökologisierung« gering gehalten
verhindern. Da der intensivste internationale Wett- werden kann, dürfte die ökologische Zielwirksam-
bewerb zwischen den Industrieländern stattfindet, keit des weltwirtschaftspolitischen Ansatzes im
wären außerdem Ausnahmeregelungen für Güter Vergleich zu unmittelbaren umweltpolitischen
aus Entwicklungsländern eine Option, entwick- Vereinbarungen gering sein. Damit rücken die
lungspolitisch bedenkliche Wirkungen zu redu- Umweltschutzpolitik und die Integration außen-
zieren, ohne die Funktionsfähigkeit des Grenzaus- wirtschaftspolitischer Aspekte in multilaterale Um-
gleichs spürbar zu gefährden. Die oben disku- weltschutzabkommen in den Vordergrund der hier
tierten Ausnahmeregelungen für Umwelt- und untersuchten Fragestellung.
Gesundheitsschutzmaßnahmen bergen ebenfalls
entwicklungshemmendes Potenzial für die Entwick-
lungsländer. Es kann m. a. W. ein Konflikt zwischen Internationale Umweltpolitik
den wirtschaftlichen Interessen (des Südens) und
der Souveränität der Länder (des Nordens), das Die Expansion internationaler Wirtschaftsströme
eigene Umweltschutzniveau zu bestimmen, beste- und die wachsende Interdependenz der Volkswirt-
hen. Der Konflikt verdient vor dem Hintergrund schaften hat verschiedene Implikationen für die
der international höchst ungleichen Verteilung internationale Umweltpolitik. Hierzu zählt, dass
von Einkommen und Marktmacht grundsätzlich bestimmte Handelsströme (z. B. Giftmüll) durch
Berücksichtigung. Es wäre u. E. jedoch eine um- internationale Umweltschutzabkommen reguliert
weltpolitisch abwegige Konsequenz, zu Gunsten werden. Außerdem eröffnet die ökonomische Inter-
ökonomischer Interessen des Auslands das nationale dependenz der internationalen Umweltpolitik die
Umweltschutzschutzniveau zu lockern. Option, ihren zunächst handelsunabhängigen Zie-
Alles in allem verdeutlicht die entwicklungs- len durch außenwirtschaftspolitische Maßnahmen
politische Perspektive, dass bei der institutionellen mehr Nachdruck zu verleihen (Siebert 1998, 214 f.;
Verankerung ökologischer Elemente in der WTO Biermann 1998, 349 ff.). Schließlich wird die ein-
Vorsicht geboten ist. Eine internationale Politik, zelstaatliche Umweltschutzpolitik angesichts der
die dem Postulat der ökologischen, ökonomischen wachsenden Standortkonkurrenz immer zögerli-
und sozialen Nachhaltigkeit verpflichtet ist, be- cher, ihre Bemühungen im Alleingang zu steigern.
deutet mehr als Ökoklauseln. Die »Ökologisie- Dem entgegen zu wirken, zählt zu den Aufgaben
rung« von Weltwirtschaftsabkommen kann sogar der internationalen Umweltschutzpolitik.
zum umweltschädlichen Bumerang werden, wenn
sie eine isolierte Maßnahme bleibt und wirtschaft-
liche und soziale Fragen im Zusammenhang mit Internationale Abkommen zur Regulierung
der Weltwirtschaftordnung außen vor bleiben. Der umweltschädlicher Handelsströme
Ansatz, Umweltproblemen mit internationalen
Wirtschaftsabkommen Herr zu werden, leidet Bisher wurden weltweit ca. 900 internationale
außerdem zum einen daran, dass der interna- Umweltschutzverträge geschlossen und schät-
tionale Güter- und Kapitalverkehr in den wenig- zungsweise zwischen 50 und 80 internationale
sten Fällen unmittelbar ursächlich für Umwelt- Umweltregime errichtet (Zürn 1997, 46 f.). Weni-
IPG 3/2000 Margareta E. Kulessa/Jan A. Schwaab, Konzepte zur »Ökologisierung« der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik 265Sie können auch lesen