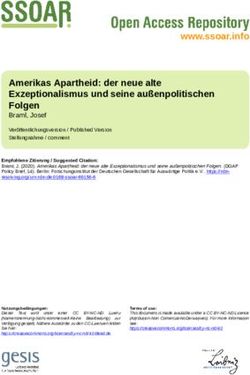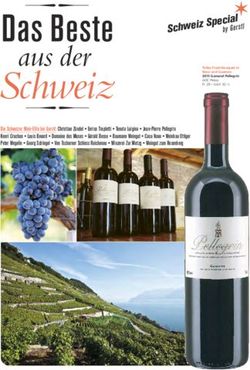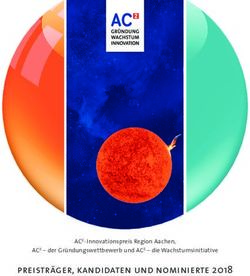POSITION - PETER BEYER MDB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020
Position
Peter Beyer
Über die Rolle der USA, der EU und
anderer Akteure auf dem Westbalkan
Eine Einordnung aus der politischen Praxis
Abstract
Regarding the Role of the USA, the EU and Other Actors in the Western Balkans
– A View from Political Practice
The six countries of the Western Balkans region are geographically located within
the heart of the European Union. This defines the responsibility of both Brussels
and of the 27 member states for supporting peace and stability in the Western
Balkans. The United States of America have traditionally played a paramount role
in the region, other than state actors from outside of Europe, such as China,
Russia, Turkey and some Arab countries. The reasons that these actors act as they
do, can be found in a weak political leadership and lack of interest by the EU. The
author lays out his view stemming from the political practitioner‘s perspective. He
describes the role of Germany, the EU, the US, and third party actors in the region.
He makes a strong case for a more transparent and closer cooperation between
the US and the EU. He criticizes the damage that has been done over the past
several years to the reputation of „The West” and its politics when it comes to the
Western Balkans. All this taken together leads the author to the conclusion that
there is a deep crisis of credibility.
Peter Beyer, MdB
Gehört seit 2013 für die CDU/CSU Fraktion dem Deutschen Bundestag an. Ist
Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und dort Haupt-Berichterstatter für Trans-
atlantische Beziehungen und den Westbalkan. Er ist Mitglied der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates, hier mit der Funktion des Berichterstatters
im Politischen Ausschuss für Kosovo. Außerdem ist er Koordinator für die Trans-
atlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung und Vizepräsident der Südost-
europa-Gesellschaft, München.
Kontakt: peter.beyer@bundestag.de
Der Beitrag wurde fertig gestellt im September 2020.8 Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Peter Beyer
It’s the credibility, stupid!1
„Die Tür steht für die Länder der Region erstmals in der Geschichte offen, vollständiger Teil
eines freien Europas zu werden“, sagte Joe Biden in Sarajevo im Jahr 2009. Der damalige
US-Vizepräsident und derzeitige Präsidentschaftskandidat signalisierte mit diesem Satz
seine Unterstützung bei der Annäherung der Staaten des westlichen Balkans2 an die Euro-
päische Union (EU). Jedoch hat sich dieses Bekenntnis mit dem Wahlsieg Donald Trumps
im November 2016 in einen radikalen Bruch mit den normativen Ansprüchen zwischen
Washington und Brüssel verkehrt.
Die bis dahin gemeinsamen sicherheitspolitischen Interessen der Region wurden zu Guns-
ten einer transaktionalen „relative gains“-Strategie der Trump Administration geopfert. Die
Länder des westlichen Balkans sind zum Spielball externer Akteure mit den unterschied-
lichsten Intentionen und Interessen geworden. Die europäische Staaten-Gemeinschaft hat
es nicht geschafft, mit überzeugenden Argumenten und Strategien dagegen zu halten. Die
Situation in diesem Teil Europas entwickelt sich mehr und mehr zum Lackmustest für die
Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union.
Nach den Zerfallskriegen im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren übernahm die
EU gemeinsam mit den USA die führende Rolle bei den Bemühungen, die Staaten des
westlichen Balkans dauerhaft im euro-atlantischen Kontext zu verankern. Für die Mehrheit
der Menschen in Südosteuropa verkörpert die EU seit jeher Frieden und Stabilität sowie
Freiheit und Demokratie. Das sind die prägenden Grundwerte der EU. Sie wurde dabei zum
Sehnsuchtsort und – gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika sowie einigen
NATO-Staaten – zum einflussreichsten Akteur.
Dabei ist die Rolle der NATO von besonderem Gewicht. Sie hat maßgeblich zur Beendigung
der Kriege beigetragen. Es waren vor allem die militärischen Missionen der NATO in Bos-
nien und Herzegowina sowie in Kosovo, die für Sicherheit und Stabilität gesorgt haben.
Jener Sicherheitsgedanke spielte seit jeher die zentrale Rolle für die Motivation, sich west-
lichen Werten zu verschreiben – Sicherheit schafft die Voraussetzung für Demokratie und
wirtschaftliche Integration.
Auch für die Internationale Gemeinschaft ist der Sicherheitsgedanke von damals zentral –
und Motivation, den westlichen Balkan auf seinem Weg in Richtung Westen zu begleiten.
Die Region stellt im sicherheitspolitischen Gefüge die Grenze zwischen Ost und West dar.
Die Bedeutung einer NATO-Zugehörigkeit für diese Staaten darf somit nicht unterschätzt
werden, gerade mit Blick auf Russland. Moskau unterstützt und inspiriert autoritäre Sys-
temansätze, um Chaos zu stiften, seine Einflusssphäre auszudehnen (auch territorial) und
nicht zuletzt Dependenzen politischer wie wirtschaftlicher Qualität zu forcieren.
Stark und vielversprechend war im Jahr 2003 die klare politische Willensbekundung der EU
auf dem viel beschworenen Gipfeltreffen von Thessaloniki. Der damalige Präsident der EU-
Kommission, Romano Prodi, unterstrich, der Beitrittsprozess für die Staaten des westlichen
Balkans sei seit dem Thessaloniki-Treffen „unumkehrbar“. Damals wie heute schätzten Be-
obachter die Formulierung „Unumkehrbarkeit des Beitrittsprozesses“ als bedenklich ein.
Prodi gab ein Sicherheitssignal, das die Staaten des westlichen Balkans ermutigen musste,
„lediglich Forderungen zu stellen, ohne zu erkennen, dass in der EU weiterhin die Gefahr
1 Bezug auf James Carville, Strategieberater der Präsidentschaftswahlkampagne von Bill Clinton im Jahr
1992 „It’s the economy, stupid!“.
2 Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien.Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Position 9
einer Erweiterungsmüdigkeit nach der [damaligen] Beitrittsrunde [bestand], zusätzlich zu
der ohnehin latent vorhandenen Abneigung gegenüber der Balkanregion mit ihren enor-
men Problemen“.3 Kurz gesagt: Die EU-Erweiterung ist bei den Bürgern und Politikern in Eu-
ropa zutiefst unpopulär. Die Assoziationen, die viele mit dem Westbalkan verbinden, sind
von Krieg, Völkerhass und Elend bestimmt. Berichterstattungen während der Kriege haben
das Bild bis heute geprägt – nicht zuletzt aufgrund von Schlagzeilen wie „Pulverfass Europa“,
„Hinterhof Europas“, „Die Balkan-Mafia“ oder „Blutiger Balkan“. Gerade in Deutschland er-
innern sich die Menschen an die großen Flüchtlingsbewegungen – die Folgen der Kriege
waren unmittelbar zu spüren.
Schon im Jahr 2012, vor dem Hintergrund der Euro-Krise, hat die Beitrittsperspektive des
Westbalkans erste Risse bekommen. Mit der geplanten Aufnahme Kroatiens als 28. EU-Mit-
glied wurde bereits im Vorfeld angekündigt, dass die Aufnahme der restlichen Staaten erst
einmal auf Eis läge. Seitdem wird der EU „Erweiterungsmüdigkeit“ bescheinigt. Und die
Staaten des westlichen Balkans tun sich schwer mit der Umsetzung der Aufnahmekriterien
der EU.
Die Erkenntnis, dass derjenige, der beitreten will, auch beitragen muss, ist oftmals in der
politischen Elite nicht verinnerlicht. Euro-Skeptizismus macht sich breit. Etliche Menschen,
die viel lieber und legitimerweise unter rechtsstaatlichen Strukturen und besseren Le-
bensbedingungen leben möchten, haben die Länder der Region vor Jahren verlassen. Und
der Exodus hält an. Weitere Hindernisse sind die fehlende historische Aufarbeitung der
Kriegszeit und die Versöhnung. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang sind die
Missing Displaced Persons. Viele Familien wissen auch nach 20 Jahren immer noch nicht,
was ihren Angehörigen widerfahren ist und wo sich diese befinden.
Die juristische Aufarbeitung des Krieges ist eine der größten Herausforderungen für die
Region. Die EU hat immer deutlich gemacht, dass ohne Kooperation der Länder mit dem In-
ternational Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) kein Vorankommen auf dem
Weg in die EU stattfinden kann. Das ICTY war das erste Kriegsverbrechertribunal, das von
den Vereinten Nationen geschaffen wurde. Die Kooperation ist schmerzlich, aber unab-
dingbar für einen ernsthaften und ehrlichen Versöhnungsprozess, der seinerseits eine
Conditio sine qua non für eine belastbare Zukunftsperspektive der Länder ist. „The leaders
of the Balkans will have our full support as they confront the challenges of reform. Beyond
complying with the political and economic Copenhagen criteria, they must commit to re-
conciliation among ethnic and religious communities and political groups to build a new
national consensus“, sagte Hillary Clinton, damals US-Außenministerin, in Sarajevo im Jahr
2010.
Die Rolle Deutschlands und der EU
Es war vor allem die Bundesrepublik Deutschland, die die Anbindung an den Westen seit
dem Krieg förderte und auf eine baldige Aufnahme der Länder drängte. Man war und ist
der Überzeugung, dass eine stabile und demokratisch entwickelte Region Südosteuropa
geopolitisch unabdingbar ist. Dieses Bekenntnis hat bis heute Gültigkeit. Der im Jahr 2014
auf Initiative der deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eingeleitete „Berlin-Pro-
zess“ ist eines der deutlichsten Signale dafür, dass alle Staaten des westlichen Balkans die
Möglichkeit haben sollen, der EU beizutreten, wenn sie die Beitrittsvoraussetzungen erfül-
3 Franz-Lothar Altmann, Der Gipfel EU – Westliche Balkanstaaten in Thessaloniki: Zurück zur Realität?, in:
SWP-Aktuell 26, Juli 2003, S. 5.10 Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Peter Beyer
len. Auch die Gründung des Regional Youth Cooperation Office (RYCO) ist auf eine Initiative
Deutschlands zurückzuführen. Hiermit soll die jüngere Generation in der Region vernetzt
werden. Es sollen Vorurteile abgebaut und die Aussöhnung vorangetrieben werden.
Nötig wurde das deutsche Engagement, da das Vertrauen zwischen Brüssel und den Staa-
ten der Region stark gelitten hatte. Aus Sicht der Westbalkan-Staaten wurden wirtschaft
liche und rechtsstaatliche Reformen nicht mit Integrationsfortschritten belohnt, sondern
immer wieder mit neuen bürokratischen Verfahren in die Länge gezogen. Auch die Erweite-
rungsmüdigkeit, die Motivations- und Sinnkrise der EU und die eigene Interessenslage ei-
niger Mitgliedstaaten haben dazu geführt, dass die EU in Südosteuropa an Attraktivität und
Einfluss verloren hat.
Andere Akteure sind mit militärischem Muskelspiel und wirtschaftlicher Macht zur verlo-
ckenden Alternative geworden. Deutlich wurde dies zuletzt im Oktober 2019, als der Euro-
päische Rat kein grünes Licht für den Beginn von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien
und Albanien gab. Frankreich, die Niederlande und Dänemark legten ihr Veto ein. Spätes-
tens mit diesem politischen Schachzug hat sich Frankreich unter Emmanuel Macron an die
Spitze der EU-Erweiterungsskeptiker gesetzt.
Verheerend war das „Nein“ zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen insbesondere für Nord-
mazedonien. Die Regierung von Ministerpräsident Zoran Zaev stürzte und musste vorgezo-
gene Parlamentswahlen ansetzen. „We are still disappointed, angry and a little bit frustra-
ted, because we got a promise from the European Union that when we deliver, they would
deliver — and they failed,” sagte Zaev enttäuscht.4 Der französische Präsident Macron hatte
sein Veto damit gerechtfertigt, dass der Mechanismus der Beitrittsverhandlungen nicht
mehr zeitgemäß sei. In der Region wurde dieses Verhalten als Ausdruck einer Erweite-
rungsmüdigkeit in den Kernländern der EU und, schlimmer noch, als Vertrauensbruch
wahrgenommen.
Diese Entscheidung war auch für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung ein
Tiefschlag. Denn beide wurden in den zurückliegenden Jahren nicht müde, für die Auf-
nahme von Verhandlungen zu werben. Insbesondere das Votum des Deutschen Bundes-
tags hatte bis dato immer Signalwirkung gehabt. Die Fraktionen der Regierungskoalition in
Berlin und auch Teile der im Bundestag vertretenen, demokratischen Opposition hatten –
durchaus mit kritischem Blick – lange Zeit für das „go“-Zeichen gerungen. Das Parlament
hat ein starkes Mitspracherecht bei Themen der EU-Erweiterung.
Als sich andeutete, dass Frankreich, die Niederlande und Dänemark aufgrund innenpoliti-
schen Drucks nicht den Mut aufbringen würden, sich positiv zu positionieren, hatte man in
Berlin noch gehofft, dass die deutsche Position wirkmächtig genug sein würde, damit sich
die kritischen EU-Mitgliedstaaten „mit Bauchschmerzen“ hinter dem deutschen Votum ver-
sammelten. Doch selbst dazu fehlte dem selbst ernannten Europavisionär Macron innen-
politisch die Kraft. Die desaströsen Folgen für die gesamte Westbalkan-Region im Herzen
Europas nahm man in Kauf und maß ihnen in der Abwägung zum eigenen Machterhalt in-
dessen nur geringe Bedeutung bei.
Inzwischen wurde eine „neue Methodik“ für den Beitritt zur EU erdacht, deren Ursprung
ebenfalls in „La Grande Nation“ zu finden ist. Selbstverständlich ist es derzeit noch viel zu
früh, eine erste Zwischenbilanz des neuen Verfahrens zu ziehen. Der Autor hegt allerdings
4 November 2019, Politico, https://www.politico.eu/article/north-macedonia-eu-accession-post-
emmanuel-macron-melancholy/Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Position 11
den Verdacht, dass man vordergründig nach Verbesserungen im EU-Erweiterungsprozess
sucht, wobei das eigentliche Ziel weitere Hürden und Verzögerungen oder gar eine Verhin-
derung der EU-Erweiterung ist. Den Verfasser machen diese und andere Überlegungen –
auch in Deutschland – sehr misstrauisch. Fast schon gebetsmühlenartig wiederholen Poli-
tiker unter Verweis auf den EU-Gipfel von 2003 in Thessaloniki unsere Bekräftigung zur Bei-
trittsperspektive der Westbalkan-Staaten. Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten
(und das möchte der Autor auf gar keinen Fall), so sollten die Verantwortlichen umgehend
damit aufhören, Thessaloniki zu bemühen.
Der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung und ihre Vertreter genießen in der Region
ein hohes Ansehen als ehrlicher – und zuweilen durchaus kritischer – Makler und Anwalt.
Was das Ansehen und die Reputation und damit den Einfluss der USA im Westbalkan an-
belangt, so ist festzuhalten, dass sie traditionell einen überragenden Stellenwert haben.
Die Rolle der USA und Einfluss anderer Akteure
In Südosteuropa zeigen sich wie in keiner anderen Region der Welt das Ausmaß und die
Tiefe der Beziehungen zwischen den USA, der EU und Deutschland. Die Geschichte hat hier
gezeigt: Wenn diese Akteure an einem Strang ziehen, können bewaffnete Konflikte zu einer
Befriedung gelangen. „This partnership is as necessary today as it has ever been, and it re-
quires all parties to work together toward our shared goal“,5 wurde Joe Biden kürzlich in der
albanischen Presse zitiert.
Die enge Verbundenheit zu den USA drückt sich nicht zuletzt dadurch aus, dass sie unsere
engsten Verbündeten außerhalb Europas sind. Wir teilen mit ihnen Werte wie Frieden, Frei-
heit, Demokratie und das Streben nach Wohlstand sowie die Beachtung von und den Ein-
satz für Menschenrechte. Wir haben in vielen Bereichen Schnittmengen bei Sachthemen
und Interessen. Diese enge Partnerschaft seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland
ist ein hohes Gut, das auch und gerade in stürmischen transatlantischen Zeiten mit Über-
zeugung hochgehalten werden muss. Das ist Voraussetzung für gemeinsames, erfolg
reiches Streben nach Frieden und Stabilität – auch auf dem Westbalkan.
Das Hauptziel der USA war von jeher die Stabilität des westlichen Balkans. „In den 90er
Jahren, als Bosnien-Herzegowina und später das Kosovo in furchtbare Kriege verwickelt
waren, waren es die Initiativen der USA, welche die Dinge im Balkan auf den rechten Weg
gebracht haben.“6 Von Beginn an war der Sicherheitsgedanke mit einer Mitgliedschaft der
einzelnen Länder in der NATO verknüpft – schon aus geopolitischen Überlegungen. Die In-
tegration in die euro-atlantischen und europäischen Strukturen galt seit jeher als Mittel,
um die russische Einflussnahme einzudämmen.
Dies hat sich insofern verändert, als dass neue (und alte) Akteure, darunter vor allem
China, ihren politischen Einfluss durch Investitionen in strategische Infrastruktur ausge-
baut haben. Längst befinden sich die USA und die EU im geopolitischen Wettkampf mit
Russland, China, der Türkei und den Golfstaaten.
Während Russland in den Staaten des Westbalkans, vor allem in Serbien, Montenegro und
der Entität Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina das Ziel der Spaltung und Schwä-
5 Illyria Press, 11.7.2020, Joe Biden Promises US-EU Cooperation to reach Kosovo-Serbia Deal.
6 Christian Schwarz-Schilling, Gastkommentar: Neue Initiative der Dayton-Staaten für den Westbalkan?,
Deutsche Welle, 10.9.2019.12 Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Peter Beyer chung der westlichen Staaten-Gemeinschaft vorantreibt, verfolgt China geostrategische Ziele. Aus der Perspektive Beijings stellt der westliche Balkan das Tor zum europäischen Markt dar. Er ist die chinesische Landbrücke zwischen Piräus und Duisburg. Durch immense chinesische Kredite haben sich fast alle Länder des Westbalkans in eine wirtschaftliche Abhängigkeit gebracht. Es wurde im großen Stil chinesisches Kapital in den Bergbau-Sek- tor und in die Stahl- und Rüstungsindustrie in Serbien investiert. Das serbische Innenministerium kündigte 2019 an, es werde in Belgrad 1.000 Kameras für Gesichtserkennung und automatische Kennzeichen-Erfassung installieren – man baue an einer „Safe City“. Die Technologie liefert der chinesische Konzern Huawei, der von den USA der Spionage für den chinesischen Staat verdächtigt wird. Es ist Fakt, dass auch Huawei der allmächtigen Kommunistischen Partei Chinas gegenüber auf Verlangen verpflichtet ist, Daten zu liefern – und zwar sowohl im Inland wie im Ausland. So lautet die einschlägige chinesische Gesetzeslage. Es handelt sich nicht um die erste chinesisch-serbische Zusammenarbeit im Sicherheits- sektor. So kann man seit dem vergangenen Jahr nicht nur serbische Polizisten auf den Stra- ßen Belgrads antreffen, sondern auch chinesische. Auch die militärische Zusammenarbeit der beiden Staaten ist kritisch zu verfolgen: Serbien kaufte kürzlich ein modernes Droh- nensystem beim chinesischen Partner. Es ist die Rede vom größten Waffengeschäft Chinas in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges. Aber auch andere Akteure, die die USA aus eigenem Sicherheitsinteresse im Auge haben, mischen kräftig mit auf dem Westbalkan. Die Golfstaaten investieren zum Teil immense Summen. Ihre größte Investition fließt in das Projekt „Beograd na Vodi“ (Belgrade on Wa- ter). Investiert wird vor allem in Ländern mit muslimischer Bevölkerung. Bosnien und Her- zegowina wurde schon im Krieg in den 1990er Jahren von Seiten muslimischer freiwilliger Kämpfer aus aller Welt unterstützt. Mudschaheddin-Kämpfer kamen ins Land, und soge- nannte Aufbaufonds wurden gegründet. Auch al-Qaida-Anhänger fanden ihren neuen Le- bensmittelpunkt auf dem Balkan, zum Beispiel durch die Eheschließung mit bosnischen Frauen. US-Nachrichtendienste machen seit damals immer wieder darauf aufmerksam, dass radi- kale Islamisten Verbindungen nach Bosnien und Herzegowina unterhalten. In diesem Zu- sammenhang sind auch die Investitionen Saudi-Arabiens zu nennen. Denn neben der Fi- nanzierung des Baus des größten Einkaufzentrums in Sarajevo sowie von „gated communi- ties“ und Freizeitparks fließt ihr Geld in den Bau von Gotteshäusern und Glaubenseinrich- tungen. Ziel ist es, eine für den Westbalkan neue Richtung des Islams zu implementieren, den Wahabismus. Auch die Türkei hat historisch, kulturell und religiös eine enge Verbin- dung zum Westbalkan. Sie investiert neben Infrastruktur, wie Autobahnen und Kanalisa- tion, in kritische Infrastruktur: Telekommunikation, Flughäfen wie zum Beispiel in Skopje, das Flughafenprojekt in Vlora oder die Gründung der Air Albania Fluggesellschaft und in Moscheen. China – darüber besteht in den USA Einigkeit – ist von allen „Playern“ die größte außenpo- litische Herausforderung. Die USA und China sind wirtschaftliche und militärische Konkur- renten. Es ist die Rede von einem neuen Kalten Krieg. Die EU bezeichnet China zu Recht als systemischen Rivalen. China spricht in der Zwischenzeit davon, dass die Amerikaner Eu- ropa vergiftet hätten und sie jetzt Europa „desinfizieren“ müssten. Die US-Administration hat längst den Schauplatz Westbalkan erkannt und geht offensiv gegen die Konkurrenz vor. Die USA bemühen sich verstärkt, als Vermittler wahrgenommen zu werden – auch oder sogar ostentativ ohne die EU.
Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Position 13 Am Beispiel von Kosovo lässt sich aufzeigen, welche Bedeutung die USA in der Region haben. Hier lässt sich auch die bereits erwähnte Annahme bestätigen, dass die Trump- Administration nicht mehr mit den Europäern zusammenarbeiten will. Fallbeispiel: Kosovo und Serbien Ohne die Amerikaner gäbe es das heutige Kosovo nicht. Am 24. März 1999 begann die Ope- ration „Allied Force“, der Angriff der NATO auf die damalige Bundesrepublik Jugoslawien, die aus Sicht der NATO als „humanitäre Intervention“ und als Meilenstein in der Geschichte des Bündnisses galt – ebenso in der Geschichte Kosovos und Serbiens. Es ging damals da- rum, einen Genozid zu verhindern. Das war richtig. Kosovo erklärte sich 2008 unabhängig von Serbien. Es entstand Europas jüngster Staat, der bis heute zwar von 101 Staaten aner- kannt ist, jedoch nicht von Russland und China. Auch in der EU herrscht nach wie vor Uneinigkeit über den Status von Kosovo, denn fünf EU-Staaten7 haben ihn nach wie vor nicht als unabhängigen Staat anerkannt. Bei diesen Mitgliedsländern handelt es sich um diejenigen, die entweder mit separatistischen Bewe- gungen innerhalb ihrer eigenen Grenzen umgehen müssen oder ihre besonders guten Be- ziehungen zu Serbien nicht ruinieren wollen. Trotz dieser nachvollziehbaren Motivationen muss es uns als Gesamt-EU zutiefst beschämen, dass wir es nicht einmal im geographi- schen Herzen Europas schaffen, eine einheitliche Politik zu verfolgen. Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der EU sind bei diesem Thema enorm unter Druck. Man sucht oftmals ver- geblich nach einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Die USA erkannten Kosovo einen Tag nach der Unabhängigkeitserklärung an, am 18. Feb- ruar 2008. Der damalige Präsident George W. Bush beendete sein Schreiben an den koso- varischen Präsidenten mit den Worten: „As Kosovo opens a new chapter in its history as an independent state, I look forward to the deepening and strengthening of our special friendship“. Bereits zwei Monate später eröffneten die Amerikaner ihre Botschaft in der Hauptstadt Pristina. Kosovo spiegelt seine spezielle Beziehung zu den USA auch im Stadtbild wider. Straßen sind nach Bill Clinton und George W. Bush benannt, auch nach Joe Bidens Sohn Beau Bi- den, der im Kosovo-Krieg gedient hat. 2009 wurde die Statue von Clinton im Stadtzentrum enthüllt. Und Senator Bob Dole wurde ein Denkmal in Podujeva gesetzt. Sogar das TIME Magazin veröffentlichte Artikel über die spezielle Verbindung der Kosovaren mit den USA.8 „Kosovo is not alone. You have friends ready to help all over the world – and no greater friend than the United States of America. […]. So as you continue to make progress on your democratic path, know the United States is going to continue to be champion for the peo- ple of Kosovo. And we will keep advocating around the world in every international orga- nization for a strong and independent Kosovo that is an integral part of a Europe whole, free and at peace“, sagte Biden 2016 in Kosovo. Die Internationale Gemeinschaft – in der die USA bisher eine dominante Rolle übernom- men haben – spielt eine überaus wichtige Bedeutung in Kosovo, eben weil es einen völker- rechtlich umstrittenen Status hat und zum Teil unter NATO-Verwaltung steht. EULEX, die Eu- ropäische Rechtsstaatlichkeitsmission, KFOR, die NATO-Schutztruppe, und UNMIK, die 7 Spanien, Griechenland, die Slowakei, Rumänien und die Republik Zypern. 8 https://time.com/kosovo-independence-america-obsession/
14 Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Peter Beyer Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen, sind internationale Missionen, die in Kosovo tätig sind. Diese Einsätze sind bis heute – notwendiger – Garant für den Frieden in der Re- gion und ein Symbol für die gemeinsame Außenpolitik der USA und ihrer Verbündeten. Da sich Amerika allenthalben aus seiner Rolle als zugleich geliebter und geschmähter „Weltpolizist“ zurückzieht – das konnte man bereits unter Präsident Barack Obama feststel- len – steht die heutige Politik der USA unter anderen Vorzeichen. Bereits im Jahr 2014 gab es von amerikanischen Sicherheitsexperten Äußerungen, dass die USA ihre globale Militär- präsenz drastisch senken und den Verteidigungshaushalt auf 2,5 Prozent des Bruttoin- landsprodukts (im Vergleich zu 3,8 Prozent heute) verringern werden – und man den Euro- päern ihre Sicherheit in die eigenen Hände geben sollte. Bereits unter der Bush-Adminis- tration wurde der Einsatz der Truppen auf dem Balkan überprüft und auf deren allmäh liche Verringerung hingearbeitet. An einen kompletten Abzug der US-Truppen dachte aber niemand. Das Hauptquartier des US-amerikanischen KFOR-Kontingents, Camp Bondsteel, zu schlie- ßen, wäre ein fatales Zeichen. Solange es keine Lösung für die umstrittene Region Nord- Kosovo gibt, werden die Nachbarstaaten Kosovo und Serbien nicht nur keine Chance ha- ben, in die EU aufgenommen zu werden, auch der Weg zur „Normalisierung“ oder gar zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern wird nicht möglich sein. Außenpolitische Realität ist aber auch, dass es zu einem zentralen Wahlversprechen Do- nald Trumps im Jahre 2016 gehörte, amerikanische Soldaten zurück nach Hause zu holen. Derzeit sind 667 US-Soldaten in Kosovo stationiert. „Bring our troops back home“ hängt da- bei wie ein Damokles-Schwert über einigen Krisenherden in der Welt, in denen GIs der US- Army Dienst tun. Auch bei der multi-nationalen Schutztruppe KFOR ist es wichtig zu verstehen, dass eine vollständige Beendigung des Einsatzes – oder auch nur eine übermäßige Reduzierung der Truppenpräsenz – falsch wäre: Ethnisch-religiöse Spannungen, ungeklärte Territorialfragen und die Lasten der (Kriegs-)Geschichte brodeln unter dem Deckel, den KFOR unten hält. Die Frauen und Männer in der Schutztruppe sorgen dafür, dass es nicht zu gravierenden In- stabilitäten kommt. Doppeldiplomatie – gefährliches Spiel Für die Geschichte des jüngsten Staates in Europa war das militärische Eingreifen der NATO der Wegbereiter in die Unabhängigkeit. Für Serbien war es dagegen das „worst case scena- rio“. Serbien wurde, das erste Mal seit Kriegsbeginn im Jahr 1999, drei Monate lang Schau- platz von Kriegshandlungen. Belgrad wurde durch die NATO bombardiert, an der Speer- spitze der Operation standen die Amerikaner. Schon durch die UN-Sanktionen von 1992 – 1995 hatte die Zivilbevölkerung stark gelitten. In den 1990er Jahren befand Serbien sich in einer Abwärtsspirale. Bis heute ist die Rolle der Internationalen Gemeinschaft (Sanktionen und militärische Intervention) im kollektiven Gedächtnis Serbiens fest veran- kert. Serbien bezeichnete sich selbst lange als das Opfer des Westens und hatte daher auch ein schwieriges Verhältnis zu den USA. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić verhält sich wie ein geschickter Doppeldiplomat. Er hält sich die Türe zu allen Akteuren auf dem Balkan offen. In einem Interview mit Euronews im Januar 2020 sagte er: „Serbien hat ein gutes Verhältnis zu Moskau. Ja, das haben wir und das werden wir weiter pflegen. Und um ehrlich zu sein, ich habe es satt, von all den ande- ren über unsere Zusammenarbeit mit China und Russland belehrt zu werden. Denn all die
Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Position 15 anderen treffen Xi Jinping und Wladimir Putin öfter als ich. Sie sollen ihre Arbeit als souve- räne Staaten erledigen. Serbien ist ein souveräner Staat. Wir tun alles, was das Beste für unser Volk und für unser Land ist“. Die Corona-Krise und die Folgen des „Nein“ für die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien zeigen, wie fortgeschritten der Vertrauensverlust und die Glaubwür- digkeitserosion in der EU sind – und wie insbesondere China, Russland und die USA dieses Machtvakuum für sich nutzen. Ein Beispiel hierfür lieferte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kürzlich selbst, als er seine Enttäuschung im EU-Parlament äußerte: In Serbiens Hauptstadt Belgrad habe man kurz nach dem Ausbruch der Pandemie großflächige Plakat- Tafeln mit Verlautbarungen „Danke Bruder Xi, du bist der einzige, der uns hilft“ lesen kön- nen. Er habe dort aber noch nie Plakate mit Dank für die Hilfe der EU erblickt. Im Mai 2020 kam dann endlich „grünes Licht“ für Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Für die Region war das zu spät. Und das dringend benötigte klare poli tische Signal verpuffte. Die EU hat mit diesem Verhalten einmal mehr an Glaubwürdigkeit verloren. In die Vertrauenskrise zwischen dem Westbalkan und der EU sind die USA mit dem ehema- ligen amerikanischen Botschafter in Deutschland, Richard A. Grenell, eingetreten, um ihre Rolle als Vermittler in der Region zu stärken. Eigentlich sollte dies als ein gutes Zeichen ei- nes stärkeren, pragmatischen Engagements der USA auf dem Westbalkan wahrgenommen werden. Wie sich in der Folge dann leider herausstellte, ist dem neu formulierten Interesse der Trump-Administration wenig Gutes abzugewinnen. Zum einen waren selbst die besten Kenner und diejenigen, die in der US-Balkanpolitik am erfahrensten waren und sind, so- wohl im Department of State als auch im National Security Council, geradezu vor den Kopf gestoßen, als Grenell plötzlich auf die Westbalkan-Bühne trat. Schlimmer noch, er ver- säumte es, auf die wertvolle Erfahrung und gute Arbeit seiner US-Kollegen zurückzugreifen. Auch im US-Kongress gab es allenthalben unverhohlenes Stirnrunzeln ob der neuen West- balkan-Politik. Die vermeintlichen Erfolge mit kurzfristig ans Oval Office verkauften „deals“ im Infrastruktur-Bereich erwiesen sich rasch als das, was sie waren und sind: PR-Aktionen und Luftnummern. Hervorzuheben ist hierbei die abstruse Vorstellung, dass die Flugverbindung zwischen Bel- grad und Pristina einen besonderen Nutzen für die Zivilbevölkerung haben könnte, deren Verbesserung der Lebensbedingungen Grenell sich als Ziel gesetzt hat. Vielmehr ist anzu- nehmen, dass diese Fluglinie von Diplomaten, Politikern und vornehmlich europäischen Besuchern frequentiert wird. Besonders misslich ist, dass trotz aller Appelle des Autors dieses Artikels und einiger anderer maßgeblicher Personen in Berlin und Brüssel bis zum heutigen Tag keine Transparenz des Grenell’schen Handelns gezeigt wird. Es scheint nicht einmal im Ansatz ein Interesse zu bestehen, mit den Europäern gemeinsam im Interesse der Menschen auf dem Westbalkan zusammenzuarbeiten. Im Gegenteil: Alle Versuche des EU-Sonderbeauftragten für Kosovo-Serbien, Miroslav Lajčák, ein Treffen oder Gespräch mit dem US-Sonderbeauftragten Grenell zu realisieren, blieben erfolglos. Klarer kann man sein Desinteresse an transparentem Handeln und an Zusammenarbeit nicht zum Ausdruck bringen. Die USA drängten – wie Deutschland auch – monatelang darauf, dass Kosovo die Zusatz- Zölle auf Waren aus Serbien und Bosnien und Herzegowina aufheben solle und knüpften dies als Bedingung an die Fortsetzung des Dialogs zwischen den beiden Staaten. Die Zoll- tarife waren 2018 eine Reaktion von Kosovo, um gegen Serbiens aktive Politik gegen die
16 Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Peter Beyer Mitgliedschaft von Kosovo in internationalen Organisationen anzugehen und eine Droh gebärde gegen die „Derecognition Campaign“ Serbiens. Zwei Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Krise kam es dann in Kosovo zu einer Regie- rungskrise. Der im Oktober 2019 neu gewählte Premierminister der links-nationalen Partei Vetëvendosje, Albin Kurti, wurde durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Inwieweit die USA hieran beteiligt oder gar treibende Kraft hinter jenen waren, die den Neuen im Amt mit Argwohn beobachtet haben, ist unklar. Auch die Rolle des Präsidenten Kosovos, Hashim Thaçi, der unter Anklage als Kriegsverbrecher bei der „Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office“ in Den Haag steht, spielte eine Rolle in dem Geflecht der amerikanischen Politik der transaktionalen Trump’schen Politik. Thaçi wird alles in seiner Macht Stehende tun, um nicht verurteilt zu werden. In Berlin und Brüssel beobachtete man die Einmischung der USA von Beginn an mit Arg- wohn, denn nur die EU bietet den Ländern des westlichen Balkans eine seriöse und ver- antwortungsbewusste Zukunftsperspektive und kann einen politischen Dialog führen und moderieren, der am Ende von beiden Seiten mit einem umfassenden und rechtlich bin- denden Abkommen besiegelt werden muss. Am 4. September 2020 haben der Premierminister von Kosovo, Avdullah Hoti, und der ser- bische Staatspräsident Aleksandar Vučić unter der „Schirmherrschaft“ der USA ein Abkom- men im Weißen Haus unterzeichnet, das einen Schwerpunkt auf wirtschaftliche Zusam- menarbeit legt. Wenn wir uns erinnern, so kommt uns dabei sofort der „Berlin-Prozess“ in den Sinn, der im Kern eine verstärkte regionale Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der Wirtschaft, im Blick hat. Das Abkommen zwischen Pristina und Belgrad wird in Washington als außenpolitischer Er- folg verkauft, als „historischer Durchbruch“. Der Vorschlag, den Beteiligten am Zustande- kommen dieser „White House Papers“ den Friedensnobelpreis zu verleihen, ist jedoch eine infame Beleidigung. Der Verdacht, dass hier die eigentliche Motivation ist, die bislang äu- ßerst bescheidene außenpolitische Bilanz des US-Präsidenten aufzuhübschen, wenige Mo- nate vor den Präsidentschaftswahlen, ist legitim. Im Rest der Welt wird das Abkommen kritisch gesehen. Beobachter bewerten die Zusam- menkunft im Weißen Haus als „Vorladung“ von Hoti und Vučić, die sich auf politisches Glatteis haben führen lassen. Trumps Expertise über die Entwicklungen zwischen Kosovo und Serbien beschreibt er selbst nach Unterzeichnung durch die beiden Parteien wie folgt: „There was a lot of fighting and now there is a lot of love“. Diese Äußerung des US-Präsi- denten kann man getrost als Tiefpunkt amerikanischer Westbalkan-Politik bezeichnen. Über die Umsetzung des Abkommens, und ob dies rechtlich bindend ist, wurde nichts kommuniziert – an einer Rechtsverbindlichkeit kann man jedoch starke Zweifel haben. Das Abkommen wurde nämlich von zwei Staaten unterschrieben, von denen der eine den anderen nicht anerkennt. Überraschend war vor allem der Punkt Israel betreffend – Verle- gung der serbischen Botschaft nach Jerusalem und gegenseitige Anerkennung von Kosovo und Israel. Hierbei wird gerade die jüdisch-muslimische Verbindung gefeiert. Kosovo wird nicht als europäischer Staat präsentiert, sondern als mehrheitlich muslimisch. Es muss jedoch ganz deutlich gesagt werden, dass Kosovo kein muslimischer Staat ist, sondern sei- ner Verfassung nach ein säkularer. Der Blick ins Abkommen zeigt deutlich die Strategie der Amerikaner auf, sich überall dort einzubringen, wo Russland und China bereits „Nägel mit Köpfen“ gemacht haben. Und es
Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Position 17 bestätigt die Äußerung im Eingang dieses Textes: Der Westbalkan ist zum Spielfeld gewor- den – nur dass die Länder selbst die Figuren sind, die von anderen nach eigenem Belieben hin- und hergeschoben werden. Für Serbien sind die „White House Papers“ ein weiterer Schritt in Richtung Anerkennung von Kosovo. Darüber kann auch Vučićs Beschwichtigung nicht hinwegtäuschen, es handele sich lediglich um einen bilateralen Vertrag mit den USA. Das ist auch deshalb falsch, weil die USA kein Signatar des Abkommens sind. Wie Trump hatte Vučić darauf gesetzt, dass die von Grenell erdachte Initiative bereits in der ersten Hälfte 2020 einen schnellen „deal“ bringen würde. Doch die – ungewöhnliche – Veröffentlichung über die Einreichung der An- klageschrift bei den Kosovo Specialist Chambers durch den Sonderermittler im April 2020, die den kosovarischen Präsidenten Thaçi namentlich benennt, durchkreuzte die Pläne des serbischen Präsidenten. Thaçi wird Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch- lichkeit beschuldigt. Eines ist bei allem politischen Tumult klar: Die Reputation der USA in Kosovo, die tradi tionell überragend gut war, ist durch das wenig sensible, wenig kenntnisreiche, unerfah- rene und keinem – außer vielleicht Donald Trump und Grenell – dienende Agieren stark ramponiert worden. Das kann niemandem gefallen. Das schafft zusätzliche Probleme. Resümee und Ausblick Im Grundsatz sind sich die USA und die EU, allen voran Deutschland, über ihr Ziel für die Staaten des westlichen Balkans einig, „[…] dass die USA keine monoethnischen, sondern ‚bürgerliche‘ Staaten auf dem Westbalkan sehen möchten. Das stimmt überein mit der eu- ropäischen Linie und Deutschland“.9 Auch wenn die USA und die EU in der Umsetzung die- ser Ziele momentan ins Wanken geraten. Die EU muss begreifen, dass sie mit einer geeinten Stimme auftreten muss, wenn sie als Vermittlerin in der Region weiterhin ernst genommen werden will. Sonst übernehmen an- dere das Heft des Handelns. Die Botschaft scheint angekommen zu sein. Der EU-Außenbe- auftragte Josep Borrell sagte kürzlich: „Um zu vermeiden, dass wir zu den Verlierern des Wettbewerbs zwischen den USA und China werden, müssen wir die Sprache der Macht neu erlernen und uns selbst als geostrategischen Akteur der obersten Kategorie begreifen“. Doch gesagt, geschrieben, philosophiert und akademisiert wurde viel in den letzten 25 Jah- ren über den westlichen Balkan, nun müssen endlich Entscheidungen getroffen und Taten ergriffen werden. Kurzum: Europa muss jetzt politisch führen. Der Westbalkan ist zu wichtig für Europa, als dass wir es zulassen könnten, dass diese Re- gion noch weiter zum Spielball anderer, nicht-demokratischer Akteure wird. Hier steht die Glaubwürdigkeit der EU und der USA auf dem Spiel. Das zu begreifen und in konsequentes politisches Handeln umzusetzen, und zwar jetzt, ist die Verantwortung, die die führenden Politiker in der EU und den USA haben. Ob EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi recht mit dem behält, was er kürzlich auf ei- ner Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin verkündet hat, nämlich, dass die „White House Papers“ gut geeignet sind dafür, Dinge nach vorne zu bringen und auch ein Startschuss für eine transatlantische Zusammenarbeit mit der EU sein werden, bleibt ein 9 Christian Schwarz-Schilling, Gastkommentar, op. cit.
18 Südosteuropa Mitteilungen | 04 | 2020 Peter Beyer noch sehr zartes Pflänzchen der Hoffnung. Von deutscher und europäischer Seite wird man sicherlich nicht nachlassen, die Hand für eine transparente, partnerschaftliche Zusam- menarbeit in Sachen Westbalkan ausgestreckt zu halten. Die USA sollten den transatlan tischen Händedruck erwidern.
Sie können auch lesen