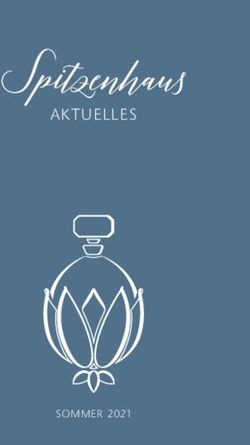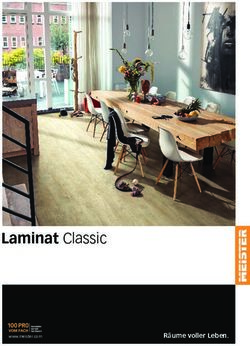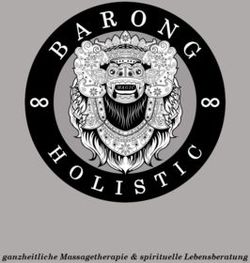Premierenstau - Reformierte Stadtkirche
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Premierenstau
Die für die vergangene lückenhaft ausgefallene Spielzeit vorbereiteten Produk-
tionen und die in der neuen, beginnenden Saison angesetzten purzeln derzeit
im regelrechten Premierenstau übereinander. Mehrfach finden diese derzeit
gleichzeitig und parallel an den beiden großen Spielhäusern Wiens statt. Am
vergangenen Donnerstag, dem 9. September waren das Grillparzers Medea in
der Josefstadt und Shakespeares Richard II. am Burgtheater. So lässt sich
dann die eine oder die andere Aufführung erst nach überstandenem Premie-
renfieber kennenlernen.
Das Theater in der Josefstadt hat sich ein Drama nach dem uralten
Mythos der Medea vorgenommen, das in den letzten Jahren mehrfach an den
verschiedenen Häusern und von verschiedensten Autoren und Regisseuren
aufgelegt wurde, hier und heute in der Vorlage von Franz Grillparzer und un-
ter der Regie von Elmar Goerden. Mit dem letzten Stück seiner Trilogie „Das
goldene Vlies“ von 1819-21 konzentriert sich Grillparzer auf das katastrophale
Ende der „Liebesgeschichte“ von Jason und Medea, das in seiner mythologi-
schen Typisierung eine geeignete Folie abgibt für die Ehekrisen seiner streng
bürgerlichen und patriarchalen Zeit. Die ihm folgenden Ehedramen von Henrik
Ibsen und August Strindberg erfreuen sich gleichfalls vieler Neuinszenierungen.
Der Blick durch die alte Brille auf die Gegenwart ist das Thema jeder aktuellen
Darstellung.
Elmar Goerden chargiert durch die Zeiten im Spiel mit wechselnden Kos-
tümen (Lydia Kirchleitner) von zeitloser dörflicher Bekleidung, die an Balkan
oder Kaukasus erinnert, über gediegen neuzeitliches Gewand bis hin zur Frei-
zeitkluft eines Karibikurlaubs. Vor der von Silvia Merlo und Ulf Stengl spär-
lich gehaltenen Kulisse – zeitweilig eine bloße Falltür im leeren dunkle Raum
oder mal die Andeutung eines Sommerstrand und nicht zu vergessen die fatale
Dusche in unterschiedlicher Funktion und Symbolik – ist genug Raum für die
Auseinandersetzungen zwischen dem Ehepaar und mit den angeflehten Gön-
nern. Gegensätze ziehen sich an, während die Fremdheit des Herkommens
auseinandertreibt. Die Schuldgemeinschaft schweißt das Paares zusammen
und spaltet, wo das Asyl für den einen gewährt und der anderen verweigert
wird. Jasons Schwäche, der sich nicht einmal die Krawatte binden kann, ent-
puppt sich als übelster Charakter, der Medeas Liebe missbraucht und verraten
hat. Höhepunkt der Perfidie ist das teuflische Angebot, die Kinder auswählen
zu lassen, wer zum Vater und wer zur Mutter will. Dieser „Sorgerechtsstreit“,
der auch heute wiederholt zu tödlichen Konsequenzen führt, wird in der Szene
durch dramatischen Musikeinsatz (Toneinrichtung Michael Huemer) und Zeit-
lupentempo markant und grauenhaft hervorgehoben.
Sandra Cervik gibt der Aufführung und dem Abend den prägenden und
berührenden, erschütternden Eindruck. Die Suche nach der verlorenen Liebe
und einst erfolgreichen Kampfgemeinschaft, die Unterwerfung unter das unge-
rechte Urteil im Streit um die Kinder, die Finten gegen den jovial und ambiva-
lent agierenden König Kreon und seine hinterhältige Tochter Kreusa und
schließlich der Bruch und der Sturz in den Vernichtungsfeldzug werden von ihr
mit allen Facetten ausgespielt. Gekrönt von einem publikumswirksamen femi-
nistischen Monolog aus Textpassagen der Medea-Verarbeitungen von Ursula
Haas und Christa Wolf. Akzentuiert im provokativem Einsatz des Kopftuchs.
Joseph Lorenz überzeugt als nicht überzeugender Heimkehrer und Thronan-
wärter, der alles und zuallererst seine Frau für seine Zukunft verrät. WolfgangHübsch verliert sich ein wenig zwischen der Rolle als sicher taktierender Real-
politiker und zynischer Spieler mit dem Schicksal der Abhängigen. Die beiden
anderen Frauenrollen: Katharina Klar als verspieltes Königstöchterchen das
bunte Vögelchen, das geopfert wird, und Michael König als bunt behängte
Amme Gora. Unprätentiös gespielt, wie jede andere ältere Schauspielerin hätte
spielen können. Ein Regieeinfall, der wohl als Beitrag zu Gender-, Diversitäts-
und Blackfacing-Debatte auf der Bühne gelten könnte.
Joseph Lorenz (Jason), Katharina Klar (Kreusa), Michael König (Gora), Sandra Cervik (Medea)
Sandra Cervik (Medea) Fotos © Astrid Knie
Mit dem Bild des deutungsschwangeren Himmel, der nach Farb- und
Formenspielen als drohende Gewitterwolke einbricht und Bauklötzchen auszu-
spucken scheint, wird dem tödlichen Ende des Dramas ein absurder Schluss
aufgepfropft. Von Zettelchen eingeleitet, die unerkennbare Botschaften an die
vier Hauptfiguren aus dem Himmel geworfen haben, schlägt die Szene in eine
idyllische Kindergeburtstagsrunde um - alle gesund und munter einschließlich
des einst an den Rollstuhl gebundenen Kindes. Der „Vorhang fällt“ und das
Licht geht aus mit dem gemeinschaftlichen Ausblasen der Kerzen auf dem Ge-
burtstagstörtchen. Ein verzichtbarer Obolus an die Political Correctness, die
sich längst schon an Kindermärchen vergreift und das übliche gewaltsame En-
de des Bösen hilflos übertüncht. Das brauchte es bei Grillparzer nicht. Das
schlägt der Kunst vor den Kopf, die ausspielen darf und muss, was wir uns an-
gesichts unerträglicher Schreckensnachrichten von Familiendramen nicht vor-
stellen möchten.
Der kräftige Applaus gilt den Schauspielerinnen und Schauspielern.Parallel gab es am Burgtheater die Premiere des Richard II. von Wil-
liam Shakespeare, die schon einmal probeweise in Bregenz unter starker
Einschränkung der Publikumszahl voraufgeführt und im Stream angeboten
wurde. Ein außergewöhnliches Shakespearedrama, das den letzten Thronwech-
sel vor dem Ausbruch der Rosenkriege thematisiert. Die Absetzung eines Kö-
nigs. Damit hat Shakespeare zur Zeit der Königin Elisabeth, die die Königin
Maria Stuart enthaupten lässt, sehr viel riskiert, noch dazu opponierende Lords
mit einer Sondervorstellung des Stücks offensichtlich provozieren wollten.
Doch die Historisierung verhinderte ernste Folgen. Die Frage, inwieweit Amt
und Amtshandlungen an die Person gebunden sind und was aus dem Amts-
und Treueeid wird, reicht bis in die Gegenwart. Hatten sich bereits die frühen
Christen im Donatisten- und Ketzertaufstreit damit auseinandergesetzt, leistet
sich die Römische Kirche derzeit das Problem eines Papstes in selbstgewählter
Pension und eines zweiten amtierenden. Derweil werden demokratische Ver-
fassungen mehrfach durch gewählte „Führer“ ausgehöhlt, die diese Macht dau-
erhaft an ihre eigene Person binden und die Amtsübergabe verweigern wollen.
Lukas Haas (Percy), Johannes Zirner (Northumberland), Sarah Viktoria Frick (Heinrich Boling-
broke), Martin Schwab (Johann von Gaunt), Stacyian Jackson (Königin Isabel), Jan Bülow (Kö-
nig Richard II.), Bardo Böhlefeld (Aumerle), Sabine Haupt (Herzogin von York)
©Lukas Beck
Die aktuelle politische Brisanz wird von Regisseur Johan Simons durch-
aus aufgezeigt. Die Passagen um Lug und Trug deutlich hervorgehoben. Gleich
zum Auftakt stehen Lüge gegen Lüge. Doch der König mag nicht entscheiden
und löst mit der Verbannung beider Kläger weiteres Unheil aus. Hofschranzen
und Familienverwicklungen im Königshaus befeuern den Unfrieden. Ausplünde-
rung des Volkes und sogar der adligen Verwandtschaft für einen Irlandfeldzug
schaffen viel böses Blut. Die unerlaubte Rückkehr des verbannten Heinrich Bo-
lingbroke, während Richard noch mit dem Irlandkrieg beschäftigt ist, kommt
defacto einer Machtübernahme gleich. Er gewinnt das Volk und der überwie-gende Teil des Hofes läuft zu ihm über. Die anschließende Absetzung Richards
– als „freiwilliger“ Akt –, seine Inhaftierung und seine Ermordung durch einen
Übereifrigen bringen Bolingbroke als Heinrich IV an die Macht. Allein das Stre-
ben und der Wille zur Macht geben ihm, so lässt Shakespeare sagen, recht.
Wie überhaupt sich die Gewalt durch ihren Erfolg selbst rechtfertigt. Doch Lo-
yalität wird zum wohlfeilen Gut und lässt den Siegreichen vereinsamt zurück:
„Hab ich nicht einen Freund, der mich von dieser Furcht befreit?“
Johan Simons ist als experimentier-
freudiger Regisseur bekannt, der ein-
zelne Stücke wiederholt, aber ganz
unterschiedlich auflegt. Hier betont er
den Spielbühnencharakter. Das En-
semble verlässt die Bühne nicht und
wartet im Hintergrund aufgereiht und
neu eingekleidet auf den jeweiligen
Auftritt. Die zeitweiligen Grunz- und
Schmatzgeräusche sowie die Grimas-
sen zur Veranschaulichung von ver-
borgenen Emotionen sind aber allzu
nah am Kasperletheater. Dagegen
geht die Anlehnung an Shakespeares
pointenreiches Straßentheater zur
Volksbelustigung in wenigen auffla-
ckernden Kalauern beinahe unter.
Einzig Martin Schwab darf mit einem
Monolog brillieren, eine Kaskade von
Wortspielen lautmalerisch um seinen
Namen Gaunt. Die weibliche Beset-
zung der Rolle des Usurpators Boling-
broke mit Sarah Viktoria Frick noch
dazu abwechselnd in Kleid oder Hosen
Lukas Haas, Sarah Viktoria Frick angezogen ist die Infragestellung von
© Marcella Ruiz Cruz
geschlechtsbezogenen Rollenklischees
und gibt der Frick ausreichend Gelegenheit, ihr komödiantisches Talent auszu-
spielen. Demgegenüber darf Jan Bülow einen unsicheren und unkontrolliert
hektisch agierenden Richard geben, der ebenfalls sinnfällig gekleidet zeitweilig
in einem zu kurzen und schief hängenden Anzug auftritt als wäre er eben erst
aus seinem Knabengewand herausgewachsen. Neben der Kostümwahl (Greta
Goiris) zeichnet das Gestänge, das wechselnd neu aufgestellt und umgekippt
wird die Fragilität der Szenerie und des Geschehens nach (Bühne
Johannes Schütz), wobei der weite, offene Raum sich als akustisches Prob-
lem entwickelt. Zur Premiere ohne Micropops haben die Kritiken die Hör-
barkeit bemängelt. Doch die in der Folgevorstellung eingesetzten Kopfmikro-
phone haben durch Klangirritationen und Störgeräusche den Effekt der gut ge-
spielten Zwischentöne beeinträchtigt.
Verdienter Applaus für eine interessante Aufführung.
Johannes LanghoffSie können auch lesen