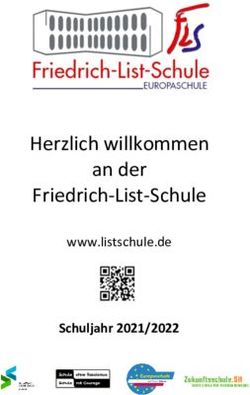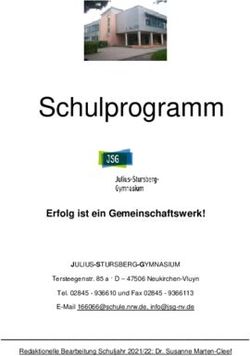Rahmenkonzept Qualitätsmanagement an den Volksschulen Nidwalden - Kanton Nidwalden
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Herausgeberin
Bildungsdirektion Nidwalden
Stansstaderstrasse 54
6371 Stans
Arbeitsgruppe Das Rahmenkonzept basiert auf dem IQES-Modell1
Rahmenkonzept: Qualitätsmanagement an den der unterrichtszentrierten Qualitätsentwicklung und
Volksschulen Nidwalden QM-Grundlagen der Kantone Zug und Glarus2 sowie
dem Grundlagenpapier zum Lehrplan 213. Es berück-
Amt für Volksschulen sichtigt Inhalte des Qualitätsentwicklungskonzepts
Patrick Meier, Marcel Stutz, Sandra Blunier, (2005) und Inhalte der Konzeptanpassung Qualitäts-
Ruth von Rotz entwicklung der Volksschulen NW (Juni 2013).
Schulleiter Kanton Nidwalden Das Rahmenkonzept wurde von der Geschäftsleitung
Willy Frank, Meinrad Leffin der Bildungsdirektion als verbindliche Grundlage für
die Umsetzung des Qualitätsmanagements an den
Projektleitung Volksschulen des Kantons Nidwalden ab August 2020
Ruth von Rotz beschlossen (Beschluss vom 13.2.2020).
1
Brägger, G. & Posse, N. (2007). Instrumente für die Qualitätsentwicklung
und Evaluation in Schulen ( IQES ). Wie Schulen durch eine integrierte
Gesundheits- und Qualitätsförderung besser werden können. Bern: hep
Verlag.
2
Brägger, G. (2011). Kantonales Rahmenkonzept «Gute Schule« – Qualitäts-
management an den gemeindlichen Schulen des Kantons Zug. (2. Auflage)
Brägger, G. (2010). Kantonales Rahmenkonzept «Gute Schule« – Qualitäts-
management an der Volksschule im Kanton Glarus.
3
Lehrplan für die Volksschule des Kantons Nidwalden, Bereinigte Fassung
vom 29.02.2016 der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz
(D-EDK), Luzern.Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Grundlagen und Zielsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Grundsätzliche Überlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Leitideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Das Qualitätsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Der Qualitätskreislauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Die sechs Ebenen des Qualitätsmanagements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Die zwölf Elemente des Qualitätsmanagements im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ebene und Elemente des Qualitätsmanagements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Übersicht Mindeststandards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Schülerinnen und Schüler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Element 1: Lernprozesse und Lernergebnisse Element 2: Kompetenzentwicklung Lehrpersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Element 3: Guter Unterricht Element 4: Feedbackkultur Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Element 5: Zusammenarbeit Element 6: Unterrichtsentwicklung Schulleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Element 7: Operative Führung und Personalentwicklung Element 8: Qualitätssteuerung und interne Qualitätssicherung Gemeinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Element 9: Strategische Führung und Controlling Element 10: Leistungsvereinbarung; Finanzen, Schulprogramm Kanton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Element 11: Planung und Steuerung des Bildungssystems Element 12: Schulaufsicht Kooperation auf allen Handlungsebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Nahtstelle Sekundarstufe I und II Kooperation mit Mittel- und Berufsfachschulen Kooperation mit weiteren Schulpartnern Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Literaturverzeichnis und Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Anhang Hinweise zu Praxis- und Umsetzungshilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vorwort
Liebe Lehrerinnen und Lehrer
Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter
Liebe Mitglieder der Schulbehörden
Qualitätsmanagement ist ein Leitbegriff, der heute so- Das Qualitätsmanagement hat zum Ziel, die Schul-
wohl in privatwirtschaftlichen als auch in öffentlichen und Unterrichtsqualität an den Volksschulen des Kan-
Handlungsfeldern von grösster Bedeutung ist. Im Bil tons Nidwalden zu sichern und eine kontinuierliche
dungsbereich spielen Fragen nach der Qualität im Rah- Weiterentwicklung zu ermöglichen. Es setzt auf sechs
men von Schulentwicklung eine zentrale Rolle: Was ist Ebenen verbindliche Mindeststandards, die in zwölf
eine gute Schule? Wie wird Unterricht wirkungsvoll ge- Elementen im Detail erörtert werden. Oberstes Ziel
staltet? Wie können Schule und Unterricht stetig zum des Qualitätsmanagements ist die nachweisbare hohe
Wohle der Lernenden verbessert werden? Qualität der Bildung der Schülerinnen und Schüler,
welche im Kanton Nidwalden die Schule absolvieren.
Die vorliegende Publikation ist eine Neuauflage des Die Schulen gestalten ihr eigenes institutionelles Ler-
Rahmenkonzepts zum Qualitätsmanagement an den nen systematisch und tragen Verantwortung für die
Volksschulen Nidwalden von 2005 und der Konzeptan- gezielte Aneignung und Förderung der fachlichen und
passung von 2013, die im Sinne einer Handreichung überfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und
die Schulen in der Umsetzung unterstützen soll. Es ist Schüler. Gute Schulen fordern und fördern bei den
ein praxisorientiertes Führungsinstrument, das Quali- Lernenden gezielt Kompetenzen, die zum Lernen und
tät nicht automatisch garantiert, aber als Praxishilfe zur Arbeiten befähigen und für die Schul- und Berufslauf-
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung dient. bahn bedeutsam sind.
Das vorliegende Rahmenkonzept beschreibt in kohä- Das Rahmenkonzept ist so angelegt, dass Schulen Ge-
renter Weise die Qualitätsarbeit der Schulen. Es ist so staltungsraum vorfinden, um ihrer Situation angepasst
gestaltet, dass die Schulen mit vertretbarem Aufwand vorzugehen. Die Schulen sind nach der Einführung des
darauf aufbauend ihr eigenes Konzept für das Quali- Lehrplans 21 in der Umsetzung entsprechend ihrem lo-
tätsmanagement verfassen oder anpassen können. kalen Umfeld und ihren Prioritäten verschieden unter-
Es soll Schulen darin unterstützen, die gesetzlichen wegs. Das Rahmenkonzept gewährleistet diese Vielfalt
Grundlagen im Bereich Qualitätsmanagement erfolg- unter einem einheitlichen Dach und dient der Entwick-
reich umzusetzen. Es ist als Dienstleistung für die Schu- lung der Schule als Ganzes. Die Grundlage für eine
len gedacht und führt die Führungsverantwortlichen in gute Schule sind fachlich kompetente und engagierte
die Denkweisen und Begrifflichkeiten eines zeitgemäs- Lehrpersonen und Schulleitungen. Ihre Wirkung wird
sen Qualitätsmanagements für Schulen ein. wesentlich verstärkt, wenn Lehrpersonen und Schul-
leitungen auf der Basis gegenseitigen Vertrauens mit
Die Schulen werden in ihrer Entwicklungsarbeit durch kantonalen und lokalen Schulbeteiligten zusammenar-
das Amt für Volksschulen und Sport unterstützt: beiten. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich
für das grosse Engagement und die Umsetzungsarbeit
• durch bedarfsorientierte Unterstützung von der Ab zum Wohle der Schülerinnen und Schüler des Kantons
teilung Qualitätsentwicklung, der Abteilung Schul- Nidwalden.
aufsicht und der Fachstelle Lehrerinnen- und Lehrer-
weiterbildung Bildungsdirektion
• durch die Netzwerke der verschiedenen Koordina
tionsgruppen
• durch webbasierte Instrumentenkoffer und Material
sammlungen
Res Schmid
Regierungsrat
5Grundlagen und Zielsetzungen
Grundsätzliche Überlegungen 3
Für die Ausübung der fachlichen Aufsicht über den
Schulbetrieb wird die Direktion durch das Amt für
Das Rahmenkonzept Qualitätsmanagement an den Volksschulen unterstützt.
Volksschulen Nidwalden ist Teil des gesetzlichen Auf-
trages zur Volksschulbildung. Es erläutert Grundlagen Art. 78 Amt für Volksschulen, Abs. 1
und Verfahren zur Überprüfung und Entwicklung von
1
Das Amt für Volksschulen bearbeitet die pädagogi-
Schulqualität und Unterrichtsqualität im Kanton Nid- schen, didaktischen und organisatorischen Belange
walden. Ziel ist, mit einem guten Volksschulangebot in der Volksschule. Es koordiniert, fördert und begleitet
allen Gemeinden eine hohe Bildungsqualität im Kan- die Entwicklung der Volksschule.
ton sicherzustellen.
Detaillierte Bezüge zu weiteren gesetzlichen Grund-
Das Rahmenkonzept stützt sich hauptsächlich auf lagen wie Vollzugsverordnung zum Gesetz über die
fol
gende gesetzliche Grundlagen: Gesetz über die Volksschule (Volksschulverordnung, VSV; NG 312.11)
Volks-schule (Volksschulgesetz, VSG; NG 312.1) insbe- und Vollzugsverordnung betreffend die Lehrpersonen
sondere auf (Lehrpersonalverordnung, LPV; NG 165.17) sind jeweils
bei den einzelnen Handlungsebenen erwähnt.
Art. 7 Interne Qualitätssicherung
1
Für die interne Qualitätssicherung und -entwicklung Leitideen
sind die Schulen sowie die Schulbehörden verantwort-
lich. Die Direktion legt die Mindestanforderungen fest. Die Ausgestaltung des Qualitätsmanagements für die
2
Die Schulleitung erstattet der Schulbehörde Bericht Volksschulen des Kantons Nidwalden orientiert sich an
über Konzeption, Feststellungen und vorgesehene folgenden Leitideen:
Massnahmen.
3
Werden bedeutende Qualitätsmängel festgestellt, Aufgabenerfüllung der Volksschule
ordnet die Schulbehörde die notwendigen Massnah- Das Rahmenkonzept dient der Aufgabenerfüllung der
men an. Sie berücksichtigt dabei nach Möglichkeit die Volksschule und ist entsprechend auf die umfassenden
Vorschläge der Schulleitung. Bildungs- und Erziehungsziele der Volksschule und de-
ren Rahmenbedingungen ausgerichtet.
Art. 8 Externe Qualitätssicherung
1
Das Amt für Volksschulen ist zuständig für die regel Legitimation und Rechenschaft
mässige Überprüfung des Qualitätsstands der Schu- Die Volksschule ist auf Qualitätsentwicklung und Qua-
len. Es kann zu diesem Zweck auch Schulbesuche litätssicherung angewiesen. Die kommunalen und
durchführen und mit ausserkantonalen Institutionen kantonalen Schulbehörden, die Politik, Wirtschaft und
zusammenarbeiten. Gesellschaft brauchen zuverlässiges Wissen zum Stand
2
Das Amt für Volksschulen erstattet der Schulleitung, der einzelnen Schulen und zum Stand der gesamten
der Schulbehörde und der Direktion Bericht und schlägt Volksschule, um Einfluss auf die weitere Entwicklung
Massnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung nehmen zu können.
vor.
3
Werden bedeutende Qualitätsmängel festgestellt, Professionalität und Eigenverantwortung
ordnet die Direktion die notwendigen Massnahmen an. Die Qualitätsentwicklung der Nidwaldner Volksschulen
Sie berücksichtigt dabei nach Möglichkeit die Vorschlä- baut auf der Verantwortung aller Schulbeteiligten auf.
ge der Schulbehörde und der Schulleitung. Im Zentrum der Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung steht die Schule als Ganzes. Es gilt, die Mei-
Art. 76 Regierungsrat, Abs. 1 nungen, Eindrücke und Wahrnehmungen zur Schul-
1
Der Regierungsrat hat die Oberaufsicht über die qualität aller Beteiligten (Behörden, Schulleitung, Lehr-
Volksschule. personen, Lernende, Eltern) zu berücksichtigen und zu
gewichten. Die Tätigkeit in den verschiedenen Ebenen
Art. 77 Direktion, Abs. 1 und 3 des Qualitätsmanagements verlangt von den profes-
1
Die Direktion leitet und beaufsichtigt den Vollzug der sionellen Akteuren ein reflektiertes Rollenbewusstsein
Volksschulgesetzgebung; sie ist für alle Massnahmen und von allen Beteiligten eine hohe Eigenverantwor-
zuständig, deren Anordnung nicht anderen Organen tung.
übertragen ist.
6Interne und externe Qualitätssicherung Vorgänge vor und wie diese beiden Bereiche systema-
Ein Konzept der Qualitätsentwicklung und Qualitäts- tisch und sinnvoll miteinander in Beziehung gesetzt
sicherung für Schule und Unterricht muss sowohl Ele- werden (vgl. Huber & Schneider, 2009).
mente «interner» wie auch «externer Überprüfung und
Beurteilung» enthalten. Evaluationen auf Schulebene
dienen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche- Der Qualitätskreislauf
rung. Evaluationsverfahren fördern die Kommunika-
tion über Schulqualität auf allen Stufen und bei allen Im Zentrum des Qualitätsmanagements steht für alle
Beteiligten. Ebenen (Kanton, Gemeinde, Schule) der Qualitäts-
kreislauf. Die Schule überlegt sich bei ihren Aufgaben,
Beratungs- und Unterstützungsangebote wo sie steht und welche Ziele sie mit welchen Instru-
Die Beratungs- und Unterstützungsangebote sind menten und Methoden am besten erreichen will. Sie
kundenorientiert und werden grundsätzlich freiwillig plant und überprüft ihre Zielumsetzung und leitet da-
genutzt. Schulen und Lehrpersonen holen sich, was sie raus die notwendigen Massnahmen ab. Ein vollständi-
ihrer Ansicht nach für ihre Entwicklung und persönliche ges Durchlaufen des Qualitätskreislaufes garantiert die
Professionalisierung benötigen. Die Beratung dient der systematische Weiterentwicklung der Schule als Gan-
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. zes.
Aufsicht In der Schule vor Ort sind diese Prozesse wesentlich
Der Kanton als Träger der Bildungshoheit hat die durch die Schulleitung zu garantieren. Dem Kanton
Hauptverantwortung für die Qualität des Bildungswe- kommen die Aufgaben der Bestimmung der kantona-
sens. Er nimmt dies wahr, indem er gesetzliche Vorga- len Rahmenbedingungen und der Aufsicht über Pro-
ben macht und deren Umsetzung beaufsichtigt. Die zesse zu.
Schulgemeinden sind als Schulträger zum einen für
die Umsetzung der kantonalen Bestimmungen, zum
andern für die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur • Konsequenzen • Ziele setzen
verantwortlich. ziehen • Massnahmen
• Massnahmen planen
weiterentwickeln
Das Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement Verbessern Planen
Überprüfen Umsetzen
Qualitätsentwicklung Qualitätssicherung
Qualitätsmanagement in Schulen hat die kontinuierli- • Zielerreichung • Umsetzen durch
che Verbesserung unter Anpassung an sich verändern- prüfen klare Prozesse
de Rahmenbedingungen und Anforderungen zum Ziel.
Es geht dabei einerseits um die Entwicklung von Ar-
beitsabläufen und Prozessen in Richtung dessen, was
(Abb. Qualitätskreislauf Kt. Nidwalden (2019) in Anlehnung an den Quali-
angestrebt und nötig ist (Qualitätsentwicklung) und tätskreislauf DVS, Kanton Luzern)
andererseits um die Sicherung der Veränderungen und
Verbesserung, die infolge dieser Entwicklung erreicht
werden (Qualitätssicherung). Das Management von
Qualität sieht das bewusste Gestalten dieser beiden
7Die sechs Ebenen des Qualitätsmanagements
Ziel ist, eine im internationalen und interkantonalen Der Kanton nimmt als oberste Führungsebene im kan-
Vergleich hohe Qualität der Bildung zu erreichen. Das tonalen Bildungssystem wichtige steuernde Funktio-
heisst: es ist sicherzustellen, dass das Bildungssystem nen wahr. Er gibt als übergeordnetes Aufsichtsorgan
des Kantons Nidwalden im Verbund aller Systempart- Rahmenbedingungen vor, die eine gleichwertige Bil-
ner leistungsfähig ist und sich mit den Veränderungen dung im Kanton garantieren. Er überprüft regelmässig
in der Wissenschaft sowie in der Arbeits- und Lebens- den Qualitätsstand und stellt Weiterbildungs- und Be-
welt weiterentwickelt. ratungsangebote sicher.
Die Gemeinde organisiert die Schule. Sie definiert im
Kanton
Rahmen der kantonalen Vorgaben das lokale Schulan-
gebot, stellt das Personal an und stellt die Infrastruktur
Gemeinde sowie die Betriebsmittel bereit. Die Gemeinde trifft im
Sinne der strategischen Führung mit den Schulen eine
Leistungsvereinbarung.
Schule
Schulleitung
Die professionell geleitete Institution Schule durch die
Schulleitung sowie die pädagogische Ausrichtung und
Team die Organisation der Teams haben einen grossen Ein-
fluss auf die Tätigkeit der Lehrpersonen und auf den
Lehrperson Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.
Die Kerntätigkeit der Schulleitung ist die operative
Führung der Schule; sie stellt die Organisation und
Schülerinnen die Durchführung des Schulalltags sicher. Die Aufga-
Schüler ben der Schulleitung in den Bereichen Organisations-,
Unterrichts- und Personalentwicklung sowie der Schul
führung sind klar geregelt und von denjenigen der Be-
hörden abgegrenzt.
In den Unterrichtsteams geschieht die konkrete Um-
setzung der Inhalte, welche die Schulleitung und das
Kollegium als bedeutsam und verbindlich für die Schu-
Fachliche Kompetenzen le bezeichnet haben. Eine Schlüsselrolle kommt der Zu-
und sammenarbeit im Team zu.
Überfachliche Kompetenzen
(personale, soziale, methodische) Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigste Ressource
Erwerb von Schlüsselkompetenzen, die für jeder Schule. Die Qualität der Schule hängt von kom-
eine erfolgreiche individuelle Lebens- und
Berufsgestaltung sowie eine funktionierende petenten, motivierten und gesunden Lehrpersonen
Gesellschaft notwendig sind. ab. Schulisch ist die Tätigkeit der Lehrperson die ge-
wichtigste Einflussgrösse für den Lernerfolg der Schü-
lerinnen und Schüler.
Im Zentrum der Qualitätsbemühungen steht das Wohl-
befinden und der Lernerfolg der Schülerinnen und
Schüler: Ihre fachliche und methodische, aber auch
ihre persönliche und soziale Kompetenz, ihr Laufbah-
nerfolg.
8Die zwölf Elemente des Qualitätsmanagements
im Überblick
Das Qualitätsmanagement umfasst sechs Handlungs sich alle Elemente beziehen, nämlich auf das gemein-
ebenen mit je zwei Elementen. Acht Elemente sind same Ziel einer hohen Bildungsqualität der Lernenden.
auf der Ebene der Schule als pädagogischer und be
trieblicher Einheit angesiedelt, zwei Elemente auf der Das Zusammenspiel der Handlungsebenen bzw. Ele-
Ebene der Gemeinde und zwei auf der Ebene des Kan- mente lässt sich mit dem folgenden Modell illustrieren:
tons. Dazu kommt ein gemeinsamer Fokus, auf den
Kanton
11. Planung und Steuerung des Bildungssystems 12. Schulaufsicht
Gemeinde 10. Leistungsvereinbarung;
9. Strategische Führung und Controlling Finanzen, Schulprogramm
Schule - Schulleitung
7. Operative Führung und 8. Qualitätssteuerung und
Personalentwicklung interne Qualitätssicherung
Team
5. Zusammenarbeit 6. Unterrichtsentwiclung
Kooperation mit Schulpartnern
Schülerinnen und Schüler • Eltern
1. Lernprozesse und Lernergebnisse • Berufsbildung, Lehrbetriebe
2. Kompetenzentwicklung • Abnehmerschulen
Bildung, • Pädagogisch therapeutische Dienste
• Schulpsychologischer Dienst
Lern- und
• Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
Lehrpersonen Laufbahn- • Berufsbeistand
3. Guter Unterricht erfolg • Gesundheitsförderung und Integration
4. Feedbackkultur
(Abb. Rahmenkonzept Kt. NW 2020 in Anlehnung an IQES-Modell)
9Alle zwölf Elemente gruppieren sich um das Ziel einer
Schule, die eine gute Bildung für die Lernenden an-
strebt. Dazu kommt - als wichtiges ergänzendes Ele-
ment - die Kooperation mit Partnern der Schule. Diese
ist auf allen Ebenen wichtig: auf der Ebene der Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrpersonen steht die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern im Vordergrund. Auf den
weiteren Handlungsebenen geht es darum, mit exter-
nen Partnern zu kooperieren, um die Bildungschancen
der Lernenden zu verbessern.
Schülerinnen und Schüler Element 1: Lernprozesse und Lernergebnisse
Element 2: Kompetenzentwicklung
Lehrpersonen Element 3: Guter Unterricht
Element 4: Feedbackkultur
Team Element 5: Zusammenarbeit
Element 6: Unterrichtsentwicklung
Schule - Schulleitung Element 7: Operative Führung und Personalentwicklung
Element 8: Qualitätssteuerung und interne Qualitätssicherung
Gemeinde Element 9: Strategische Führung und Controlling
Element 10: Leistungsvereinbarung; Finanzen und Schulprogramm
Kanton Element 11: Planung, Steuerung des Bildungssystems
Element 12: Schulaufsicht
Auf allen Handlungsebenen Nahtstelle Sekundarstufe I und II /
Kooperation mit Mittel- und Berufsfachschulen
Kooperation mit weiteren Schulpartnern
10Ebene und Elemente des Qualitätsmanagements
Kanton
Gemeinde
S ch u l e
11Übersicht Mindeststandards
Schülerinnen und Schüler 3.3 Jede Lehrperson richtet ihre individuelle Wei-
terbildung auf die eigene Qualitäts- und Unter
1. Lernprozesse und Lernergebnisse richtsentwicklung aus.
1.1 Den Schülerinnen und Schüler stehen kompe-
tenzorientierte, fachbedeutsame und gehaltvolle 4. Feedbackkultur
Aufgaben zur Verfügung, welche den individuel- 4.1 Jede Lehrperson holt in der Regel pro Jahr ein
len Voraussetzungen der Lernenden hinsichtlich Feedback ihrer Schülerinnen und Schüler, ihrer
des eigenverantwortlichen Lernens gerecht wer- Kolleginnen und Kollegen und der Eltern (Koordi-
den. nation über die Klassenlehrperson) ein.
1.2 Schüleraktivierende und kooperative Lernformen 4.2 Jede Leitungsperson holt in der Regel pro Jahr ein
werden im Unterricht eingeführt und weiterent- Feedback ihrer Mitarbeitenden ein.
wickelt. 4.3 Die Lehr- und Leitungspersonen informieren die
1.3 Die Schulleitung vereinbart mit den Lehrpersonen Feedbackgebenden über die Auswertung des
in den Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesprä- Feedbacks.
chen Ziele, die sich auf das eigenverantwortliche 4.4 Jede Lehrperson und jede Leitungsperson erkennt
Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirken für ihre berufliche Tätigkeit persönliche Entwick-
und sich dabei am aktuellen Stand der Unter- lungsziele.
richtsforschung orientieren.
1.4 Die Schülerinnen und Schüler kennen ihre Pflich- Team
ten, aber auch ihre Rechte im Schulbetrieb.
5. Zusammenarbeit
2. Kompetenzentwicklung 5.1 Jede Schule verfügt über ein schulinternes Un-
2.1 Die Schule legt den Fokus auf die für den Kom- terrichtsteamkonzept, das die Ziele der pädago-
petenzerwerb im Lehrplan 21 notwendigen An- gischen Zusammenarbeit, die dafür eingesetzten
eignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der Mittel, die Aufgaben und Zuständigkeiten von
Schülerinnen und Schüler. Teamleitung und Teammitgliedern beschreibt.
2.2 Die Lehrpersonen setzen Beurteilungsformen ein, 5.2 Jede Lehrperson gehört zu einem festen Un
die eine differenzierte Selbst- und Fremdbeur- terrichtsteam.
teilung des Lernstandes und des Kompetenzzu- 5.3 In der Schuljahresplanung sind Zeitgefässe für
wachses der Schülerinnen und Schüler erlauben eine regelmässige Zusammenarbeit in Unter-
und Entwicklungen sichtbar machen. richtsteams reserviert.
2.3 Die Kompetenzförderung im Allgemeinen und die 5.4 Jedes Unterrichtsteam verfügt über einen Auftrag
prognostische Beurteilung der Schülerinnen und und erarbeitet zu Beginn des Schuljahres eine
Schüler gegen Ende des 2. und 3. Zyklus sind von Zielvereinbarung und gemeinsame Arbeitspla-
den Lehrpersonen auf die Anforderungen ausge- nung an-hand der Vorgaben der Schulleitung.
richtet, die für den späteren Schul-, Berufs- und 5.5 Jedes Unterrichtsteam reflektiert periodisch seine
Lebenserfolg massgebend sind. Arbeit und erstattet der Schulleitung Bericht.
2.4 Die gemeinsame Beurteilungsstrategie ist kom-
muniziert. 6. Unterrichtsentwicklung
6.1 Jede Lehrperson wirkt gemäss ihrem beruflichen
Lehrpersonen Auftrag an der von der Schule geplanten Unter-
richtsentwicklung mit.
3. Unterricht 6.2 In der Schuljahresplanung sind Zeitgefässe für die
3.1 Jede Lehrperson vereinbart mit der Schulleitung schulinterne Weiterbildung reserviert.
in den Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesprä- 6.3 Unterrichtsmaterialien und Methodensammlun-
chen Ziele, die sich auf den Unterricht beziehen. gen stehen allen Lehrpersonen zur Verfügung.
3.2 Jede Lehrperson reflektiert die Wirkungen ihres
Unterrichts und nutzt dafür individuelle stufen
spezifische Feedbacks sowie klassenübergreifen-
de Lernstandserhebungen.
12Schule - Schulleitung 10.2 Die bedeutsamen kantonalen und kommunalen
Entwicklungen und Vorgaben widerspiegeln sich
7. Operative Führung und Personalentwicklung im Schulprogramm.
7.1 Mitglieder der Schulleitung sind für ihre Aufga- 10.3 Die Schulbehörde überprüft die Zielerreichung
ben qualifiziert. auf der Grundlage der Berichterstattung der
7.2 Die Schulleitung führt ein Schulprogramm, kon- Schulleitung.
kretisiert dieses im Jahresprogramm und erstellt
einen Jahresbericht. Kanton
7.3 Die Schulleitung besucht mindestens einmal
jährlich den Unterricht. 11. Planung und Steuerung des
7.4 Die Schulleitung führt jährlich ein Mitarbeiterin- Bildungssystems
nen- und Mitarbeitergespräch durch. 11.1 Die Bildungsdirektion erlässt ein Rahmenkonzept
für das Qualitätsmanagement an den Volksschu-
8. Qualitätssteuerung und interne len des Kantons Nidwalden.
Qualitätssicherung 11.2 Die Abteilung Qualitätsentwicklung des Amts für
8.1 Die Schulbehörde, die Schulleitung und das Kol- Volksschulen und Sport überprüft regelmässig,
legium verfügen über ein starkes gemeinsames ob die definierten Qualitätsleitziele in den Schu-
Qualitätsverständnis. len erreicht werden und leitet bei Nichterreichen
8.2 Die Schule erstellt auf der Grundlage des kanto- entsprechende Massnahmen ein.
nalen Rahmenkonzeptes zum Qualitätsmanage- 11.3 Die Abteilung Qualitätsentwicklung des Amts für
ment ein schulinternes Qualitätskonzept. Volksschulen und Sport gewährleistet bedarfsori-
8.3 Die Schule plant und führt in regelmässigen Ab- entierte Unterstützung.
ständen schulinterne Evaluationen durch. Nach
der Evaluation werden Massnahmen in einem 12. Schulaufsicht
Plan festgehalten und schrittweise umgesetzt. 12.1 Zwischen den Schulen und der Abteilung Schul-
8.4 Die Ergebnisse der internen Schulevaluation sol- aufsicht des Amts für Volksschulen und Sport fin-
len der externen Evaluation zur Verfügung stehen den jährlich Berichterstattungen statt.
– dies als Vorwissen zu Fokusevaluationen. 12.2 Die Abteilung Schulaufsicht des Amts für Volks-
schulen und Sport kontrolliert die Einhaltung der
Gemeinde gesetzlichen Bestimmungen und leitet bei Nicht-
einhalten entsprechende Massnahmen ein.
9. Strategische Führung und Controlling 12.3 Die Abteilung Schulaufsicht des Amts für Volks-
9.1 Die Schulbehörde legt eine gemeindliche Kom- schulen und Sport überprüft und unterstützt die
petenzordnung mit klarem Organisationsstatut schulinterne Qualitätsentwicklung und Qualitäts-
fest, welches die interne Organisation der Schul- sicherung.
leitung und der Schule regelt.
9.2 Die Schulbehörde genehmigt das von der Schul-
leitung erarbeitete schulinterne Qualitätskonzept.
9.3 Die Schulbehörde legt die strategischen Zielset-
zungen fest. Sie prüft die Güte des schulinternen
Qualitätskonzepts anhand des kantonalen Rah-
menkonzepts.
10. Leistungsvereinbarung; Finanzen, Schulpro-
gramm
10.1 Die Schulbehörde und die Schulleitung treffen
regelmässig Leistungsvereinbarungen. Auftrag
und finanzielle oder zeitliche Ressourcen stehen
in einem sinnvollen Verhältnis.
13Schülerinnen und Schüler Element 1 – Schülerinnen und Schüler
Lernprozesse und Lernergebnisse
Das Zusammenleben in einer Schulgemeinschaft Kurzbeschrieb
kann nur dann erfolgreich und zum Wohle der Schü- Eine wesentliche Aufgabe von Lehrpersonen besteht
lerinnen und Schüler erfolgen, wenn alle Beteiligten darin, den Unterricht auf die individuellen Lernvoraus-
sich ihrer Erwartungen, Rechte und Pflichten be- setzungen der Schülerinnen und Schüler auszurichten.
wusst sind und bemüht sind diese einzuhalten. Diese sollen in ihrem altersgerechten, selbständigen
Lernen und Arbeiten optimal unterstützt und sowohl
Schülerinnen und Schüler haben Rechte, aber auch gefordert als auch gefördert werden.
Pflichten. Damit Schule und Unterricht gut funktio-
nieren können, ist es wichtig, dass die Lernenden um Selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen
diese wissen und diese befolgen. Das Gesetz über heisst nicht, die Kinder und Jugendlichen sich in ih-
die Volksschule (Volksschulgesetz, VSG; NG 312.1) rem Lernen selbst zu überlassen. Vielmehr braucht es
gibt in Abschnitt D. Schülerinnen und Schüler Hin- seitens der Lehrperson eine achtsame Wahrnehmung,
weise auf die Pflichten und Rechte der Lernenden. wann und wie Kinder und Jugendliche diesem An-
spruch gerecht werden. Die Bereitstellung der entspre-
Eine Schule, die am Wohl und am nachhaltigen Ler- chenden Lernumgebungen und Unterrichtseinheiten
nen ihrer Schülerinnen und Schüler interessiert ist, sowie die stetig optimierte Passung an die Bedürfnisse
zeichnet sich durch eine hohe Qualität der Lehr- und der Lernenden obliegt immer der Lehrperson.
Lernarrangements aus. Die ganzheitlichen Lernpro-
zesse und Lernergebnisse der Schülerinnen und Wirkungsvolle Lernprozesse zeichnen sich dadurch aus,
Schüler sowie deren Kompetenzentwicklung und dass Schülerinnen und Schüler verschiedenste Mög-
Beurteilung sind der zentrale Bezugspunkt des Qua- lichkeiten haben, selber im Lernen aktiv zu sein, selbst-
litätsmanagements. ständig Informationen zu verarbeiten, zu recherchieren,
zu experimentieren, zu präsentieren, zu kooperieren, zu
üben und zu wiederholen sowie selber zu lehren. Viel-
fältige Handlungs- und Trainingsmöglichkeiten geben
Gelegenheit, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwi-
ckeln und zu vertiefen. Dabei kommt dem Sichtbar-
und somit dem Bewusstmachen dieser individuellen
Lernprozesse und deren Lernergebnissen eine grosse
Bedeutung zu.
Erfahrungen und Untersuchungen zeigen, dass die
schrittweise Einführung kooperativer und individuali-
sierender Lernformen
• zu mehr Lernerfolgen für alle Schülerinnen und
Schüler führt,
• gleichzeitig das fachliche und soziale Lernen fördert,
• zu positiven zwischenmenschlichen Beziehungen
und zu einem guten Lernklima beiträgt.
Ziele
• schüleraktivierende Aufgaben und kompetenzorien-
tierte Lernmaterialien entwickeln und einsetzen
• Schülerinnen und Schüler mit passenden Lernstrate-
gien und Arbeitstechniken vertraut machen
• Verantwortung für das eigene Lernen der Schülerin-
nen und Schüler stärken
• mit individuellen und kooperativen Lernformen das
selbstständige Lernen fördern
14Element 2 – Schülerinnen und Schüler
Kompetenzentwicklung
Instrumente Kurzbeschrieb
• Methoden- und Aufgabenpool für individualisieren- Die Lehrpersonen sind auch in einem Unterricht, der
de und kooperative Lernformen sich am Erwerb von fachlichen und überfachlichen
• differenzierte Schülertrainings zum eigenverantwort- Kompetenzen orientiert, absolut zentral. Sie gestalten
lichen Lernen und Arbeiten fachlich und methodisch vielfältige Lernumgebun-
• Unterrichtsplanung für die Umsetzung gen und Unterrichtseinheiten, führen die Klasse und
• Unterrichtsbeobachtungsbogen, Befragungs- und unterstützen die Lernenden pädagogisch und fach-
Reflexionsinstrumente für die Beobachtung und Be- didaktisch. Mit einer sensiblen Führung und bedarfs-
gleitung von Lernprozessen gerechter Lernunterstützung stellen Lehrerinnen und
Lehrer sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren
Ressourcen Voraussetzungen und Möglichkeiten entsprechend
• finanzielle und zeitliche Mittel für individuelle und Kompetenzen erwerben und aufbauen können. Nach-
schulinterne unterrichtsbezogene Weiterbildungen haltiger Kompetenzerwerb ist darauf angewiesen, dass
• Zusammenarbeit im Unterrichtsteam Schülerinnen und Schüler im Unterricht die Möglich-
• Erkenntnisse der Unterrichtsforschung keit haben, möglichst vielseitige Lernerfahrungen zu
• schulinternes Qualitätskonzept machen.
Verantwortlichkeit Eine konsequente Förderung von fachlichen und über-
Die einzelnen Lernenden, ihre Eltern und die Lehrper- fachlichen Kompetenzen verlangt sowohl das Engage-
sonen tragen Verantwortung für die gezielte Förderung ment der einzelnen Lehrpersonen als auch eine ge-
des selbstständigen Lernens. meinsame Strategie der ganzen Schule.
Die Gesamtverantwortung hinsichtlich eines optimalen Diese beinhaltet unter anderem Folgendes:
Lernumfeldes und den damit verbundenen Lernan-
geboten sowie deren Passung an die Bedürfnisse der Orientierung an Bildungsstandards
Lernenden liegt immer bei der Lehrperson. Sie ist ver- Die Schule orientiert sich an den Bildungsstandards,
antwortlich, dass die Lernenden, basierend auf den in- welche für die Fachbereiche Deutsch, Fremdsprachen,
dividuellen Voraussetzungen, im Unterricht möglichst Mathematik und Naturwissenschaften den Bildungs-
selbständig lernen können. Die Lehrperson stellt ent- auftrag konkretisieren. Sie beschreiben, welche Grund-
sprechend differenzierte Lernarrangements zur Verfü- kompetenzen von möglichst allen Schülerinnen und
gung. Schülern bis zum Ende eines Zyklus erreicht werden
sollen. Als Orientierungsmarken der schulischen Ziel
Mindeststandards erreichung beschreiben sie wesentliche Ziele für das
1.1 Den Schülerinnen und Schüler stehen kompe- Lehren und Lernen im Unterricht.
tenzorientierte, fachbedeutsame und gehaltvolle
Aufgaben zur Verfügung, welche den individuel- Lernziele und Kompetenzen
len Voraussetzungen der Lernenden hinsichtlich Durch die Beschreibung von Lernzielen in Form von
des eigenverantwortlichen Lernens gerecht wer- Kompetenzen im Lehrplan 21 werden Inhalte mit da-
den. ran zu erwerbenden fachlichen und überfachlichen
1.2 Schüleraktivierende und kooperative Lernformen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbunden; Wissen und
werden im Unterricht eingeführt und weiterent- Können, fachliche und personale, soziale und metho-
wickelt. dische Kompetenzen werden miteinander verknüpft.
1.3 Die Schulleitung vereinbart mit den Lehrpersonen Die Schule muss den Fokus auch auf die für den Kom-
in den Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesprä- petenzerwerb notwendigen Aneignungs-, Lern- und
chen Ziele, die sich auf das eigenverantwortliche Problemlöseprozesse der Schülerinnen und Schüler
Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirken ausrichten.
und sich dabei am aktuellen Stand der Unter-
richtsforschung orientieren.
1.4 Die Schülerinnen und Schüler kennen ihre Pflich-
ten, aber auch ihre Rechte im Schulbetrieb.
15Kumulativer Kompetenzerwerb Instrumente
Bedeutsame fachliche und überfachliche Kompeten- • Arbeitsmaterialien für die Entwicklung und Förde-
zen lassen sich nicht kurzfristig und in einer einzelnen rung der fachlichen und überfachlichen Kompeten-
Unterrichtseinheit erwerben. Sie erfordern eine konti- zen
nuierliche und längerfristige Bearbeitung im Sinne des • Arbeitsmaterialien für die Förderung der Aneig-
kumulativen Lernens. Dies setzt eine langfristige Pla- nungs-, Lern- und Problemlöseprozesse
nung und Beobachtung der Zielerreichung im Unter- • individuelle und schulinterne Weiterbildungen zur
richt voraus. Förderung der fachlichen und überfachlichen Kom-
petenzen sowie zu Aneignungs-, Lern- und Problem-
Kompetenzbeurteilung löseprozesse von Schülerinnen und Schülern
Aus der Kompetenzorientierung ergeben sich nicht nur
neue Akzente in der Betrachtung von Lernen und Un- Ressourcen
terricht, sondern auch mit Bezug auf die Rückmeldung • finanzielle und zeitliche Mittel für individuelle und
und Beurteilung von Lernprozessen und Leistungen schulinterne unterrichtsbezogene Weiterbildungen
der Lernenden. • Zusammenarbeit im Unterrichtsteam
• erprobte Arbeitsmaterialien zum Kompetenzaufbau
Zum kompetenzorientierten Unterricht gehört deshalb (IQES, zebis...)
eine auf die Erreichung von Kompetenzzielen bezo-
gene Feedbackkultur. Nicht einfach das Abfragen von Verantwortlichkeit
Stoffwissen darf im Vordergrund stehen, sondern es Die einzelnen Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern
braucht Überprüfungsformen, mit denen der Stand der und die Lehrpersonen tragen Verantwortung für die
Kompetenzaneignung differenziert beurteilt werden gezielte Aneignung und Förderung der fachlichen und
kann. Dabei sind sowohl Formen der Selbstbeurteilung überfachlichen Kompetenzen. Die Gesamtverantwor-
als auch der Fremdbeurteilung zwingend. tung hinsichtlich eines optimalen Lernumfeldes und
den damit verbundenen Lernangeboten sowie deren
Die Gewichtung der Beurteilungsarten verändert sich Passung an die Bedürfnisse der Lernenden liegt immer
im Laufe der Schullaufbahn. Zu Beginn der Schulzeit bei der Lehrperson.
steht die formative Beurteilung im Zentrum. Im Hin-
blick auf den Wechsel am Ende des 1. Zyklus gewinnt Mindeststandards
daneben die summative Beurteilung an Bedeutung. 2.1 Die Schule legt den Fokus auf die für den Kom-
Gegen Ende des 2. Zyklus und im 3. Zyklus, wenn Über- petenzerwerb im Lehrplan 21 notwendigen An-
trittsentscheide in weiterführende Schulen oder in eine eignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der
Berufslehre anstehen, kommt der prognostischen Be- Schülerinnen und Schüler.
urteilung vermehrtes Gewicht zu. 2.2 Die Lehrpersonen setzen Beurteilungsformen ein,
die eine differenzierte Selbst- und Fremdbeur-
Ziele teilung des Lernstandes und des Kompetenzzu-
• fachliche und überfachliche Kompetenzen durch me- wachses der Schülerinnen und Schüler erlauben
thodisch vielfältiges Lernen entwickeln und fördern und Entwicklungen sichtbar machen.
• Aneignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der 2.3 Die Kompetenzförderung im Allgemeinen und die
Schülerinnen und Schüler fördern prognostische Beurteilung der Schülerinnen und
• fachliches und soziales Lernen miteinander verbin- Schüler gegen Ende des 2. und 3. Zyklus sind von
den den Lehrpersonen auf die Anforderungen ausge-
• Überprüfungsformen nutzen, die Aufschluss darüber richtet, die für den späteren Schul-, Berufs- und
geben, inwieweit Schülerinnen und Schüler nachhal- Lebenserfolg massgebend sind.
tig Kompetenzen erworben haben 2.4 Die gemeinsame Beurteilungsstrategie ist kom-
• Kompetenzzuwachs durch die Lehrperson und die muniziert.
Schülerinnen und Schüler erfassen und rückmelden
16Lehrpersonen Element 3 – Lehrpersonen
Unterricht
Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigste Ressour- Kurzbeschrieb
ce jeder Schule. Die Qualität der Schule hängt von Ein zentrales Anliegen vieler Lehrerinnen und Lehrer ist,
kompetenten, motivierten und gesunden Lehrper- sich auf den Unterricht als Kernaufgabe der Schule zu
sonen ab. Die Vollzugsverordnung betreffend die fokussieren. Ein gelungener Unterricht trägt wesentlich
Lehrpersonen (Lehrpersonalverordnung, LPV; NG zur Berufszufriedenheit vieler Lehrpersonen bei.
165.117) regelt, gestützt auf Art. 22 des Bildungsge-
setzes, den beruflichen Auftrag der Lehrerinnen und Guter Unterricht ist motivierend, leistungswirksam,
Lehrer. entwicklungsfördernd und stärkt die Selbstlernkom-
petenz der Schülerinnen und Schüler. Er kann auf un-
Gute Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass jede terschiedliche Weise, nicht aber beliebig verwirklicht
Lehrperson an ihrer professionellen und persönli- werden. Mittlerweile sind die Qualitätsmerkmale guten
chen Weiterentwicklung kontinuierlich und evidenz- Unterrichts sehr umfassend erforscht. Auf diese Quali-
basiert arbeitet. Indem Lehrpersonen regelmässig tätsmerkmale Bezug zu nehmen ist zwingend, um den
ihre eigene Arbeit reflektieren, Feedbacks einholen eigenen Unterricht zu reflektieren und weiterzuentwi-
und sich in Teams an der Weiterentwicklung des Un- ckeln.
terrichts beteiligen, leisten sie einen unverzichtba-
ren Beitrag zur Qualität der Schule und der eigenen Wirkungsvoller Unterricht fördert das aktive Selbstler-
Arbeit. nen und die Kompetenzaneignung der Schülerinnen
und Schüler. Da Lernen ein individueller Vorgang ist,
Auch wenn Teamarbeit in der Schule eine zuneh- kommt der Gestaltung der Lernarrangements eine be-
mend bedeutsame Rolle spielt (Elemente 5 und 6), sondere Bedeutung zu. Die Wirksamkeit des Lernens
nimmt das individuelle Handeln der Lehrperson steht und fällt damit, inwieweit es gelingt, am beste-
dennoch viel Raum ein. Für die Qualität ihrer Praxis henden Wis-sen und den bereits vorhandenen per-
ist daher das individuelle Lernen und Optimieren sönlichen Kompetenzen anzuknüpfen, individuellen
zentral und bildet die Grundlage für die Teamarbeit. Zugängen, Neigungen, Interessen und Arbeitsweisen
gerecht zu werden bzw. diese zu ermöglichen. Daher
muss die Unterrichtsgestaltung auf das (unterschied-
liche und individuelle) Lernen der Schülerinnen und
Schüler ausgerichtet sein.
17Die nachfolgenden Merkmale haben erwiesenermas- • Zielvereinbarungen und persönliche Entwicklungs-
sen einen grossen Einfluss auf die Lernleistung (Meyer, planung im Rahmen der Mitarbeiterinnen- und Mit-
2004), (Hattie, 2013), (Helmke, 2014): arbeitergespräche
1. effiziente Klassenführung Ressourcen
2. lernförderliches Unterrichtsklima • finanzielle und zeitliche Mittel für individuelle und
3. vielfältige Motivierung schulinterne unterrichtsbezogene Weiterbildungen
4. Strukturiertheit und Klarheit • Unterrichtsteam, Lernpartnerschaften, kollegiale Be-
5. Wirkungs- und Kompetenzorientierung ratung, Intervision, Hospitation
6. Lehrperson-Lernenden-Beziehung • Dokumente für Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
7. formative Unterrichtsevaluation gespräche
8. metakognitive Strategien
9. Orientierung an den Schülerinnen und Verantwortlichkeit
Schülern Die primäre Verantwortung für die eigene professionel-
10. Förderung aktiven, selbstständigen Lernens le Weiterentwicklung liegt bei der einzelnen Lehrper-
11. Variation von Methoden und Sozialformen son. Ihr pädagogisch-erzieherisches Handeln auch im
12. Konsolidierung, Sicherung, intelligentes Üben Sinne der Beziehungsarbeit lässt sich nicht delegieren.
13. Feedback
Die Schulleitung ist für die gemeinsame schulinterne
Weiterbildung und für die individuellen Zielvereinba-
Ziele rungen mit den Lehrpersonen zuständig.
Sich auf den Unterricht als Kerngeschäft der Schule zu
fokussieren, ist für jede Lehrperson mit der professio- Mindeststandards
nellen (Selbst-)Verpflichtung verbunden; 3.1 Jede Lehrperson vereinbart mit der Schulleitung
• sich am aktuellen Stand der Forschung hinsichtlich in den Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesprä-
wirkungsvollen Unterrichts zu orientieren chen Ziele, die sich auf den Unterricht beziehen.
• den eigenen Unterricht ins Zentrum des beruflichen 3.2 Jede Lehrperson reflektiert die Wirkungen ih-
Lernens und der persönlichen Qualitätspflege zu rü- res Unterrichts und nutzt dafür individuelle stu-
cken fenspezifische Feedbacks sowie klassenübergrei-
• die Wirksamkeit der gewählten Lehr- und Lernformen fende Lernstandserhebungen.
zu prüfen 3.3 Jede Lehrperson richtet ihre individuelle Wei-
• Feedback zu nutzen, um herauszufinden, unter wel- terbildung auf die eigene Qualitäts- und Unter-
chen Bedingungen Schülerinnen und Schüler erfolg- richtsentwicklung aus.
reich und motiviert lernen können
• sich eigener Stärken und Schwächen in der Unter-
richtsführung bewusst zu werden und
• sich Ziele für die Verbesserung des eigenen Unter-
richts zu setzen
Instrumente
• Feedbackinstrumente zu Merkmalen guten Unter
richts für die Erhebung von Daten bezüglich der
Wirksamkeit des eigenen Unterrichts
• Lernstandserhebungen und klassenübergreifende
Leistungsmessungen
• Intervision, kollegiale Beratung, Lernpartnerschaften,
Hospitation
18Element 4 – Lehrpersonen
Feedbackkultur
Kurzbeschrieb • offene Methoden der mündlichen und schriftlichen
Die einzelne Lehrperson ist hauptsächlich für die Qua- Befragung
lität ihres eigenen Unterrichts verantwortlich. Für die • dialogische Kurzfeedbackformen
Reflexion ihrer Arbeit holt sie gezielt Feedbacks von
Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen Ressourcen
sowie Eltern ein. Die Rückmeldungen helfen «blinde • erprobte Instrumente von Feedbackmethoden (z.B.
Flecken«, Stärken und Schwächen zu erkennen, um die IQES…..)
eigene pädagogische und didaktische Praxis zu opti- • Weiterbildungsangebote des Kantons
mieren und weiterzuentwickeln. • schulinterne Weiterbildung zum Aufbau einer schu-
linternen Feedbackkultur
Im Fokus des Feedbacks steht nicht die Schule, sondern • schulinterne Weiterbildung in der Anwendung und
immer das Handeln der einzelnen Lehrperson. Sie holt Auswertung von Feedbackformen
die Feedbacks ein, hütet die Daten, wertet sie aus und
berichtet den Feedbackgebenden, welche Schlüsse sie Verantwortlichkeit
daraus zieht und bleibt mit diesen in Kontakt. Die Schulleitung sorgt mit geeigneten Verfahren und
Instrumenten dafür, dass das Individual-Feedback
Zusammen mit der Beurteilung durch die Schullei- profes
sionell durchgeführt wird. Es ist Aufgabe der
tung im Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch Schulleitung, die verschiedenen Formen des Feedbacks
(Element 7) und den kollegialen Feedbacks im Unter- zu planen und damit zu koordinieren.
richtsteam (Element 5) ergibt sich so eine 360°-Rück-
meldung, die der Lehrperson hilft, ihr professionelles Für das Einholen und Auswerten der Feedbacks ist die
Handeln bedürfnis- und bedarfsgerecht auszurichten. einzelne Lehrperson verantwortlich. Die Datenhoheit
An der Schule entsteht eine Feedbackkultur, in der über die eingeholten Rückmeldungen liegt bei der
Lernbereitschaft nicht nur als eine individuelle, sondern Lehrperson. Im Rahmen der Lehrpersonenbeurteilung
auch als eine institutionelle Haltung wahrnehmbar ist. kann die Schulleitung aber Auskunft über einzelne Da-
ten verlangen.
Ziele
• sich Informationen über beabsichtigte und unbe- Das Individual-Feedback in der oben beschriebenen
absichtigte Wirkungen des individuellen Berufshan- Form gilt für Lehrpersonen. Die Anforderungen an die
delns beschaffen Durchführung von Individual-Feedbacks gelten jedoch
• Wahrnehmungen, Werthaltungen und Erwartungen analog auch für Schulleitungen.
anderer Personen im beruflichen Umfeld kennen ler-
nen Mindeststandards
• «Blinde Flecken» im eigenen Handeln aufdecken 4.1 Jede Lehrperson holt in der Regel pro Jahr ein
• Hinweise zur Optimierung und Verbesserung der ei- Feedback ihrer Schülerinnen und Schüler, ihrer
genen Unterrichtspraxis gewinnen Kolleginnen und Kollegen und der Eltern (Koordi-
• Offenheit und Bereitschaft im Kollegium stärken, sich nation über die Klassenlehrperson) ein.
über das individuelle professionelle Handeln auszu- 4.2 Jede Leitungsperson holt in der Regel pro Jahr ein
tauschen Feedback ihrer Mitarbeitenden ein.
4.3 Die Lehr- und Leitungspersonen informieren die
Instrumente Feedbackgebenden über die Auswertung des
• Fragebogen für Lernenden- und Eltern-Feedback Feedbacks.
• Unterrichtsbeobachtungsbogen für das Kol legial 4.4 Jede Lehrperson und jede Leitungsperson erkennt
feedback für ihre berufliche Tätigkeit persönliche Entwick-
lungsziele.
19Team Element 5 – Team
Zusammenarbeit
Guter kompetenzorientierter Unterricht ist die Kern- Kurzbeschrieb
aufgabe der Lehrpersonen. Unterricht wird in einer Ein Unterrichtsteam ist eine kleine professionelle Ar-
bunten Palette unterschiedlicher Erscheinungsfor- beitsgruppe von Lehrpersonen, die den Unterricht für
men praktiziert. Deshalb muss sich die schulische die Schülerinnen und Schüler einer Stufe, eines Jahr-
Zusammenarbeit vor allem auf den Unterricht und gangs und/oder eines Fachs miteinander plant, durch-
das Lernen beziehen. führt und auswertet.
Gemäss Vollzugsverordnung betreffend die Lehr- Bei der Bildung von Unterrichtsteams kann einerseits
personen (Lehrpersonalverordnung, LPV; NG 165.117 die «horizontale» Zusammenarbeit gefördert und in-
§ 7 Abs. 2) gehört zum beruflichen Auftrag im Ar- stitutionalisiert werden: Klassen-, Jahrgangs-, Stufen-
beitsfeld Schule die Zusammenarbeit im Kollegium, teams.
mit Behörden und Amtsstellen. Ebenso gehört die
pädagogische Mitgestaltung der Schule, insbeson- Anderseits kann die «vertikale» Kooperation in Fach-
dere durch die Teilnahme an internen Veranstaltun- teams gestärkt werden, die über die einzelnen Jahr-
gen zur Schul- und Qualitätsentwicklung dazu. gänge hinweg die fachliche Zusammenarbeit pflegen.
Weiter umfasst der berufliche Auftrag im Arbeitsfeld Vorrangiges Ziel der Unterrichtsteams ist es, den Un-
Lehrperson laut § 8 LPV die Evaluation der eigenen terricht so weiterzuentwickeln, dass die Arbeits- und
Tätigkeit gemäss dem Qualitätskonzept der Schule; Lernleistungen der Lernenden sowie die Motivation der
die Weiterentwicklung der eigenen beruflichen Tä- Lehrenden und Lernenden steigen.
tigkeit sowie die institutionalisierte, die nicht insti-
tutionalisierte und die schulinterne Weiterbildung. Unterrichtsteams arbeiten in Nidwalden in folgenden
Aufgabenfeldern zusammen:
In den Unterrichtsteams geschieht die konkrete
Umsetzung der Inhalte, welche die Schulleitung • Vereinbarung von fachlichen und überfachlichen Bil-
und das Kollegium als bedeutsam und verbindlich dungs- und Erziehungszielen sowie pädagogischen
für ihre Schule bezeichnet haben. Erfahrungen und Grundsätzen, z.B. bei der Hausaufgabenpraxis…
wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass • Absprache der Unterrichtsinhalte/Stoffkoordination
Unterrichtsteams positive Auswirkungen auf die in Jahresplänen
Lehrpersonen haben, die Berufszufriedenheit er- • Unterrichtsvorbereitung und Austausch von Unter-
höhen, motivierend wirken und den Berufseinstieg richtsmaterialien
neuer Lehrpersonen erleichtern. • Planung und Auswertung von Unterrichtseinheiten
• Ermittlung des Lernstands, der Lernvoraussetzungen
und -potentiale der Schülerinnen und Schüler
• Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen und
Schüler, z.B. Festlegung von Beurteilungsmassstä-
ben, Reflexion der Ergebnisse von Vergleichsarbeiten
• Zusammenarbeit mit schulischen Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen, Schulsozialarbeit, Schuldiens-
ten, Schulbehörden
• Zusammenarbeit mit Eltern, z.B. gemeinsame Eltern-
information
• kollegiale Beratung
20Ziele Mindeststandards
• arbeitsfähige Unterrichtsteams schrittweise aufbau- 5.1 Jede Schule verfügt über ein schulinternes Un-
en terrichtsteamkonzept, das die Ziele der pädago-
• gemeinsame pädagogische Grundsätze innerhalb gischen Zusammenarbeit, die dafür eingesetzten
des Unterrichtsteams erarbeiten Mittel, die Aufgaben und Zuständigkeiten von
• Unterrichtsvorbereitungen und Unterrichtsmateria Teamleitung und Teammitgliedern beschreibt.
lien miteinander austauschen und teilen 5.2 Jede Lehrperson gehört zu einem festen Unter-
• gegenseitige Unterrichtsbesuche organisieren und richtsteam.
sich kritisch-konstruktiv mit dem Unterricht ausein- 5.3 In der Schuljahresplanung sind Zeitgefässe für
andersetzen eine regelmässige Zusammenarbeit in Unter-
• Zusammenarbeit mit schulischen Heilpädagoginnen richtsteams reserviert.
und Heilpädagogen und weiteren Instanzen koordi- 5.4 Jedes Unterrichtsteam verfügt über einen Auftrag
nieren und erarbeitet zu Beginn des Schuljahres eine
• innerhalb des Unterrichtsteams durch Zielvereinba- Zielvereinbarung und gemeinsame Arbeitspla-
rungen Verbindlichkeiten herstellen nung anhand der Vorgaben der Schulleitung.
5.5 Jedes Unterrichtsteam reflektiert periodisch seine
Instrumente Arbeit und erstattet der Schulleitung Bericht.
• schulinternes Unterrichtsteamkonzept mit Vorgaben
zu Zielvereinbarungen und Arbeitsplanungen des
Unterrichtsteams zu Beginn des Schuljahres
• erarbeitetes Unterrichtsmaterial, Vergleichstests usw.
Ressourcen
• Zeitgefäss für die Leitung sowie die Zusammenarbeit
in den Unterrichtteams
• Weiterbildung der Leitungspersonen der Unter
richtsteams
• schulinterne Weiterbildung
Verantwortlichkeit
Die Schulleitung ist verantwortlich für ein schulinternes
Unterrichtsteamkonzept und sorgt dafür, dass Unter-
richtsteams gebildet bzw. weiter konsolidiert werden.
Sie entscheidet über die personelle Zuordnung (insbe-
sondere auch von Teilzeitlehrpersonen) zu den Unter-
richtsteams, deren Leitung und Ressourcen.
Jede Lehrperson arbeitet in einem Unterrichtsteam mit.
Die Unterrichtsteams planen miteinander den Unter-
richt, führen ihn durch und werten ihn aus.
21Sie können auch lesen