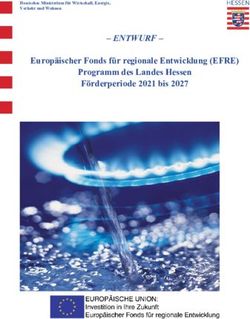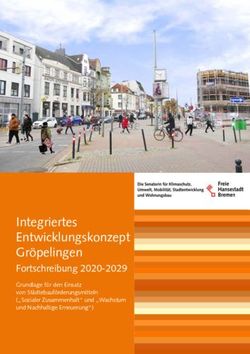Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft - Innovative Produktkreisläufe (ReziProK) - Forschung für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhaltsverzeichnis Projektblätter AddRE-Mo Seite 4/5 Werterhaltungsszenarien für urbane Elektromobilität der Personen und Lasten durch additive Fertigung und Refabrikation All Polymer Seite 6/7 Faserverstärkung zur Erhöhung der Ressourceneffizienz hochwertiger, voll recyclingfähiger Kunststoffprodukte Circular by Design (CbD) Seite 8/9 Ressourcenwende über nachhaltiges Produktdesign von Konsumgütern am Fallbeispiel Kühl-/Gefriergeräte ConCirMy Seite 10/11 Entwicklung eines stufen- und kreislaufübergreifend vernetzen Konfigurators für zirkuläres Wirtschaften (Circular Economy) C.O.T. CIRCLE OF TOOLS Seite 12/13 Entwicklung und Erprobung von Demonstratoren im Kontext der zirkulären Wertschöpfung von Werkzeugstählen DIBICHAIN Seite 14/15 Digitales Abbild von Kreislaufsystemen mittels einer Blockchain Di-Link Seite 16/17 Digitale Lösungen für industrielle Kunststoffkreisläufe DiTex Seite 18/19 Digitale Technologien als Enabler einer ressourceneffizienten kreislauffähigen B2B-Textilwirtschaft EffizientNutzen Seite 20/21 Datenbasierte Geschäftsmodelle für die Kaskadennutzung und verlängerte Produktnutzung von Elektronikprodukten EIBA Seite 22/23 Sensorische Erfassung, automatisierte Identifikation und Bewertung von Altteilen anhand von Produktdaten sowie Information über bisherige Lieferungen KOSEL Seite 24/25 Kreislaufgerechter Open-Source-Baukasten für elektrisch angetriebene Poolfahrzeuge LEVmodular Seite 26/27 Light Electric Vehicle modular - mit neuer Mobilität zur ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft LifeCycling² Seite 28/29 Rekonfigurierbare Designkonzepte und Services für die ressourceneffiziente (Weiter-)Nutzung von E-Cargobikes
LongLife Seite 30/31
Neue Geschäftsmodelle für die Weiternutzung technischer Systeme basierend auf einer
einfachen, dezentralen Zustandsbestimmung und Prognose der Restnutzungsdauer
MoDeSt Seite 32/33
Produktzirkularität durch modulares Design --
- Strategien für langlebige Smartphones
OptiRoDig Seite 34/35
Optimierung der Rohstoffproduktivität in der Gießerei- und Stahlindustrie aus Produkten der
Recyclingwirtschaft durch mathematische Verfahren, Vernetzung und Digitalisierung
PERMA Seite 36/37
Plattform zur effizienten Ressourcenauslastung in der Möbel- und Ausstattungsindustrie
praxPACK Seite 38/39
Nutzerintegrierte Entwicklung und Erprobung praxistauglicher ressourceneffizienter
Mehrwegverpackungslösungen im Versandhandel
ReLIFE Seite 40/41
Adaptives Remanufacturing zur Lebenszyklusoptimierung vernetzter Investitionsgüter
RePARE Seite 42/43
Regeneration von Produkt- und Produktionssystemen durch Additive Repair und
Refurbishment
REPOST Seite 44/45
Recycling-Cluster Porenbeton: Erarbeitung neuer Optionen für die Kreislaufführung
ResmaP Seite 46/47
Ressourceneffizienz durch smarte Pumpen
RessProKA Seite 48/49
Schließung von ressourceneffizienten Produkt-Kreisläufen im Ausbaugewerbe durch neue
Geschäftsmodelle
UpZent Seite 50/51
Upcycling-Zentrum --
- Ein partizipatives Geschäftsmodell zur Sensibilisierung und
Implementierung einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft
Wear2Share Seite 52/53
Innovative Kreislaufgeschäftsmodelle in der Textilwirtschaft
Wissenschaftliches Begleitvorhaben
RessWInn Seite 54/55
Vernetzungs- und Transfervorhaben zur BMBF-Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente
Kreislaufwirtschaft --
- Innovative Produktkreisläufe‘‘AddRE-Mo – Werterhaltungsszenarien für urbane
Elektromobilität der Personen und Lasten durch
additive Fertigung und Refabrikation
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Mit fast einer Million verkaufter E-Bikes in Deutschland stiegen die Verkaufszahlen 2018 um 36 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr, doch was am Ende des Produktlebens mit den E-Bikes geschieht, ist derzeit häufig ungeklärt. Daher hat
sich der „AddRE-Mo“-Verbund aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen zum Ziel gesetzt, Werterhaltungs-
netzwerke für die urbane Elektromobilität zu entwickeln, um eine Kreislaufführung von E-Bikes, z. B. mittels additiver
Fertigungsverfahren, zu ermöglichen.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt-
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Werterhaltungsnetzwerke für urbane Elektromobilität Im Rahmen des Projekts erfolgt ein prototypischer
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Elektro- Aufbau eines Werterhaltungsnetzwerks für E-Bikes.
mobilität spielt die Menge der eingesetzten Ressourcen Die Ergebnisse sollen künftig systematisch auf weitere
je Fahrzeug, z. B. Energie, Material, etc., eine zentrale Bereiche der urbanen Elektromobilität übertragbar
Rolle für eine nachhaltige Marktentwicklung. Im Projekt sein, sodass weitere Ressourceneffizienzpotenziale er-
„AddRE-Mo“ verfolgt ein Verbund aus Unternehmen und schlossen werden können.
Forschungseinrichtungen das Ziel, ressourceneffiziente
Werterhaltungsnetzwerke für die urbane Elektromobilität Design für additives Remanufacturing
zu entwickeln. Geeignete Komponenten elektrifizierter Für eine umfassende Erhebung potenzieller Handlungs-
Mobilitätsträger sollen durch additive Fertigungsverfahren felder werden im Projekt zunächst die Interessen der
und Refabrikation – also durch das Aufarbeiten gebrauchter aktuellen und zukünftigen Akteurinnen und Akteure
Produkte – von derzeit linearen Produktlebenszyklen in sowie relevante Komponenten elektrisch betriebener
geschlossene Produktkreisläufe überführt werden. So wird Mobilitätsträger ermittelt. Ausgehend von dieser Analyse
die Ressourceneffizienz über den gesamten Produktlebens und den identifizierten Anforderungen für die Gestaltung
zyklus erhöht und eine Entkopplung von Ressourcen der zukünftigen Werterhaltungsnetzwerke, bewertet
verbrauch und wachsender Nachfrage erzielt. das Projektkonsortium Komponenten hinsichtlich ihres
Potenzials zur Refabrikation und der Einsatzmöglichkeit
von additiven Fertigungsverfahren. Zur effizienten
Kreislaufführung der Komponenten werden geeignete
Geschäftsmodelle sowie die Supply Chain zwischen den
Akteuren des Werterhaltungsnetzwerks analysiert und
Lösungen einer Rückführlogistik der Komponenten für
die Refabrikation erarbeitet. Mit Hilfe von Simulationen
und Szenarioanalysen werden zudem die Auswirkungen
ökologischer, ökonomischer und sozialer Einflussfaktoren
auf das zukünftige Werterhaltungsnetzwerk analysiert. Die
Integration additiver Fertigungstechnologien in die Refab-
rikation ist ein wichtiger Bestandteil, um ein lokales und
Werterhaltung mit „AddRE-Mo“: Qualitätsprüfung am E-Bike. ressourceneffizientes Werterhaltungsnetzwerk aufzubauen.Die Erkenntnisse bezüglich der Komponenten fließen in
Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Gestaltung von Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
Produkten ein – ins Design for additive Remanufacturing.
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Darüber hinaus dienen sie der Übertragung der Projekt-
ergebnisse auf weitere Bereiche der urbanen Elektro Projekttitel
mobilität. AddRE-Mo – Werterhaltungsszenarien für urbane
Elektromobilität der Personen und Lasten durch
Kompetentes Netzwerk additive Fertigung und Refabrikation
Das Projektkonsortium von „AddRE-Mo“ bündelt im
Laufzeit
Allgemeinen das Know-how für die Bildung zukünftiger 01.07.2019–30.06.2022
Wertschöpfungsnetzwerke. Der Praxispartner Electric
Bike Solutions GmbH bringt dabei seine Kompetenzen im Förderkennzeichen
Bereich des Umrüstens und der Reparatur von E-Bikes als 033R234
Anwendungsbeispiel ein. Im Rahmen des Projekts sollen
Fördervolumen des Verbundes
darüber hinaus Komponenten weiterer elektrisch be-
1.708.292 Euro
triebener Fahrzeuge ermittelt werden. Diese können dabei
auch durch additiv gefertigte Bauteile ersetzt werden. Kontakt
Hierzu verfolgt der Praxispartner O.R. Lasertechnologie Prof. Dr.-Ing. Frank Döpper
GmbH die Entwicklung von Handlungsempfehlungen Universitätsstraße 9
95447 Bayreuth
zum Thema „Design for Additive Remanufacturing“. Das
Telefon: 0921 78516-100
Wuppertal Institut und die Fraunhofer-Projektgruppe E-Mail: frank.doepper@ipa.fraunhofer.de
Prozessinnovation konzentrieren sich auf den Bereich
Refabrikation und Kreislaufwirtschaft, wo sie ihre Projektpartner
Expertise aus zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Electric Bike Solutions GmbH; O.R. Lasertechnologie GmbH;
Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster Bayern e. V.;
Forschungsprojekten einfließen lassen. Mit einem wissen-
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
schaftlichen Vorgehen sorgen die Forschungspartnerinnen
und -partner zudem dafür, dass die Projekterkenntnisse Internet
auf weitere Bereiche der Mobilität übertragbar sind. innovative-produktkreislaeufe.de
Hierzu werden sie zudem vom Trägerverein Umwelt
technologie-Cluster Bayern unterstützt, welcher die Herausgeber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Projektergebnisse aufgreift und zusätzlich öffentlich
Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
keitswirksam verbreitet. 53170 Bonn
Redaktion und Gestaltung
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweis
AddRE-Mo
Stand
August 2019
Visuelle Prüfung an E-Bike-Komponenten.
bmbf.deAll Polymer – Faserverstärkung zur Erhöhung
der Ressourceneffizienz hochwertiger, voll
recyclingfähiger Kunststoffprodukte
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Im Projekt „All Polymer“ werden Kunststofffaserverbundwerkstoffe (KFVW) eingesetzt, um Recyclingkunststoffe
aufzuwerten. Durch die Zusammenarbeit von Nachhaltigkeitsforschenden, Kunststoff-, Recycling- und Faserverbund-
Fachleuten aus unterschiedlichen Branchen sollen Wirtschaftskreisläufe entstehen, die zu einer erheblichen Ver
ringerung von CO2-Emissionen und Kunststoffabfällen führen.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt-
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Mehr Recyclingkunststoffe Glasfasern werden CO2-Emissionen in der Produktion
Angesichts großer Nachhaltigkeitsprobleme steht die Re verringert. Gleiches geschieht durch eine energieeffiziente
cyclingfähigkeit von Kunststoffen derzeit im Vordergrund Herstellung und Weiterverarbeitung der KFVW.
der Innovationsbemühungen vieler Unternehmen. Ent
sprechend groß ist die Notwendigkeit, die Ressourcen Neue Potenziale für Fasern
effizienz von Kunststoffen zu erhöhen und insbesondere Das Projekt zielt auf eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit
Recyclingkunststoffen zu mehr Einsatz zu verhelfen. Diesem von Recyclingkunststoffen im Leichtbau. Dadurch kann
Ziel folgt das Projekt „All Polymer“, an dem sich drei Unter der Anteil an Rezyklat in bestehenden Produkten erhöht
nehmen und zwei Forschungseinrichtungen beteiligen. Fünf und neue Produktsegmente für Recyclingkunststoffe
weitere Unternehmen sind als assoziierte Partner dabei. erschlossen werden. Dadurch, dass die KFVW sortenrein
und somit zu 100 Prozent recyclingfähig sind, wird ein
vollständiger Recyclingkreislauf aufgebaut. Die höhere
Leistungsfähigkeit sorgt zudem für Energieeinsparungen
während des Produktlebens.
Um die im Vorfeld definierten mechanischen Eigenschaften
zu erhalten, werden die Bauteile faserverstärkt. Dazu werden
bereits bestehende sowie neue Prozesse wie additives
Tapelegen – das automatisierte Ablegen von faserverstärkten
Kunststoff-Tapes auf ebenen Strukturen – genutzt. Die
faserverstärkten Bauteile aus Recyclingkunststoff werden
„Das All-Polymer“-Team erforscht neue Methoden zur Kreislaufführung von
auf ihre mechanischen Eigenschaften hin analysiert und
Kunststoffen. bei den jeweiligen Recyclingunternehmen dem Prozess
zugeführt. Zudem wird der Einfluss der Fasern auf die
Die beteiligten Unternehmen werden typische Bauteile Eigenschaften des Rezyklats untersucht.
aus den drei größten Bereichen der Kunststoffindustrie –
der Fahrzeug-, Verpackungs- und der Bauindustrie – Die recycelten faserverstärkten Bauteile sollen erneut als
aus Recyclingkunststoffen herstellen und durch KFVW Ausgangsmaterial eingesetzt werden, damit ein Kreislauf
aufwerten. Durch den Verzicht auf energie- und kosten entsteht. Bereits der Einsatz eines geringen Anteils
intensiv hergestellte, nicht voll recyclingfähige Carbon- und faserverstärkten Materials führt zu einer erheblichenVerbesserung der mechanischen Eigenschaften des Bau
teils, sodass sich dieser Ansatz durch Verfahrensvereinfa Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
chungen, Materialeinsparungen und vermehrten Einsatz von
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Sekundärkunststoffen bereits für Produkte im Niedrig
preissegment lohnt. Projekttitel
All Polymer – Faserverstärkung zur Erhöhung der
Projektteam aus Wirtschaft und Wissenschaft Ressourceneffizienz hochwertiger, voll recyclingfähiger
Die Projektbeteiligten aus Wirtschaft und Wissenschaft Kunststoffprodukte
gehen bei ihrem „All Polymer“-Vorhaben arbeitsteilig vor,
Laufzeit
damit sie ihre Ziele einer Kreislaufführung erreichen. Die 01.09.2019–28.02.2022
Unternehmen HAHN Kunststoffe, BSB Recycling und
TOMRA beschäftigen sich mit der Untersuchung vor Förderkennzeichen
liegender Recyclingmaterialien aus verschiedenen Quellen 033R237
sowie dem Recycling der faserverstärkten Bauteile. Infinex
Fördervolumen des Verbundes
Kunststofftechnik, HAHN Kunststoffe, Schütz und Röchling
1.066.292 Euro
definieren die Prototypen und entwickeln gegebenenfalls
neue Prozesse für den Einsatz der Faserkunststofftapes. Kontakt
A+ Composites und DSM untersuchen die Herstellung Dr.-Ing. Markus Brzeski
der Faserverbundtapes und deren Modifizierung für den A+ Composites GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 7
Einsatz mit Sekundärkunststoffen. Die Prozessintegration
66919 Weselberg
und Prozessentwicklung der anderen Partner wird von Telefon: 06333 9999060
A+ Composites begleitet. E-Mail: m.brzeski@aplus-composites.de
Die Aufgaben der Arbeitsgruppe Materialphysik der Projektpartner
Infinex Kunststofftechnik GmbH; HAHN Kunststoffe GmbH;
Universität Koblenz Landau sind die Verbesserung der
Universität Koblenz-Landau; Technische Universität
Faserhaftung mit der Matrix sowie die Charakterisierung
Kaiserslautern
der Bauteile, Materialien und Tapes und die Entwicklung
des Recyclingprozesses. Der Lehrstuhl für Sustainability Internet
Management der TU Kaiserslautern wird sich mit staatlichen innovative-produktkreislaeufe.de
Anreizsystemen, der Entwicklung von Geschäftsmodellen
Herausgeber
und der Untersuchung ökologischer Implikationen
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
beschäftigen. Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
53170 Bonn
Redaktion und Gestaltung
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweise
S. 1: Infinex Kunststofftechnik GmbH
S. 2: Letiha/pixabay
Stand
September 2019
Kunststoffabfälle, wie etwa den Inhalt von gelben Säcken, nutzt „All Polymer“
für die Kreislaufwirtschaft.
bmbf.deCircular by Design (CbD) – Ressourcenwende über
nachhaltiges Produktdesign von Konsumgütern am
Fallbeispiel Kühl-/Gefriergeräte
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Im Projekt wird ein kreislauffähiges Produktdesign für Kühl-/Gefriergeräte simuliert, das sowohl energie- als auch
ressourceneffizient ist. Dazu werden verschiedene Szenarien mit dem Fokus auf Repair und Reuse sowie möglichst
geschlossene Recyclingpfade entwickelt. Die Zusammenführung der Ressourceneffizienzanalyse mit dem technologie
orientierten „Design for Recycling“-Modell soll künftig die Vorhersage eines für eine vollständige Kreislaufführung
geeigneten Produktdesigns erlauben.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt-
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Recyclingfähigkeit Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass bei der Herstellung
Um zukünftig eine stabile Versorgung der deutschen Wirt- bzw. Neukreation von Produkten (Produktdesign) die
schaft mit Rohstoffen sicherzustellen, bedarf es dringend Kreislauf- und Recyclingfähigkeit am Lebenszyklusende
eines Umdenkens in der Rohstoffnutzung und beim (EoL) bisher kaum mitgedacht wird. Hier setzt das Projekt
lebenszyklusweiten Stoffstrommanagement. Im Jahr 2010 „Circular by Design“ an, um an einem konkreten Haus-
wurden beispielsweise nur 14 Prozent der in Deutsch- haltsprodukt zu zeigen, welche Materialeffizienzpotenziale
land eingesetzten Rohstoffe aus Schrott gewonnen, bei im Hinblick auf die Rückgewinnung der enthaltenen
Recyclingkosten von über 50 Milliarden Euro. Für Stoffe Rohstoffe, sowohl bezüglich des konstruktiven Produkt-
wie Aluminium, Stahl oder Kupfer, die sich in vielen designs als auch der Materialauswahl, vorhanden sind.
Konsumgütern wiederfinden, lag der Anteil an Sekundär-
rohstoffen bei der Gesamtproduktion in Deutschland Labor für Design
im Jahr 2016 gerade einmal bei 40 Prozent. Die erstmalige Zusammenführung der Ressourcen-
effizienzanalyse (Ressourcen-LCA auf Mikroebene) und
des multiregionalen erweiterten Input-Output-Modells
(WI-SEEGIOM, Makroebene) des Wuppertal Institutes
für Klima, Umwelt und Energie sowie des technologie
orientierten simulationsbasierten „Design for Recycling“-
Modells (Metallrad, Mikroebene) des Helmholtz-Institut
Freiberg für Ressourcentechnologie soll zukünftig die
Vorhersage eines für die Kreislaufwirtschaft geeigneten
Produktdesigns erlauben. Dies soll am Beispiel eines der am
häufigsten verwendeten und bereits gut charakterisierten
Konsumgüter, dem Kühl-/Gefriergerät, unter Mitwirkung
des Herstellers Liebherr-Hausgeräte demonstriert werden.
Ziel ist, unter Einbeziehung der Folkwang Universität der
Künste (FUdK), innerhalb eines Living-Lab-Design-Prozesses
verschiedene Szenarien während der Projektlaufzeit zu
durchlaufen. Dabei sollen Modelle entworfen und simu-
CbD entwickelt kreislauffähige Kühlgeräte. liert werden, deren Gestaltung ein nahezu vollständigesRecycling sowie die Wiederverwendung/Reuse einzelner
Bauteile ermöglichen und dadurch neue Markt- bzw. Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
Geschäftsmodelle wie Repair, Cash-back, Leasing etc.
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
eröffnen.
Projekttitel
Unter Mitwirkung der Projektpartner Becker Elektro Circular by Design (CbD) – Ressourcenwende über
recycling (BEC) und Entsorgungsdienste Kreis Mittel- nachhaltiges Produktdesign von Konsumgütern am
sachsen (EKM) sowie ausgehend von dem derzeitigen Fallbeispiel Kühl-/Gefriergeräte
insbesondere auf Energieeffizienz ausgerichteten
Laufzeit
Referenzprodukt soll anhand der Quantifizierung der 01.07.2019–30.06.2022
tatsächlichen Verluste gezeigt werden, an welchen
Stellen die Rohstoffe verloren gehen, wie diese Förderkennzeichen
Verluste durch ein geeignetes Produktdesign reduziert 033R244
und Rohstoffe langfristig im Kreislauf gehalten werden
Fördervolumen des Verbundes
können.
799.606 Euro
Gesellschaftlicher Nutzen Kontakt
Erwartet wird ein übertragbares Designkonzept zur PD Dr. Simone Raatz
Kreislaufführung der verwendeten Materialien von Helmholtz-Institut Freiberg
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Konsumgütern am Beispiel eines Kühl-/Gefriergerät-
Chemnitzer Str. 40
Prototyps. Betrachtet man den Anteil von Stahl, Kupfer 09599 Freiberg
und Aluminium, machen diese zusammen fast 35 Prozent Telefon: 0351 260-4747
des Gewichtsanteils in zu recycelnden Kühl-/Gefriergeräten E-Mail: s.raatz@hzdr.de
aus, dazu kommen Kunststoffe mit einen Gewichtsanteil
Projektpartner
von etwa 30 Prozent. Das entspricht einem Materialwert an
Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH,
Sekundärrohstoffen von rund 25 Millionen Euro pro Jahr,
Wuppertal; Folkwang Universität der Künste, Essen; BEC
allein für die produzierte Gerätetonnage eines Kühlgeräte- Becker Elektrorecycling Chemnitz GmbH, Chemnitz; EKM
herstellers. Diese Zahl weist auf das enorme Einsparpotenzial Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH, Freiberg
hin, das durch eine Reduzierung des Materialeinsatzes,
die Substitution nicht nachhaltiger Materialien wie PU- Internet
innovative-produktkreislaeufe.de
Schaum oder Kühlmittel, die Verbesserung der Erfassung
der metallischen Abfälle sowie eine Erhöhung des Anteils Herausgeber
sekundärer Rohstoffe bei Konsumgütern erreicht werden Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
kann. Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
53170 Bonn
Redaktion und Gestaltung
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweise
S. 1: Liebherr
S. 2: FUdK
Stand
September 2019
Hohes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft haben Kühlgeräte.
bmbf.deConCirMy – Entwicklung eines stufen- und
kreislaufübergreifend vernetzten Konfigurators
für zirkuläres Wirtschaften (Circular Economy)
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
In Deutschland fällt jährlich rund eine halbe Million Tonnen Altreifen an. Nur ein kleiner Anteil wird als Recycling
material für die Herstellung neuer Reifen verwendet. Im Rahmen von „ConCirMy“ wird untersucht, ob und wie der
Reifen hinsichtlich der Ziele einer Kreislaufwirtschaft ohne Qualitätseinbußen optimiert werden kann. Es wird ein
Tool entwickelt, das verschiedenen Beteiligten der Lieferkette Informationen zur Umweltverträglichkeit bereitstellt,
die dann in Kauf-Entscheidungen berücksichtigt werden können.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Verwertung von Altreifen die Umweltwirkungen im Lebenszyklus des Reifens
Obgleich Technologien für die stoffliche Verwertung von transparent macht und ihnen andererseits ermöglichen
Altreifen vorhanden sind, werden diese bisher in eher soll, Informationen zur Nachhaltigkeit des Produktes
geringem Umfang genutzt. Dabei besteht auch bei den (Umweltwirkung, verwendete Rohstoffe, Möglichkeiten
Fahrzeugherstellern Interesse daran, diesen Anteil zu des Recyclings bzw. der Wiederverwendung) in ihre
steigern – eine beispielsweise durch die Altfahrzeug-Richt- Kauf-Entscheidung mit einzubeziehen. Diese können von
linie begründete Motivation, nach welcher Altfahrzeuge unterschiedlichen Nutzergruppen, d. h. verschiedenen
zu 85 Gewichtsprozent wiederverwendet oder recycelt Akteuren der Lieferkette – Verbrauchern, Designern,
und zu 95 Prozent wiederverwertet werden müssen. Diese Recyclern – abgerufen und in Entscheidungsfindungen
Vorgaben sind auch im Hinblick auf die Entwicklung von neben anderen wichtigen Faktoren wie Funktionalität und
Neufahrzeugen bzw. deren Komponenten wichtig. Mit Kosten berücksichtigt werden.
der Transformation zur Elektromobilität erhöht sich der
Druck, da einige Komponenten schwer zu recyceln sind. So sollen die Herstellung bzw. der Kauf von nachhaltigeren
Produkten, die Entwicklung eines umweltfreundlicheren
Designs sowie die Zuführung zu einer Wiederaufbereitung
und Wiederverwendung unterstützt werden. Der Konfi-
gurator agiert als zusammenführendes Kernsystem, das
verschiedenen Akteuren der Lieferkette jeweils spezifische
Informationen zugänglich macht. Technisch sind sowohl
die integrierte Umweltbewertung von Produkten und
Komponenten in einem Produktkonfigurator für den
Endkunden als auch die vergleichende Umsetzung ver-
schiedener Berechnungsansätze hierzu neu.
Altreifen besitzen hohes Recyclingpotenzial.
Im Rahmen sozioökonomischer Analysen werden Ver
Zusammenführendes Kernsystem braucherpräferenzen und Nachfragepotenziale für bio- und
Ziel des Projektes „ConCirMy“ ist es, einen Produkt kreislaufwirtschaftsbasierte Kfz-Komponenten einschließ
konfigurator zu entwickeln, der am Anwendungsfall des lich hiermit verbundener Nachhaltigkeitsaspekte erforscht
Autoreifens den Nutzerinnen und Nutzern einerseits sowie Handlungsempfehlungen für die verschiedenenAnbietergruppen des angestrebten Kreislaufsystems
abgeleitet. Zur erfolgreichen Implementierung des zir- Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
kulären Systems in der Praxis werden Geschäftsmodelle
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
entwickelt. Weiterhin wird der Bedarf an Normen zur
Unterstützung einer Entwicklung der Lieferkette in Projekttitel
Richtung einer Circular Economy geprüft. ConCirMy – Entwicklung eines stufen- und kreislauf
übergreifend vernetzten Konfigurators für zirkuläres
Vernetztes Assistenzsystem Wirtschaften (Circular Economy)
Im Projekt „ConCirMy“ arbeiten die CAS Software AG,
Laufzeit
der Dechema e. V., die TU Berlin (Fachgebiet Innovations 01.07.2019–30.06.2022
ökonomie) und der Deutsche Institut für Normung e. V.
(DIN) zusammen, um ein vernetztes und nachhaltiges Förderkennzeichen
Assistenzsystem zu entwickeln. 033R236
Fördervolumen des Verbundes
CAS bringt Expertise im Bereich Softwareentwicklung mit
1.165.446 Euro
und entwickelt unter Mitarbeit aller Partner den Konfigu-
rator. Kontakt
Preslava Krahtova
Dechema e. V. führt eine Marktrecherche zum Produkt- CAS Software AG
CAS-Weg 1–5
lebenszyklus sowie zur momentanen Handhabung und
76131 Karlsruhe
Verwertung von Altreifen in Deutschland durch und Telefon: 0721 9638-762
erstellt Ökobilanzen als Bewertungsgrundlage im Kon E-Mail: Preslava.Krahtova@cas.de
figurator-Tool.
Projektpartner
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin;
Die TU Berlin ermittelt anhand sozioökonomischer
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Innovations
Analysen Akzeptanzfaktoren und Nachfragepotenziale
ökonomie; DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik
für nachhaltige Kfz-Komponenten und entwickelt und Biotechnologie e. V., Frankfurt am Main
Handlungsempfehlungen für die Akteure des zirkulären
Systems. Zur erfolgreichen Implementierung des Systems Internet
werden von ihr Geschäftsmodelle entwickelt. innovative-produktkreislaeufe.de
Herausgeber
DIN überprüft die Projektergebnisse hinsichtlich poten- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
zieller Normungs- und Standardisierungsbedarfe. Dazu Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
wird eine Übersicht über die bestehenden Normen und 53170 Bonn
Standards erstellt. Nach der Identifikation von Standar-
Redaktion und Gestaltung
disierungspotenzialen werden im Projekt gegebenenfalls
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Standardisierungsaktivitäten eingeleitet.
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweise
S. 1: Imthaz Ahamed on Unsplash
S. 2: pxhere
Stand
August 2019
Recycling von Altreifen.
bmbf.deC.O.T. CIRCLE OF TOOLS – Entwicklung und
Erprobung von Demonstratoren im Kontext der
zirkulären Wertschöpfung von Werkzeugstählen
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen ist derzeit eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen.
Rohstoffe sollten gemäß einer Kreislaufwirtschaft so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf gehalten, Abfall
sollte vermieden werden. Zentrales Anliegen des Projekts „C.O.T.“ ist es, regionale Stoffkreisläufe in der metall
verarbeitenden Industrie über Re-Manufacturing und Re-Engineering von verschlissenen metallischen Produkten
zu schließen.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Stoffkreislauf der Metallbranche
Allgemein wird das Konzept der Kreislaufwirtschaft, der
Circular Economy (CE), als eine wesentliche Strategie
angesehen, den Rohstoff- und Ressourcenverbrauch
wirksam zu senken. Eine bekannte Möglichkeit ist das
Recycling. Dem vorgeschaltet sind Konzepte wie Re-Use,
Reparatur, Re-Manufacturing und Re-Engineering, durch
die Materialien länger im Wirtschaftszyklus genutzt
werden können. Die kooperierenden Forschungs Industrielle Schneidwaren im Kreislauf führen will das Projekt „C.O.T.“
einrichtungen und Unternehmen aus dem Bergischen
Land wollen im Projekt „C.O.T.“ beispielhaft einen Stoff Hochlegierte Werkzeugstähle
kreislauf der ansässigen metallverarbeitenden Industrie Die Recyclingquoten des Werkstoffs Stahl sind im All-
über Re-Manufacturing und Re-Engineering schließen. gemeinen hoch und liegen, in Abhängigkeit von der
Stahlgruppe, bei 60 bis 90 Prozent. Das Recycling umfasst
Das Ziel ist es, den Ressourcen- und Energieverbrauch überwiegend die stoffliche, schmelzmetallurgische Ver-
zu reduzieren sowie ökonomische Vorteile für die Unter- wertung des Stahlschrotts, die mit hohen Energiebedarfen
nehmen aufzuzeigen. Die Herausforderungen dabei und Verlusten an metallischen Legierungselementen
sind vielfältig: Es muss ein Prozess entwickelt werden, durch Oxidation und Schlackebildung verbunden ist.
der darauf basiert, sortenrein rückgeführte, qualitativ
hochwertige Materialien entweder im primären Das Projekt „C.O.T.“ soll durch Re-Manufacturing und
Herstellungsprozess zu nutzen oder unternehmens Re-Engineering von Hand-Werkzeugen und Schneid-
übergreifend in andere Herstellungsprozesse zu inte- waren die Verwertung durch Umschmelzen verhindern.
grieren. Zudem sollen Materialien ausgewählt werden, Dadurch können besonders die in hochlegierten Werk-
die den Anforderungen verschiedenster Hand-Werkzeuge zeug-Stählen enthaltenen Legierungselemente wie
und Schneidwaren entsprechen. Darüber hinaus sollte Chrom, Mangan, Nickel und Vanadium erhalten werden.
der Prozess so gestaltet sein, dass ein hohes Energie- Durch ihren hohen Anteil an Legierungselementen
und Ressourcensparpotenzial realisiert und ein öko können sich hochlegierte Stähle den ökologischen Aus-
nomisch tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt wirkungen, in Bezug auf die Rohmaterialerzeugung, von
werden kann. Aluminium annähern.Vielfältige Kompetenz
Im Projekt „C.O.T.” ist ein inter- und transdisziplinäres Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
Team aus insgesamt sechs Projektpartnerinnen und
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
-partnern vereint. Firmen aus dem Bergischen Land,
das für seine Schneidwaren und Werkzeuge bekannt ist, Projekttitel
arbeiten eng mit zwei Forschungseinrichtungen zusammen. C.O.T. CIRCLE OF TOOLS – Entwicklung und Erprobung
Anhand der Produkte der Firmen TKM GmbH, KIRSCHEN- von Demonstratoren im Kontext der zirkulären Wert
Werkzeuge und Freund & CIE soll mit Unterstützung der schöpfung von Werkzeugstählen
Plan Consult GmbH demonstriert werden, wie eine Rück-
Laufzeit
führung und anschließende Weiternutzung des Materials 01.07.2019–30.06.2022
über Re-Manufacturing und Re-Engineering gestaltet
werden kann. Des Weiteren werden auf Grundlage von Förderkennzeichen
Materialanalysen Demonstratoren durch Re-Manu 033R230
facturing und Re-Engineering von den jeweiligen
Fördervolumen des Verbundes
Firmen hergestellt.
941.266 Euro
Werkstoffforschende der Bergischen Universität Wuppertal Kontakt
sind für die metallurgischen Analysen der Werkzeuge Dr. Kai Uwe Paffrath
und Schneidwaren während des Projekts verantwortlich. TKM GmbH
In der Fleute 18
Darüber hinaus sollen neue Materialien ausgewählt und
42897 Remscheid
erprobt werden, die weniger ressourcenintensiv sind Telefon: 02191 969 296
und die Anforderungen verschiedenster Werkzeuge E-Mail: KPaffrath@tkmgroup.com
und Schneidwaren erfüllen. Das Wuppertal Institut ist
während der Projektlaufzeit für die Entwicklung und Projektpartner
Kirschen-Werkzeuge, Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co.
Anwendung einer Methodik zur ökologischen und öko-
KG, Remscheid; P.F. FREUND & CIE. GmbH, Wuppertal;
nomischen Bewertung verantwortlich, in der vor allem
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH,
die Aspekte von Re-Manufacturing und Re-Engineering Wuppertal; Bergische Universität Wuppertal, Standort
integriert werden. Es werden dabei konkrete Einspar Solingen; PlanConsult GmbH, Wuppertal
potenziale für Ressourcen und Emissionen berechnet
sowie ökonomische Potenziale dargestellt. Internet
innovative-produktkreislaeufe.de
Herausgeber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
53170 Bonn
Redaktion und Gestaltung
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweis
TKM 2019
Stand
Diskussion der Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten innerhalb des August 2019
Projektteams.
bmbf.deDIBICHAIN – Digitales Abbild von Kreislaufsystemen
mittels einer Blockchain
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
In „DIBICHAIN“ werden dezentralisierte Datenspeicherungsmöglichkeiten untersucht. Im Fokus steht die Erhebung
von Daten eines Produktlebenszyklus, um den Produktentwicklungsprozess fair, sicher und ökonomisch zu gestalten.
Als Grundlage dient das Modell der Blockchain, in welchem Daten dezentralisiert und ohne Hoheitsrechte gespeichert
werden. Aktuelle Blockchain-Modelle sind allerdings meist zu langsam, um auf große Datenmengen zu skalieren. Hier
setzt die Forschung im „DIBICHAIN“-Projekt an.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt-
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Software-Demonstrator
„DIBICHAIN“ zielt darauf ab, die Anwendung der Blockchain-
Technologie zur digitalen Abbildung von Produktkreisläufen
in Abgrenzung zu anderen Distributed Ledger Technologien
(DTL), zu untersuchen. DTL, also das verteilte Datenspeichern,
ist eine neuartige Technologie, sicher und transparent
Daten für viele Nutzerinnen und Nutzer zu speichern.
Zunächst sollen die Hauptunterschiede der einzelnen DLT
herausgestellt werden, um im Anschluss die Eignung der
einzelnen Techniken für das ausgewählte Fallbeispiel be- Das Projektteam von „DIBICHAIN“.
werten zu können. Ziel ist es hierbei, die Wissensbasis für die
Anwendung einer Blockchain für eine Kreislaufwirtschaft Innovationen der dezentralen Datenspeicherung
zu vertiefen, um weiterführende und tiefergreifende Herkömmliche Datenverwaltung funktioniert derzeit
Forschungsvorhaben zu ermöglichen, die das volle über zentralisierte Server. Lädt ein Nutzer ein Bild auf
Potenzial für DLT in diesem Zusammenhang erschließen. seine Social-Media-Seite hoch, wird dieses Bild von einem
Dabei soll ein Software-Demonstrator entwickelt werden, zentralisierten Server an einem dem Nutzer meist un-
der am Fallbeispiel der „Bionic Partition“ u. a. folgende bekannten Ort gespeichert. Möchte der Nutzer nun sein
Anwendungsszenarien enthält: Bild löschen, muss er dem Serveranbieter vertrauen, die
Daten nicht nur unerreichbar zu machen, sondern auch
• (Rück-)Verfolgung von ausgewählten Materialien, tatsächlich vom Server zu löschen. Da die moderne Welt
von der Rohstoffentnahme bis zur Rückführung in und auch das sogenannte Internet der Dinge ohne Server-
Stoffkreisläufe. datenspeicherung nicht mehr funktionieren würden, ist es
• Sicherstellung der Einhaltung von sozialen und nahezu unmöglich, dieses vollends zu umgehen. Dezen
ökologischen Standards über den gesamten Produkt- tralisiertes Speichern, also verteilt auf viele einzelne Nutzer
lebenszyklus. anstatt auf einem einzigen Server, wäre ein Lösungsansatz,
• Blockchain für integrierte Lebenszyklusanalysen das Internet der Dinge mit einer Lösung zu genannten
sowie für den Einsatz als Grundlage (Data Backbone) Problemen zu verbinden.
für Sustainability Driven Design Anwendungen.
• Eindeutige Identifikation und Verfolgbarkeit von Das Potenzial von DLT lässt sich aktuell nur vermuten.
Produkten über den gesamten Produktlebenszyklus. Die Anwendung der DLT würde eine Verfeinerung desnoch nicht völlig erkundeten „Web 3.0“ darstellen. Das
Projekt wird insgesamt nach dem Wasserfall-Modell Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
bearbeitet, während die Software-Entwicklung über die
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
sogenannte Scrum-Methode erfolgt. Scrum ist eine agile
Projektmanagementmethode, welche primär bei der Projekttitel
Software-Entwicklung angewandt wird. DIBICHAIN – Digitales Abbild von Kreislaufsystemen
mittels einer Blockchain
Das Team der Innovationen
Laufzeit
Die fünf beteiligten Unternehmen bringen jeweils das
01.07.2019–30.06.2022
eigene, teils über Jahre hinweg erworbene Fachwissen
in das Projekt ein, um ein möglichst optimales Ergebnis Förderkennzeichen
zu verwirklichen. Dieses Wissen umfasst u. a. klassische 033R241
Software-Entwicklung, Blockchains, Kreislaufwirtschaft,
Fördervolumen des Verbundes
Ökologie, Produktentwicklung. Das Projekt ist in fünf
643.284 Euro
Arbeitspakete unterteilt. Auf den administrativen Teil
folgen Fokusgruppen, Analysen und final die Entwicklung Kontakt
der Software und dessen Evaluation. Andreas Kötter
Altran Deutschland
Ziel der Projektpartner Airbus, Altran, Blockchain Research Karnapp 25
21079 Hamburg
Lab, Chainstep, Circular Tree, iPoint ist es, nicht nur die
Telefon: 0172 2439460
Unterschiede aktueller DLT herauszustellen, sondern E-Mail: andreas.koetter@altran.com
auch eine neue Technologie zu entwerfen, welche final
in einem Anwendungsszenario, dem Software-Demon Projektpartner
strator, bewertet werden kann. In „DIBICHAIN“ soll somit Blockchain Research Lab gemeinnützige GmbH;
CHAINSTEP GmbH; iPoint-systems GmbH
eine Technologie entwickelt werden, die von Unternehmen
weltweit zur modernen, dezentralisierten Datenspeicherung
Internet
genutzt werden kann. Gleichwohl profitieren auch Privat- innovative-produktkreislaeufe.de
personen von Datensicherheit und verteilter Hoheitsrechte.
Herausgeber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
53170 Bonn
Redaktion und Gestaltung
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweis
Airbus
Stand
August 2019
Im Zeichen der Nachhaltigkeit und für eine Kreislaufwirtschaft:
Das Projektteam bei der Arbeitsbesprechung.
bmbf.deDi-Link – Digitale Lösungen für industrielle
Kunststoffkreisläufe
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Durch die „Di-Link“-Forschung wird es Kunststoffproduzierenden ermöglicht, hochwertige Produkte aus Recycling-
kunststoffen zu erzeugen, Plastikmüll zu vermeiden und Stoffkreisläufe zu schließen. Dafür werden neueste Sensor-
technologien und digitale Softwarelösungen entwickelt und verknüpft, um wertvolle Daten über die Qualität von
Kunststoffabfällen und den aus ihnen hergestellten Rezyklaten erheben, analysieren, weiterentwickeln und an den
richtigen Stellen zum Einsatz bringen zu können.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt-
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Geschlossene Kreisläufe Produktqualität erkannt und vermieden bzw. digital
Das Projekt „Di-Link“ trägt zur Schließung von Stoff dokumentiert werden, so dass Rezyklatabnehmer die
kreisläufen in der Kunststoffwirtschaft bei. Durch die in relevanten Informationen zu den Materialien erhalten
„Di-Link“ weiterentwickelten Sensortechnologien und und so das richtige Material kaufen oder auch ihre
durch darauf zugeschnittene digitale Lösungen werden die Prozesse entsprechend anpassen können.
benötigten Daten für eine Schließung der Stoffkreisläufe
erhoben und die Verbreitung und Verarbeitung der ge-
wonnenen Daten ermöglicht. Somit kann ein ressourcen
schonenderes Modell der Kunststoffverwendung etabliert
werden.
Denn große Mengen an Sekundärkunststoffen – Rezyklate –
können zurzeit gar nicht oder nur zu minderwertigen Pro-
dukten weiterverarbeitet werden. Informationsdefizite des
Marktes hinsichtlich der Qualität und Verfügbarkeit der
Rezyklate sind dafür ein Hauptgrund. Mit den richtigen
Daten zu Beschaffenheit und Menge von Kunststoffresten
sowie den aus ihnen hergestellten Rezyklaten und einer
Möglichkeit, diese Daten entlang der Wertschöpfungskette
digital weiterzureichen, können Kunststoffverarbeitende,
gewerbliche Unternehmen und Recycler in die Lage
versetzt werden, solche Kunststoffe als hochwertige
Wertstoffe im Kreislauf zu halten.
„Di-Link“ will Kunststoffreste mittels Sensoren der Kreislaufwirtschaft zuführen.
Die Vielzahl der verschiedenen Quellen von Reststoffen
für das Recycling kann sich in der Produktqualität der Digitale Recyclinglösungen
Rezyklate niederschlagen. Mitunter schwanken Produkt- In einem ersten Schritt werden dazu die genauen Bedürf-
eigenschaften von Charge zu Charge, was eine Verarbeitung nisse der Industrie durch Interviews und Vor-Ort-Termine
im Rahmen der maßgeschneiderten Prozesse der Produ ermittelt. Daraufhin werden dann die entsprechenden
zierenden erschwert. Mit Hilfe der zu entwickelnden Lösungen entwickelt, softwareseitig abgebildet und in ge-
„Di-Link“-Sensoren können diese Schwankungen in der eigneten Systemen verbunden, zum Beispiel, indem sie inUnternehmenskooperationen eingesetzt und erprobt
werden. Gleichzeitig findet eine Bewertung der Nach- Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
haltigkeit der entwickelten Lösungen statt, um sicher
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
zustellen, dass der Aufwand nicht den potenziellen
Nutzen übersteigt. Projekttitel
Di-Link – Digitale Lösungen für industrielle
Mittels der innovativen Lösungsansätze von „Di-Link“ kann Kunststoffkreisläufe
Kunststoffrezyklat in Zukunft sicherer und zuverlässiger
Laufzeit
eingesetzt werden. Die zusätzlichen Informationen zu-
01.06.2019–31.05.2022
sammen mit der schnellen Verfügbarkeit von digitalen
Daten entlang der Wertschöpfungskette ermöglichen es, Förderkennzeichen
eine Vorreiterrolle im stark wachsenden Recyclingmarkt 033R235
einzunehmen und sichern somit die internationale Wett-
Fördervolumen des Verbundes
bewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
899.261 Euro
Interdisziplinäres Expertenteam Kontakt
Für die Aufgabe hat sich ein interdisziplinäres Team Dr. Holger Berg
gebildet. Auf Forschungsseite wird das dreijährige Projekt Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
durch das SKZ – Das Kunststoff-Zentrum, das Forschungs- Döppersberg 19
42103 Wuppertal
institut für Rationalisierung der RWTH Aachen (FiR)
Telefon: 0202 2492-179
sowie das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie E-Mail: holger.berg@wupperinst.org
(Konsortialleitung) durchgeführt. Aus der Industrie sind
die Unternehmenspartner INFOSIM, Experten auf dem Projektpartner
Gebiet der industriellen Softwareentwicklung, sowie SKZ - KFE gGmbH; Forschungsinstitut für Rationalisierung
e. V.; Infosim GmbH & Co. KG; Hoffmann u. Voss GmbH;
die Unternehmen Hoffmann + Voss und MKV Kunst
MKV GmbH Kunststoffgranulate
stoffgranulate beteiligt, die über große Erfahrung im
Kunststoffrecycling verfügen. Internet
innovative-produktkreislaeufe.de
Die entwickelten Lösungen aus der „Di-Link“-Forschung
können von der gesamten kunststoffverarbeitenden Herausgeber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Industrie sowie von anderen Unternehmen, bei denen
Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
Kunststoffabfälle anfallen, genutzt werden, um mehr 53170 Bonn
Recyclingkunststoffe bereitzustellen oder zu verwenden.
Redaktion und Gestaltung
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweis
Dr. Holger Berg
Stand
Juli 2019
bmbf.deDiTex – Digitale Technologien als Enabler
einer ressourceneffizienten kreislauffähigen
B2B-Textilwirtschaft
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Berufsbekleidung bedeutet eine hohe Menge identischer Textilien und ist damit ein optimaler Ansatzpunkt für
weitgehend geschlossene Stoffkreisläufe. Im Vergleich zum Kauf ermöglichen Textilmiete oder -leasing einen
ressourceneffizienteren Materialeinsatz. „DiTex“ erprobt und bewertet Qualitäts-, Ressourcen- und Nachhaltig
keitseffekte von zwei kreislaufgeführten Produktlinien aus Recyclingfasern und erprobt zirkuläre Geschäftsmodelle
in einjähriger Testanwendung bei gewerblichen Großverbrauchenden.
Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produkt-
kreisläufe (ReziProK)“ gefördert. „ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes „Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft“ und unterstützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte oder digitale Technologien für geschlossene
Produktkreisläufe entwickeln.
Kreislauffähige Produktdesigns Informationsbasis für Nachhaltigkeitsbewertung
In der Textilwirtschaft besteht die Notwendigkeit der Der zentrale Untersuchungsstrang Anwendungsfälle von
Kreislaufführung, u. a. wegen des hohen Verbrauchs an „DiTex“ betrifft Textildesign und -pilotierung und die
Wasser, Pestiziden und Düngemitteln im konventionellen Erprobung zirkulärer Geschäftsmodelle. Das Forschungs-
Baumwollanbau sowie wegen der umweltschädlichen team berücksichtigt die Voraussetzungen der Faserrege-
Abluft- und Abwasseremissionen in der Synthetikfaser- nerierung im Produktdesign und setzt auf hochwertige
herstellung und der konventionellen Textilveredelung. innovative sogenannte Closed loop-Recyclinglösungen.
Im Kreislauf geführte Textilfasern vermeiden viele Ein flankierender Untersuchungsstrang sind sechs Markt-
negative Umwelteffekte, es fehlt aber an kreislauffähigen dialoge, in denen Produzierende mit gewerblichen und
Produktdesigns und Infrastrukturen zur Rückführung öffentlichen Großverbraucherinnen und -verbrauchern
recyclingfähiger Textilien. die angebots- und nachfrageseitigen Rahmenbedingungen
zu Produktanforderungen, Recycling-Kapazitäten, Nach-
Das Projekt „DiTex“ erprobt als Machbarkeitsstudie kreis- haltigkeitszertifizierungen u. a. erörtern. Ein weiterer flan-
laufgeführte Berufsbekleidung und Bettwäsche aus Rezy- kierender Strang sind Analysen und Abschätzungen, für
klatfasern und bewertet deren Qualitäts-, Ressourcen- und die beide Textillinien ein „Intelligentes Etikett“ erhalten
Nachhaltigkeitseffekte. Es wird im gewerblichen Kontext und zur Untersuchung der Materialeigenschaften und Be-
pilotiert, wegen der großen Volumina identischer Textilien ständigkeit umfangreiche textilphysikalische Prüfungen,
und einer gut organisierten Logistik über fixe Ausgabe- Wasch- und Tragetests durchlaufen. Für jede pilotierte
und Rücknahmepunkte. Textillinie wird eine Übersichtsökobilanz erstellt. Als Alter
native zum Kauf beforscht „DiTex“ das Geschäftsmodell
Textilmiete bzw. -leasing.
Industrie- und anwendungsfokussiert
Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung ko-
ordiniert den Verbund, leitet die Prozess-, Akteurs- und
Kostenanalysen, die Marktdialoge und die Evaluation der
achtmonatigen Pilotierungsphase. Alle Partner sind in
Produktdesign und Marktdialoge involviert. WILHELM
Kreislaufführung für Berufsbekleidung erprobt das Projekt „DiTex“. WEISHÄUPL e. K. und Dibella GmbH übernehmen Upscaleund Testproduktion der Textilien. Die circular.fashion UG
bringt als Dienstleisterin IT-Lösungen und Know-how ein. Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
Das Hohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH und
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
die Fakultät Textil und Design der Hochschule Reutlingen
verantworten die Textilprüfungen und die Formulierung Projekttitel
der Miettextil-Produktspezifikationen. Das ifeu – Institut DiTex – Digitale Technologien als Enabler einer ressourcen-
für Energie- und Umweltforschung erstellt Übersichts- effizienten kreislauffähigen B2B-Textilwirtschaft
ökobilanzen. Als assoziierter Partner unterstützt MEWA
Laufzeit
Textil-Service AG & Co. Management OHG die Akquise
01.08.2019–31.07.2022
von Großverbrauchern als Testanwender der Textilien und
die Erprobung im Miet- bzw. Leasing-Geschäftsmodell. Förderkennzeichen
033R228
Zentrale Ergebnisse sind: kreislauffähige Produktdesigns
Fördervolumen des Verbundes
für zwei Textillinien, ein digitales Informationsmanagement
2.104.543 Euro
für textile Kreislaufführung und die Geschäftsmodell
beschreibung Textilmiete bzw. -leasing inklusive Be- Kontakt
wertung der Übertragbarkeit, Qualitätsstandards für Ria Müller
Miettextilien aus Recyclingmaterial. Weiterhin: eine Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Materialsammlung zur Dissemination des für eine Um- Potsdamer Straße 105
10785 Berlin
stellung auf rezyklierbare nachhaltige Berufsbekleidung
Telefon: 030 884 594-56
erforderlichen Know-hows in die Textilwirtschaft und an E-Mail: ria.mueller@ioew.de
textile Großverbraucher. Insbesondere die Übersichtsöko-
bilanzen und Marktdialoge flankieren die Anstrengungen Projektpartner
der Bundesregierung bei der Umsetzung des Stufenplans WILHELM WEISHÄUPL Hans Peter Weishäupl e. K.; Dibella
GmbH; Hochschule Reutlingen, Fakultät Textil und Design;
für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesver-
Hohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH; ifeu –
waltung.
Institut für Energie- und Umweltforschung
Internet
innovative-produktkreislaeufe.de
Herausgeber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat Ressourcen, Kreislaufwirtschaft; Geoforschung,
53170 Bonn
Redaktion und Gestaltung
Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit;
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Bildnachweise
S. 1: Markus Hein/pixelio.de
S. 2: Bruno Glätsch/pixabay
Auch textiles Garn ist rezyklierfähig.
Stand
September 2019
bmbf.deSie können auch lesen