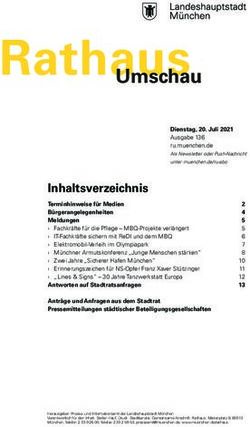SELBSTÄNDIGES EINSCHREITEN DER POLIZEI - JKU ePUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SELBSTÄNDIGES EINSCHREITEN
DER POLIZEI
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Magistra der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium der Rechtswissenschaften
Angefertigt an der Johannes Kepler Universität Linz
Institut für öffentliches Wirtschaftsrecht
Eingereicht von:
Natascha Nussbaum
Matrikelnummer: 0201915
Betreuung:
o.Univ.-Prof. Dr. Bruno Binder
Waltersdorf a.d..April 2020
12
Inhaltsverzeichnis
I. Abkürzungsverzeichnis
II. Einleitung
III. Einführung
A. Der Polizeibegriff
B. Die Wachkörper
C. Gesetzliche Grundlagen
D. Der Begriff Befugnis
E. Verhältnismäßigkeit
IV. kurzer historischer Überblick
V. Befugnisse und Zuständigkeiten
A. Begriffsbestimmung
1. Allgemeine Gefahr
2. Gefährlicher Angriff
3. Gefahrenerforschung
4. Mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlung
B. Aufgaben der Polizei
1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
2. Erste allgemeine Hilfeleistungspflicht
3. Gefahrenabwehr
4. Beendigung gefährlicher Angriffe
5. Vorbeugender Schutz von Rechtsgütern
6. Fahndung
7. Weitere Aufgaben
8. Strafrechtspflege
C. Befugnisse der Polizei
1. Befehls- und Zwangsgewalt
2. Auskunftsverlangen
3. Identitätsfeststellung
4. Eingriffe in die persönliche Freiheit
5. Durchsuchung von Personen
6. Betreten und Durchsuchen von Orten, Räumlichkeiten und Gegen-
ständen
7. Verhängung eines Betretungsverbots
8. Wegweisung
9. Sicherstellung von Sachen
VI. Danksagung
VII. Literaturverzeichnis
3I. Abkürzungsverzeichnis
mE meines Erachtens
Abs Absatz
bzw beziehungsweise
dh das heißt
gem gemäß
S Seite
zB zum Beispiel
Rsp Rechtsprechung
ggf gegebenenfalls
ua unter anderem
SPG Sicherheitspolizeigesetz
StPO Strafprozessordnung
B-VG Bundesverfassungsgesetz
w.o wie oben
Z Ziffer
Art Artikel
B-VG Bundesverfassungsgesetz
uvm und vieles mehr
BV Betretungsverbot
VStG Verwaltungsstrafgesetz
ABGB Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch
EAH Erste allgemeine Hilfeleitung
EGVG Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen
RLV Richtlinienverordnung
4II. Einleitung
Die Polizei Ihr Freund und Helfer! Mit diesem Slogan sollte das Tätigkeitsbild der Polizei für
die Bevölkerung in kurzen Worten positiv beschrieben werden. Er vermittelt Bürgernähe und
Hilfsbereitschaft und soll Vertrauen in die Exekutive schaffen. In einer Notsituation soll sich
der Bürger hilfesuchend an die Polizei wenden, die sich nicht nur im Ernstfall beschützend
vor ihn stellt, sondern auch in anderen Lebensbereichen mit Rat und Tat zur Seite steht. Das
ist aber nur eine Seite der Medaille, denn wo die Rechte des Einzelnen und der Schutz des
Rechtsstaats beginnen, endet die Freiheit des Anderen.
Wie viel und was darf die Polizei? Wann darf sie einschreiten und mit welchen Mitteln in die
Rechte der Menschen eingreifen?
Die Beantwortung dieser Fragen, wird Thema der gegenständlichen Arbeit sein, welche fol-
gendermaßen aufgebaut ist:
In der Einführung werden die nötigen Grundlagen erörtert, um ein Verständnis für die weite-
re Behandlung zu schaffen. Es werden die gesetzlichen Grundlagen erklärt, sowie der Poli-
zeibegriff und seine unterschiedlichen Bedeutungen näher beleuchtet.
Dann folgt ein kurzer historischer Rückblick, in dem die Entstehungsgeschichte der Polizei,
wie wir sie heute kennen, kurz umrissen wird.
Der Hauptteil geht in medias res und befasst sich mit dem Aufgabengebiet der Polizei und
ihren Befugnissen. Hier wird darauf eingegangen welche Bereiche in die Zuständigkeit der
Polizei fallen, wann sie einzuschreiten hat sowie welche Mittel und Wege ihr zur Vollziehung
ihrer Aufgaben dafür zur Verfügung stehen. Mit eingehenden Beispielen aus der Praxis wird
ein anschauliches Bild über den spannenden Polizeialltag, seine Möglichkeiten, aber auch
seine Grenzen gezeichnet.
5III. Einführung
A. Der Polizeibegriff
Wenn man von der Polizei spricht, scheint es auf den ersten Blick sofort und völlig klar zu
sein, was sich dahinter verbirgt, jedoch bedarf es zum vollen Verständnis einer näheren Be-
leuchtung dieser Thematik.
Die wichtigste Unterscheidung ist die zwischen der allgemeinen Sicherheitspolizei, der Ver-
waltungspolizei und der Ortspolizei. Nach der Rsp zählt die Abwehr allgemeiner Gefahren für
Leben, Gesundheit, Sicherheit, öffentliche Ruhe und Ordnung zur allgemeinen Sicherheitspo-
lizei. Allgemein ist eine Gefahr, wenn sie nicht einer bestimmten Verwaltungsmaterie zuzu-
ordnen ist. Zur Verwaltungspolizei zählen zB die Verkehrspolizei, die Gewerbepolizei, die
Baupolizei, die Gesundheitspolizei und die Lebensmittelpolizei. Die Abwehr von besonderen,
einer bestimmten Verwaltungsmaterie zugehörigen Gefahr ist Sache der Verwaltungspolizei.
Man könnte es auch so formulieren: Alles was nicht Verwaltungspolizei ist, ist Sicherheitspo-
lizei.1
„Polizei im materiellen Sinn bezeichnet somit die Abwehr von Gefahren für den Staat, die
Person (Leben, körperliche Integrität, Gesundheit, Freiheit, Ehre) und die Sachgüter sowie für
die gesamte (übrige) öffentlich-rechtliche Rechtsordnung und jene ungeschriebenen Regeln,
deren Befolgung nach allgemeiner Auffassung unentbehrliche Voraussetzung für ein gedeih-
liches Zusammenleben der Menschen ist.“2
Für Angelegenheiten, die in den selbständigen Wirkungsbereich der Gemeinde fallen, wer-
den jene polizeilichen Aufgaben, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der
Gemeinde gelegen und geeignet sind auch von ihr besorgt zu werden, von der Ortspolizei
wahrgenommen. Die genaue Abgrenzung im Einzelfall stellt nicht nur die Praxis vor gele-
gentliche Schwierigkeiten.3
B. Die Wachkörper
Damit der Staat all seine hoheitlichen Aufgaben besorgen kann, hat er verschiedene Behör-
den eingerichtet und diese mit unterschiedlichen Befugnissen ausgestattet. Diese staatlichen
Verwaltungsorgane sind befugt generelle und individuelle Rechtsakte zu setzen und ggf auch
Zwang auszuüben, um deren Umsetzung zu erreichen. Natürlich braucht eine Behörde zur
1
vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), S 4,5
2
Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), S 1
3
vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), S 5
6Erfüllung ihrer Aufgaben Personal, welches auch als Exekutive bezeichnet wird. Unter den
Oberbegriff der Exekutivorgane fallen unter anderem die Wachkörper und die Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes. 4
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Hilfsorgane der Behörde. Sie sind spezi-
ell dafür ausgebildet und ausgerüstet die Rechtsakte der Behörde mit Befehls- und Zwangs-
gewalt durchzusetzen.5
„ § 5 Abs 2SPG definiert den Begriff der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der in
der gesamten Rechtsordnung als organisatorischer Anknüpfungsbegriff Verwendung findet:
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind
1. Angehörige des Wachkörpers Bundespolizei
2. Angehörige der Gemeindewachkörper
3. Angehörige des rechtskundigen Dienstes bei Sicherheitsbehörden, wenn diese Organe
zur Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigt sind, und
sonstige Angehörige der Landespolizeidirektionen und des Bundesministeriums für In-
neres, wenn diese Organe die Grundausbildung für den Exekutivdienst (Polizeigrund-
ausbildung) absolviert haben und zur Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangs-
gewalt ermächtigt sind.“6
„Mit 1. Juli 2005 ist der Wachkörper Bundespolizei an die Stelle der traditionellen Wachkör-
per der Bundesgendarmerie, der Bundessicherheitswachekorps und der Kriminalbeamtekorps
getreten. § 5 Abs 6 SPG legt fest, dass der Wachkörper Bundespolizei aus den Bediensteten
der Besoldungsgruppe Exekutivdienst und Wachbeamte sowie allen in vertraglicher Verwen-
dung stehenden Exekutivbeamten besteht, unbeschadet ihrer Zuständigkeit zu einer be-
stimmten Dienststelle. Mit anderen Worten: Der Wachkörper Bundespolizei als Organisati-
onseinheit besteht nicht; vielmehr werden alle Exekutivbediensteten im Bundesministerium
für Inneres, mögen sie einer Landespolizeidirektion beigegeben, einer Sondereinheit im Bun-
desministerium für Inneres angehören oder im Bundeskriminalamt oder Bundesamt für Kor-
ruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention tätig sein, zum Wachkörper Bundespolizei
zusammengefasst.“7
§ 78d Abs 1 B-VG definiert Wachkörper als bewaffnete oder uniformierte oder sonst nach
militärischem Muster eingerichtete Formationen, denen Aufgaben polizeilichen Charakters
übertragen sind.8
4
vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), S 15,16
5
Keplinger/Stamminger, Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (2015), S 19,20
6
Keplinger/Stamminger, Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (2015), S 24
7
Keplinger/Stamminger, Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (2015), S 25
8
Binder/Trauner, Öffentliches Recht-Grundlagen (2014),RZ 1256
7Die Wachkörper sind keine Verwaltungsbehörden, sie sind nicht befugt Verordnungen und
Bescheide zu erlassen. Sie dürfen grundsätzlich auch sonst nicht aus eigener Initiative ein-
schreiten, außer dies ist gesetzlich vorgesehen. Solche gesetzlichen Grundlagen finden sich
beispielsweise im SPG in der StPO. Die Wachkörper stellen die bewaffnete Macht des Staates
bloß bereit und setzen sie nur über Auftrag und Weisung der jeweils zuständigen staatlichen
Verwaltungsbehörde ein. Eigenmächtig ohne behördlichen Auftrag dürfen Angehörige eines
Wachkörpers nur auf besonderer gesetzlicher Grundlage, etwa bei Gefahr im Verzug, ein-
schreiten. “9
Und genau diese gesetzlichen Grundlagen, diese Ausnahmen, welche die Wachkörper zu
selbständigem Einschreiten ermächtigen, sollen Gegenstand dieser Arbeit sein. Dabei wer-
den wir sehen, dass obwohl hier von Ausnahmen gesprochen wird, der Katalog der Möglich-
keiten eigenmächtig zu agieren, ziemlich umfangreich ist. Der Hauptteil der Arbeit wird sich
mit der Frage befassen, in welchen Situationen der Polizei eigenmächtiges Handeln ohne
behördliche Anordnung erlaubt ist. Wenn im Folgenden von Polizei gesprochen wird, be-
zieht sich das auf die Wachkörper des Bundes.
C. Gesetzliche Grundlagen
In der österreichischen Bundesverfassung ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe
und Sicherheit einschließlich der allgemeinen Hilfeleistung – ausgenommen die örtliche Si-
cherheitspolizei – in Art 10 Abs 1 Z 7 geregelt. Die Aufklärung von Straftaten durch die Krimi-
nalpolizei wird unter den Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG subsumiert. Nach der Kompetenzverteilung
bedeutet das, dass in diesen Materien die Zuständigkeit in Gesetzgebung und Vollziehung
dem Bund zufällt. Die Verwaltungspolizei umfasst, w.o. schon erklärt, viele verschiedene
Sachmaterien und wird daher als Annexmaterie gesehen. Ob der Bund oder das Land die
Kompetenz zur Gesetzgebung und Vollziehung hat, ergibt sich daraus, aus welchem Kompe-
tenztatbestand die Sachmaterie stammt, mit der die polizeilichen Regelungen in Zusammen-
hang stehen. Handelt es sich zB um polizeiliche Angelegenheiten, die ein Gewerbe betreffen,
ist sowohl für die Gesetzgebung als auch für die Vollziehung der Bund zuständig, da das Ge-
werbewesen in Art 10 B-VG normiert ist. Art 118 Abs 3 B-VG weist die örtliche Sicherheits-
und Verwaltungspolizei dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu. Die Definition der
Wachkörperfindet sich w.o schon erwähnt in Art 78 d Abs 1 B-VG.10
Die rechtlichen Grundlagen über die Befugnisse der Polizei finden sich nicht in einem einheit-
lichen Katalog, sondern sind über die gesamte Rechtsordnung verstreut. Die für die Praxis
bedeutsamsten Normen sind neben der des SPG und der StPO, auch der § 35 VStG ist hier zu
erwähnen.11
9
vgl Binder/Trauner, Öffentliches Recht-Grundlagen (2014),RZ 1256
10
vgl Demmelbauer/Hauer, Grundriss des österreichischen Sicherheitsrechts (2002), S 2,4,17
11
vgl Keplinger/Stamminger, Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (2015), S 30
8Das SPG regelt u.a die Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitspolizei. Es ist vor allem für die
Praxis eine der bedeutsamsten gesetzlichen Grundlagen, auf die sich das polizeiliche Han-
deln stützt. Hier werden wir uns hauptsächlich auf die Behandlung des Sicherheitspolizeige-
setzes, Teile des Verwaltungsstrafrechtes und der Strafprozessordnung am Rande beschrän-
ken, da die Behandlung aller, für die Polizei relevanten gesetzlichen Grundlagen, den Rah-
men der Arbeit sprengen würde. Nun möchte ich noch kurz auf das Verhältnis des SPG zur
StPO eingehen.
Bei der täglichen Polizeiarbeit werden das SPG und die StPO einfach nebeneinander ange-
wendet und kommen sich nicht in die Quere, da die beiden Gesetze völlig unterschiedliche
Schutzzwecke und Ziele haben. Eine einzige Handlung eines Polizisten kann somit einmal aus
Sicht der StPO und gleichfalls aus der Sicht des SPG beleuchtet werden, je nachdem welchen
Zweck die Amtshandlung verfolgt. Wird zB bei der Überwältigung eines bewaffneten Täters
die Waffe dem Täter weggenommen, so ist dies einerseits nach dem SPG zu beurteilen, weil
dadurch die Gefahr, die vom Täter ausging, abgewehrt wurde. Andererseits dient das Sicher-
stellen der Waffe der Beweissicherung nach der StPO. 12
D. Der Begriff Befugnis
Unter Befugnis versteht man die behördliche Ermächtigung bzw die Ermächtigung ihrer Or-
gane durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt in die Rechte von Menschen einzugrei-
fen. Das SPG weist die jeweiligen Befugnisse entweder einer Behörde oder den Organen des
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu. Demnach wird zwischen Behördenbefugnissen und Or-
ganbefugnissen unterschieden. Das gesamte polizeiliche Handeln muss sich auf eine gesetz-
liche Grundlage stützen. Es darf nur dann in die Rechte der Menschen eingegriffen werden,
wenn eine gesetzliche Ermächtigung dazu besteht.13
In der Praxis ist es oft sehr schwierig für den einschreitenden Polizisten in der kurzen Zeit,
die ihm zum Handeln und Eingreifen bleibt, die Lage rechtlich immer einwandfrei einzuord-
nen. Im Nachhinein, wenn alle Fakten bekannt sind und ausreichend Zeit für eine rechtliche
Analyse und Abwägung aller Umstände bleibt, ist es um vieles leichter zu sagen, ob ein Ein-
schreiten gesetzlich gedeckt war. Diese Umstände berücksichtigend, wird daher bei der
rechtlichen Beurteilung des polizeilichen Handelns eine ex-ante Beurteilung vorgenommen.
Es wird die Situation so beurteilt, wie sie sich für den Polizisten zum Zeitpunkt des Einschrei-
tens dargestellt hat. 14
Um diese Befugnisse notfalls auch zwangsweise durchsetzen zu können, sind die Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes mit Befehls- und Zwangsgewalt ausgestattet. Nicht immer
12
vgl Birklbauer/Keplinger, Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 28
13
vgl Keplinger/Stamminger, Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (2015) S 28,31
14
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 98
9geht aus einer gesetzlich festgeschriebenen Ermächtigung eindeutig hervor, inwieweit diese
auch durch Gewalt erzwungen werden darf, speziell wenn es sich um privatrechtliche Eingrif-
fe wie zB in das Eigentumsrecht handelt. Diese schwierigen Fragen sind je nach Einzelfall
durch die gängigen Auslegungsmethoden zu klären.15
E. Verhältnismäßigkeit
Das Gebot der Verhältnismäßigkeit ist zum einen verfassungsrechtlich verankert und ergibt
sich zum anderen aus dem Gleichheitssatz des Art. 7 Abs. 1 B-VG sowie aus weiteren Grund-
rechten, wie der Europäischen Menschrechtskonvention. Die Verhältnismäßigkeit ist immer
zu wahren, auch wenn dies nicht ausdrücklich aus einer gesetzlichen Regelung hervorgeht.
Deshalb wird in dieser Arbeit darauf verzichtet dies bei jeder einzelnen Befugnis zu erwäh-
nen. Ein Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist, dass bei Vorhandensein verschie-
dener Mittel stets dem gelinderen Mittel der Vorzug gegeben werden muss. In § 29 SPG wird
das Gebot der Verhältnismäßigkeit näher ausgeführt. 16 Diese Bestimmung ist ein Grundprin-
zip des polizeilichen Handelns. Die Verhältnismäßigkeit wird aus der ex-ante-Sicht geprüft
und beinhaltet drei Aspekte, welche erfüllt sein müssen, damit das polizeiliche Handeln
rechtmäßig ist. Die gesetzte Maßnahme muss geeignet und erforderlich sein, um den ange-
strebten Zweck zu erreichen, d.h. dass ohne diese Maßnahme der gewünschte Erfolg nicht
eintreten würde. Außerdem muss sie in einem angemessenen Verhältnis zum beabsichtig-
ten Zweck stehen.
Insbesondere sind folgende Kriterien in § 29 SPG festgeschrieben:
Stehen verschiedene Befugnisse zur Verfügung, darf nur von demjenigen Gebrauch gemacht
werden, welches am wenigsten in die Rechte der Menschen eingreifen. Dabei ist auch wäh-
rend der Amtshandlung auf die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen Bedacht zu neh-
men. Unbeteiligte sollen von Maßnahmen verschont werden. Sobald der gewünschte Zweck
erreicht ist, oder sich herausstellt, dass er nicht erreicht werden kann ist die Ausübung der
Befehls- und Zwangsgewalt einzustellen. 17
15
vgl Keplinger/Stamminger, Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (2015) S 33,34
16
vgl Keplinger/Stamminger, Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (2015) S 38
17
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 102
10IV. Kurzer historischer Überblick
„Die Sicherheit ist ein Zustand, worinnen wir nichts zu fürchten haben. Der Zustand, worinnen
der Staat nichts zu fürchten hat, heißt die öffentliche; worinnen kein Bürger etwas zu fürch-
ten hat, die Privatsicherheit. Wenn der Staat von äußeren Angriffen nichts zu fürchten hat, so
heißt dieser Zustand die äußere, und besorgt er von seinen Bürgern nichts, die öffentliche
innere Sicherheit. Wenn weder der Staat von außen, noch von seinen Bürgern, weder diese
irgendher etwas zu befürchten haben: so heißt dieser glückliche Zustand, die allgemeine Si-
cherheit.“18
So beschrieb Josef Freiherr von Sonnenfels, Staatsrechtslehrer und Berater des Hofes, Ende
des 18. Jahrhunderts die öffentliche Sicherheit. Dieses Begriffsverständnis prägte gewisser-
maßen das Bild der öffentlichen Sicherheit während der gesamten Monarchie.19
Das erste Polizeiamt wurde in Wien 1755 nach französischem Vorbild errichtet. Danach er-
öffneten weitere Polizeibehörden in den Städten Graz, Linz, Innsbruck, Prag, Brünn und eini-
gen mehr. Die polizeibehördlichen Aufgaben wurden durch das Organisationsstatut festge-
schrieben und umfassten im Wesentlichen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung,
Ruhe und Sicherheit.20 Durch die Jahrhunderte hinweg bis heute ist dieses Tätigkeitsfeld eine
der wichtigsten Aufgaben der Polizei geblieben.
§ 1 des Ministerialerlasses vom 10. Dezember 1850, Zl 63708 konkretisierte die Vorgaben des
Organisationsstatutes wie folgt21: „ Die k.k Polizeibehörden haben den Gefahren, womit der
Monarch, das kaiserliche Haus, die gesetzliche Ordnung, sowie überhaupt der Rechtsbestand
und die Wohlfahrt des Staates sowie der Einzelnen bedroht sind, auf den gesetzlichen Wegen
vorzubeugen und zu begegnen, die öffentliche Ruhe und Ordnung in dem Bereiche ihres Be-
zirkes zu erhalten, die Angriffe gegen dieselbe und die Verletzungen der Person und des Ei-
gentums, mögen sie vom Zufall herrühren oder durch menschliche Tätigkeit absichtlich oder
unabsichtlich veranlasst werden, zu hindern, bei vorfallenden Störungen der Ordnung und
Sicherheit dem Umsichgreifen des Schadens Einhalt zu tun, die eingetretenen nachteiligen
Folgen zu beseitigen, endlich die Übertreter des Gesetzes auszuforschen, anzuhalten und den
berufenen Behörden zu überliefern.“22
18
vgl Hauer, Ruhe Ordnung Sicherheit (1999) S 52
19
vgl Hauer, Ruhe Ordnung Sicherheit (1999) S 52
20
vgl Hauer, Ruhe Ordnung Sicherheit (1999) S 54
21
vgl Hauer, Ruhe Ordnung Sicherheit (1999) S 54,55
22
Hauer, Ruhe Ordnung Sicherheit (1999) S 55
11Es lässt sich feststellen, dass eine deutliche Ähnlichkeit zu den Aufgaben der heutigen Bun-
despolizeibehörden besteht.
Da die k.u.k Polizeiwache nach und nach auf Abneigung in der Bevölkerung stieß, was auch
immer öfter durch tätlichen Widerstand und Behinderung der polizeilichen Aufgaben zum
Ausdruck kam, war sie nicht mehr in der Lage ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.
Daher wurde mit kaiserlicher Entschließung vom 2. Februar 1868 eine neue Sicherheitswa-
che errichtet, welche die k.k Polizeiwache in den nächsten Jahren völlig ersetzen sollte. Das
Aufgabengebiet sollte grundsätzlich unverändert bleiben und umfasste abermals die Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit.
Nach Ende der Monarchie verdankte die Polizei ihren Fortbestand, ohne große Erneuerun-
gen, vor allem dem im Juni 1918 eingesetzten Polizeipräsidenten Dr. Johann Schober23
„Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten im März 1938 wurde das Sicherheitswesen in
der "Ostmark" umgestaltet und dem Deutschen Reich angepasst. Nach dem Ende des natio-
nalsozialistischen Regimes wurde mit dem Behördenüberleitungsgesetz 1945 wieder die be-
hördliche Struktur eingesetzt, wie sie vor der NS-Machtübernahme im März 1938 bestanden
hatte.“24
V. Befugnisse und Zuständigkeiten
A. Begriffsbestimmungen
W.o. schon beschrieben regelt das SPG die Aufgaben und Befugnisse der Polizei. In § 16 SPG
werden die Begriffe der allgemeinen Gefahr, des gefährlichen Angriffs und der Gefahrener-
forschung definiert. § 17 SPG definiert eine mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlung ist.
Da viele Befugnisse an diese Tatbestände anknüpfen, ist es notwendig auf diese Begriffsbe-
stimmungen näher einzugehen.
1. Allgemeine Gefahr
§ 16 Abs 1 SPG besagt, dass eine allgemeine Gefahr im Falle eines gefährlichen Angriffs (le-
galdefiniert in § 16 Abs 2 SPG ) oder einer kriminellen Verbindung von mindestens drei oder
mehr Menschen, die vorsätzlich fortgesetzt gerichtlich strafbare Handlungen begehen möch-
ten, besteht. „Die allgemeine Gefahr der kriminellen Verbindung beginnt mit dem Zusam-
menschluss mehrerer Personen zur fortgesetzten Begehung gerichtlich strafbarer Handlun-
gen und endet mit der Auflösung dieser Verbindung“. Erfasst sind alle gerichtlich strafbaren
Handlungen, einschließlich der des Nebenstrafrechts. Auf die Strafmündigkeit der Verbin-
dungsmitglieder kommt es bei diesem Begriff nicht an. Der Gesetzgeber möchte mit dieser
23
vgl http://www.polizei.gv.at/wien/publikationen/geschichte/start.aspx
24
http://www.polizei.gv.at/ooe/publikationen/geschichte/bpd.aspx
12Bestimmung eine rechtliche Handhabe schaffen, die es ermöglicht eine Gefahr abzuwehren.
Nämlich die Gefahr, die von der kriminellen Verbindung ausgeht, noch bevor eine gerichtlich
strafbare Handlung gesetzt wurde. Auch wenn noch keine gerichtlich strafbare Handlung
gesetzt wurde, kann demnach schon eine kriminelle Verbindung vorliegen, solange ihr Zweck
darin besteht, so eine Handlung begehen zu wollen. Eine besondere Organisation der Ver-
bindung ist nicht erforderlich. Das gemeinsame Vorhaben eine einzige strafbare Handlung
begehen zu wollen, ist noch nicht ausreichend, da sich der Vorsatz auch auf die Fortsetzung
der Straftaten beziehen muss. 25
2. Gefährlicher Angriff
Die Legaldefinition des gefährlichen Angriffs lautet:
„Ein gefährlicher Angriff ist die Bedrohung eines Rechtsgutes durch die rechtswidrige Ver-
wirklichung des Tatbestandes einer gerichtlich strafbaren Handlung, die vorsätzlich began-
gen und nicht bloß auf Verlangen eines Verletzten verfolgt wird, sofern es sich um einen
Straftatbestand
nach dem Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, ausgenommen die Tatbestände
1.
nach den §§ 278, 278a und 278b StGB, oder
2. nach dem Verbotsgesetz, StGBl. Nr. 13/1945, oder
3. nach dem Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, oder
nach dem Suchtmittelgesetz (SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, ausgenommen der Erwerb
4. oder Besitz von Suchtmitteln zum ausschließlich persönlichen Gebrauch (§§ 27 Abs. 2, 30
Abs. 2 SMG), oder
5. nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 (ADBG 2007), BGBl. I Nr. 30, oder
6. nach dem Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG), BGBl. I Nr. 146/2011,
handelt.“26
Nach dieser Definition ist es somit erforderlich, dass ein Rechtsgut - davon sind alle Rechts-
güter erfasst - durch die Verwirklichung einer, der in § 16 Abs 2 SPG taxativ aufgezählten
gerichtlich strafbaren Handlungen, bedroht ist. Ein gefährlicher Angriff scheidet aus, wenn
ein Rechtfertigungsgrund, wie z.B Notwehr vorliegt oder wenn es sich um ein Fahrlässig-
keitsdelikt oder Privatanklagedelikt handelt. Die Schuldfähigkeit ist keine Voraussetzung,
weshalb ein gefährlicher Angriff beispielsweise auch von einem Minderjährigen oder einer
25
Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 61, 62
26
§ 16 SPG 1991, BGBl. Nr. 566/1991
13Person, die sich in einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Geisteszustand befin-
det, begangen werden kann. Das ermöglicht die Anwendung des SPG auch bei den oben ge-
nannten Personen. Gem. § 16 Abs. 3 SPG stellt auch schon eine nach § 15 StGB straflose
Vorbereitungshandlung einen gefährlichen Angriff dar, sofern sie in einem engen zeitlichen
Zusammenhang mit der Verwirklichung des Tatbestandes steht.27
3. Gefahrenerforschung
§ 16 Abs 4 SPG Gefahrenerforschung ist die Feststellung einer Gefahrenquelle und des für die
Abwehr einer Gefahr sonst maßgeblichen Sachverhalts.28
4. Mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlung
§ 17 SPG Mit beträchtlicher Strafe bedroht sind gerichtlich strafbare Handlungen, die mit
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind.29
B. Aufgaben der Polizei und allgemeine Befugnisse
Das SPG verteilt die Aufgaben, welche die Sicherheitsbehörden und ihre Organe zu erledigen
haben und stattet sie mit besonderen Befugnissen aus, um diese Aufgaben ordnungsgemäß
erfüllen zu können. Da die Polizei nur dann ihre gesetzlich festgeschriebenen Befugnisse
ausüben darf, wenn dies zur Erreichung eines Zwecks erforderlich ist, zu deren Aufgabener-
füllung sie berufen ist, ist es nun notwendig im Folgenden kurz zu klären, um welche Aufga-
ben es sich überhaupt handelt.30
1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
Die Polizei hat dafür zu sorgen, dass die öffentliche Ordnung aufrechterhalten wird. Sie soll
ein friedliches Miteinander unter den Bürgern gewährleisten. Der Begriff „öffentliche Ord-
nung“ geht über die Einhaltung von Rechtsvorschriften hinaus und umfasst auch die allge-
mein anerkannten Grundlagen des Zusammenlebens.31Der VwGH umschreibt die öffentliche
Ordnung als „die Gesamtheit jener ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen
in der Öffentlichkeit, deren Befolgung als unentbehrliche Voraussetzung für ein gedeihliches
Miteinander der Menschen angesehen wird“.32
Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH (Hinweis E 13.2.1984, 82/10/0178) ist das
Tatbild der Ordnungsstörung durch zwei Elemente gekennzeichnet: Zum ersten muss der Tä-
ter ein Verhalten gesetzt haben, dass objektiv geeignet ist, Ärgernis zu erregen. Zum zweiten
27
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 60-64
28
§ 16 SPG 1991, BGBl. Nr. 566/1991
29
§ 16 SPG 1991, BGBl. Nr. 566/1991
30
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 66
31
vgl Pürstl/Zirnsack, Sicherheitspolizeigesetz (2011) S 132
32
Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 93
14muss durch dieses Verhalten die Ordnung an einem öffentlichen Ort gestört worden sein. Die
Beurteilung, ob einem Verhalten die objektive Eignung zur Ärgerniserregung zukommt, ist
nicht nach dem Empfinden der durch das Verhalten besonders betroffenen Personen vorzu-
nehmen, sondern unter der Vorstellung, wie unbefangene Menschen auf ein solches Verhal-
ten reagieren würden; von einem Ärgernis wird man dann sprechen können, wenn eine
Handlung bei anderen die lebhafte Empfindung des Unerlaubten und Schändlichen hervor-
zurufen geeignet ist.33
Öffentliche Orte sind – unbeschadet der konkreten Eigentumsverhältnisse – solche Orte, die
von einem nicht von vornherein bestimmten Personenkreis betreten werden können. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob dieser Ort zu jeder Zeit öffentlich zugänglich ist oder ob an
diesem Ort tatsächlich eine größere Anzahl von Personen anwesend ist.34
Die Rechtsprechung hat beispielsweise folgende Orte als öffentlich qualifiziert:
ein Gastlokal während der Öffnungszeit
Straßen mit öffentlichem Verkehr
Öffentliche Verkehrsmittel
Das Stiegenhaus allgemein zugänglicher Gebäude
Für jedermann zugängliche Gänge und Höfe eines Hauses
Ein Polizeiwachzimmer
Ein Amtszimmer eines magistratischen Bezirksamtes
Vor einem Gasthof35
Um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, kann auf folgende Befugnisse zurückgegrif-
fen werden:
Auflösung von Besetzungen gem § 37 SPG
Wegweisung gem § 38
Nach erfolgloser Abmahnung kommt bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 35
VStG eine Festnahme in Betracht, sofern diese dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
nicht entgegen steht und gelindere Mittel sich als wirkungslos erwiesen haben.
Sicherstellung von Sachen, die für die Störung gebraucht wurden36
33
VwGH 09.07.1984 84/10/0080
34
Thanner/Vogl, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2013) S 248
35
Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 94
36
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 68
152. Erste allgemeine Hilfeleistungspflicht
Die EAH ist in § 19 SPG geregelt. Wenn eines der Rechtsgüter Leben, Gesundheit, Freiheit
oder Eigentum gefährdet ist oder eine Gefahr unmittelbar bevorsteht, sind die Behörden
und ihre Organe dazu verpflichtet sofortige Hilfe zu leisten und alle Maßnahmen zu setzen,
die für die Abwehr der Gefahr erforderlich sind und zwar solange bis die tatsächlich zustän-
digen Verwaltungsbehörden - die Rettung oder die Feuerwehr - einschreiten und die Amts-
handlungen übernehmen. Die Pflicht zur Hilfe endet auch, wenn der Betroffene die Hilfe
ablehnt.37 Hierbei muss allerdings auf die Fähigkeit die Tragweite der eigenen Entscheidung
zu erkennen abgestellt werden, da gerade Personen, die ein erschütterndes Erlebnis hatten,
oft in einem, die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden, Schockzustand geraten können.
Zur Erfüllung der EAH kann grundsätzlich auf folgende Befugnisse zurückgegriffen werden:
Auskunftsverlangen
Identitätsfeststellung
Wegweisung von Unbeteiligten
Betreten von Grundstücken und Räumen
Durchsuchen von Grundstücken, Räumen und Kraftfahrzeugen nach gefährdeten
Menschen
Inanspruchnahme von Sachen
Ermittlung und Erarbeitung personenbezogener Daten38
In Abwägung der Verhältnismäßigkeit zwischen der Rechtsgutverletzung und dem daraus
resultierenden Schaden kann zur Erfüllung der EAH auch in Rechtsgüter von Dritten einge-
griffen werden.39
3. Gefahrenabwehr
Eine der wichtigsten Aufgaben neben der EAH, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung und der Beendigung von gefährlichen Angriffen stellt die in § 21 SPG normierte Gefah-
renabwehr dar. Die Polizei ist berechtigt, bessergesagt verpflichtet, eine allgemeine Gefahr
abzuwehren und einem gefährlichen Angriff unverzüglich Einhalt zu gebieten und zu been-
den. Die Bedeutung der beiden Begriffe und was dabei alles mit inbegriffen ist wurde in Ka-
pitel III Punkt A behandelt. Die folgenden Befugnisse sind zur Gefahrenabwehr vorgesehen:
Platzverbot
Wegweisung
Außerordentliche Anordnungsbefugnisse
37
vgl Thanner/Vogl, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2013) S 187
38
Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 68
39
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 109
16 Sicherheitsbereich einrichten
Betreten von Räumen und Grundstücken
Durchsuchen von Grundstücken, Räumen und Kraftfahrzeugen nach einem Menschen
von dem ein gefährlicher Angriff ausgeht
Durchsuchen von Grundstücken, Räumen und Kraftfahrzeugen nach einer Sache die
für einen gefährlichen Angriff bestimmt ist
Sicherstellung von Sachen
Inanspruchnahme von Sachen40
4. Beendigung gefährlicher Angriffe
§ 33. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einem gefährlichen
Angriff durch Ausübung von unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ein Ende zu setzen.41
Die Frage, wie die Abwehr eines gefährlichen Angriffes zu geschehen hat, wird in § 33 SPG
1991 nur durch den rechtsförmlichen Begriff der "Ausübung unmittelbarer Befehls und
Zwangsgewalt" näher beschrieben. Weitere Determinanten des zur Erreichung der An-
griffsbeendigung zu setzenden polizeilichen Verhaltens ergeben sich aus den §§ 28 ff SPG
1991, dann aus den §§ 35 ff SPG 1991, sofern sie Sondervorschriften zu § 33 SPG 1991 ent-
halten, und letztlich aus sonstigen, insbesondere verfassungsrangigen Rechtsvorschriften, die
bestimmte hoheitliche Verhaltensweisen von vornherein verbieten. In diesen durch die
Rechtsordnung gezogenen Grenzen hat die Behörde (bzw. haben deren Organe) im Übrigen
das Zweckdienliche vorzukehren, um das in § 33 SPG 1991 umschriebene Ziel (Ende des ge-
fährlichen Angriffes) zu erreichen. Was hierfür in Betracht kommt, hängt jeweils von den
konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Beendigung des Angriffes kann beispielsweise
durch ein Wegzerren des Schlägers von seinem Opfer, durch die Abnahme des soeben "ge-
stohlenen Gegenstandes" oder durch gezielten Schusswaffengebrauch erfolgen.42
5. Vorbeugender Schutz von Rechtsgütern
§ 22 SPG verpflichtet die Polizei nicht nur bei einer schon konkret vorhandenen Gefahr tätig
zu werden, sondern auch dazu Rechtsgüter vorbeugend vor gefährlichen Angriffen zu schüt-
zen.43 Es reicht schon das Vorhandensein einer abstrakten Gefahr für ein Rechtsgut aus, um
die Schutzpflicht auszulösen. Sinn und Zweck ist es, Personen und Objekte, die besonders
gefährdet sind Ziel eines gefährlichen Angriffs zu werden, davor zu bewahren.44 Besondere
40
Hauer/Keplinger, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2011) S 225
41
§ 33 SPG 1991 BGBl Nr. 566/1991
42
VwGH 08.03.1999 98/01/0096
43
vgl Hauer/Keplinger, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2011) S 232
44
vgl Thanner/Vogl, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2013) S 210
17Befugnisse zur Aufgabenerfüllung können aus § 22 SPG allerdings nicht abgeleitet werden,
diese werden erst durch andere Bestimmungen des SPG begründet.45
Besonderen Schutz genießen Menschen, die hilflos sind und deshalb nicht selbst für ihren
eigenen Schutz sorgen können. Das sind z.B Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung
oder mit veränderter Wahrnehmung der Realität, da sie „leichtere“ Opfer darstellen und
deshalb öfter von gefährlichen Angriffen betroffen sind.
Auch verfassungsmäßige Einrichtungen wie z.B der Nationalrat, der Bundesrat, der oberste
Gerichtshof, der Bundespräsident und der Verfassungsgerichtshof uvm bedürfen auf Grund
ihrer wichtigen Bedeutung für unseren Staat und unserer Werte, wie z.B unserem demokra-
tischen Prinzip, eines vorbeugenden Schutzes. 46
Besonderen Schutz bedürfen auch die Vertreter von ausländischen Staaten, Vertreter inter-
nationaler Organisationen und die Vertreter anderer Völkerrechtssubjekte und der ihnen zur
Verfügung stehenden amtlichen und privaten Räumlichkeiten sowie das ihnen beigegebene
Personal. 47
Verlorengegangene Sachen, die sich in niemandes Gewahrsam befinden, müssen ebenso vor
gefährlichen Angriffen geschützt werden und dürfen zu diesem Zweck sichergestellt werden,
da der Verfügungsberechtigte nicht selbst für deren Schutz sorgen kann. Daraus ergibt sich
aber auch, dass es darauf ankommt, ob die Sachen mit oder ohne Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gewahrsamsfrei wurden, weil Sachen, denen sich der Eigentümer absichtlich ent-
ledigen wollte gerade keinen Schutz benötigen.48 Auf diesen Punkt wird in dem Kapitel über
Sicherstellungen noch näher eingegangen.
Ein weiterer Punkt ist der des Zeugenschutzes, wobei Menschen, die über spezielle Kennt-
nisse über gefährliche Angriffe oder kriminelle Verbindungen verfügen, beispielsweise durch
Bewachung oder durch spezielle Unterbringung vor Gefahren geschützt werden sollen. Diese
Schutzmaßnahmen erschöpfen sich allerdings in nicht-eingreifenden Maßnahmen und be-
gründen keine besonderen Befugnisse.49
Kritische Infrastrukturen, die eine wesentliche Bedeutung für die Öffentlichkeit haben, wie
für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit,sowie der Katastrophenschutz, die öf-
fentliche Versorgung, das Gesundheitswesen usw. sollen vorbeugend geschützt werden, vor
allem durch Sammlung von Informationen, die auf einen konkret bevorstehenden gefährli-
chen Angriff hinweisen sollen. Liefert eine Information konkrete Anhaltspunkte, die eine
45
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 77
46
vgl Hauer/Keplinger, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2011) S 234
47
Hauer/Keplinger, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2011) S 235
48
vgl Hauer/Keplinger, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2011) S 236
49
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 80
18Gefahr befürchten lassen, so sind die Verantwortlichen der jeweiligen Infrastrukturen sofort
darüber zu benachrichtigen.50
6. Fahndung
Den Sicherheitsbehörden und ihrer Organe obliegt die Fahndung nach Personen und Sachen,
wenn die Voraussetzungen des § 24 SPG gegeben sind. Zusammenfassend ist das der Fall,
wenn Personen zur Festnahme ausgeschrieben sind oder die Befürchtung besteht, dass ihr
Leben oder ihre Gesundheit durch sich selbst, aufgrund eines Unfalls oder durch Fremden-
wirkung gefährdet sind. Ist ein Minderjähriger abgängig, so kann auf Verlangen eines Obsor-
gepflichtigen gem. § 162 ABGB die Fahndung nach ihm eingeleitet werden. Durch diese Be-
stimmung allein werden allerdings keine Befugnisse begründet. Die gesetzlichen Grundlagen
für das weitere Einschreiten nach erfolgreicher Fahndung, wie beispielsweise die Rückfüh-
rung zu den Erziehungsberechtigten, finden sich in anderen Bestimmungen des SPG oder
anderen Gesetzen wie der StPO. 51
7. Weitere Aufgaben
Abschließend normiert das SPG die Verpflichtung zur sicherheitspolizeilichen Beratung von
Personen darüber wie sie am besten gefährliche Angriffe vorbeugen können. Aus § 26 SPG
können keine Befugnisse abgeleitet werden.52
In der Praxis wird dem ua durch Aufklärung über Einbaumöglichkeiten von Sicherheitstüren
und Sicherheitsschlössern oder die bestmögliche Verwahrung von Wertsachen und Handta-
schen auf öffentlichen Plätzen, wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, entsprochen.
Auch die Streitschlichtung ist eine Aufgabe der Polizei. Dabei hat sich die Polizei darum zu
bemühen, streitende Parteien zur Beilegung ihrer Streitigkeiten zu bewegen und zwischen
ihnen zu vermitteln. Sie hat dabei aber keinerlei Befugnisse in Rechtsgüter einzugreifen.
Erst wenn es zu einer Eskalation kommt, die eine allgemeine Gefahr gem. § 16 SPG begrün-
det, kann auf die Befugnisse des 3. Teils des SPG zurückgegriffen werden.53
Strafrechtspflege
Die rechtliche Grundlage der Kriminalpolizei im Sinne der Strafrechtspflege in bestimmten
Bereichen selbständig tätig zu werden, liegt in einem der leitenden Prozessgrundsätze der
StPO verankert. Das Offizialprinzip bzw der Anklagegrundsatz ist in § 2 StPO geregelt und
normiert eine Verpflichtung der Kriminalpolizei im Strafrecht jedem Anfangsverdacht nach-
zugehen und in der Strafrechtspflege aktiv zu werden. Die Polizei hat bei Kenntniserlangung
50
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 80
51
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 86,87
52
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 91
53
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 91,92
19über eine Straftat nicht die Wahl ob sie einschreitet oder nicht. Im Gegenteil besteht die
amtswegige Pflicht sofort im Rahmen ihrer in der StPO aufgezählten Befugnisse tätig zu
werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Privatanklagedelikte, wie beispielsweise die
Beleidigung in § 115 StGB. Selbst wenn ein Opfer von einer Strafanzeige absehen möchte,
hat die Polizei im Sinne des Offizialprinzips zu ermitteln. 54
Zwischenresümee
Im 2., 3. und 4. Hauptstück des SPG werden alle Aufgaben genannt, die den Sicherheitsbe-
hörden und ihren Organen übertragen sind, wobei nicht alle davon die Polizei dazu ermäch-
tigen in die Rechtsgüter von Menschen einzugreifen. Manche Aufgaben verleihen keine Be-
fugnisse und müssen daher mit nicht-eingreifenden Mitteln erfüllt werden, wie dies bei-
spielsweise bei der Streitschlichtung oder der sicherheitspolizeilichen Beratung der Fall ist.
Erst wenn eine allgemeine Gefahr iSd § 16 SPG droht, ein gefährlicher Angriff oder dessen
Versuch unmittelbar bevorsteht oder ein Fall eintritt bei dem erste allgemeine Hilfe iSd § 19
SPG geleistet werden muss, kann auf die Befugnisse des 3. Hauptstücks des SPG zurückge-
griffen werden. Für diese Arbeit besonders interessant sind jene Aufgaben welche auch Be-
fugnisse verleihen und der Polizei die Handhabe geben, in Rechtsgüter von Menschen ein-
zugreifen. Und diese sind – um es nochmals zu verdeutlichen – die Erste allgemeine Hilfe-
leistungspflicht gem.§ 19 SPG, die Gefahrenabwehr gem.§ 21 SPG, die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung gem. § 27 SPG und die Beendigung gefährlicher Angriffe gem. §
33 SPG. Erlangt die Polizei Kenntnis über einen strafrechtlichen Tatbestand, hat sie sofort
auf die in der StPO geregelten und nach dem jeweiligen Fall geeigneten Maßnahmen zu-
rückzugreifen.
C. Befugnisse der Polizei
1. Befehls- und Zwangsgewalt
Obwohl die Regelungen über Befehls- und Zwangsgewalt, welche sich sowohl in § 50 SPG als
auch in § 93 StPO finden, eigentlich keine eigenen Befugnisse sind, erscheint es mir trotzdem
sehr wichtig, sie an dieser Stelle kurz zu behandeln. Dies deshalb, weil ohne die gesetzliche
Möglichkeit die gesetzlichen Befugnisse der Polizei, bei entsprechender Notwendigkeit mit-
tels Zwang durchsetzen zu können, mE die Polizei als Ganzes schlichtweg handlungsunfähig
wäre, was die Überflüssigkeit der Gesetze zur Folge hätte und den Rechtsstaat an sich ad
absurdum führen würde. Die Anwendung von Zwang umfasst nicht bloß das Einsetzen von
Körperkraft, sondern auch die Zuhilfenahme von Waffen nach Maßgabe der Bestimmungen
des Waffengebrauchsgesetzes. Der Zwang kann sich sowohl gegen Personen als auch gegen
Sachen richten. Befehlsgewalt meint die Anordnung den geforderten Zustand herzustellen.
54
vgl Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 37
20Die beiden Bestimmungen haben im Großen und Ganzen denselben Regelungsinhalt. Je
nachdem, ob Befugnisse des SPG oder der StPO ausgeübt werden, ist das geeignete Gesetz
heranzuziehen. Die Zwangsgewalt ist in jedem Falle vorerst anzudrohen und in weiterer Fol-
ge anzukündigen. Dieses Erfordernis entfällt in den Fällen von Notwehr, bei Beendigung ge-
fährlicher Angriffe oder wenn dadurch kriminalpolizeiliche Ermittlungen oder Beweisauf-
nahmen gefährdet wären. 55
2. Auskunftsverlangen/Befragung/Vernehmung
Wenn es für die Erfüllung der in § 19 SPG normierten EAH erforderlich ist, ist die Polizei er-
mächtigt von Personen Auskunft zu verlangen, welche für die erste Hilfeleistung wichtige
Hinweise liefern können, wie zB Informationen über die Gefahrenquelle oder zur Klärung der
Frage ob und wenn ja, welche Gefahr überhaupt vorliegt. Das Wort „Verlangen“ deutet
schon darauf hin, dass die Erteilung der Auskunft nicht von der Freiwilligkeit der betreffen-
den Person abhängig sein soll. Im Gegensatz zum schlichten Auskunftsersuchen, bei dem
bloß die Bitte nach Informationen geäußert wird, ohne dass eine Verpflichtung besteht die-
ser zu entsprechen, ermächtigt § 34 SPG zur Ausübung von Befehlsgewalt. Der Betroffene
hat dem Verlangen der Polizei Folge zu leisten und Auskunft zu erteilen. Allerding handelt es
sich bei dieser Bestimmung um eine lex imperfecta, da eine Weigerung des Betroffenen oder
auch das Erteilen einer falschen Auskunft, zu keinen rechtlichen Konsequenzen führt und das
Auskunftsverlangen nicht mit Zwangsgewalt durchgesetzt werden kann.56
„Eine Verpflichtung zu wahrheitsgemäßer Äußerung besteht nicht; dies wäre nicht zulässig,
weil es immer wieder dazu kommen wird, dass ein Auskunftsverlangen Personen gestellt
wird, von denen sich im Nachhinein herausstellt, dass sie dem Inhalt nach einer gerichtlich
strafbaren Handlung verdächtig sind.“57
Dies würde dem Aussageverweigerungsrecht, welches in § 157 Abs 1 Z 1 StPO verankert ist
und seinen Ursprung in Art 6 EMRK findet entgegen sprechen, welches besagt, dass nie-
mand gezwungen werden darf sich selbst zu belasten und sich der Gefahr einer strafgericht-
lichen Verfolgung auszusetzen.58 Einzig und allein auf dem Zivilrechtsweg kann ein eventuel-
ler Schadenersatzanspruch durchgesetzt werden, wenn durch eine bewusst falsch erteilte
Auskunft ein größerer Schaden entstanden ist.59
Auch in der Strafprozessordnung wird von einem Auskunftsverlangen gesprochen, geregelt
in § 152 StPO. Dabei handelt es sich um formlose Erkundigungen, die den Zweck haben bei
Vorliegen eines Strafrechtsdeliktes den Sachverhalt vorab zu ordnen. Zu diesem Zeitpunkt
weiß man noch nicht genau, was passiert ist und welche Personen welche Rolle in einem
55
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 194,195
vgl Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 120-122
56
vgl Hauer/Keplinger, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2011) S 313,314,315
57
RV zu BGBl 566/1991, 148 der Beilagen XVIII. GP – Regierungsvorlage, S 39
58
vgl § 157 StPO 1975 BGBl. Nr. 631/1975 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 26/2016
59
vgl Hauer/Keplinger, SPG Sicherheitspolizeigesetz Kommentar (2011) S 315
21strafrechtlich relevanten Sachverhalt spielen. Durch diese formlosen Erkundigungen soll
festgestellt werden, ob überhaupt ein Anfangsverdacht besteht. Durch das Auskunftsverlan-
gen dürfen allerdings nicht die Vorschriften der Vernehmung umgangen werden. Sobald
feststeht welche Rolle die Beteiligten in dem Verfahren zukommt, müssen die Vorschriften
über die Vernehmung eingehalten werden. Damit bleibt gewährleistet, dass den Beteiligten
die jeweiligen Rechte als Opfer, Beschuldigte oder Zeugen zukommen. 60
Vernehmungen nach §153 StPO sind förmliche Befragungen von Verdächtigen bzw Beschul-
digten, Opfer und Zeugen und haben den Sinn eine Straftat aufzuklären und Beweise zu er-
heben. Grundsätzlich hat eine Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft schriftlich
zu erfolgen. Liegen Umstände vor, die die Annahme rechtfertigen, dass eine Fluchtgefahr des
Beschuldigten bestehen könnte oder dass die Beweisaufnahme gefährdet wäre, kann die
Staatsanwaltschaft den Beschuldigten zur sofortigen Vernehmung vorführen lassen. Wenn
die vorherige Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft wegen Gefahr im Verzug nicht
möglich ist, kann die Polizei bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen den Be-
schuldigten auch ohne Anordnung der Staatsanwaltschaft vorführen.61
„Die Vorführung kann von der Kriminalpolizei – auch ohne Vorliegen von Gefahr im Verzug-
aus eigenem vorgenommen werden, wenn der Beschuldigte auf frischer Tat betreten wird,
oder unmittelbar nach der Tat glaubwürdig der Tatbegehung beschuldigt wird, oder mit Ge-
genständen betreten wird, die auf eine Beteiligung an der Tat hinweisen. In diesen Fällen ist
für eine Vorführung auch nicht die Annahme notwendig, dass sich der Beschuldigte ansons-
ten dem Verfahren entziehen oder Beweismittel beeinträchtigen werde.“62
In der Praxis wurde die Institution des Journalstaatsanwaltes eingerichtet, welcher zu jeder
Tag- und Nachtzeit telefonisch erreichbar ist und fernmündlich eine Anordnung erteilen
kann. Deshalb kann man sagen, dass es praktisch kaum Fälle gibt, bei denen Gefahr im Ver-
zug besteht.
Praxisrelevant sind die Situationen, in welchen der Verdächtige auf frischer Tat betreten,
unmittelbar danach glaubwürdig der Tatbegehung beschuldigt oder mit Gegenständen be-
treten wurde, die auf eine Tatbegehung hinweisen. Die sofortige Vernehmung der Kriminal-
polizei ist als gelinderes Mittel der Festnahme nach § 170 StPO vorzuziehen.63
60
vgl Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 216
61
vgl Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 218
62
Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 218,219
63
vgl Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 218,2019
223. Identitätsfeststellung
„Geht man vom Wortlaut der Legaldefinition im § 35 Abs. 2 SPG aus, so stellt jedes Erfassen
der Namen, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift eines Menschen in dessen Anwesen-
heit eine Feststellung der Identität dar.“64
Die in § 35 SPG normierte Ermächtigung zur Identitätsfeststellung muss von jener schlichten
Identitätsfeststellung, welche auf freiwilliger Mitwirkung der Person basiert und keinen Ein-
griff in die Menschenrechte darstellt unterschieden werden. § 35 SPG enthält eine abschlie-
ßende Aufzählung aller Fälle, in denen die Durchführung einer Identitätsfeststellung gerecht-
fertigt ist, welche bei Verweigerung der Mitwirkung mittels Befehls- und Zwangsgewalt
durchgesetzt werden können. Das führt allerdings nicht dazu, dass eine generelle Pflicht zur
Mitführung von Ausweisdokumenten besteht, gleichwohl andere gesetzliche Regelungen
wie beispielsweise das Führerscheingesetz oder das Fremdenpolizeigesetz- um nur einige zu
nennen - eine solche begründen. 65
„§ 35 Abs 1 Z 1 SPG Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Feststellung der
Identität eines Menschen ermächtigt, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen
ist, er stehe im Zusammenhang mit einem gefährlichen Angriff oder könne über einen sol-
chen Angriff Auskunft erteilen“66
„Aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen“ drückt aus, dass es für die einschreitenden
Organe bei einer ex-ante Betrachtungsweise ausreicht, wenn sie den Zusammenhang mit
einem gefährlichen Angriff vermuten. Dass sich diese Vermutung bewahrheitet, ist nicht er-
forderlich. Unter diese Bestimmung sind auch Vorbereitungshandlungen für einen gefährli-
chen Angriff zu subsumieren, vorausgesetzt sie stehen in einem engen zeitlichem Zusam-
menhang mit diesem.67 Weiters sind von dieser Bestimmung nicht bloß Personen erfasst,
von welchen eine Gefahr ausgeht, sondern auch solche, die Opfer eines solchen werden soll-
ten oder Zeugnis darüber ablegen können.68
㤠35 Abs 1 Z 2 SPG wenn der dringende Verdacht besteht, dass sich an seinem Aufenthalts-
ort
a) mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlungen ereignen oder
b) flüchtige Straftäter oder einer Straftat Verdächtige verbergen;“69
„Nach dieser Bestimmung (lit a) soll der dringende Verdacht genügen, dass sich am Aufent-
haltsort der betreffenden Person abstrakt solche Straftaten ereignen, weshalb ein konkreter
Verdacht gegen die zu identifizierende Person nicht erforderlich ist; unter diesem Kontext ist
64
VwGH 29.07.1998 97/01/0448
65
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 114
66
§ 35 SPG 1995 BGBl. Nr. 566/1991 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/2017
67
vgl VwGH 29.06.2000 96/01/1071
68
vgl Keplinger/Pühringer, Sicherheitspolizeigesetz Praxiskommentar (2016) S 115
69
§ 35 SPG 1995 BGBl. Nr. 566/1991 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/2017
23die in der Gegenschrift wiedergegebene Passage aus der Regierungsvorlage 1990 zu verste-
hen, wonach an diesen Orten auch unterhalb der Schwelle des konkreten Verdachtes Identi-
tätskontrollen vorgenommen werden können. Der konkrete Verdacht auf die Begehung mit
beträchtlicher Strafe bedrohter Handlungen ist aber auch für eine Identitätsfeststellung nach
§ 35 Abs. 1 Z. 2 SPG nicht entbehrlich.“70
Es wird daher an einen bestimmten Ort und nicht an eine Person angeknüpft. Beispiele aus
der Praxis dazu wären einschlägige U-Bahnstationen bzw deren umliegende Bereiche, wel-
che von diversen Straftätern als Drogenumschlagplätze genutzt werden.
Anders als nach § 35 SPG ist unter Feststellung der Identität nach der StPO die Ermittlung
und Feststellung von (personenbezogenen) Daten, die eine Person unverwechselbar kenn-
zeichnen, zu verstehen.71
Die Kriminalpolizei ist ermächtigt, zur Identitätsfeststellung die Namen einer Person, ihr Ge-
schlecht, ihr Geburtsdatum, ihren Geburtsort, ihren Beruf und ihre Wohnanschrift zu ermit-
teln. Die Kriminalpolizei ist auch ermächtigt, die Größe einer Person festzustellen, sie zu foto-
grafieren, ihre Stimme aufzunehmen und ihre Papillarlinienabdrücke abzunehmen, soweit
dies zur Identitätsfeststellung erforderlich ist.72
Voraussetzung für die I-Feststellung nach der StPO ist eine der drei folgenden Alternativen.
Nämlich wenn auf Grund bestimmter Tatsachen angenommen werden kann, dass
- Der Betroffene an einer Straftat beteiligt ist,
- Der Betroffene über die Umstände der Begehung der Straftat Auskunft geben kann,
oder
- Der Betroffene Spuren hinterlassen hat, die der Aufklärung dienen könnten.73
Das bedeutet, dass nicht nur der unmittelbare Täter, sondern auch Beitragstäter oder Be-
stimmungstäter, Zeugen und auch das Opfer zur Identitätsfeststellung verpflichtet sind. So-
mit darf auch in Rechte von Personen eingegriffen werden, die mit der Tat selbst nichts zu
tun haben. Sogar wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die betroffene Person unbetei-
ligt und unschuldig war, war die I-Feststellung rechtmäßig, wenn es zuvor Gründe für eine
gegenteilige Annahme gab. Auch sogenannte Gelegenheitspersonen, also solche die eben-
falls Spuren am Tatort hinterlassen haben, wie beispielsweise Familienangehörige, können
zur I-Feststellung aufgefordert werden, da es für die Abgrenzung von Täterspuren notwendig
sein kann.
70
VwGH 29.07.1998 97/01/0448
71
Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 169
72
§ 118 StPO BGBl. Nr. 631/1975 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 19/2004
73
Birklbauer/Keplinger,Strafprozessordnung 1975 Polizeiausgabe (2016) S 170
24Sie können auch lesen