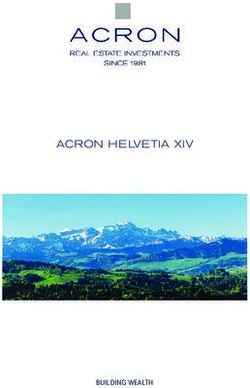Sozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Erstveröffentlichung in "Allemagne d'aujourd'hui" 2021/1 (Nr. 235)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Dr. Fritz Felgentreu
Mitglied des Deutschen Bundestages
Sozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1 (Nr. 235)
Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der deutschen Sozialdemokratie befindet sich in einer
Krise – allerdings in einer Krise, bei der nicht lichterloh die Hütte brennt, sondern die als
Schwelbrand so langsam um sich greift, dass wir uns daran gewöhnt haben, mit ihr zu leben. Ein
Teil der Krise ist sogar in der Struktur der SPD verankert: Seit es sie gibt, entwickelt die SPD ihre
Positionen zu Sicherheit und Verteidigung im innerparteilichen Streit zwischen Realpolitik und
Pazifismus. Der kreative Prozess, der dadurch in Gang gehalten wird, hat unserem Land nicht die
schlechtesten Köpfe geschenkt: Julius Leber, Helmut Schmidt, Georg Leber, Peter Struck – es
waren Sozialdemokraten, die das verteidigungspolitische Denken der deutschen Demokratie und
die Bundeswehr nachhaltig geprägt haben.
Und wie so viele Krisen ist auch die gegenwärtige ein Kind des Erfolges, sogar eines
überwältigenden Erfolges. In der SPD und weit darüber hinaus herrscht ja Konsens darüber, dass
die Entspannungspolitik, die Anfang der Siebziger Jahre durch Willy Brandt, Walter Scheel und
Egon Bahr durchgesetzt wurde, eine unverzichtbare Voraussetzung für die friedliche
Wiedervereinigung Deutschlands und Europas zwanzig Jahre später gewesen ist. Zum 50. Mal
jährt sich in diesen Tagen der ikonische Moment des Kniefalls von Warschau. Willy Brandts
große Geste hat sich tief ins kollektive Gedächtnis nicht nur der deutschen Linken gebrannt, als
Sinnbild eines friedfertigen Deutschlands, das angesichts der Schrecken der Vergangenheit
Versöhnung und gute Nachbarschaft erstrebt und das für diese Haltung mit der
Wiederherstellung der nationalen Einheit und Souveränität in Frieden und Freiheit belohnt
worden ist.
Unter der Wirkungsmacht dieses Bildes ist die Erinnerung daran verblasst, dass es nicht die
Entspannungspolitik alleine war, die letztlich zur Selbstaufgabe der Sowjetunion und ihres
Vasallensystems geführt hat. Unter dem Bundeskanzler Willy Brandt wuchs der heute als
„NATO-Quote“ umstrittene Anteil des Bruttoinlandsprodukts, das für Verteidigung aufgewendet
wurde, von 3,1 auf 3,6 Prozent. Brandt reichte Breschnjew die Hand zur Entspannung bewusst
aus einer Position der Stärke heraus und er konnte mit Verweis auf den substanziellen deutschen
Beitrag zur gemeinsamen Abschreckung der NATO auch Kritik aus Washington zurückweisen.
Und die Endphase des Kalten Krieges wurde weniger durch die Friedensbewegung als durch den
NATO-Doppelbeschluss eingeläutet, dessen Vater, Helmut Schmidt, den strategischen Erfolg auf
internationaler Ebene mit dem Verlust seines Rückhalts in der eigenen Partei bezahlt hat.
Die historische Lehre aus diesen Zusammenhängen, die gewissermaßen zu sozialdemokratischem
Gemeingut geworden ist, läuft jedoch weitestgehend auf die Verklärung allein der
Entspannungsidee hinaus. Dank ihr nimmt die Sozialdemokratie Deutschland nur allzu gern als
ein von Freunden umgebenes Land wahr, das mit der Kraft seiner eigenen positiven Erfahrung
global zur friedlichen Beilegung so gut wie aller Konflikte beitragen kann: Denn eigentlich muss
24.03.2021
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Telefon: +49 30 227-77847, Fax: +49 30 227-76847, fritz.felgentreu@bundestag.deSozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 2
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
sich doch auf allen Seiten nur die Vernunft durchsetzen! Dass wir uns sogar als Regierungspartei
eher widerwillig mit Themen wie Rüstung, Auslandseinsätze oder Waffenexporte befassen, ist
eine Folge dieser historisch gewachsenen Mentalität.
Zugleich aber spüren wir jeden Tag, dass die Lehren, die wir aus dem Erfolg der
Entspannungspolitik gezogen haben, nicht mehr ausreichen, um auch die Stürme einer neuen
Zeit in Frieden und Sicherheit zu bestehen. Frank-Walter Steinmeiers Metapher von der „aus den
Fugen geratenen“ Welt bringt das sozialdemokratische Unbehagen perfekt zum Ausdruck. Das
Bild ist auch deshalb so passend, weil es noch keinen Hinweis darauf enthält, wie wir das
Zerbrochene wieder zu fügen gedenken.
Auftrag und Lage der Bundeswehr und der wehrtechnischen Industrie
Das knappe Vierteljahrhundert zwischen dem Ende des Kalten Krieges und dem russischen Krieg
gegen die Ukraine war in Europa überwiegend von Kooperation geprägt (wobei die historische
Analyse die zersetzenden Folgen der Balkankriege im Zerfall Jugoslawiens nicht unterschätzen
darf). In dieser auch für Planungsprozesse langen, nachhaltig wirksamen Phase hat die
Bundeswehr, wie andere Armeen auch, Schritt für Schritt ihre Fähigkeiten abgebaut, sich im
Rahmen von Bündnis- und Landesverteidigung auf dem Schlachtfeld durchzusetzen und
flächendeckende territoriale Kontrolle auszuüben. Stattdessen wuchsen die Fähigkeiten in den
Bereichen Krisenintervention und Friedenssicherung, die für Auslandseinsätze von
entscheidender Bedeutung sind.
Im Ergebnis sank der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bundeshaushalt kontinuierlich ab.
Die Bundeswehr schrumpfte, mit entsprechenden Folgen auch für die Wirtschaftlichkeit und
Innovationsfähigkeit der wehrtechnischen Industrie. Dennoch ist es auf wichtigen Feldern bisher
gelungen, die Innovationsfähigkeit deutscher Hersteller zu erhalten – zum Beispiel bei kleinen U-
Booten, in der Elektronik und bei den Landsystemen. Dazu trägt neben Neuentwicklungen wie
dem GTK Boxer auch der noch immer nicht einsatzreife Schützenpanzer Puma bei, anhand
dessen trotz aller Probleme technisches Knowhow erhalten und weiterentwickelt worden ist.
Mit den Reformen der Jahre 2011 und 2012 wurde, wie sich im Rückblick gezeigt hat, das Maß
eines vertretbaren Abbaus überschritten. Die in der Sache nicht unbegründete, aber überstürzte
Reform zur Abschaffung der Wehrpflicht hat das Rekrutierungspotenzial der Bundeswehr bis
heute nachhaltig geschwächt. Noch schwerer wiegen die negativen Folgen anschließender
Sparmaßnahmen. Am schlimmsten: Die Ersatzteilbevorratung wurde weitgehend eingestellt, was
wenig später einen massiven Einbruch der Einsatzbereitschaft von Hauptwaffensystemen zur
Folge hatte. Auch Einzelentscheidungen im Detail machen uns heute zu schaffen: Dass zum
Beispiel die Fähigkeit zur Heeresflugabwehr aufgegeben wurde, erscheint doppelt fragwürdig,
wenn wir den kriegsentscheidenden Einsatz bewaffneter Drohnen durch Aserbaidschan im
Herbstkrieg in Berg-Karabach analysieren.
Auf dem Tiefpunkt der Entwicklung bewegte sich die Bundeswehr 2013 auf eine Personalstärke
von 170.000 Soldatinnen und Soldaten zu. Der Dienstalltag war von technischen Ausfällen beim
Gerät und Versorgungsengpässen bei der persönlichen Ausstattung geprägt. Dennoch war die
Bundeswehr stets in der Lage, ihre Dauerverpflichtungen im Auslandseinsatz und ihre
punktuellen Verpflichtungen bei Übungen zu erfüllen.Sozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 3
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
Die große europäische Lageänderung im Februar 2014, als Russland die Krim besetzte und später
annektierte und im Osten der Ukraine einen Krieg begann, der bis heute allein auf ukrainischer
Seite fast 14.000 Menschen das Leben gekostet hat und immer noch andauert, ging in
Deutschland mit einem Regierungswechsel weg von der konservativ-liberalen hin zur so
genannten Großen Koalition einher. Seit 2014 trägt die SPD in einer Koalition mit den
Unionsparteien wieder Regierungsverantwortung.
2014 galt es nicht nur, strategische Konsequenzen aus der neuen Bedrohungsanalyse abzuleiten.
Als Hintergrundrauschen musste und muss die Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf die
technischen Innovationen der Digitalisierung, der Raumfahrt und der Künstlichen Intelligenz
reagieren. Hinzu kamen akute Krisen wie die Herausforderung durch das mörderische IS-Kalifat
in Syrien und im Nordirak oder die Staatskrise in Mali, die sich zu einer Dauerkrise der Sahel-
Region auszuwachsen droht. Es waren noch Krisen wie diese, auf die sich der so genannte
Münchener Konsens bezogen hatte, der sich in den Reden von Bundespräsident Johannes Gauck,
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Bundesverteidigungsministerin Ursula von
der Leyen bei der Münchener Sicherheitskonferenz im Januar 2014 manifestierte.
Die Große Koalition hat auf alle diese Herausforderungen gemeinsame Antworten gefunden. Von
fundamentaler Bedeutung ist dabei, dass die Bündnis- und Landesverteidigung als Auftrag der
Bundeswehr im Weißbuch von 2016 wieder auf die gleiche Stufe wie die Auslandseinsätze
gestellt worden ist. Diese Grundsatzentscheidung hat unmittelbare Folgen für das planerische
Fähigkeitsprofil der Streitkräfte. Ohne nennenswerte Vergrößerung soll die Bundeswehr in
Zukunft nicht nur in Auslandseinsätzen voll einsatzbereit sein, sondern auch zur
Rückversicherung unserer Verbündeten und zur Abschreckung potenzieller Angreifer auf die
NATO oder die Europäische Union. Um dieses Ziel zu erreichen, sind unter den Bedingungen
kontinuierlicher Modernisierung deutliche Fortschritte bei der Ausstattung der Streitkräfte mit
Personal, Waffen und Gerät erforderlich. Das alles kostet viel Mühe und viel Geld. Aber: Unsere
verteidigungspolitische Lage duldet kein freundliches Desinteresse mehr.
Die Haltung der SPD im politischen Alltag
Wie immer in ihrer Geschichte ist die SPD ihrer Verantwortung allen Widerständen zum Trotz in
vollem Umfang gerecht geworden. Seit die SPD wieder mitregiert, ist der Verteidigungshaushalt
gegenüber den Planungswerten für 2014 bis 2021 um fast 50 % aufgewachsen. Wir haben in Mali
im Rahmen des UN-Mandates MINUSMA und der EU-Ausbildungsmission Mitverantwortung für
die Stabilisierung von Staat und Gesellschaft übernommen, ohne bestehende Verpflichtungen
wie zum Beispiel die Einsätze in Afghanistan und im Kosovo zu vernachlässigen. Zur
Bekämpfung des IS ist Deutschland Teil einer internationalen Allianz geworden, der die
Bundeswehr Luftaufklärungsfähigkeiten (Recce-Tornados und AWACS) und Luftbetankung zur
Verfügung stellt. Die Bundeswehr beteiligt sich an der Ausbildung der irakischen
Regierungsstreitkräfte und der Peschmerga-Miliz in der kurdischen Autonomieregion. Durch
großzügige Militärhilfe (Panzerabwehrrakete Milan und Handfeuerwaffen) leistete Deutschland
einen wesentlichen Beitrag dazu, dass es den Kurden im Irak gelungen ist, den IS
zurückzuschlagen. Deutschland stellt in Litauen als einzige europäische Rahmennation ein
verstärktes Kampftruppenbataillon für die Enhanced Forward Presence der NATO an ihrer
Ostflanke, stellte 2019 die sofort verlege- und einsatzfähige Brigade für die Very high readiness
Joint Task Force (VJTF) und wird das auch 2023 und 2027 wieder tun.Sozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 4
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
Um die notwendigen inneren Reformprozesse der Bundeswehr als einer modernen
Freiwilligenarmee zu unterstützen, haben wir umfangreiche Maßnahmenpakete zur Steigerung
der Attraktivität der Streitkräfte, zur Verbesserung der Einsatzversorgung, zu Kranken- und
Rentenversicherung ehemaliger Zeitsoldaten und zur besseren Vereinbarkeit von Dienst und
Familienleben beschlossen. Gleichzeitig haben wir das Bundesamt für den Militärischen
Abschirmdienst gestärkt, um besser gegen Extremisten gewappnet zu sein, die die Bundeswehr
unterwandern wollen. Es bleibt uns ein besonderes Anliegen, das Selbstverständnis der
Soldatinnen und Soldaten als Staatsbürger in Uniform zu stärken, für die ihr Diensteid auf die
Bundesrepublik Deutschland als dem Staat der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mehr
ist als nur leere Worte.
Auf internationaler Ebene tragen wir die Anstrengungen mit, innerhalb der Europäischen Union
zu tragfähigen Strukturen engerer Zusammenarbeit zu finden. Die Permanente Strukturierte
Zusammenarbeit (PESCO) und der Europäische Verteidigungsfonds (EDF) können sich zu
Plattformen entwickeln, die unsere Armeen und Industrien zu dauerhafter und nachhaltiger
Kooperation befähigen. Mit Frankreich haben wir zwei ehrgeizige Großvorhaben auf den Weg
gebracht, mit dem Ziel, zur Mitte des Jahrhunderts über voll digitalisierte und mit ihrem
militärischen Umfeld voll vernetzte Luft- und Landsysteme aus europäischer Produktion zu
verfügen (FCAS und MGCS).
Wie erfolgreich alle diese Anfänge letztlich sein können, wird sich zeigen. Jedenfalls ist auch
hier nichts daran gescheitert, dass die SPD sich als Regierungspartei naiv an Idealen der
Entspannungspolitik festgeklammert und sich notwendigen Entscheidungen verweigert hätte.
Gleichwohl erweckt die SPD immer wieder den Eindruck, als würde sie jede
verteidigungspolitische Entscheidung nur „der Not gehorchend“ fällen, „nicht dem eignen
Triebe.“ Die Erfolge unserer soliden und an den Erfordernissen orientierten Politik werden
deshalb oft nicht der SPD zugute gehalten. Diskussionen mit Soldatinnen und Soldaten bringen
einerseits immer wieder eine gute Verankerung der SPD insbesondere unter dienstälteren
Unteroffizieren und im Offizierskorps zutage, zeigen andererseits aber auch, wieviele
Soldatinnen und Soldaten die Sorge haben, dass die SPD ihnen eigentlich misstraut oder
jedenfalls wenig Sympathie oder Verständnis für ihre Bedürfnisse aufbringt. Pauschal
Bundeswehr-kritische Äußerungen aus den Reihen der SPD werden stets genau registriert.
Die leidigen zwei Prozent
Ein Thema, an dem sich diese Problematik in besonderer Weise kristallisiert, ist die Debatte um
das Zwei-Prozent-Ziel der NATO, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholt. Auf dem
NATO-Gipfel 2014 in Wales wurde im Sinne einer Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten
festgelegt, dass alle Mitgliedstaaten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung
aufwenden. Da Deutschland damals eine NATO-Quote von lediglich etwas über 1,2 Prozent
erreichte, erschienen die notwendigen Steigerungen als so exorbitant hoch, dass es leicht war,
gegen die Absprache zu polemisieren.
Eine merkwürdige Dynamik setzte ein: Die Union machte sich das Zwei-Prozent-Ziel flugs zu
eigen und forderte vom Koalitionspartner SPD, sich dazu zu bekennen. Dass das unionsgeführte
Bundesverteidigungsministerium in den vorangegangenen Jahren nicht einmal in der Lage
gewesen war, die knappen für Beschaffung vorgesehenen Mittel auch tatsächlich dafürSozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 5
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
auszugeben, spielte bei ihrer Forderung nach mehr Geld für die Bundeswehr keine Rolle.
Genauso abwegig war die Unionskritik an der mittelfristigen Finanzplanung der
Bundesregierung, die in einem Fünfjahres rahmen Jahr für Jahr davon absieht, im
Verteidigungshaushalt eine Steigerungskurve vorzusehen, weil das nach dem planerischen
Regelwerk nur auf Kosten der anderen Ministerien möglich wäre. Die Verantwortung für die
Aufstellung des mittelfristigen Finanzplans trägt das 2014 bis 2017 ebenfalls unionsgeführte
Finanzministerium, verabschiedet wird er vom ganzen Kabinett. Gleichwohl machen
Verteidigungs- und Außenpolitiker der Union seit 2014 regelmäßig den Koalitionspartner SPD
dafür verantwortlich, dass der mittelfristige Finanzplan keine Annäherung an das Zwei-Prozent-
Ziel vorsieht. Und schließlich suchen die frenemies aus CDU und CSU in der SPD Zwietracht zu
säen, indem sie die deutsche Zustimmung zum Zwei-Prozent-Ziel innerhalb der NATO auf den
damaligen sozialdemokratischen Außenminister Frank-Walter Steinmeier zurückführen.
Ergebnis und Siegerehrung: Die Rechnung ging auf. Denn kaum lag das Zwei-Prozent-Ziel auf
dem Tapet, wurde es aus den Reihen der SPD im Geist der Entspannungspolitik auch schon als
ein maßloses Instrument der Aufrüstung zurückgewiesen. Der politische Mobilisierungseffekt
war zwiespältig: Obwohl die Union die Reformen zu verantworten hatte, durch die die
Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die Leistungsfähigkeit des Beschaffungswesens massiv
gelitten hatten, galt in weiten Kreisen auf einmal die SPD als die politische Kraft, die die Wende
zum Besseren verhinderte. Das entschiedene „Nein!“ zum Zwei-Prozent-Ziel, das diverse
Wortführer dem Koalitionspartner entgegendonnerten, hatte für die Partei auch positive
Mobilisierungseffekte: In der Regierung erschien jetzt die SPD als die Stimme, die auf Dialog und
Vertrauensbildung statt Aufrüstung setzte und den Werten der Entspannungspolitik gerade in
schwierigen Zeiten die Treue hielt.
Mit der Realität hatte und hat das alles nicht das geringste zu tun. Das SPD-geführte Auswärtige
Amt arbeitet seit 2014 hart daran, die geschlossene europäische Haltung gegenüber Russland
auch von Ländern wie Ungarn oder Zypern nicht aufweichen zu lassen. Deutschland ist, wie
oben erwähnt, die einzige europäische Rahmennation bei der Stärkung der Abschreckung an der
NATO-Ostflanke. Seit 2014 wächst der Verteidigungshaushalt kontinuierlich dem Zwei-Prozent-
Ziel entgegen. Und ein schnelleres Wachstum würde der politisch von der Union gesteuerte
Beschaffungsapparat, der schon jetzt immer wieder überfordert ist, auch nicht verkraften. Noch
einmal zur Erinnerung: Auf dem Höhepunkt der Entspannungspolitik lag die Verteidigungsquote
der Bundesrepublik Deutschland bei 3,6 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (die DDR brachte
über 5 Prozent für die NVA auf).
Dass Deutschland 2020 schon früher als geplant eine NATO-Quote von 1,65 Prozent erreichen
wird, hängt im übrigen nicht mit Entscheidungen der Koalition zusammen, sondern mit der
inhärenten Unsinnigkeit des vereinbarten Maßstabs, der lediglich einer politischen, keiner
militärischen Logik folgt. Die Wirtschaftskraft eines Landes sagt ja zunächst einmal nichts über
die Fähigkeiten seiner Streitkräfte aus. Es ist nachvollziehbar, dass die NATO einen Maßstab für
eine gerechte Lastenteilung braucht. Wenn sie dabei aber komplett von den beigesteuerten
Fähigkeiten abstrahiert, ergibt sich ein absurder Effekt: Das arme Griechenland erfüllte in der
Finanzkrise seine Verpflichtungen, weil seine Armee langsamer schrumpfte als die Wirtschaft.
So schnellte trotz Fähigkeitsverlust die griechische NATO-Quote in die Höhe. Deutschland
hingegen wurde für seinen langsamen Fähigkeitsaufbau kritisiert, weil das Zwei-Prozent-Ziel
immer noch in weiter Ferne zu sein schien. Nur im Corona-Jahr 2020 machen wir plötzlich einen
Riesenschritt in Richtung Zwei-Prozent-Ziel, allerdings ohne auch nur einen Cent mehr fürSozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 6
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
Verteidigung auszugeben: Die Pandemie lässt die Wirtschaft schrumpfen, ergo steigt die NATO-
Quote.
Zumindest die SPD-Abgeordneten im Verteidigungsausschuss haben aus dieser Analyse den
Schluss gezogen, die Debatte um das Zwei-Prozent-Ziel zu ignorieren. Wir haben ein Hundert-
Prozent-Ziel für die Bundeswehr: Unsere im historischen Maßstab nach wie vor sehr kleine
Armee soll zu hundert Prozent mit Personal, Waffen und Gerät ausgestattet werden, damit sie
ihren Auftrag erfüllen kann und die Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst als motivierende
Erfahrung erleben – Stichwort Attraktivität der Freiwilligenarmee. Mit dieser Forderung kann
sich sowohl die Bundeswehr als auch die große Mehrheit der SPD-Mitglieder anfreunden. Wie
groß der Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist, den eine solche Armee kosten würde, ist
demgegenüber zweitrangig. Ich bin aber sicher: Die NATO wird keinen Grund haben, sich über
den deutschen Beitrag zur Lastenteilung zu beklagen.
An dieser Stelle ist ein Zwischenfazit möglich. Als Regierungspartei wird die SPD ihrer
Verantwortung gerecht. Wir sind in jeder Lage entscheidungsfähig. Seit die SPD wieder regiert,
hat die Bundeswehr ihre Talsohle durchschritten. Die SPD steht für internationale
Zusammenarbeit und die Bereitschaft, weltweit Mitverantwortung für Frieden und Sicherheit zu
übernehmen. Der größte Erfolg dieser Politik ist die Zerschlagung des IS-Kalifats, zu der
Deutschland durch die Beteiligung an der Counter-Da'esh-Allianz und die Militärhilfe für die
Peschmerga einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Wir sind zur Fortsetzung dieser Politik
bereit und in der Lage.
Ein sozialdemokratischer Blick auf Deutschlands und Europas Sicherheit
Wenn wir aber heute über die Feststellung, dass die Welt aus den Fugen geraten sei, noch nicht
weit hinausgekommen sind, dann wird auch das Defizit oder eben die Krise
sozialdemokratischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik deutlich. Wir haben auf die
veränderte Weltlage noch keine kohärente Antwort gefunden, obwohl unterschiedliche Ansätze
zu Antworten lebhaft diskutiert werden. Die Konzepte, mit denen der Kalte Krieg und die
Spaltung Europas überwunden wurden, haben für die Sozialdemokratie weiterhin eine große
Strahlkraft. Sie lassen sich aber nicht 1:1 in die Gegenwart übertragen.
Das beginnt mit dem Verhältnis zu Russland. Die historische Erfahrung der Sozialdemokratie ist,
dass das vertrauensvolle Gespräch von Führungspersönlichkeiten mit großer Autorität positive
Entwicklungen in Gang bringen kann: Brandt und Breschnjew, Kohl und Gorbatschow, Schröder
und Putin – sie alle machten Politik auf der Basis persönlichen Vertrauens. Auch deshalb setzt
die SPD im Konflikt mit Russland weiterhin auf Dialog. Diejenigen, die den Dialog tatsächlich zu
führen versuchen, stellen aber oft sehr schnell fest, dass zu einem echten Dialog immer zwei
gehören. Gemeinsam in einem Raum zu sitzen ist zu wenig. Die Methode der Vergangenheit war
es, die konfliktträchtigeren Bereiche erst einmal auszuklammern und Themenfelder zu
identifizieren, auf denen Fortschritt möglich ist, sodass der Erfolg von Gesprächen Vertrauen
wachsen lässt. Diese Methode funktioniert gegenwärtig kaum, vor allem, weil die russische Seite
daran kein echtes Interesse zu haben scheint.
Die geübte Praxis hat der SPD in den letzten Jahren besonders in Polen und im Baltikum
Misstrauen eingetragen, weil wir nicht aufhören, einem als aggressiv wahrgenommenen RusslandSozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 7
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
Gesprächsangebote zu machen. Die Rolle des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder mit
seiner persönlichen Freundschaft zu Wladimir Putin und seinem Engagement für den Bau der
Gaspipeline Nordstream 2 tut ein übriges, um die auf Dialog orientierte Russlandpolitik der SPD
zu diskreditieren. Sie bleibt trotzdem richtig, weil sie schon jetzt die eine oder andere kleine
Lösung erleichtert. Langfristig bietet sie die Chance, dass wir in einer Situation, in der Moskau
seine Rolle in der Welt überdenkt, über persönliche Kontakte verfügen, die dann schnell
fruchtbar gemacht werden können. Wichtig ist nur, dass die Russlandpolitik der SPD stets von
unzweideutigen Beweisen der Bündnistreue und der Zuverlässigkeit gegenüber den NATO- und
EU-Ländern begleitet wird, die zwischen Deutschland und Russland liegen.
Aber so wichtig und identitätsstiftend die Auseinandersetzung mit Russland für die SPD auch
ist: Die großen strategischen Fragen werden heute vor allem im Verhältnis zu den USA, zur
Europäischen Union (mit besonderem Akzent auf Frankreich) und zu China aufgeworfen. Hier ist
noch wenig geklärt.
Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA hat eine Entwicklung augenfällig werden
lassen, die sich bereits seit längerem vollzieht. Dabei könnte es falsch sein, in Obamas viel
zitiertem pivot to Asia eine bewusst gewählte Alternative zu einer auf Europa ausgerichteten
Interessenpolitik zu sehen. Wir Europäer haben uns daran gewöhnt, für die USA wichtig zu sein,
weil wir es in den letzten achtzig Jahren immer waren. Fast drei Generationen: Das ist im
menschlichen Leben eine so lange Zeit, dass die Versuchung nahe liegt, die in diesem Zeitraum
unveränderten Verhältnisse für eine unverrückbare Gewissheit zu halten, wie den Frieden
zwischen den großen Ländern Europas. Auch dort wäre die Gewissheit trügerisch. Die
geostrategische Lage der Vereinigten Staaten prädestiniert sie nicht zu einem europäischen
Engagement. Ökonomisch sind sie nicht in dem Maße auf einen florierenden interkontinentalen
Handel angewiesen, dass sie nicht auch in Autarkiebestrebungen oder mit anderen Partnern
einen größeren Vorteil suchen könnten. Die engsten Bande zwischen Europa und den USA sind
geschichtlicher Natur. Sie manifestieren sich in gemeinsamen Werten und ähnlichen politischen
Systemen. Ob sie alleine ausreichen, um Nordamerikas und Europas Sicherheitsinteressen
zusammenzuhalten, ist nicht sicher.
Es ist Donald Trumps Verdienst, uns Europäern klar gemacht zu haben, dass der Fortbestand der
NATO kein Naturgesetz, sondern an die Interessen der USA gebunden ist. Diese Konstante der
transatlantischen Beziehungen bleibt bestehen, auch wenn ein anderer Präsident Europa mit
freundlicheren Absichten und in verbindlicherem Ton gegenübertritt. Mittel- und langfristig
müssen wir aus der Präsidentschaft Trumps die Lehre ziehen, dass sie sich jederzeit wiederholen
kann und dass ein populistischer Präsident mit nationalistischer Agenda der NATO den Boden
unter den Füßen wegziehen könnte.
Auf diese Erkenntnis eine für alle akzeptable europäische Antwort zu finden, ist eine
Herkulesaufgabe. Sie sozialdemokratisch zu interpretieren, eine weitere. Die schnelle Antwort
betont die Bedeutung der NATO für Europas Sicherheit. Die Bereitschaft, Aufgaben- und
Lastenteilung ernster zu nehmen als in der Vergangenheit, ist gewachsen, ebenso das Verständnis
dafür, dass die USA in Europa Entlastung brauchen, um mehr Kraft in die Konfrontation mit
China lenken zu können. Wenn das so umgesetzt wird, wird allerdings auch der Anspruch
kleinerer Bündnispartner auf Mitsprache wachsen. Wie die benevolente Hegemonialmacht USA
sich darauf einstellt, wird auch interessant.Sozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 8
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
Aber schon jetzt reißen überall dort, wo die USA nicht mehr sind, Löcher auf, die zumindest
Europa bisher nicht stopfen kann. Das Machtvakuum in Syrien füllen Russland, die Türkei und
der Iran, das in Libyen Russland, die Türkei und andere arabische Mächte. Die Entlastung der
USA (die in Syrien und Nordafrika eher wie das Abschütteln einer lästigen Zusatzaufgabe durch
die USA wirkt) funktioniert also bisher nicht so, dass Europa in seiner unmittelbaren Umgebung
die gleiche Sicherheit wie zur Zeit des amerikanischen Engagements genösse. Zwei
Sozialdemokraten haben daraus eindeutige Schlüsse gezogen: Jens Stoltenberg, der mit aller Kraft
für den Zusammenhalt der NATO kämpft, und Josep Borrell, der sagt, Europa müsse lernen, die
Sprache der Macht zu sprechen.
Wie stellt sich die deutsche Sozialdemokratie dazu? Bisher folgen wir weder dem einen noch
dem anderen. Ein eigenes Konzept ist aber selbst in seinen Konturen noch kaum zu erahnen.
Nukleare Teilhabe als Prüfstein
Gegenüber der NATO steht die SPD vor einer Bewährungsprobe. Der Ablauf der Nutzungsdauer
des Mehrzweck-Kampfflugzeugs Tornado steht bevor und damit die Frage im Raum, ob und wie
die Bundeswehr die Fähigkeit zum Transport amerikanischer Atomwaffen ersetzen wird. Damit
steckt die SPD in einem Dilemma.
Programmatisch scheint die Antwort klar: Die SPD steht für eine atomwaffenfreie Welt, also auch
für ein atomwaffenfreies Deutschland. Nicht ganz so klar ist der Weg dahin: Ein einseitiger
Verzicht Deutschlands auf die Nukleare Teilhabe der NATO wäre im Sinne der SPD-
Programmatik zwar konsequent. Er würde aber den Zusammenhalt der NATO auf eine schwere
Probe stellen, denn die Nukleare Teilhabe ist ein Garant dafür, dass sich die
Sicherheitsinteressen Nordamerikas und Europas nicht voneinander entkoppeln lassen. Wenn
Deutschland keinen Beitrag mehr zur nuklearen Abschreckung leistet, könnten die
ostmitteleuropäischen Länder, deren historische Erfahrung ihr Vertrauen in europäische
Sicherheitsgarantien in überschaubaren Grenzen hält, ihr Heil in einem engeren bilateralen
Verhältnis zu den USA suchen. Die Saat der Trump-Jahre ginge weiter auf.
Liest man das Hamburger Programm der SPD etwas genauer, dann erweist es sich allerdings auch
als ein Manifest des Multilateralismus. Einsame Entscheidungen, zumal in Grundsatzfragen wie
der der Nuklearen Teilhabe, widersprechen diesem Ansatz diametral. Deshalb war es bisher
immer die Politik der SPD, die eigenen Ziele in die Politik des Bündnisses einzubringen und so
für Fortschritt im Sinne von Dialog, Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und Abrüstung zu
werben, mit dem Ziel eines Kontinents ohne Atomwaffen. In der Logik dieser Politik läge es, die
Nukleare Teilhabe nicht infrage zu stellen, sondern die Beschaffung eines Tornado-
Nachfolgesystems mitzutragen.
Und so befinden wir uns derzeit in einer aus Strategielosigkeit geborenen Aporie: Die
Zustimmung zur Beschaffung eines Tornado-Nachfolgers auch für die Nukleare Teilhabe stößt
auf erbitterte Kritik aus den eigenen Reihen, die sie als Verrat am Ziel eines atomwaffenfreien
Europas empfinden. Der unilaterale Ausstieg kann die NATO in empfindlichster Weise
schwächen und statt zu mehr Frieden zu mehr Konfrontation und zu weniger Stabilität in Europa
führen. Definitiv wird er den deutschen Einfluss innerhalb der NATO verringern. Der
verständliche Impuls schließlich, das Problem durch Vertagung auszusitzen, wirkt nur dannSozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 9
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
entlastend, wenn wir die Antwort auf die für uns so quälende Frage einer Regierung vererben, an
der wir nicht beteiligt sind. Das wollen wir natürlich erst recht nicht. Der technische Zustand des
Systems Tornados setzt einer solchen Politik ohnehin die Grenzen naher Endlichkeit.
Ausweg Europa?
Unter der Prämisse, dass die NATO für die Sicherheit Europas für unabsehbare Zeit das Rückgrat
bleiben muss, hat die Erfahrung der letzten Jahre der Debatte um Europas eigene Verantwortung
neuen Schwung gegeben. Auch hier steht eine klare Positionierung der SPD aus. In
Wahlprogrammen beschwören wir die „Friedensmacht“ der EU, die sich nicht nur auf
militärische Mittel gründen dürfe. Was das konkret bedeuten soll, verliert sich im Vagen. Am
konkretesten werden wir da, wo die SPD im Zusammenhang mit Auslandeinsätzen auf den
vernetzten Ansatz und die positiven, friedensstiftenden Auswirkungen einer feministischen
Außenpolitik setzt, übrigens völlig zu recht. Für den europäischen Kontinent selbst haben wir
aber bisher über die allgemein wohlwollend-kritische Begleitung neuer Institutionen wie PESCO
und des EDF hinaus keine eigenen Zielvorstellungen entwickelt. Irgendwie soll das alles einmal
auf eine europäische Armee hinauslaufen, ohne dass wir genau sagen könnten, was das
eigentlich ist und welche Aufgaben sie hätte.
Frankreich ist da weiter. Das strategische Denken in Paris ist eine Provokation und ein Stimulus
für die SPD, auch da, wo es uns hilft zu verstehen, was wir nicht wollen. Der von Präsident
Macron geprägte und gesetzte Begriff der strategischen Autonomie bleibt umstritten: Als
Messlatte für das level of ambition einer souveränen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist er
über jede Kritik erhaben. Soweit sich damit aber die Vorstellung verbindet, dass Europa
sicherheitspolitisch aus dem Schatten der USA heraustreten könnte, scheint er von europäischer
Seite die NATO infrage zu stellen, und das will niemand.
Aus dem französischen Ansatz ergibt sich Konkretes: Die Großprojekte FCAS und MGCS sind
nicht einfach nur Rüstungsvorhaben, sie sind auch die Manifestation einer strategischen
Erwartung des wichtigsten Partners an Deutschland. Wer Ohren hat zu hören, vernimmt deutlich
den Ruf aus Paris, dass auch der militärische Schiffsbau auf französisch-deutscher Grundlage
europäisch konsolidiert werden müsste. Über die Nukleare Teilhabe bietet Frankreich das
Gespräch an.
Gerade der enorme Respekt für Frankreichs militärische und strategische Fähigkeiten zeigt uns
auch, an welcher Stelle wir zu abweichenden Einschätzungen kommen. Frankreich sieht sich
schon jetzt zur Führungsmacht befähigt, die mit der notwendigen materiellen Unterstützung zum
Beispiel aus Deutschland viele von den Aufgaben übernehmen könnte, die heute noch von den
USA getragen werden. Das französische Modell für europäische Sicherheit gleicht einer Zwiebel,
mit Paris im Herzen und konzentrischen Schalen darum herum, die auch über die Grenzen
Europas hinausreichen, wenn es dort, etwa in Nordafrika, die nötigen Partner gibt, um
gemeinsam für Sicherheit und Stabilität zu sorgen.
Die SPD wird bei gemeinsamer Sicherheit für die Europäische Union immer eher das Bild einer
Walnuss im Sinn haben, deren harte Schale die gemeinsam zu bewahrenden Schätze im Inneren
schützt. Wir gehen davon aus, dass die Europäische Union sich auch bei Sicherheit und
Verteidigung das Vertrauen aller ihrer Mitgliedstaaten erarbeiten muss, um nachhaltig erfolgreichSozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 10
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
zu sein und dem Zerfall der europäischen Sicherheitslandschaft in Länder mit unterschiedlicher
Nähe und Abhängigkeit gegenüber den USA vorzubeugen. Anstelle von Ad-hoc-Allianzen im
Dienst konkreter Ziele werden wir immer die multilaterale Struktur suchen: das EU-Mandat für
Mali, den Einsatz unter europäischem Kommando oder, wie jüngst von den SPD-Abgeordneten
im Verteidigungsausschuss des Bundestages vorgeschlagen, die 28. Armee Europas auf der Ebene
der Kommission.
Diese Ideen können schneller konkret werden, als es vielleicht den Anschein hat. Aber überall
da, wo ein europäisches Engagement mit neuen Risiken für Leib und Leben von Einsatzkräften
verbunden ist, bleibt die SPD auf Distanz. Beispiel Mali: Für Friedenssicherung und Ausbildung
bringen wir die Bundeswehr gerne ein, bei der Terrorismusbekämpfung halten wir Abstand.
Unter diesen Voraussetzungen kann es nicht gelingen Frankreich davon zu überzeugen, dass es
für den Kampf gegen den Terror lieber ein EU-Mandat anstrebt als selbst eine Allianz der
Willigen anzuführen. Auch die bisherigen Erfahrungen mit der Gemeinsamen Sicherheit- und
Verteidigungspolitik (GSVP) sind nicht geeignet, um französisches Vertrauen in die
Handlungsfähigkeit der EU zu stärken. Denn es gibt ja schon heute kampfstarke Verbände auf
europäischer Ebene. Nur sind die rotierend aus nationalen Streitkräften zusammengestellten EU
Battle Groups noch nie zum Einsatz gelangt. Im entscheidenden Moment überwog immer das
nationale vor dem europäischen Interesse und blockierte eine europäische
Entscheidungsfindung. Die SPD hat darauf bisher keine Antwort. Noch steht das Strategiedefizit
der SPD einer tragfähigen Weiterentwicklung europäischer Strategien im Wege, die ohne
gemeinsame Zielvorstellungen Deutschlands und Frankreichs nicht zustande kommen kann.
Dabei sind die Voraussetzungen für gemeinsame deutsch-französische Impulse in der GSVP nicht
schlecht. Im Aachener Vertrag haben wir die deutsch-französische Allianz noch einmal
nachhaltig gestärkt und ausdrücklich auch Sicherheitsverantwortung füreinander übernommen.
Beim Kampf gegen den IS ist Deutschland dem Ruf aus Paris gefolgt, der auf Grundlage des
Lissabon-Vertrages ergangen war. Die Bundeswehr und die französische Armee haben
gemeinsame Verbände aufgestellt: Die seit Jahrzehnten etablierte Deutsch-Französische Brigade
und zuletzt die gemeinsame Lufttransportstaffel in Evreux sind Beispiele für das, was beide
Länder gemeinsam erreichen können.
Wenn wir auf dieser Grundlage aufbauen wollen, brauchen wir aber auch einen scharfen Blick
für die Bereiche, in denen die bilaterale Zusammenarbeit besser funktionieren könnte.
Militärische Kultur und Organisation sind zwischen Deutschland und Frankreich immer noch so
verschieden, dass es immer wieder zu Reibungsverlusten kommt. Das zeigt sich am deutlichsten
in der Deutsch-Französischen Brigade, deren nationale Anteile wenig Berührung miteinander
haben und die noch nie als geschlossener Verband im Einsatz war. Tatsächlich arbeiten das
deutsche und das niederländische Heer enger zusammen als die Streitkräfte Deutschlands und
Frankreichs. Das heißt nicht, dass die deutsch-französische militärische Kooperation falsch wäre
- im Gegenteil: Sie bedarf der Vertiefung und Weiterentwicklung. Zur GSVP der EU kann sie aus
sozialdemokratischer Sicht aber keine Alternative sein. Wir wollen gemeinsam mit Frankreich
Handlungsfähigkeit auf europäischer Grundlage herstellen: Sei es durch eine 28. Armee, wie von
den Expertinnen und Experten im Bundestag vorgeschlagen, sei es auf anderen geeigneten
Wegen.
Was das Verhältnis zu China angeht, hat die SPD immerhin schon einen Ausgangspunkt
definiert, auch dank der beharrlichen Überzeugungsarbeit des ehemaligen Vorsitzenden SigmarSozialdemokratische Verteidigungspolitik in unserer Zeit Seite 11
Erstveröffentlichung in „Allemagne d'aujourd'hui“ 2021/1
(Nr. 235)
Gabriel. Unser Nachdenken über China geht wiederum von der Europäischen Union aus. Sie hat
das Potenzial, sich zwischen den USA und China zu behaupten, wenn wir Europäer es schaffen,
unsere Kräfte zu bündeln und geschlossen zu agieren. Das betrifft in erster Linie Europa als
Wirtschaftsmacht, überträgt sich aber auf die innere und äußere Sicherheit. Zur
Verteidigungsbereitschaft im weiteren Sinne gehört auch der Schutz des gesellschaftlichen
Zusammenhalts gegen zersetzende Einflüsse durch Desinformation und Agitation, der Schutz
personenbezogener uns sicherheitsrelevanter Daten, der Schutz kritischer Infrastruktur gegen
Cyberangriffe und der Schutz kritischer industrieller Technologie vor Spionage und
Manipulation.
In der Vergangenheit standen bei diesen Themen eher russische Aktivitäten im Mittelpunkt
unserer Wachsamkeit. Zunehmend wächst aber auch das Bewusstsein für die Bedrohungen, die
aus dem chinesischen Machtanspruch erwachsen sind. Die SPD-Fraktion im Deutschen
Bundestag hat deshalb Kriterien für den sicheren Ausbau der 5G-Infrastruktur entwickelt, die
eine Beteiligung der chinesischen Firma Huawei im Grunde ausschließen. Industriepolitisch
sollte Europa unbedingt durch eigene Fähigkeiten auf der technischen Höhe der Digitalisierung
bleiben. Die SPD erkennt hier eine Frage der Souveränität, die uns angesichts des
Systemgegensatzes zwischen dem freiheitlich-demokratischen Europa und dem totalitär-
autoritären China weiterhin beschäftigen muss, selbst wenn wir wirtschaftliche Nachteile davon
haben sollten.
Fazit
Die SPD hat die Kraft und den Sachverstand, um auf dem Gebiet der Sicherheits- und
Verteidigungspolitik im politischen Tagesgeschäft als Regierungspartei verantwortungsvolle und
tragfähige Entscheidungen zu treffen. Um über die Anforderungen des Tagesgeschäfts hinaus in
den großen strategischen Fragen unserer Zeit als Wegweiserin aufzutreten, muss die SPD sich die
Grundlagen erst noch erarbeiten. Unser Stolz auf das Erreichte ist berechtigt. Der Leitstern der
Entspannungspolitik kann auch in unserer Zeit weiter leuchten. Er darf uns aber nicht dazu
verleiten, auf komplexe Fragen schematische Antworten zu geben.
Zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehört zwingend das Nachdenken über die
Voraussetzungen und die Grenzen der Anwendung von Gewalt, ein Nachdenken, das sich auf
einer grundsätzlichen Bereitschaft dazu gründet, wenn es denn notwendig ist. Wir dürfen als
Sozialdemokratie dieser dornigen Frage nicht ausweichen. Wo es kein besseres Mittel gibt, um
für Stabilität und Frieden zu wirken, müssen wir zur Anwendung militärischer Gewalt befähigt
sein. Dafür müssen wir auch die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Die ultima ratio ja ist
nicht das letzte in der zeitlichen Abfolge zur Anwendung gebrachter Mittel, sondern das
äußerste, zu dem ein souveränes Land greifen muss, wenn es erkennt, dass kein anderes Mittel
tauglich ist, um das Ziel zu erreichen.
Die Welt im Jahre 2021 verlangt der SPD die Mühe ab, ein konsequentes strategisches Denken
neu zu lernen, ohne darüber zu vergessen, woher wir kommen. Daran, dass die deutsche
Sozialdemokratie die intellektuelle und politische Substanz hat, um eine tragfähige Politik für
Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhundert zu formulieren, kann es indes keinen Zweifel geben.Sie können auch lesen