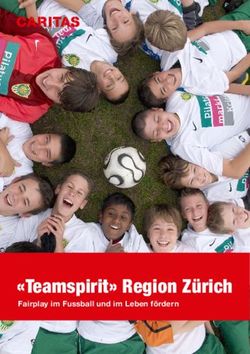SRG SSR Wahl-barometer - Studienbericht 15. Oktober 2021 - Sotomo
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SRG SSR Wahl- barometer Studienbericht 15. Oktober 2021
1 Aktuelle Wahlabsicht 3 1.1 Dreikampf um den dritten Platz 3 1.2 SVP findet aus ihrem Tief 5 1.3 Motive der Wählenden 6 2 Themen und Herausforderungen 8 2.1 Klimawandel schlägt Pandemie 8 2.2 Soziale Themen verlieren an Gewicht 10 2.3 Freiheitsrechte als Thema der SVP-Wählerschaft 12 2.4 Themen und Wählerschaft 15 3 Profil der Wählenden 19 3.1 Demographie: Geschlecht und Alter 19 3.2 Soziale Schichtung: Bildung und Einkommen 21 3.3 Selbstpositionierung auf der Links-rechts-Achse 24 4 Einschätzung von Bundesrat und Parlament 26 4.1 Ausrichtung der Räte 26 4.2 Bundesrats-Rating: Einfluss 30 4.3 Bundesrats-Rating: Sympathie 34 5 Datenerhebung und Methode 36
IMPRESSUM
SRG SSR Wahlbarometer, 10/2021
Auftraggeber_in: SRG SSR
Auftragnehmer_in: Sotomo, Dolderstrasse 24, 8032 Zürich.
Autor_innen: Michael Hermann, Sarah Bütikofer, David Krähenbühl3 SRG SSR Wahlbarometer
Aktuelle
Wahlabsicht
Das 2. SRG SSR Wahlbarometer zeigt die Wahlabsicht
zwei Jahre vor den nationalen Wahlen. An der
Online-Befragung zwischen dem 29. September und
dem 3. Oktober 2021 haben insgesamt knapp 28 000
Personen teilgenommen. Die folgenden Ergebnisse sind
repräsentativ für die aktive Stimmbevölkerung der
Schweiz.
1.1. DREIKAMPF UM DEN DRITTEN PLATZ
Zwei Jahre sind seit den eidgenössischen Wahlen vom 20. Okto-
ber 2019 vergangen. In zwei Jahren finden in der Schweiz die
nächsten Parlamentswahlen statt. Das 2. SRG SSR Wahlbarome-
ter zeigt den Formstand der Parteien zur Halbzeit der Legisla-
tur. Trotz Covid-19-Pandemie werden dabei sehr stabile Verhält-
nisse sichtbar. Gemäss aktueller Wahlabsicht ist weiterhin die
SVP klar stärkste Partei. Auf den Plätzen zwei bis fünf hat aller-
dings eine Annäherung der Wähleranteile stattgefunden. Insbe-
sondere die drei Parteien FDP, Die Mitte sowie die Grünen lie-
gen momentan praktisch gleichauf und stehen damit in einem
Dreikampf um Platz drei. Ein Grund für dieses Kopf-an-Kopf-
Rennen ist der aktuelle Rückgang des Wähleranteils der FDP um
1,5 Prozentpunkte. Gleichzeitig hat die Fusion von CVP und BDP
dazu geführt, dass die gemeinsame neue Partei «Die Mitte» an
Grösse gewonnen hat. Dazu kommen die stabilen Wahlabsich-
ten für die Grünen. Damit liegen diese drei Parteien, die sichSRG SSR Wahlbarometer 4
in der Zahl der Bundesratssitze deutlich unterscheiden (zwei,
eins, null Bundesratssitz) zumindest gemäss Wahlabsicht gleich-
auf bei etwas mehr als 13 Prozent.
Wähleranteile der Parteien gemäss aktueller Wahlabsicht (Abb. 1)
Die fehlenden Prozentwerte entfallen auf übrige Parteien
26.6
20
Anteil [%]
15.8
13.6 13.3 13.2
10
9.8
2.1
0
SVP SP FDP Die Mitte Grüne GLP EVP
Gewinne und Verluste im Vergleich zu den Nationalratswahlen 2019 (Abb. 2)
2
+2.0
1
Prozentpunkte
+1.0
+/-0 +/-0
0
-1.0 -0.5
-1
-1.5
-2
SVP SP FDP Die Mitte Grüne GLP EVP
Der grösste Zuwachs im Vergleich zu den Wahlen 2019 er-
zielt gemäss aktueller Wahlumfrage die GLP mit einem Plus
von 2 Prozentpunkten. Weil die Sozialdemokraten gleichzeitig5 SRG SSR Wahlbarometer
einen Punkt einbüssen, liegen zwischen der zweit- und der
sechstgrössten Partei momentan nur noch 6 Prozentpunkte. Die
SVP erzielt einen leichten Zuwachs (+1). Stabil sind die Wahl-
absichten für die Grünen, die EVP sowie die Mitte. Letztere
erreichet allerdings nicht ganz die Summe der Wähleranteile
ihrer Herkunftsparteien CVP und BDP (-0.5). Insgesamt gilt es
zu berücksichtigen, dass die Schätzgenauigkeit dieser Umfra-
ge einer Zufallsstichprobe mit einem Strichprobenfehler von
+/-1,3 Prozentpunkten entspricht.
1.2. SVP FINDET AUS IHREM TIEF
Entwicklung der nationalen Wähleranteile (Abb. 3)
Nationalratswahlen 2015, 2019, SRG Wahlbarometer 2020, SRG Wahlbarometer 2021
29.4
30
SVP
26.6
25.6
24.1
Wählerstärke [%]
20 18.8
SP
16.8 16.8
16.4 15.8
FDP
15.1 15.1
15.8 13.8 13.6
Die Mitte
13.8
(CVP+BDP) 13.2
13.2
12.2
10
7.1 Grüne 9.8 9.8
7.8
GLP
4.6
0
Wahlen 2015 Wahlen 2019 WB 2020 WB 2021
Die SVP hatte bei den Wahlen 2019 fast 3 Prozentpunkte verlo-
ren. Dieser negative Trend setzte sich beim 1. SRG SSR Wahlba-
rometer von Herbst 2020 fort. Nun hat sich die Partei innerhalbSRG SSR Wahlbarometer 6
eines Jahres um 2,5 Prozentpunkte verbessert. Dies entspricht
der grössten Veränderung aller Parteien seit der letzten Wahl-
umfrage. Seit damals hat sich der Streit über den Umgang mit
der Covid-19-Pandemie zugespitzt und die SVP hat sich als be-
sonders massnahmenkritisch positioniert. Der Bundesrat hat im
Frühsommer 2021 das Institutionelle Abkommen mit der EU im
Sinn der SVP für gescheitert erklärt und die SVP sich bei der Ab-
stimmung zum CO2-Gesetz knapp gegen alle grösseren Parteien
durchgesetzt. In der Gesamtbilanz haben diese Entwicklungen
die rechtskonservative Partei offenbar wieder etwas stärker in
den Fokus der Wähler:innen gerückt.
1.3. MOTIVE DER WÄHLENDEN
Wichtigster Grund für die aktuelle Wahlabsicht (Abb. 4)
«Was ist der wichtigste Grund für Ihre Wahl?»
Gesamt
60 22 14 5
Nach Parteipräferenz
Grüne 71 19 7
Politische Ausrichtung
SP 69 16 10 5
Lösungskompetenz
GLP 53 27 17 Art des Politisierens
Persönlichkeiten in der Partei
Die Mitte 34 30 28 7
FDP 53 24 15 8
SVP 69 18 9 4
0% 25% 50% 75% 100%
Da die eidgenössischen Wahlen in der Schweiz keinen unmit-
telbaren Einfluss auf die personelle Zusammensetzung der Re-
gierung haben, steht die politische Ausrichtung der Parteien als
Motiv für den Wahlentscheid klar im Vordergrund. 60 Prozent
der aktiven Stimmberechtigten entscheiden sich für eine Partei
primär aufgrund ihrer Ausrichtung. Für 22 Prozent steht die Lö-
sungskompetenz im Vordergrund. Die politische Ausrichtung ist7 SRG SSR Wahlbarometer
insbesondere für den Wahlentscheid zugunsten der Polparteien
auf der linken und der rechten Seite ausschlaggebend. Etwas we-
niger stark im Vordergrund steht er bei einem Entscheid für die
FDP oder die GLP ( je 53 %). Einzig die Die Mitte wird wie ihre
Vorgängerparteien (CVP und BDP) hauptsächlich aus anderen
Gründen gewählt.
Art der aktuellen Wahlabsicht (Abb. 5)
«Wie würden Sie den Entscheid für diese Partei beschreiben?»
Gesamt
47 34 8 12
Nach Parteipräferenz
Grüne 57 21 4 19
... aus voller Überzeugung.
SP 53 25 15 7
... aus Mangel an besseren Alternativen.
GLP 37 34 28 ... aufgrund langjähriger Bindung.
... aus einem Bedürfnis nach Neuem.
Die Mitte 29 46 11 15
FDP 36 42 13 9
SVP 54 36 3 7
0% 25% 50% 75% 100%
Knapp die Hälfte der Befragten gibt an, sich aus voller Überzeu-
gung für die bevorzugte Partei zu entscheiden. Es sind insbeson-
dere Wählende der Polparteien, die dies tun. Im Unterschied zu
den linken Parteien entscheiden sich aber relativ viele Wählen-
de der SVP aus Mangel an besseren Alternativen für diese Partei.
Das Bedürfnis nach Neuem wir am häufigsten bei der GLP an-
gegeben (28 %). Die Partei profitiert offenbar noch immer vom
Image einer neuen Kraft. Zu etwas geringerem Mass gilt dies
auch für die Grünen (19 %). Auch bei Die Mitte geben 15 Prozent
an, dass sie diese Partei wählen, weil sie für etwas Neues steht.
Dies deutet darauf hin, dass das Rebranding bei der Fusion der
Traditionspartei CVP mit der BDP die erwünschte Wirkung er-
zielt.SRG SSR Wahlbarometer 8
Themen und
Herausforderungen
In der Schweiz erfolgt die Wahl der Regierung
weitgehend unabhängig von den Ergebnissen der
Parlamentswahlen. Statt Führungskompetenz stehen
deshalb beim Wahlentscheid vor allem Sachthemen im
Vordergrund. Die Entwicklung der wahrgenommenen
politischen Herausforderungen ist ein wichtiger Faktor
für den Formstand der Parteien.
2.1. KLIMAWANDEL SCHLÄGT PANDEMIE
Seit Frühjahr 2020 dominiert die Covid-19-Pandemie Gesell-
schaft und Politik. Die Fortschritte der Impfkampagne haben
mittlerweile zu einer gewissen Normalisierung des Alltags
beigetragen. Aus Sicht der Stimmberechtigen bleibt die Pande-
miebekämpfung eine zentrale Herausforderung der Schweizer
Politik. 32 Prozent zählen sie zu den drei wichtigsten politischen
Herausforderungen. Nur eine Herausforderung wird noch häu-
figer genannt: Der Klimawandel mit 44 Prozent Nennungen.
Die Pandemie wirkt sich allerdings nicht nur direkt, sondern
auch indirekt auf die Politik aus. Die vom Bundesrat beschlosse-
nen Schutzmassnahmen haben zu Kritik an der Einschränkung
der persönlichen Freiheiten geführt. Immerhin 17 Prozent der
Stimmberechtigten zählen heute den Schutz der Freiheitsrechte
zu den drei wichtigsten politischen Herausforderungen.9 SRG SSR Wahlbarometer
Wichtigste politische Herausforderungen (Abb. 6)
«Welches sind Ihrer Meinung nach gegenwärtig die wichtigsten politischen Herausforderungen in unserem Land? (Maximal
3 Antworten)»
Klimawandel, CO2-Ausstoss 33 11 44
Pandemiebekämpfung 14 18 32
Reform Altersvorsorge 14 16 30
Gute Beziehungen zur EU 14 9 24
Zuwanderung, Ausländer 15 4 20
Soziale Sicherheit 10 7 18
Freiheitsrechte 12 5 17
Unabhängigkeit, Souveränität 12 4 16
Natur- und Landschaftsschutz 9 6 16
Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaft 9 6 15
Krankenkassenprämien 6 8 14
Steuerbelastung, Staatsausgaben 6 6 12
Kriminalität, Sicherheit 6 5 11
Gleichstellung der Geschlechter 5 7
Arbeitslosigkeit, Lohndruck 3 4 7
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Relevant für Wahlentscheid
Wichtig, aber nicht relevant für Wahlentscheid
Die Freiheitsrechte werden damit fast ebenso oft genannt wie
die soziale Sicherheit. Das Freiheitsthema bildet insbesondere
für die SVP eine willkommene Ergänzung zu ihren traditionel-
len Kernthemen Zuwanderung und Europa, die in den letzten
Jahren eher an Bedeutung verloren haben.SRG SSR Wahlbarometer 10
2.2. SOZIALE THEMEN VERLIEREN AN GEWICHT
Abbildung 7 zeigt die Entwicklung der wichtigsten politischen
Herausforderungen aus Sicht der Stimmberechtigen seit 2018.
Es sind insbesondere die beiden Themen Wirtschaft sowie
Arbeitslosigkeit/Lohndruck, die im Vergleich zum vergangenen
Jahr weniger oft genannt werden. Vor einem Jahr war die Furcht
gross vor Arbeitslosigkeit und einer Wirtschaftskrise als Folge
der Pandemie. Heute sind die Sorgen um die Wirtschaft und die
Beschäftigungslage offenbar weitgehend verflogen. Auswirkun-
gen hat dies vor allem für die FDP und die SP. Die Wirtschaft
bzw. das Soziale sind die Kernthemen dieser beiden Parteien.
Es erstaunt deshalb nicht, dass diese im Vergleich zur letzten
Befragung eher an Zuspruch verloren haben. Im Vergleich zu
den Wahlen 2019 haben die Krankenkassenprämien am mei-
sten an Bedeutung verloren. Noch vor zwei Jahren zählten 43
Prozent der Befragten die Prämienlast zu den drei wichtigsten
politischen Herausforderungen. Heute tun diese nur noch 14
Prozent. Mit 44 Prozent wird dagegen das Klimathema sogar
noch etwas häufiger genannt als 2019 im Jahr der grünen Welle
und der Klimawahl. Auch wenn das CO2-Gesetz im Juni 2021
knapp gescheitert ist, bleibt der Klimawandel für annähernd
die Hälfte der Befragten eine zentrale Herausforderung. Dazu
dürften auch die Wetterextreme im Sommer beigetragen haben.
Die weiterhin verbreitete Sorge um das Klima ist die wichtigste
Erklärung für das anhaltend gute Abschneiden von Grünen und
Grünliberalen, die 2019 die Wahlsieger waren.11 SRG SSR Wahlbarometer
Wichtigste politische Herausforderungen – Zeitverlauf (Abb. 7)
«Welches sind Ihrer Meinung nach gegenwärtig die wichtigsten politischen Herausforderungen in unserem Land? (Maximal
3 Antworten)»
. 8
. 9
.2 0
1
. 8
. 9
.2 0
1
. 8
. 9
.2 0
1
. 8
. 9
.2 0
1
. 8
. 9
.2 0
1
O 201
O 201
O 202
02
O 201
O 201
O 202
02
O 201
O 201
O 202
02
O 201
O 201
O 202
02
O 201
O 201
O 202
02
.
.
.
.
.
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
O
O
O
O
O
60%
42 44
40% 37
34 32 33 34
30 30 31
28 26
24
20% 20
16 16
13
0%
Klimawandel, Reform Zuwanderung,
Pandemiebekämpfung Beziehungen zur EU
CO2-Ausstoss Altersvorsorge Ausländer
60%
40%
30
20% 19 18 17 19
16 16 16 16 15
11 13 13 11 11
0%
Unabhängigkeit, Natur- und
Soziale Sicherheit Freiheitsrechte Wirtschaft
Souveränität Landschaftsschutz
60%
42 43
40%
29
20% 22
14 12 12 14 13 13
11 11 11 11
9 8 9 7 7 7
0%
Steuerbelastung, Kriminalität, Gleichstellung der Arbeitslosigkeit,
Krankenkassenprämien
Staatsausgaben Sicherheit Geschlechter Lohndruck
Die wichtigsten politischen Herausforderungen unterscheiden
sich nicht grundlegend zwischen den Sprachregionen. Die
Pandemiebekämpfung steht aus Sicht der Stimmberechtigten
der Romandie etwas weniger stark im Zentrum. Demgegen-
über wird in der frankofonen Schweiz der Klimawandel am
häufigsten als wichtige Herausforderung genannt. In der ita-SRG SSR Wahlbarometer 12
Wichtigste politische Herausforderungen – Sprachregionen (Abb. 8)
Klimawandel, CO2-Ausstoss Pandemiebekämpfung
Deutschschweiz 44 34
Franz. Schweiz 45 19
Ital. Schweiz 37 28
Reform Altersvorsorge Gute Beziehungen zur EU
Deutschschweiz 30 23
Franz. Schweiz 26 25
Ital. Schweiz 24 15
Zuwanderung, Ausländer Soziale Sicherheit
Deutschschweiz 20 19
Franz. Schweiz 21 13
Ital. Schweiz 20 15
Freiheitsrechte Unabhängigkeit, Souveränität
Deutschschweiz 17 16
Franz. Schweiz 17 17
Ital. Schweiz 18 28
0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60%
lienischsprachigen Schweiz gelten demgegenüber Unabhängig-
keit/Souveränität vermehrt als Herausforderungen.
2.3. FREIHEITSRECHTE ALS THEMA DER
SVP-WÄHLERSCHAFT
Abbildung 9 zeigt welche Themen und Herausforderungen für
die Wählenden der sechs grösseren Parteien besonders wichtig
sind. Die dargestellte Reihenfolge entspricht der Wichtigkeit für
den Wahlentscheid. Eine wichtige Erkenntnis, die sich aus die-
ser Abbildung ableiten lässt: Die Freiheitsrechte sind ein neues
Thema, mit dem sich die SVP von ihrer Konkurrenz abheben
kann. Das Thema Freiheit ist für ihre Basis eines der drei wichtig-
sten Argumente für den Wahlentscheid – neben Migration und
Unabhängigkeit/Souveränität. Nur bei der SVP tauchen die Frei-13 SRG SSR Wahlbarometer
heitsrechte unter den sechs wichtigsten Themen auf. Diese The-
matik hat als Reaktion auf die Covid-19-Massnahmen in der poli-
tischen Debatte stark an Bedeutung gewonnen. Die SVP konnte
sich hier mit ihrer Kritik an den Massnahmen zur Pandemiebe-
kämpfung offenbar Profil verschaffen. Dies dürfe eine Erklärung
dafür sein, dass sich die Partei in dieser Wahlumfrage gefangen
hat, obwohl ihre alten Kernthemen Migration und Europa ge-
genwärtig nur eine untergeordnete Rolle in der Problemwahr-
nehmung der Bevölkerung spielen.
Wahlrelevante Herausforderungen nach Partei (Abb. 9)
«Welche der folgenden Faktoren sind besonders wichtig für Ihren Wahlentscheid?»
SVP SP
Zuwanderung, Ausländer 44 Klimawandel, CO2−Ausstoss 49 18
Freiheitsrechte 34 8 Soziale Sicherheit 27 6
Unabhängigkeit, Souveränität 34 6 Gute Beziehungen zur EU 23 11
Kriminalität, Sicherheit 15 8 Pandemiebekämpfung 19 21
Pandemiebekämpfung 12 7 Reform Altersvorsorge 18 13
Steuerbelastung, Staatsausgaben 11 10 Natur− und Landschaftsschutz 10 10
0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
FDP Die Mitte
Wirtschaft 30 7 Reform Altersvorsorge 24 16
Reform Altersvorsorge 23 16 Gute Beziehungen zur EU 22 11
Gute Beziehungen zur EU 22 10 Pandemiebekämpfung 20 26
Pandemiebekämpfung 17 19 Klimawandel, CO2−Ausstoss 19 23
Zuwanderung, Ausländer 12 11 Krankenkassenprämien 10 8
Klimawandel, CO2−Ausstoss 11 16 Soziale Sicherheit 10 10
0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
Grüne GLP
Klimawandel, CO2−Ausstoss 88 Klimawandel, CO2−Ausstoss 65 6
Natur− und Landschaftsschutz 34 7 Gute Beziehungen zur EU 27 12
Soziale Sicherheit 12 11 Pandemiebekämpfung 15 25
Gute Beziehungen zur EU 10 16 Natur− und Landschaftsschutz 14 7
Reform Altersvorsorge 8 18 Reform Altersvorsorge 13 26
Pandemiebekämpfung 8 21 Soziale Sicherheit 6 9
0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%SRG SSR Wahlbarometer 14 Für die FDP und die Sozialdemokraten besteht demgegen- über die Herausforderung, dass wirtschaftliche und soziale Themen im Vergleich zum ersten Jahr der Pandemie in der Wahrnehmung der Bevölkerung deutlich an Dringlichkeit verlo- ren haben. Die beiden Parteien, die für Wirtschaft und Soziales stehen, sind gewissermassen Opfer des Erfolgs der wirtschaftli- chen Krisenpolitik des Bundes. Wenn Wirtschaft und Soziales an Dringlichkeit verlieren, dann schafft dies Raum für die Klimathematik und davon profitieren am ehesten die beiden grünen Kräfte, die momentan ihren Wahlerfolg von 2019 bestä- tigen oder sogar steigern können. Seit den Wahlen am meisten Bedeutung verloren haben die Krankenkassenprämien. Dieses Thema wurde neben der SP vor allem von der CVP besetzt. Da für die CVP und nun für Die Mitte Themen und Positionen weniger wichtig für die anderen Parteien, ist deren Formstand tendenziell auch weniger an die Themenkonjunktur geknüpft. Gefragt wurde nicht nur nach den relevanten Themen für den Wahlentscheid, sondern auch nach den Themen, bei denen Vor- behalte über den Kurs der eigenen Partei bestehen. Bei der SVP wird dabei die Pandemiebekämpfung am häufigsten genannt. Es sind dies allerdings nur halb so viele, wie jene, welche Freiheits- rechte positiv erwähnen. Dennoch zeigt diese Kritik, dass die Covid-19-Politik der SVP durchaus parteiinternes Spannungspo- tenzial besitzt. Insgesamt fällt auf, dass es bei GLP und Grünen deutlich mehr Befragte gibt als bei den anderen, die nirgendwo mit dem Kurs der eigenen Partei unzufrieden sind.
15 SRG SSR Wahlbarometer
Unzufriedenheit mit der eigenen Partei (Abb. 10)
«Bei welchen Herausforderungen sind Sie am wenigsten zufrieden mit dem Kurs der Partei, die Sie aktuell wählen wür-
den?»
SVP SP
Pandemiebekämpfung 17 Klimawandel, CO2−Ausstoss 19
Zuwanderung, Ausländer 16 Reform Altersvorsorge 17
Krankenkassenprämien 14 Gute Beziehungen zur EU 16
Reform Altersvorsorge 12 Krankenkassenprämien 13
Klimawandel, CO2−Ausstoss 12 Wohnungspreise 13
Nirgendwo 26 Nirgendwo 29
0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40%
FDP Die Mitte
Klimawandel, CO2−Ausstoss 20 Klimawandel, CO2−Ausstoss 19
Reform Altersvorsorge 19 Reform Altersvorsorge 17
Zuwanderung, Ausländer 18 Krankenkassenprämien 15
Krankenkassenprämien 18 Gute Beziehungen zur EU 14
Gute Beziehungen zur EU 16 Zuwanderung, Ausländer 13
Nirgendwo 21 Nirgendwo 27
0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40%
Grüne GLP
Pandemiebekämpfung 14 Reform Altersvorsorge 13
Klimawandel, CO2−Ausstoss 13 Krankenkassenprämien 11
Gute Beziehungen zur EU 12 Gute Beziehungen zur EU 10
Reform Altersvorsorge 12 Klimawandel, CO2−Ausstoss 10
Wohnungspreise 11 Wohnungspreise 8
Nirgendwo 37 Nirgendwo 41
0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40%
2.4. THEMEN UND WÄHLERSCHAFT
Alle wichtigen Themen und Herausforderungen werden abhän-
gig von der Position der Befragten im Links-rechts-Spektrum
unterschiedlich beurteilt (Abb. 11). Die Klimafrage ist noch
immer ein Thema, das links der Mitte als weit dringlicher an-SRG SSR Wahlbarometer 16
gesehen wird als rechts davon. Die Pandemiebekämpfung wird
besonders im Bereich Mitte-Mittelinks als zentrale Heraus-
forderung wahrgenommen. Demgegenüber beschäftigen die
Freiheitsrechte vor allem Personen rechts der Mitte. Dieses
Thema ist jedoch weniger rechts geprägt als Migration und Sou-
veränität. Einen etwas erhöhten Wert haben die Freiheitsrechte
ausserdem ganz links aussen. Dies deutet darauf hin, dass die
SVP mit der Freiheitsthematik Wähler:innen ausserhalb ihrer
angestammten Basis ansprechen könnte.
Relevanteste Herausforderungen nach Selbstpositionierung im Links-Rechts-Spektrum (Abb. 11)
links 2 3 Mitte 5 6 rechts links 2 3 Mitte 5 6 rechts
80%
80 79
60% 66
40%
41 36 38 38
20% 30 30 33
23
13 16
0% 8
Klimawandel, CO2-Ausstoss Pandemiebekämpfung
80%
60%
40%
36 34 32 33
20% 27 27 29 31
18 17 20 21
0% 12
Reform Altersvorsorge Gute Beziehungen zur EU
80%
60%
61
40% 45
20% 31 29 24
22 19
0% 11 12
Zuwanderung, Ausländer Soziale Sicherheit
80%
60%
40% 44
20% 34
22 27 27
22
16
0% 10 10 12
Freiheitsrechte Unabhängigkeit, Souveränität
Das Alter spielt für die Bewertung der wichtigsten politischen
Herausforderung eine weniger wichtige Rolle als die Position
im Links-rechts-Spektrum. Trotz entsprechender Irritationen17 SRG SSR Wahlbarometer
im Nachgang der CO2-Abstimmung bleibt der Klimawandel
ein Thema, das besonders junge Wählende als zentral erachten.
Gute Beziehungen zur EU halten dagegen vermehrt die Älte-
ren für dringlich. Auffällig ist die Altersverteilung beim neuen
Thema Freiheitsrechte. Dieses bewegt insbesondere die 18- bis
44-Jährigen.
Relevanteste Herausforderungen nach Alter (Abb. 12)
18-24 25-34 35-44 45-64 65-75 75+ 18-24 25-34 35-44 45-64 65-75 75+
60%
61
40% 49
45 42 39
33 33 36 34
20% 31 30
26
0%
Klimawandel, CO2-Ausstoss Pandemiebekämpfung
60%
40%
34 32 31 32
20% 28 30 29
23 25
18 17 18
0%
Reform Altersvorsorge Gute Beziehungen zur EU
60%
40%
20% 25
21 19 23 19 19
18 15 16 16 18
13
0%
Zuwanderung, Ausländer Soziale Sicherheit
60%
40%
20%
22 22 22
17 16 18 17 16 17
10 13
0% 9
Freiheitsrechte Unabhängigkeit, Souveränität
In der unterschiedlichen Bewertung der politischen Herausfor-
derungen durch Männer und Frauen kommt nicht zuletzt die
Tatsache zum Ausdruck, dass Frauen im Durchschnitt etwas lin-
ker positioniert sind als Männer. Auffällig ist dennoch der sehr
grosse Bewertungsunterschied des Klimawandels. Ebenfalls auf-
fällig ist, dass wesentlich mehr Frauen (40 %) die Pandemiebe-SRG SSR Wahlbarometer 18
kämpfung als eine der drei zentralen Herausforderungen anse-
hen als Männer (25 %).
Relevanteste Herausforderungen nach Geschlecht (Abb. 13)
Klimawandel, CO2-Ausstoss Pandemiebekämpfung
Weiblich 52 40
Männlich 36 25
Reform Altersvorsorge Gute Beziehungen zur EU
Weiblich 30 26
Männlich 29 21
Zuwanderung, Ausländer Soziale Sicherheit
Weiblich 14 21
Männlich 25 14
Freiheitsrechte Unabhängigkeit, Souveränität
Weiblich 15 11
Männlich 19 21
0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60%
Demgegenüber ist der Geschlechterunterschied beim Thema
Freiheitsrechte kaum ausgeprägt. Dieses Thema ist weniger
männlich geprägt als die traditionellen Kernthemen der SVP
(Migration, Sourveränität).19 SRG SSR Wahlbarometer
Profil der
Wählenden
Wer setzt sich die Wählerschaft der einzelnen Parteien
nach demographischen und sozioökonomischen
Kriterien zusammen? Wie sieht ihre ideologische
Ausrichtung aus? Im folgenden Kapitel wird das Profil
der Parteianhängerschaften unter die Lupe genommen.
Das stabile Parteiengefüge der Schweiz bringt es mit
sich, dass sich bei der aktuellen Wahlabsicht auch in
soziodemographischer Hinsicht vergleichsweise stabile
Muster zeigen. Dennoch zeigen sich ein paar
ungewohnte Veränderungen.
3.1. DEMOGRAPHIE: GESCHLECHT UND ALTER
Die Mitte und die GLP werden zu fast gleichen Teilen von Män-
nern und Frauen unterstützt, während dies sowohl bei links wie
rechts der Mitte stehenden Parteien nicht zutrifft. Abbildung 14
zeigt, dass Männer eher Parteien des rechten Spektrums wählen,
während Frauen eher dazu tendieren, die Parteien auf der lin-
ken Seite zu unterstützen. Knapp dreissig Prozent der Männer
würden heute die SVP wählen und 15 Prozent die FDP, d.h. über
vierzig Prozent der männlichen Wählerschaft unterstützt eine
Partei, die deutlich rechts der Mitte angesiedelt ist, aber nur gut
dreissig Prozent der weiblichen Wählerschaft. Dafür würden 36
Prozent der Frauen eine Partei des links-grünen Spektrums wäh-
len, während dies nur auf 28 Prozent der Männer zutrifft.SRG SSR Wahlbarometer 20
Wähleranteile nach aktueller Wahlabsicht – Nach Geschlecht (Abb. 14)
«Welche Partei würden Sie hauptsächlich wählen, wenn am kommenden Wochenende in der Schweiz Nationalratswahlen
wären?»
30%
28
23
20%
20
15 16
14
14
12 12
10%
10
9 8
0%
SVP SP FDP Die Mitte Grüne GLP
Weiblich Männlich
Die GLP ist die einzige Partei, die zur Zeit in allen Altersgrup-
pen einen ungefähr gleich hohen Wähleranteil hat, bei der SP
fallen die Unterschiede zwischen den Altersgruppen ebenfalls
nicht gross aus.
Die Mitte hingegen – und etwas weniger ausgeprägt auch die
FDP – wird von älteren Wähler:innen wesentlich mehr unter-
stützt als von jüngeren. Die Mitte hat einen gut doppelt so gro-
ssen Wähleranteil unter Personen über 66 als bei den unter drei-
ssig Jährigen. Genau umgekehrt zeigt sich das Bild bei den Grü-
nen. Die Partei behält ihre Attraktivität für junge Wählersegmen-
te, sie hat fast doppelt so viele Unterstützer:innen unter dreissig
als im Rentenalter.
Veränderungen zu früheren Jahren zeigen sich bei der SVP. So-
wohl ihre Anziehungskraft auf junge Wählende als auch die star-
ke Unterstützung durch ältere Wählersegmente haben sich re-
duziert, dafür ist die SVP nun in den mittleren Altersgruppen
klar die Nummer eins. Dreissig Prozent der Wähler:innen zwi-
schen 30 und 65 würden heute SVP wählen.21 SRG SSR Wahlbarometer
Wähleranteile gemäss aktueller Wahlabsicht – Nach Alter (Abb. 15)
«Welche Partei würden Sie hauptsächlich wählen, wenn am kommenden Wochenende in der Schweiz Nationalratswahlen
wären?»
30%
30 30
22 22
20%
18 18
18 17
16 15 15 15
13 13 13
10% 12 11
10 10 10
10 10 9
8
0%
SVP SP FDP Die Mitte Grüne GLP
18-29 30-45 46-65 66+
3.2. SOZIALE SCHICHTUNG: BILDUNG UND
EINKOMMEN
Bildungsabschluss und Haushaltseinkommen sind die beiden
wichtigsten Merkmale der sozialen Schichtung. Die Auswertung
der Profile der einzelnen Wählerschaften zeigt, dass diese bei-
den Merkmale zwischen den einzelnen Parteiwählerschaften
sehr unterschiedlich verteilt sind.
Wie Abbildung 16 zeigt, ist die Verteilung nach Bildungsniveau
bei der Mitte und der SVP gleich und beide Parteien weisen ei-
nen viel grösseren Anteil an Wählenden mit tieferer Bildung aus
als mit höherer Bildung. Umgekehrt ist es bei der Wählerschaft
der GLP und am ausgeprägtesten bei den Grünen, denn unter ih-
ren Parteiwählerschaften sind Personen mit höheren Bildungs-
abschlüssen deutlich übervertreten. Bei der SP, die wie die Grü-
nen ebenfalls dem linken politischen Spektrum zuzuordnen ist,
sind hingegen nur kleine Unterschiede nach Bildungsniveau in-
nerhalb ihrer Wählerschaft festzustellen, ebenso bei der FDP.SRG SSR Wahlbarometer 22
Wähleranteile gemäss aktueller Wahlabsicht – Nach Bildungsabschluss (Abb. 16)
«Welche Partei würden Sie hauptsächlich wählen, wenn am kommenden Wochenende in der Schweiz Nationalratswahlen
wären?»
40%
34
30%
30
20%
20
17 18
16 16
14 15 15
13 13
10% 12 11
10 10 10
7
0%
SVP SP FDP Die Mitte Grüne GLP
obgl. Schule / Berufsschule
Höhere Berufsbildung, Mittelschule
FH, Universität, ETH
Aufgeschlüsselt nach Einkommensgruppen, zeigen sich eben-
falls deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der
einzelnen Parteiwählerschaften. Die klare Nummer eins für
Personen mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von
über 10’000 Franken ist die SVP mit einem Wähleranteil in
dieser Einkommensklasse von 26 Prozent. Allerdings ist die
Wählerschaft der SVP relativ gleichmässig aus allen Einkom-
mensklassen zusammengesetzt.
Ganz im Gegensatz zur FDP, die deutlich mehr als zwei Mal so
viele gut verdienende Wähler:innen wie Wähler:innen aus tie-
fen Einkommensklassen hat. Auch die Grünliberalen stossen bei
Wähler:innen aus der höchsten Einkommensklasse auf doppelt
so viel Zuspruch wie in tieferen Einkommensklassen. Genau um-
gekehrt ist die Wählerschaft der Grünen zusammengesetzt. Die
Personen aus tieferen Einkommensklassen sind deutlich stärker
vertreten als diejenigen aus hohen. Ähnlich ist es bei der SP, die
ebenfalls stärker von Wähler:innen mit tiefen und mittlerem Ein-
kommen gewählt wird als von Personen mit hohem Einkommen.23 SRG SSR Wahlbarometer
Und auch Die Mitte setzt sich stärker aus Wähler:innen aus mitt-
leren Einkommensklassen zusammen als aus hohen.
Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Schere zwi-
schen Bildung und Einkommen bei den Grünen am stärksten
auseinanderdriftet. Ihre Wählerschaft ist zwar überdurch-
schnittlich gebildet, viele ihner Wähler:innen gehören jedoch
auch der untersten Einkommensklasse an. Dies ist damit zu
erklären, dass es sich bei der Wählerschaft der Grünen auch
um eine besonders junge Wählerschaft handelt und auch die
postmateriell orientierten Wähler:innen überdurchschnittlich
vertreten sind. Die Wählerschaft der SVP weist im Schnitt zwar
ein eher tiefes Bildungsniveau auf, was sich in der Einkommens-
verteilung aber nicht widerspiegelt, während es bei der FDP
gerade umgekehrt ist. Sie hat eine Wählerschaft, die sich relativ
ausgegliechen auf alle Bildungsmilieus verteilt, aber überdurch-
schnittlich viele Gutverdienende in ihren Reihen. Und unter der
GLP-Wählerschaft sind viele überdurchschnittlich Gebildete
und gut Verdienende anzutreffen.
Wähleranteile gemäss aktueller Wahlabsicht; nach monatlichem Haushaltseinkommen (Abb. 17)
«Welche Partei würden Sie hauptsächlich wählen, wenn am kommenden Wochenende in der Schweiz Nationalratswahlen
wären?»
30%
26 26
24
23
20%
20 19 19
18
17
15 15
15
13 12 13 13
10% 12 12
10 10
9
8
7
6
0%
SVP SP FDP Die Mitte Grüne GLP
> 10000 CHF
6001 - 10000 CHF
4000 - 6000 CHF
< 4000 CHFSRG SSR Wahlbarometer 24
3.3. SELBSTPOSITIONIERUNG AUF DER
LINKS-RECHTS-ACHSE
Verteilung der Wählenden der Parteien im Links-rechts-Spektrum (Abb. 18)
«Wo würden Sie sich auf einer Skala zwischen «links» und «rechts» einstufen?»
-1.6
SP
-1.6
Grüne
-0.5
GLP
0.2
Die Mitte
1.1
FDP
1.7
SVP
-3 -2 -1 0 1 2 3
Links Mitte Rechts
Die Teilnehmenden der Befragung wurden gebeten, sich im
politischen Spektrum zwischen links und rechts einzuordnen.
Abbildung 18 zeigt das politische Profil der Wählerschaft der
einzelnen Parteien. Identisch fällt die Selbstpositionierung der
Wählerschaft der Grünen und der SP aus. Im Spektrum zwi-
schen links (-3) und rechts (+3) positioniert sich die Basis der
beiden Parteien bei -1,6. Die Anhängerschaft der GLP ist mit
-0,5 leicht links der Mitte positioniert, während Die Mitte mit
+0,2 tatsächlich ziemlich genau in der Mitte angesiedelt ist. Klar25 SRG SSR Wahlbarometer
rechts der Mitte befindet sich die Wählerschaft der FDP. Ihre
mittlere Position liegt bei 1,1. Die FDP hat einen leichten Rechts-
rutsch erlebt und unterscheidet sich dadurch heute stärker von
der ehemaligen CVP und der BDP bzw. der Mitte als von der
SVP-Wählerschaft. Diese ist mit 1.7 die Partei, die am weitesten
rechts im politischen Spektrum der Schweiz zu verorten ist.SRG SSR Wahlbarometer 26
Einschätzung
von Bundesrat
und Parlament
Parlamentswahlen haben in der Schweiz keine direkten
Einflussauf die Regierungszusammensetzung. Sie
wirken sich jedoch unmittelbar auf die die
Mehrheitsverhältnisse in den beiden
Parlamentskammern bei Sachfragen aus. Von
besonderem Interesse ist deshalb die Einschätzung der
politischen Ausrichtung des aktuellen Parlaments
durch die Wählenden. Die Bundesratsmitglieder stehen
nicht zur Wahl. Die Wählenden können deren Einfluss
und ihre Sympathie jedoch im Rahmen des SRG SSR
Wahlbarometers regelmässig bewerten.
4.1. AUSRICHTUNG DER RÄTE
Wie schätzen die Wähler:innen die politische Ausrichtung der
beiden Parlamentskammern und der Regierung ein? Sind diese
Organe ihrer Meinung nach politisch gerade richtig, oder eher
zu links bzw. eher zu rechts ausgerichtet? Die Einschätzungen
für den Nationalrat zu drei Zeitpunkten sind in Abbildung 19
dargestellt. In der letzten Legislatur waren jeweils deutlich
mehr Wählende der Ansicht, dass der Nationalrat politisch zu
weit rechts stehe als zu links. So gaben unmittelbar vor den
Wahlen im Oktober 2019 46 Prozent an, der Nationalrat stehe27 SRG SSR Wahlbarometer
zu weit rechts und nur 30 Prozent schätzen ihn als zu links
ein. In der Folge kam es zu einem für Schweizer Verhältnisse
markanten Linksrutsch.
Beurteilung der Ausrichtung des Nationalrats – Zeitvergleich (Abb. 19)
«Wie schätzen Sie die politische Ausrichtung des Nationalrats in dieser Legislatur ein?»
Nationalrat
Okt. 2021 39 28 34
Eher zu links
Okt. 2019 30 24 46 Gerade richtig
Eher zu rechts
Okt. 2018 32 20 48
0% 25% 50% 75% 100%
Das neue Parlament wird nun ausgeglichener eingeschätzt. Et-
was mehr Befragte empfinden den aktuellen Nationalrat als eher
zu links (39 %) als zu rechts (34 %). Passend dazu zeigen sich bei
der aktuellen Wahlabsichten kaum Bewegungen zwischen den
politischen Lagern und nur eine leichte Tendenz nach rechts.
Beurteilung der Ausrichtung des Nationalrats – nach Partei (Abb. 20)
«Wie schätzen Sie die politische Ausrichtung des Nationalrats in dieser Legislatur ein?»
Gesamt
39 28 34
Nach Parteipräferenz
Grüne 21 78
Eher zu links
SP 24 73
Gerade richtig
GLP 13 45 42
Eher zu rechts
Die Mitte 28 49 23
FDP 55 38 7
SVP 86 11 3
0% 25% 50% 75% 100%
Wenig erstaunlich ist, dass unter den Wählenden der Polpartei-
en der Nationalrat jeweils in grossen Mehrheiten als zu rechtsSRG SSR Wahlbarometer 28
oder als zu links wahrgenommen wird. Dennoch gibt es Unter-
schiede: Während fast neun von zehn SVP-Wählenden die gro-
sse Kammer als zu links betrachten, empfinden lediglich drei
Viertel der Wählerschaft der SP und der Grünen den National-
rat als zu rechts. Auch eine Mehrheit der FDP-Wählenden er-
achtet den aktuellen Nationalrat als zu links. Bei der GLP findet
keine Mehrheit, aber immerhin 42 Prozent, dass der aktuelle Na-
tionalrat zu rechts sei. Insgesamt klar auf Linie mit der grossen
Kammer sind die Wählenden von Die Mitte.
Beurteilung der Ausrichtung des Ständerats – Zeitvergleich (Abb. 21)
«Wie schätzen Sie die politische Ausrichtung des Ständerats in dieser Legislatur ein?»
Ständerat
Eher zu links
Okt. 2021 28 38 34
Gerade richtig
Okt. 2019 30 39 31 Eher zu rechts
0% 25% 50% 75% 100%
Der Ständerat wurde in der letzten Legslatur als sehr ausgegli-
chen einschätzt. In der aktuellen Befragung ist die Zahl derer,
die ihn als zu rechts einschätzen im Vergleich zu jenen, die das
Gegenteil tun, leicht gestiegen.
Die Mitglieder des Ständerats werden in fast allen Kantonen im
Majorzwahlrecht gewählt. Nach wie vor haben im Ständerat die
FDP und Die Mitte die deutliche Mehrheit der Sitze inne. Das
wirkt sich auf das Profil und die Wahrnehmung des Ständerats
aus. Der Anteil der Befragten, der zufrieden mit der Ausrichtung
ist, ist deutlich grösser als beim Nationalrat. Dies gilt in besonde-
rem Mass für die Wählerschaft von Mitte und FDP. Die weniger
polarisierte Einschätzung dürfte auch damit zu tun haben, dass
die Lager und die Abstimmungsresultate im Ständerat weniger
sichtbar sind als im Nationalrat.29 SRG SSR Wahlbarometer
Beurteilung der Position des Ständerats – nach Partei (Abb. 22)
«Wie schätzen Sie die politische Ausrichtung des Ständerats in dieser Legislatur ein?»
Gesamt
28 38 34
Nach Parteipräferenz
Grüne 22 77
Eher zu links
SP 21 76
Gerade richtig
GLP 5 50 45 Eher zu rechts
Die Mitte 13 69 19
FDP 31 61 7
SVP 71 25 4
0% 25% 50% 75% 100%
Noch weniger durch das Links-rechts-Schema als der Ständerat
wird der Bundesrat beurteilt. 45 Prozent der Wählenden sind
der Ansicht, dass dieser weder zu links noch zu rechts ausgerich-
tet sei. Diese Gruppe hat im Vergleich zur vergangenen Legisla-
tur noch einmal stark zugenommen. Hier spielt möglicherweise
die durch die Pandemie verursachte Krise eine Rolle, die zu ei-
ner überparteilichen Wahrnehmung des Bundesrats beigetragen
hat. Obwohl im Bundesrat mit zwei SVP und zwei FDP das rech-
te Spektrum eher übervertreten ist, finden etwas mehr Befragte,
dass der Bundesrat eher zu links als zu rechts sei.
Beurteilung der Ausrichtung des Bundesrats – Zeitvergleich (Abb. 23)
«Wie schätzen Sie die politische Ausrichtung des Bundesrats in dieser Legislatur ein?»
Bundesrat
Okt. 2021 31 45 24
Eher zu links
Okt. 2019 28 38 34 Gerade richtig
Eher zu rechts
Okt. 2018 35 30 36
0% 25% 50% 75% 100%SRG SSR Wahlbarometer 30
Interessant ist, dass trotz seiner aktuellen parteipolitischen Zu-
sammensetzung nur 50 Prozent der SP Wählenden der Ansicht
sind, der Bundesrat sei zu rechts positioniert. Die Ansicht, er sei
zu links wird hauptsächlich durch SVP-Wähler:innen geteilt.
Beurteilung der Ausrichtung des Bundesrats – nach Partei (Abb. 24)
«Wie schätzen Sie die politische Ausrichtung des Bundesrats in dieser Legislatur ein?»
Gesamt
31 45 24
Nach Parteipräferenz
Grüne 4 35 61
Eher zu links
SP 48 50 Gerade richtig
Eher zu rechts
GLP 10 64 25
Die Mitte 15 71 14
FDP 31 65 4
SVP 79 19
0% 25% 50% 75% 100%
4.2. BUNDESRATS-RATING: EINFLUSS
Ein fester Bestandteil des SRG SSR Wahlbarometers bildet
das Rating der Bundesratsmitglieder. Diese zeigt, welche Bun-
desratsmitglieder aus Sicht der Bevölkerung als einflussreich
und welche als sympathisch eingeschätzt werden. Geht es
um den Einfluss der Bundesrät:innen, zeigt sich eine enorme,
wahrgenommene Dominanz von Alain Berset (SP). 76 Prozent
zählen ihn gegenwärtig zu den zwei Mächtigsten im Amt. Fast
ebenso viele (70 %) zählen Ignazio Cassis (FDP) zu den zwei
Ratsmitgliedern mit dem geringsten Einfluss.31 SRG SSR Wahlbarometer
Einschätzung des Einflusses der Bundesratsmitglieder (Abb. 25)
«Was denken Sie: Welche beiden Bundesräte oder Bundesrätinnen üben am meisten Einfluss aus?» und «Was denken
Sie: Welche beiden Bundesräte oder Bundesrätinnen können am wenigsten Einfluss ausüben?»
Alain Berset 74
Karin Keller-Sutter -14 31
Ueli Maurer -20 29
viel Einfluss
Simonetta Sommaruga -19 25
wenig Einfluss
Guy Parmelin -24 21
Viola Amherd -36 8
Ignazio Cassis -70
-80% -40% 0% 40% 80%
Ihn der Wahrnehmung der Stimmberechtigten galt Bundesrat
Alain Berset (SP) bereits vor Beginn der Covid-19-Pandemie als
besonders einflussreich. Es erstaunt nicht, dass der Gesundheits-
minister nach 20 Monaten Pandemie noch einmal einen deut-
lichen Sprung im Rating gemacht hat. Neben Berset hat einzig
Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) hat aus Sicht der Befrag-
ten seit 2019 an Einfluss gewonnen. Deutlich zurückgefallen ist
dagegen Karin Keller-Sutter (FDP). Als am wenigsten Einfluss-
reich gelten allerdings Viola Amherd (Die Mitte) sowie Ignazio
Cassis (FDP).SRG SSR Wahlbarometer 32
Einfluss der Bundesratsmitglieder – Zeitvergleich. (Abb. 26)
Bundesräte mit besonders grossem Einfluss. Maximal zwei Nennungen.
9
9
1
9
9
1
9
9
1
9
9
1
01
01
02
01
01
02
01
01
02
01
01
02
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
02
10
10
02
10
10
02
10
10
02
10
10
74
60%
56
50 51
46
40% 39
31 31
29 29
24 25
20%
0%
Alain Berset Karin Keller-Sutter Ueli Maurer Simonetta Sommaruga
60%
40%
20% 21
19
14
8 10
4 4 5
3
0%
Guy Parmelin Viola Amherd Ignazio Cassis
Die Anhängerschaften der Parteien unterscheiden sich in Vie-
lem. Nicht jedoch in ihrer Einschätzung darüber, wer der Mäch-
tigste im Bundesrat ist und wer am wenigsten Einfluss hat. Für
die Anhängerschaften aller Parteien ist Alain Berset der Einfluss-
reichste und Ignazio Cassis jener mit dem geringsten Einfluss.33 SRG SSR Wahlbarometer
Einfluss der Bundesratsmitglieder – nach Partei (Abb. 27)
«Was denken Sie: Welche beiden Bundesräte oder Bundesrätinnen üben am meisten Einfluss aus?» und «Was denken
Sie: Welche beiden Bundesräte oder Bundesrätinnen können am wenigsten Einfluss ausüben?»
SVP SP
Alain Berset 65 Alain Berset 80
Ueli Maurer 43 Simonetta Sommaruga 35
Guy Parmelin −18 29 Karin Keller−Sutter 31
Karin Keller−Sutter 22 Ueli Maurer −25 21
Simonetta Sommaruga −27 20 Guy Parmelin −26 15
Viola Amherd −44 Viola Amherd −34
Ignazio Cassis −58 Ignazio Cassis −77
−100% −50% 0% 50% 100% −100% −50% 0% 50% 100%
FDP Die Mitte
Alain Berset 72 Alain Berset 75
Karin Keller−Sutter 44 Karin Keller−Sutter 38
Ueli Maurer 25 Simonetta Sommaruga 22
Simonetta Sommaruga −22 18 Viola Amherd −25 18
Guy Parmelin −26 21 Ueli Maurer −28 19
Viola Amherd −37 Guy Parmelin −27 18
Ignazio Cassis −70 Ignazio Cassis −79
−100% −50% 0% 50% 100% −100% −50% 0% 50% 100%
Ansonsten kommen zumindest in der Tendenz auch parteipoliti-
sche Optiken zum Ausdruck. Die Bundesräte der eigenen Partei
werden tendenziell eher als einflussreicher eingeschätzt.SRG SSR Wahlbarometer 34
4.3. BUNDESRATS-RATING: SYMPATHIE
Einschätzung der Bundesratsmitglieder nach Sympathie (Abb. 28)
«Welche Bundesräte und Bundesrätinnen sind Ihrer Meinung nach besonders sympathisch?»
Alain Berset 32 27 15 8 18
Viola Amherd 22 35 28 9 5
sehr sympathisch
Simonetta Sommaruga 24 28 17 13 18
eher sympathisch
Karin Keller-Sutter 14 32 30 15 10
teils / teils
eher nicht sympathisch
Guy Parmelin 10 32 34 16 8
gar nicht sympathisch
Ueli Maurer 17 18 20 19 27
Ignazio Cassis 4 19 37 23 17
0% 25% 50% 75% 100%
Weniger unausgeglichen als die wahrgenommene Verteilung
des Einflusses im Bundesrat ist die Verteilung der Sympathie
auf die Ratsmitglieder. Zwar sind an den beiden Enden der
Sympathie-Rangliste dieselben Exponenten finden wie beim
Einfluss-Rating. Alain Berset liegt jedoch nur wenig vor Viola
Amherd (Die Mitte). Wobei letztere im Unterschied zu ersterem
fast niemand hat, der als nicht so symphytisch einschätzt. Wenig
neutrale Einschätzungen gibt es zu Alain Berset, aber auch zu
Simonetta Sommaruga sowie zu Ueli Maurer.35 SRG SSR Wahlbarometer
Sympathie der Bundesratsmitglieder– Zeitvergleich (Abb. 29)
Anteil sehr und eher symphatich
9
9
1
9
9
1
9
9
1
9
9
1
01
01
02
01
01
02
01
01
02
01
01
02
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
02
10
10
02
10
10
02
10
10
02
10
10
70
64 64
60% 60 61
59 57 58
52
50 48
45
40%
20%
0%
Alain Berset Viola Amherd Simonetta Sommaruga Karin Keller-Sutter
60%
42 42
40% 38
35
27 26
22 24 24
20%
0%
Guy Parmelin Ueli Maurer Ignazio Cassis
Die Sympathiewerte der meisten Bundesratsmitglieder haben
sich seit 2019 nur wenig verändert. Ein deutliches Plus weisst
einzig Guy Parmelin auf. Er hat seine Rolle als Bundespräsident
des zweiten Pandemiejahres genutzt, um seinen Rückhalt in
der Bevölkerung deutlich zu verbessern. Demgegenüber hat
die Anfang 2019 mit viel Vorschusslorbeeren ins Amt gestartete
Karin Keller-Sutter weiter an Sympathiewerten eingebüsst.Datenerhebung
und Methode
Die Datenerhebung des SRG SSR Wahlbarometers fand
zwischen dem 29. September und dem 3. Oktober 2021
statt. Die Befragung erfolgte online, die Teilnehmenden
wurden einerseits über die Webportale von SRG SSR,
andererseits via Online-Panel von Sotomo rekrutiert.
Nach der Bereinigung und Kontrolle der Daten
konnten die Angaben von 27‘976 Stimmberechtigten für
die Auswertung verwendet werden (Deutschschweiz:
23‘611, Franz. Schweiz: 3‘828, Ital. Schweiz: 537).
Da sich die Teilnehmenden der Umfrage selber rekrutieren (opt-
in), ist die Zusammensetzung der Stichprobe nicht repräsentativ
für die Grundgesamtheit. So nehmen typischerweise mehr Män-
ner als Frauen an politischen Umfragen teil. Den Verzerrungen
in der Stichprobe wird mittels statistischer Gewichtungsver-
fahren entgegengewirkt. Die Gewichtung erfolgt dabei mittels
IPF-Verfahren (Iterative Proportional Fitting). Neben räumli-
chen (Wohnort) und soziodemographischen (Alter, Geschlecht,
Bildung) Gewichtungskriterien werden dabei auch politische
Gewichtungskriterien beigezogen (Stimm- und Wahlverhalten,
regionale Parteienstruktur usw.). Durch die Gewichtung wird
eine hohe Repräsentativität für die aktive Stimmbevölkerung
erzielt. Der Stichprobenfehler, wie er für Zufallsstichproben
berechnet wird, lässt sich nicht direkt auf politisch gewichtete
opt-in Umfragen übertragen. Die Repräsentativität dieser Be-
fragung ist jedoch vergleichbar mit einer Zufallsstichprobe mit
einem Stichprobenfehler von +/-1,3 Prozentpunkten.
36Sie können auch lesen