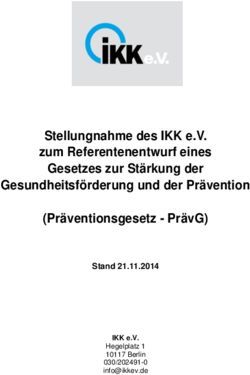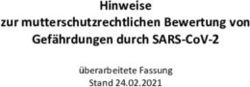Stellungnahme der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vom 04.04.2019 zur öffentlichen Anhörung zum ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stellungnahme der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vom 04.04.2019 zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (Drucksache 19/8753)
I. Allgemeines
Der Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) hat
insbesondere das Ziel, Maßnahmen für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
aufgrund von Vollzugserfahrungen und Vorkommnissen, wie z. B. mit gefälschten bzw.
verunreinigten Arzneimitteln, umzusetzen. Daneben beinhaltet der Entwurf aber auch diverse
Regelungen, welche verschiedene Aufgabenbereiche des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) in der Arzneimittelversorgung betreffen.
So begrüßen die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA ausdrücklich, dass der
G-BA die Möglichkeit erhalten soll, weitere Datenerhebungen nach der Zulassung zum Zweck
der Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen zu fordern und die Verordnung
dieser Arzneimittel auf solche Vertragsärztinnen und -ärzte zu beschränken, die an der
anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Darüber hinaus wird begrüßt, dass der
G-BA zur Gewährleistung einer sachgerechten Anwendung von Arzneimitteln für neuartige
Therapien ermächtigt wird, Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beschließen und die
Versorgung von Versicherten mit diesen Arzneimitteln an die Erfüllung der
Qualitätsanforderungen zu knüpfen.
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen auch, dass zur Bestimmung
des Umsatzes mit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Arzneimittel, die zur
Behandlung eines seltenen Leidens zugelassen sind (sog. Orphan-Drugs), künftig sowohl die
ambulanten als auch stationären Ausgaben in der GKV heranzuziehen sind. Auch die in
diesem Zusammenhang vorgesehene Mitwirkungspflicht der pharmazeutischen Unternehmer
wird begrüßt.
Anstelle einer Beteiligung der Fachgesellschaften an den Beratungen der pharmazeutischen
Unternehmen durch den G-BA sollten diese bei der Erstellung von evidenzbasierten Leitlinien
fach- und sachgerechte Unterstützung erhalten, damit sich die klinische Expertise im
Zusammenspiel mit aktueller, systematischer Evidenzaufbereitung zeitnah in den
medizinischen Empfehlungen der Fachgesellschaften widerspiegeln. Denn auch die
Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie im Verfahren der Nutzenbewertung nach
§ 35a SGB V durch den G-BA basiert auf einer systematischen Literaturrecherche zum
allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse. Über diesen Weg finden
Leitlinien der Fachgesellschaften Berücksichtigung und gewährleisten so bereits jetzt eine
regelhafte Einbindung der klinischen Expertise von Fachgesellschaften in die Beratungen des
G-BA.
In Bezug auf die vorgesehenen Änderungen zur (Weiter-)Verordnung von
Cannabisarzneimitteln bei stationärem Therapiebeginn oder Therapieanpassungen weisen
die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA darauf hin, dass auch in diesen Fällen
eine begründete Einschätzung des Vertragsarztes für die Begleiterhebung erforderlich ist,
damit letztere nach ihrem Abschluss auch als Grundlage zur späteren Regelung der
Einzelheiten für die Leistungsgewährung dienen kann.
Die Änderung des § 31 Abs. 1a Satz 2 SGB V wird ausdrücklich begrüßt, da auf dieser
Grundlage eine Grenzziehung zwischen Verbandmitteln und sonstigen Produkten zur
Wundbehandlung einerseits rechtssicher erfolgen kann und zudem eine evidenzbasierte
Fortentwicklung der Versorgung mit dem Ziel sachgerechter und qualitativ hochwertiger
Leistungen für die Versicherten mit Wundmitteln fördert.
Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Bemerkungen zum Entwurf des GSAV im Einzelnen
verwiesen.
2Inhalt
Zu Artikel 1 „Änderungen des Arzneimittelgesetzes“ ...................................................... 4
Zu Artikel 6 „Änderungen des Transfusionsgesetzes“ und Artikel
7 „Änderung der Transfusionsgesetz-Meldeverordnung“ ............................................... 5
Zu Artikel 12 „Änderungen des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch“ .............................................................................................................. 5
Zu Artikel 13 „Änderung der Arzneimittel-
Nutzenbewertungsverordnung“ ........................................................................................27
Zum fachfremden Änderungsantrag 4: Artikel 12 Nummer 0 (§ 20i
Absatz e Fünftes Buch Sozialgesetzbuch) .......................................................................30
3II. Einzelbemerkungen
Zu Artikel 1 „Änderungen des Arzneimittelgesetzes“
Nummer 14:
§ 47 Arzneimittelgesetz
Vertriebsweg
Bewertung:
Die vorgesehene Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG), die die Ausnahme vom
Vertriebsweg nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AMG auf aus menschlichem Blut
gewonnene Blutzubereitungen (insbesondere labile zelluläre Blutzubereitungen sowie
Plasma zur Transfusion) beschränkt und keine biotechnologisch hergestellten
Blutbestandteile mehr mit einbezieht, wird begrüßt. Es gibt keine Kriterien, die eine
Ausnahme dieser Arzneimittel von dem üblichen Vertriebsweg begründen würden, da
von keinen besonderen Risiken durch diese Arzneimittel auszugehen ist, die sich von
den anderen biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen unterscheiden. Die bisherige
Unterscheidung des Vertriebsweges für biotechnologische Arzneimittel zwischen
rekombinant hergestellten Blutbestandteilen und rekombinant hergestellten anderen
Wirkstoffen wird aufgehoben und somit eine sachgerechte Gleichbehandlung in Bezug
auf den Vertriebsweg und somit auch in Bezug auf den Geltungsbereich der
Arzneimittelpreisverordnung hergestellt.
Nummer 20:
§ 63j Arzneimittelgesetz (neu)
Dokumentations- und Meldepflichten der behandelnden Person für nicht zulassungs- oder
genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige Therapien
Bewertung:
Die vorgesehene Änderung des AMG zu den Dokumentations- und Meldepflichten der
behandelnden Person für nicht zulassungs- oder genehmigungspflichtige Arzneimittel
für neuartige Therapien werden begrüßt. Insbesondere aufgrund der Besonderheit
dieser Produkte sind im Sinne der Patientensicherheit ebenso die bei der Anwendung
dieser Arzneimittel auftretenden Risiken zentral zu erfassen und auszuwerten.
Nummer 23:
§ 67 Arzneimittelgesetz
Allgemeine Anzeigepflicht
Bewertung zu lit. c) – Absatz 9 neu:
Die vorgesehene Änderung des AMG zur Anzeigepflicht der Anwendung nicht
zulassungs- oder genehmigungspflichtiger Arzneimittel für neuartige Therapien bei der
zuständigen Bundesoberbehörde wird begrüßt.
4Zu Artikel 6 „Änderungen des Transfusionsgesetzes“ und Artikel 7 „Änderung der
Transfusionsgesetz-Meldeverordnung“
Bewertung:
Die vorgesehenen Änderungen im Transfusionsgesetz sowie in der
Transfusionsgesetz–Meldeverordnung, die alle Arzneimittel, welche zur Therapie von
Gerinnungsstörungen bei Hämophilie eingesetzt werden, in die entsprechenden
Dokumentations-, Unterrichtungs- und Meldepflichten einbezieht, werden begrüßt.
Damit können auch Daten zu neuartigen Wirkstoffen zur Behandlung von
Gerinnungsstörungen unter Nutzung der bereits vorhandenen Erhebungs- und
Meldestrukturen in diesem Bereich zentral gesammelt und ggf. für eine vergleichende
Bewertung im Rahmen der Nutzenbewertung, auch im Hinblick auf epidemiologische
Daten, Daten zu Therapiesequenzen und -regimen sowie Daten zur langfristigen
Sicherheit und Wirksamkeit, nutzbar gemacht werden.
Zu Artikel 12 „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“
Nummer 1:
§ 31 SGB V
Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung
Zu lit. a) Absatz 1a wird wie folgt geändert:
Zu aa):
Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend
weitere Wirkungen entfaltet, die ohne pharmakologische, immunologische oder
metabolische Wirkungsweise im menschlichen Körper der Wundheilung dienen,
beispielsweise, indem er eine Wunde feucht hält, reinigt, geruchsbindend oder
antimikrobiell ist.“
Bewertung:
Diese Änderung des § 31 Abs. 1a Satz 2 SGB V wird ausdrücklich begrüßt, da sich
auf dieser Grundlage eine Grenzziehung zwischen Verbandmitteln und sonstigen
Produkten zur Wundbehandlung durch den G-BA hinreichend rechtssicher vornehmen
lässt.
Die Klarstellung, dass zu den ergänzenden Eigenschaften eines Verbandmittels nur
solche Wirkungen zuzuordnen sind, die ohne pharmakologische, immunologische oder
metabolische Wirkungsweise im menschlichen Körper der Wundheilung dienen,
ermöglicht es dem G-BA zum einen anhand von einheitlich geltenden und abstrakt
generellen Leitkriterien eine Abgrenzung zwischen Verbandmitteln mit ergänzenden
Eigenschaften und sonstigen Produkten zur Wundbehandlung vorzunehmen. Zum
anderen ist es angemessen, sonstige Produkte zur Wundbehandlung, welche aufgrund
pharmakologischer, immunologischer oder metabolischer Wirkweise der Wundheilung
dienen können, einer fundierten Überprüfung hinsichtlich ihres therapeutischen
5Nutzens und der medizinischen Notwendigkeit zuzuführen. Dies dient vor allem der
Sicherheit und dem Schutz der Patienten vor unwirksamen Therapieansätzen. Denn
zur Wundversorgung kommen vermehrt komplexe Produkte auch mit höheren Preisen
in den Markt und in die GKV-Versorgung, denen neben der ein Verbandmittel
klassischerweise auszeichnenden abdeckenden und aufsaugenden Funktion weitere
– auch ggf. als untergeordnet deklarierte – (die physikalische Wundversorgung)
überlagernde Funktionen zugeschrieben werden, ohne dass diese Zusatzfunktionen
einer systematischen Bewertung unterzogen würden. Die nunmehr nach dem
Gesetzeswortlaut mögliche und eindeutige Differenzierung zwischen Verbandmitteln
und sonstigen Produkten zur Wundversorgung ist geeignet, einen wichtigen Beitrag zur
Verbesserung der Versorgung der Versicherten in diesem Bereich zu leisten. Denn es
kann zukünftig sichergestellt werden, dass nur solche sonstigen Produkte zur
Wundversorgung zu Lasten der GKV verordnungsfähig sind, wenn sie medizinisch
notwendig im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V sind und daher in der
Wundversorgung gegenüber „klassischen“ Verbandmitteln auch einen nach den
Maßstäben der Evidenzbasierten Medizin belegten Mehrwert für die Patienten
bedeuten.
Zu lit. c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
Zu aa):
In Satz 3 werden nach der Angabe „§ 37b“ die Wörter „oder im unmittelbaren
Anschluss an eine Behandlung mit einer Leistung nach Satz 1 im Rahmen eines
stationären Krankenhausaufenthalts“ eingefügt.
Bewertung:
Bereits zum Gesetzgebungsverfahren zur Einführung des Leistungsanspruchs nach
§ 31 Abs. 6 SGB V hatten die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA auf
die Bedeutung einer geeigneten und aussagefähigen Evidenzgrundlage zur Regelung
der Einzelheiten der Leistungsgewährung nach Abschluss der vorgesehenen
Begleiterhebung hingewiesen. Die gemäß Cannabis-Begleiterhebungs-Verordnung
(CanBV) durchgeführte Datenerhebung stellt aus Sicht der hauptamtlichen
unparteiischen Mitglieder des G-BA diesbezüglich ein Mindestmaß dar. Dieses
Mindestmaß darf durch die Umsetzung der vorgesehenen Änderungen in § 31 Abs. 6
SGB V nicht weiter beschnitten werden.
Vor diesem Hintergrund begrüßen die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-
BA, dass es gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf für eine unmittelbare
Anschlussbehandlung mit Cannabisprodukten nach Beginn der Behandlung im
Rahmen eines stationären Krankenhausaufenthalts weiterhin einer Genehmigung der
Krankenkasse bedarf. Dieser Genehmigungsvorbehalt stellt sicher, dass der
verordnende Arzt im Rahmen der Antragstellung zu einer begründeten Einschätzung
für den Einsatz von Cannabisprodukten kommt und sich entsprechend mit den Fragen
auseinandersetzt, die später im Rahmen der Begleiterhebung erfasst werden. Der
hierbei eingesetzte Erhebungsbogen enthält insbesondere durch den in § 1 Nr. 4
CanBV geregelten Datenumfang („Angaben zu vorherigen Therapien, einschließlich
der Beendigungsgründe wie mangelnder Therapieerfolg, unverhältnismäßige
Nebenwirkungen, Kontraindikation“) auch Erwägungsgründe für die Entscheidung, den
Patienten mit Leistungen gemäß § 31 Abs. 6 Satz 1 SGB V zu versorgen, welche
beispielsweise den Vergleich zu möglichen Therapiealternativen adressieren. Diese
6Erwägungsgründe sind in Hinblick auf eine zukünftige Regelung der Einzelheiten der
Leistungsgewährung aus Sicht der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA
von besonderer Bedeutung und daher grundlegend.
Zu bb):
Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Leistungen, die auf der Grundlage einer Verordnung einer Vertragsärztin oder eines
Vertragsarztes zu erbringen sind, bei denen allein die Dosierung eines Arzneimittels
nach Satz 1 angepasst wird oder die einen Wechsel zu anderen getrockneten Blüten
oder zu anderen Extrakten in standardisierter Qualität anordnen, bedürfen keiner
erneuten Genehmigung nach Satz 2. Bei einer vertragsärztlichen Verordnung nach
Satz 4 besteht der Anspruch nach Satz 1 auch, ohne dass die Voraussetzung nach
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist.“
Bewertung:
Einen Wechsel zwischen Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder zwischen
Cannabisextrakten oder eine Dosisanpassung soll der Vertragsarzt künftig ohne
Genehmigung der Krankenkasse vornehmen können. Im Sinne der Begleiterhebung
gemäß CanBV gilt ein Wechsel der Cannabissorte oder eine Dosisanpassung zwar
nicht als Therapieabbruch, sondern als Therapieanpassung und erfordert keine
gesonderte Datenübermittlung (Cremer-Schaeffer et al. Deutsches Ärzteblatt
2017;114(4):A677-679).
Im Stellungnahmeverfahren zur CanBV hatten die hauptamtlichen unparteiischen
Mitglieder des G-BA bereits darauf hingewiesen, dass Mehrfacherhebungen desselben
Datensatzes (d. h. die Anwendung einer Leistung nach § 31 Abs. 6 SGB V in Bezug
auf denselben Patienten) vor dem Hintergrund der anonymisierten Datenerfassung und
der fehlenden Möglichkeit, die erhobenen Datensätze auf Patientenebene zu
verknüpfen, die Interpretation der erhobenen Daten erschweren. Erhebungsbögen
können lediglich der Kategorie „Patienten, die nach Abbruch einer Therapie mit einem
Cannabisarzneimittel mit einem anderen Cannabisarzneimittel behandelt wurden […]“
zugeordnet werden (Cremer-Schaeffer et al. Deutsches Ärzteblatt 2017;114(4):A677-
679). Insofern ist aus Sicht der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA die
Erfassung von Therapieanpassungen auf einem Erhebungsbogen, wie sie derzeit
erfolgt, zielführend.
Die Kriterien für die Auswahl einer bestimmten, „bestgeeigneten“ Sorte durch die
Verordnenden und deren Strategien zur Dosisfindung stellen für die hauptamtlichen
unparteiischen Mitglieder des G-BA relevante Informationen zur Therapieanpassung
dar. Um auch diese als Entscheidungsgrundlage heranziehen zu können, ist aus Sicht
der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA daher eine begründete
Einschätzung des Vertragsarztes nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, und
entsprechend eine Prüfung, ob die Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist
zum Zeitpunkt der Therapieanpassung, die dann zum Zeitpunkt der Datenübermittlung
im Rahmen der Begleiterhebung in den Erhebungsbogen einfließt, weiterhin
erforderlich.
7Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, Satz 5 (neu) zu streichen.
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„bb) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Leistungen, die auf der Grundlage einer Verordnung einer Vertragsärztin oder eines
Vertragsarztes zu erbringen sind, bei denen allein die Dosierung eines Arzneimittels
nach Satz 1 angepasst wird oder die einen Wechsel zu anderen getrockneten Blüten
oder zu anderen Extrakten in standardisierter Qualität anordnen, bedürfen keiner
erneuten Genehmigung nach Satz 2. Bei einer vertragsärztlichen Verordnung nach
Satz 4 besteht der Anspruch nach Satz 1 auch, ohne dass die Voraussetzung nach
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist.“
Nummer 2:
§ 35a SGB V
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
Zu lit. a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) – dd) – Änderungen in den Sätzen 9, 11, 12, und 13:
Bewertung:
Zunächst sind die vorgesehenen Änderungen zu den Regelungen zur Bestimmung des
Umsatzes mit der gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel, die zur
Behandlung eines seltenen Leidens zugelassen sind (sog. Orphan-Drugs),
begrüßenswert. Für Orphan-Drugs gilt bislang bis zu einem Umsatz von 50 Millionen
Euro der Zusatznutzen als belegt. Erst bei Überschreiten der 50 Millionen Euro
Umsatzgrenze hat das pharmazeutische Unternehmen den Zusatznutzen gegenüber
der zweckmäßigen Vergleichstherapie nachzuweisen. Es ist vorgesehen, dass künftig
bei der Feststellung des Erreichens der Umsatzgrenze nicht ausschließlich die
Angaben nach § 84 Abs. 5 Satz 4 SGB V, welche sich allein auf die ambulanten
Verordnungsdaten beziehen, sondern sowohl die ambulanten als auch stationären
Ausgaben der Krankenkassen für das Arzneimittel heranzuziehen sind. Damit wird im
Sinne der Gleichbehandlung ähnlicher Sachverhalte zur Erfassung der Ausgaben für
Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen folgerichtig ein einheitliches Monitoring für von der
Nutzenbewertung freigestellte Arzneimittel im Sinne des § 35a Abs. 1a SGB V
einerseits und Orphan-Drugs andererseits erreicht.
Die Ausgaben einiger kostenintensiver nutzenbewerteter Arzneimittel (z. B. über
500 000 €/Jahr) spiegeln sich trotz einer im Beschluss nach § 35a SGB V festgestellten
relevanten Anzahl an in Frage kommenden Patientinnen und Patienten in der GKV–
Zielpopulation, nur zu einem kleinen Teil in den ermittelten ambulanten Kosten zu
Lasten der GKV wider. Dies ist in einem hohen Anteil stationär abgegebener
Arzneimittel begründet, sodass der Anteil der im nicht vertragsärztlichen Sektor
behandelten Patientinnen und Patienten somit um ein Vielfaches den Anteil der im
ambulanten Bereich Behandelten übersteigt. Die mit dem Beschluss nach § 35a
8SGB V getroffenen Feststellungen zum Zusatznutzen des Arzneimittels entfalten
jedoch verbindliche Wirkungen auch für den stationären Bereich und es wird nicht
zwischen einer Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln im ambulanten und
stationären Sektor unterschieden. Der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V liegt somit
ein sektorenübergreifender Bewertungsansatz zugrunde. Folglich ist eine
Unterscheidung zwischen Orphan-Drugs, deren Umsätze vorwiegend im stationären
Bereich erzielt werden und denjenigen, deren Umsätze vorwiegend im ambulanten
Bereich erzielt werden, in Bezug auf die Feststellung des Überschreitens der 50
Millionen Euro Umsatzgrenze nicht gerechtfertigt.
Zu ee):
Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Zu diesem Zweck teilt der pharmazeutische Unternehmer dem Gemeinsamen
Bundesausschuss auf Verlangen die erzielten Umsätze des Arzneimittels mit der
gesetzlichen Krankenversicherung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung mit.
Abweichend von Satz 11 kann der pharmazeutische Unternehmer für Arzneimittel, die
zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000
zugelassen sind, dem Gemeinsamen Bundesausschuss unwiderruflich anzeigen, dass
eine Nutzenbewertung nach Satz 2 unter Vorlage der Nachweise nach Satz 3 Nummer
2 und 3 durchgeführt werden soll.“
Bewertung:
Die vorgesehenen Ergänzungen hinsichtlich einer Mitwirkungspflicht des
pharmazeutischen Unternehmers zur Feststellung der 50 Millionen Euro
Umsatzgrenze und die Klarstellung, dass die Informationen zum Umsatz des
pharmazeutischen Unternehmens mit dem Arzneimittel außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung ausschließlich an den Zweck des Monitorings gebunden
sind, werden begrüßt.
Ebenso wird die Einführung eines Wahlrechtes für die pharmazeutischen
Unternehmen, bei Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Drugs) auf die vom
Gesetzgeber eingeräumten Verfahrenserleichterungen in § 35a Abs. 1 Satz 11 SGB V
bei der Nutzenbewertung zu verzichten, begrüßt.
Die ergänzend vorgeschlagene Regelung bezogen auf Arzneimittel für neuartige
Therapien (ATMPs) bezweckt, dass die Nutzenbewertung von zugelassenen ATMP im
Sinne von § 4 Abs. 9 AMG ausschließlich dem Geltungsbereich der Nutzenbewertung
nach § 35a SGB V zugeordnet werden. Insoweit wird mit den Wörtern „Als Arzneimittel
im Sinne von Satz 1 gelten auch…“ klargestellt, dass zugelassene ATMP Arzneimitteln
mit neuen Wirkstoffen im Sinne des § 35a SGB V gleichgestellt werden. Mit dem Wort
„zugelassene“ vor den Wörtern „Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne von § 4
Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes“ wird klargestellt, dass von der Zuordnung von
ATMP im Sinne von § 4 Abs. 9 AMG zum Geltungsbereich der Nutzenbewertung nach
§ 35a SGB V lediglich die von der Europäischen Kommission zentral zugelassenen
Arzneimittel erfasst sind. Für die ebenfalls von § 4 Abs. 9 AMG erfassten ATMP,
namentlich die nach § 4b AMG genehmigten ATMP oder ATMP, die keiner Zulassungs-
bzw. Genehmigungspflicht unterliegen, da sie patientenindividuell von einem Arzt
hergestellt werden, gilt die Regelung nicht.
Die Regelung ist sachgerecht, weil im Zulassungsverfahren für ATMP nach § 4 Abs. 9
AMG die wirksamen Bestandteile des Arzneimittels einschließlich der für die
9Anwendung des ATMP erforderlichen ärztlichen Behandlungsmaßnahmen, der sog.
Methodenanteil, im Zulassungsverfahren im Rahmen der Zulassungsprüfung unter den
materiellen Zulassungskriterien (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit) gleich
einem „normalen“ Fertigarzneimittel geprüft und nach erfolgreicher Prüfung
arzneimittelrechtlich wie jene als Fertigarzneimittel zum Verkehr zugelassen werden.
Es bedarf damit keiner vorgängigen Entscheidung im G-BA mehr darüber, welchem
Bewertungsregime (Arzneimittelnutzenbewertung nach § 35a SGB V oder
Methodenbewertung nach §§ 135 und 137c SGB V) ein zugelassenes ATMP im
Einzelfall nach den vom Bundessozialgericht (BSG) aufgestellten Kriterien (vgl. BSG,
Urteil vom 19.10.2004 – B 1 KR 27/02 R – Visudyne) zuzuordnen ist. Dies kommt in
der Wendung „unabhängig von Art und Umfang des für die Anwendung dieser
Arzneimittel aufzuwendenden ärztlichen Behandlungsanteils“ zum Ausdruck. Damit
unterliegen ärztliche Behandlungsmaßnahmen, z. B. operative Maßnahmen, die nach
der Zulassung erforderlich sind, um ein ATMP in den menschlichen Organismus
einzubringen, damit es seine Wirkung entfalten kann (z. B. das Implantieren von
Gewebe), grundsätzlich nicht der Methodenbewertung. Voraussetzung hierfür ist, dass
die ärztliche Behandlung und die Anwendung des Arzneimittels eine untrennbare
Einheit darstellen. Insoweit gelten die §§ 135 und 137c nicht (vgl. Halbsatz 2 der
Regelung). Im Umkehrschluss folgt daraus, dass immer dann, wenn im Rahmen der
Arzneimittelanwendung eine Methode zum Einsatz kommt, die losgelöst von den
ärztlichen Behandlungsmaßnahmen im engeren Sinne zur Einbringung des
Arzneimittels in den menschlichen Organismus betrachtet werden kann, die Methode
dem Bewertungsregime der §§ 135 und 137c SGB V unterliegt. Das gilt insbesondere
für diagnostische Maßnahmen, sofern sie nicht dem Tatbestand des § 87 Abs. 5b
Satz 5 SGB V unterfallen. Einer teilweisen Aufrechterhaltung des Erlaubnisvorbehalts
in § 135 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V für die Regelung von Qualifikationsanforderungen
für insbesondere behandelnde Ärztinnen und Ärzte oder die Veranlassung von
bestimmten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anwendung des ATMP bedarf es
nicht, da insoweit eine spezielle Ermächtigungsgrundlage für die Regelung von
Anforderungen an die qualitätsgesicherte Anwendung von ATMP mit § 136a Abs. 5
SGB V neu i. d. F. des GSAV geschaffen wird.
Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, einen weiteren Satz anzufügen, mit dem geregelt wird,
dass zukünftig alle zugelassenen Arzneimittel für besondere Therapien (ATMP)
grundsätzlich dem Geltungsbereich des § 35a SGB V unterfallen.
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„ee) Folgende Sätze werden angefügt:
„Zu diesem Zweck teilt der pharmazeutische Unternehmer dem Gemeinsamen
Bundesausschuss auf Verlangen die erzielten Umsätze des Arzneimittels mit der
gesetzlichen Krankenversicherung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung mit.
Abweichend von Satz 11 kann der pharmazeutische Unternehmer für Arzneimittel, die
zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000
zugelassen sind, dem Gemeinsamen Bundesausschuss unwiderruflich anzeigen, dass
eine Nutzenbewertung nach Satz 2 unter Vorlage der Nachweise nach Satz 3 Nummer
2 und 3 durchgeführt werden soll. Als Arzneimittel im Sinne von Satz 1 gelten auch
zugelassene Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des
Arzneimittelgesetzes unabhängig von Art und Umfang des mit der Anwendung dieser
10Arzneimittel untrennbar verbundenen ärztlichen Behandlungsanteils; insoweit gelten
die §§ 135 und 137c nicht.“
Zu lit. b) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt:
„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann bei den folgenden Arzneimitteln vom
pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage
anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der
Nutzenbewertung fordern:
1. bei Arzneimitteln, deren Inverkehrbringen nach dem Verfahren des Artikels
14 Absatz 7 oder Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung
von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von
Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen
Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1), die zuletzt durch die
Verordnung (EU) Nr. 1027/2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 38) geändert
worden ist, genehmigt wurde, sowie
2. bei Arzneimitteln, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann die Befugnis zur Verordnung eines solchen
Arzneimittels zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung auf solche
Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser beschränken, die an der geforderten
anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Die näheren Vorgaben an die
Dauer, die Art und den Umfang der Datenerhebung oder die Auswertung, einschließlich
der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss
bestimmt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-
Ehrlich-Institut sind vor Erlass einer Maßnahme nach Satz 1 zu beteiligen. Das Nähere
zum Verfahren der Anforderung von anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder
von Auswertungen, einschließlich der Beteiligung nach Satz 4, regelt der Gemeinsame
Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. Die gewonnenen Daten und die
Verpflichtung zur Datenerhebung sind in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
jährlich, vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu überprüfen. Für Beschlüsse nach
den Sätzen 1 und 2 gilt Absatz 3 Satz 4 bis 6 entsprechend.“
Bewertung:
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen den vorliegenden
Entwurf und die Möglichkeit des G-BA, weitere Datenerhebungen nach der Zulassung
zum Zweck der Nutzenbewertung zu fordern, da dies eine wesentliche Grundlage für
die weitere Evidenzgenerierung für Arzneimittel während der Anwendung in der
klinischen Praxis schafft, bei denen die Evidenzlage zum Zeitpunkt der
Nutzenbewertung unzureichend ist. Es werden dennoch folgende Änderungen
vorgeschlagen:
Ersetzung des Wortes „anwendungsbegleitend“ durch „versorgungsbegleitend“
Der G-BA schlägt vor, in Satz 1 das Wort „anwendungsbegleitend“ durch das Wort
„versorgungsbegleitend“ zu ersetzen.
Der Begriff „versorgungsbegleitend“ knüpft an den in § 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m
§ 31 Abs. 1 Satz 1 SGB V normierten Anspruch der Versicherten auf „Versorgung“ mit
Arzneimitteln in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung an, der mit der
Formulierung in § 39 Abs. 1 Satz 3 SGB V, wonach die Krankenhausbehandlung auch
11die „Versorgung mit Arzneimitteln“ umfasst, seine Entsprechung für den stationären
Bereich findet. Damit soll sichergestellt werden, dass über das Wort
„anwendungsbegleitend“ rechtlich keine tatbestandliche Einengung hinsichtlich der in
Betracht kommenden Möglichkeiten zu begleitenden Datenerhebungen erfolgt, welche
aus fachlich-methodischer Sicht auch nicht gerechtfertigt wäre. Um das Instrument der
begleitenden Datenerhebung in zweckverwirklichender Weise zukunftsoffen und damit
hinreichend entwicklungsoffen einsetzen zu können, wird es daher als sachgerecht
angesehen, den Begriff „anwendungsbegleitend“ durch den Begriff
„versorgungsbegleitend“ zu ersetzen.
Gemäß Gesetzesbegründung kann es sich bei den Datenerhebungen z. B. um
Anwendungsbeobachtungen, Fall-Kontroll-Studien oder Registerstudien handeln,
solange die Datenerhebung „anwendungsbegleitend“ ist. Aus methodischer Sicht
könnten auch kontrollierte Studien (zum Beispiel pragmatische Studiendesigns)
versorgungsbegleitend durchgeführt werden und sollten von den möglichen
Datenerhebungen mit umfasst sein. Durch die Formulierung „anwendungsbegleitend“
werden ausschließlich Daten zu dem zu bewertenden Arzneimittel erhoben. Damit sich
die erhobenen Daten für die Nutzenbewertung eignen, sollte es nicht von vornherein
ausgeschlossen sein, dass mit den erhobenen Daten auch eine vergleichende
Betrachtung möglich ist. Dies ist beispielsweise bei Anwendungsbeobachtungen nicht
möglich, bei denen ausschließlich Erkenntnisse bei der Anwendung des einzelnen
Arzneimittels durch den pharmazeutischen Unternehmer gesammelt werden. Die
Erhebung von Daten alleinig für das bewertete Arzneimittel führt zu Verzerrungen in
der Bewertung der Ergebnisse, da eine Erfassung von alternativen Therapieoptionen
nicht umfasst ist. Datenerhebungen ohne wissenschaftlichen Mehrwert und ohne
transparente Veröffentlichung der Ergebnisse müssen auch im Rahmen der
begleitenden Datenerhebungsforderung vermieden werden.
Vor diesem Hintergrund bewerten die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-
BA es als kritisch, über erläuternde Hinweise zu medizinisch-methodischen
Fragestellungen in der Gesetzesbegründung den Anwendungsbereich der Norm unter
dem Gesichtspunkt „Datenerhebungen“ wieder einzuschränken. Die große Sachnähe
und fachliche Expertise des G-BA auf dem Gebiet der Nutzenbewertung von
Arzneimitteln verbunden mit dem Erfordernis einer regelhaften Abstimmung mit den
Bundesoberbehörden zu fachlichen Fragestellungen von Datenerhebungen
gewährleisten sachgerechte sowie methodisch-adäquate Entscheidungen im
jeweiligen Einzelfall.
Zum Beispiel wäre es durch die Einrichtung einer unabhängigen zentralen
Datenerfassung, z. B. im Rahmen eines klinischen Registers, prinzipiell möglich,
therapierelevante Krankheitsverlaufsdaten überregional produktunabhängig zu
erfassen und die im Regierungsentwurf bezweckte Verbesserung der
Evidenzgrundlage im Rahmen der Nutzenbewertung zu gewährleisten. Die
Übermittlung pseudonymisierter personenbezogener Daten aus diesen
Datenerhebungen an den G-BA zur Bewertung der Evidenz sollte nicht
ausgeschlossen sein.
Bei späterer Zulassung von Arzneimitteln mit gleichgelagerter Evidenzproblematik in
selbiger oder ähnlicher Indikation könnten die versorgungsbegleitenden Daten in das
gleiche Register, ggf. mit angepassten Modulen, eingepflegt werden, ohne dass neue
Strukturen aufgebaut werden müssen. Interoperabilitätsproblematiken, die mit der
Etablierung verschiedener Datenerhebungen entstehen, würden vermieden, und der
Aufbau von Parallelstrukturen unterbunden.
12Zudem wäre ein zentraler Ansprechpartner für Inhalte und Erweiterungen bezüglich
der Einzelheiten zum Datensatz von Registern verfügbar.
Aufgrund der erforderlichen Abstimmung mit etwaigen zulassungsbezogenen
Anforderungen und Auflagen könnten für eine derartige Datenerhebung die
Bundesoberbehörden oder andere qualifizierte Institutionen in den Fällen beauftragt
werden, in denen keine produktübergreifenden Register vorhanden sind.
Ergänzung des Wortes „insbesondere“ in Satz 1:
Gemäß der Gesetzesbegründung sollen randomisierte, verblindete, kontrollierte
Studien (RCT) explizit von den Regelungen in Absatz 3b ausgenommen sein. Danach
beschränken sich die ergänzenden Datenerhebungen grundsätzlich auf Arzneimittel in
Indikationen, in denen es unmöglich oder unangemessen ist, Studien höchster
Evidenzstufe durchzuführen oder zu fordern. Dies ist hauptsächlich bei Arzneimitteln
der Fall, die nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 7 und 8 der Verordnung (EG)
Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur
Behandlung eines seltenen Leidens zugelassen werden. Jedoch kann auch bei
anderen Zulassungsarten sehr eingeschränkte Evidenz vorliegen und die
Durchführung von RCTs nicht realisierbar sein, weshalb die Verknüpfung der
versorgungsbegleitenden Datenerhebung allein an die Zulassungsart nicht
vollumfassend ist. Beispielsweise kann ein pharmazeutischer Unternehmer auf die
Zulassung seines Arzneimittels als „Orphan-Drug“ verzichten oder der Orphan-Drug-
Status wird nach Zulassung eines weiteren Anwendungsgebietes aberkannt, obwohl
eine versorgungsbegleitende Datenerhebung weiterhin erforderlich wäre. Für solche
oder vergleichbare Fallgestaltungen sollte eine weitere Datenerhebung zum Zwecke
der Nutzenbewertung im Sinne dieser Regelung nicht ausgeschlossen sein und die
Möglichkeit ihrer Einbeziehung in den Anwendungsbereich der Norm geschaffen
werden. Hierfür kann es erforderlich sein, nach Zulassung, aber bereits vor dem
Inverkehrbringen eines Arzneimittels sich mit eventuellen weiteren Datenerhebungen
zu befassen, sofern absehbar ist, dass bei den Arzneimitteln eine weitere
Datenerhebung aufgrund der unzureichenden Evidenz und der nicht vertretbaren
Forderung nach randomisierten kontrollierten Studien erforderlich ist. Da nicht immer
im Vorfeld absehbar ist, welche Art der Zulassung letztendlich ausgesprochen wird,
könnten diese Beratungen ohne die Ausnahmeregelung vor Zulassung nicht beginnen.
Ersetzung des Wortes „oder“ durch das Wort „und“ in Satz 1 und 5:
Nach dem Wortlaut des Regelungsvorschlags in Satz 1 kann der G-BA vom
pharmazeutischen Unternehmer die Vorlage versorgungsbegleitender
Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern. Die
Verknüpfung der Forderungsgegenstände mit dem Wort „oder“ hat zur Folge, dass
diese in einem Alternativverhältnis zu einander stehen: entweder kann der G-BA eine
versorgungsbegleitende Datenerhebung oder eine Auswertung derselben vom
pharmazeutischen Unternehmer fordern, aber nicht beides zusammen. Entscheidet
sich der G-BA für die Forderung einer versorgungsbegleitenden Datenerhebung, wäre
damit die Forderung einer Auswertung der Datenerhebung durch den
pharmazeutischen Unternehmer ausgeschlossen. Dies ist nicht sachgerecht. Die
Erhebung von versorgungsbegleitenden Daten und deren Auswertung gehören nach
der Systematik der frühen Nutzenbewertung zusammen. Da die Forderung der in Rede
stehenden Maßnahmen der Nutzenbewertung von Arzneimitteln dient und der
pharmazeutische Unternehmer für die Vorlage aussagekräftiger Daten die Darlegungs-
und Beweislast trägt, ist es sachgerecht, vom pharmazeutischen Unternehmer die
Erhebung versorgungsbegleitender Maßnahmen und deren Auswertung kumulativ
13fordern zu können. Deshalb sollte die „oder“-Verknüpfung der in Rede stehenden
Forderungsgegenstände durch eine „und“-Verknüpfung ersetzt werden.
Ersetzung der Wörter „Verordnung“ durch „Versorgung der Versicherten mit einem
Arzneimittel“ und „Vertragsärzte und zugelassene Krankenhäuser“ durch
„Leistungserbringer“ in Satz 2:
Die Regelung zur Kopplung der Verordnungsbefugnis des Arzneimittels an die
Teilnahme eines Leistungserbringers an der versorgungsbegleitenden Datenerhebung
wird begrüßt.
In Krankenhäusern werden, im Gegensatz zum ambulanten Bereich, Arzneimittel in
der Regel nicht im Wortsinn „verordnet“. Deshalb soll in Anlehnung an die
vorgeschlagene Ersetzung des Wortes „anwendungsbegleitend“ durch
„versorgungsbegleitend“ in Satz 1 mit einer versorgungsbereichsneutralen
Formulierung der Versichertenanspruch auf Versorgung mit Arzneimitteln in Satz 2
klargestellt werden, dass sich die Verpflichtung zur Teilnahme an den begleitenden
Datenerhebungen auch auf Arzneimittelanwendungen in Bereichen bezieht, in denen
nicht eine regelhafte Verordnung der Arzneimittel erfolgt. Dies wird ergänzend dadurch
unterstrichen, dass die Worte „Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser“ durch
den Ausdruck „Leistungserbringer“ ersetzt wird. Damit sind sowohl an der ambulanten
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer (z. B.
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte) als auch stationäre Leistungserbringer (z. B.
zugelassene Krankenhäuser) gemeint.
Durch die verpflichtende Teilnahme wird sichergestellt, dass der Einschluss der
Patienten in die Datenerhebung nahezu vollzählig erfolgen kann. Eine vollständige und
valide Datengrundlage und die Vermeidung einer lediglich fragmentarischen
Datenerfassung ist für die Eignung der Daten für die Nutzenbewertung von
grundlegender methodischer Bedeutung. Allein hierdurch wird die notwendige
einheitliche Methodik der Datenerhebung und -auswertung geschaffen. Der G-BA weist
an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass mit einer aus Versorgungssicht
sinnvollen Konzentration der Verordnungsbefugnis des Arzneimittels auf
Leistungserbringer, die an der Datenerhebung teilnehmen, zumutbare
Einschränkungen im Hinblick auf eine leistungserbringernahe Versorgung der
Versicherten verbunden sein können.
Die Möglichkeit zur Beschränkung auf bestimmte Leistungserbringer findet ihren
rechtfertigenden Sachgrund darin, dass die ergänzende Datenerhebung bei
Arzneimitteln erfolgen soll, bei denen die zur Nutzenbewertung vorgelegte Evidenz
noch nicht ausreicht, um das Ausmaß des Zusatznutzens abschließend beurteilen zu
können oder zu quantifizieren. Dies bedeutet, dass bestimmte Unsicherheiten mit der
Anwendung des Arzneimittels verbunden sind. Deshalb ist es sachgerecht, die
Verordnungs- bzw. Anwendungsbefugnis des Arzneimittels auf die an der
Datenerhebung teilnehmenden Leistungserbringer beschränken zu können.
„Erlass einer Maßnahme nach Satz 3“ in Satz 4
Gemäß dem Wortlaut des Gesetzentwurfes ist die Forderung der weiteren
begleitenden Datenerhebungen nicht zwingendermaßen an den Beschluss nach
§ 35a SGB V gebunden, sondern kann verfahrenstechnisch und zeitlich davon
losgelöst sein und gegebenenfalls vor dem Inverkehrbringen eines Arzneimittels
erfolgen. Dessen ungeachtet können sich jedoch auch erst im Rahmen des
Bewertungsverfahrens konkrete Fragestellungen für die weitere
versorgungsbegleitende Datenerhebung und deren Auswertung zum Zweck der
Nutzenbewertung ergeben, sodass diese erst am Ende des
14Nutzenbewertungsverfahrens festgestellt werden können. Um diese
Anwendungsoptionen der versorgungsbegleitenden Datenerhebung in
zweckverwirklichender Weise realisieren zu können, ist es erforderlich, die Einbindung
und Abstimmung mit den Bundesoberbehörden durch eine klarstellende Regelung von
dem Erfordernis einer vorgängigen Beschlussfassung über eine Nutzenbewertung
nach § 35a Abs. 3 SGB V zu entkoppeln. Um dies zu gewährleisten sowie die
Beteiligung der Bundesoberbehörden in zeitlicher und sachlicher Hinsicht angemessen
organisieren zu können, halten es die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-
BA daher für erforderlich, die Beteiligung der Bundesoberbehörden
verfahrenstechnisch auf die Festlegung von Vorgaben an die Dauer, die Art und den
Umfang der Datenerhebung und der Auswertung einschließlich der zu verwendenden
Formate zu beziehen. Mit der vorgeschlagenen Änderung (Ersetzung der Worte „vor
Erlass einer Maßnahme nach Satz 1“ durch „vor Festlegung der Vorgaben nach
Satz 3“) wird somit die Einbindung der Bundesoberbehörden im Zusammenhang mit
dem „Erlass einer Maßnahme“ durch den Bezug auf Satz 3 inhaltlich klargestellt.
Zur Streichung der Worte „gewonnenen Daten und die“ in Satz 7
Durch die Streichung soll klargestellt werden, dass der G-BA vor einer
Beschlussfassung lediglich die Durchführung und den Fortschritt der Datenerhebung
prüft und nicht eine inhaltliche Bewertung der eigentlich erhobenen Daten vor der
Nutzenbewertung vornimmt. Die Feststellung, ob ein erneuter Beschluss auf Basis der
ergänzenden Datenerhebung zu fassen ist, darf nicht von einer inhaltlichen Bewertung
der Ergebnisse der erhobenen Daten abhängig gemacht werden, sondern sollte sich
an der Zielerfüllung der vorab festgelegten Anforderungen wie beispielsweise
Vollständigkeit, Vollzähligkeit und Validität orientieren.
Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, die oben genannten Änderungsvorschläge umzusetzen.
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„b) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt:
„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann bei den folgenden Arzneimitteln vom
pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage
anwendungsbegleitender versorgungsbegleitender Datenerhebungen oder und
Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern, insbesondere:
1. bei Arzneimitteln, deren Inverkehrbringen nach dem Verfahren des Artikels
14 Absatz 7 oder Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung
von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von
Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen
Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1), die zuletzt durch die
Verordnung (EU) Nr. 1027/2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 38) geändert
worden ist, genehmigt wurde, sowie
2. bei Arzneimitteln, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann die Befugnis zur Verordnung eines
Versorgung der Versicherten mit einem solchen Arzneimittels zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung auf solche Vertragsärzte oder zugelassene
15Krankenhäuser Leistungserbringer beschränken, die an der geforderten
versorgungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Die näheren Vorgaben an die
Dauer, die Art und den Umfang der Datenerhebung oder und die Auswertung,
einschließlich der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen
Bundesausschuss bestimmt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
und das Paul-Ehrlich-Institut sind vor Erlass einer Maßnahme nach Satz 1 Festlegung
der Vorgaben nach Satz 3 zu beteiligen. Das Nähere zum Verfahren der Anforderung
von anwendungsbegleitenden versorgungsbegleitenden Datenerhebungen oder und
von Auswertungen, einschließlich der Beteiligung nach Satz 4, regelt der Gemeinsame
Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. Die gewonnenen Daten und die
Verpflichtung zur Datenerhebung sind ist in regelmäßigen Abständen, mindestens
jedoch jährlich, vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu überprüfen. Für Beschlüsse
nach den Sätzen 1 und 2 gilt Absatz 3 Satz 4 bis 6 entsprechend.““
Zu lit. c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
Zu aa) :
„Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Eine Beratung vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase drei zur Planung
klinischer Prüfungen oder zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen soll unter
Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder des Paul-
Ehrlich-Instituts stattfinden. Zu Fragen der Vergleichstherapie sollen unter Beachtung
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmers die
wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften schriftlich beteiligt werden.“
Bewertung:
Die Einbeziehung wissenschaftlich-medizinischer Fachexpertise zu Fragestellungen
zu nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse
zweckmäßigen Therapien in einem Anwendungsgebiet ist sachgerecht, durch das
Verfahren zur Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie aber bereits
etabliert.
Die Grundlagen für den G-BA für die Bestimmung der zweckmäßigen
Vergleichstherapie (zVT) sind in § 6 AM-NutzenV festgelegt:
„Die zweckmäßige Vergleichstherapie muss eine nach dem allgemein anerkannten
Stand der medizinischen Erkenntnisse zweckmäßige Therapie im Anwendungsgebiet,
vorzugsweise eine Therapie, für die Endpunktstudien vorliegen und die sich in der
praktischen Anwendung bewährt hat, soweit nicht Richtlinien nach § 92 Absatz 1 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder das Wirtschaftlichkeitsgebot
dagegensprechen.“
Der Bestimmung der zVT liegt deshalb in jedem Verfahren eine systematische
Literaturrecherche zum vorliegenden allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse im Anwendungsgebiet zu Grunde, der hinsichtlich der Qualität
entsprechend der Evidenzstufen I – V (I a – systematische Übersichtsarbeiten von
Studien der Evidenzstufe; I b – randomisierte klinische Studien; II a – systematische
Übersichtsarbeiten der Evidenzstufe, lI b – prospektiv vergleichende Kohortenstudien;
III – retrospektiv vergleichende Studien; IV – Fallserien und andere nicht vergleichende
Studien) gemäß § 5 Abs. 6 AM NutzenV bewertet wird. Dabei finden auch Leitlinien der
Fachgesellschaften, in Abhängigkeit von deren methodischen Güte und Aktualität,
16Eingang in die Evidenzübersicht und werden dadurch bei der Bestimmung der zVT
durch den G-BA grundsätzlich mitberücksichtigt. Über diesen Weg ist die Einbindung
der Fachgesellschaften in die Bestimmung der Vergleichstherapie bereits jetzt
regelhaft gewährleistet.
Der vorgesehene, verpflichtende Weg der Einbindung von Fachgesellschaften in die
Beratung von pharmazeutischen Unternehmen ist in Anbetracht der Fristvorgaben für
die Bearbeitungszeit und der Vielzahl der Beratungen nicht in einem regelhaften
Verfahren unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit sowie der Wahrung von Betriebs-
und Geschäftsgeheimnissen zu gewährleisten. In der Regel lassen sich
pharmazeutische Unternehmer zu einem sehr frühen Zeitpunkt beraten, zu dem bereits
das intendierte Anwendungsgebiet als ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis
anzusehen ist. Darüber hinaus gibt es keine Kriterien, welche Fachgesellschaften oder
klinische Sachverständige auszuwählen sind und wie mit Fragestellungen der
Kostenerstattung und insbesondere Interessenkonflikten umzugehen ist.
Vielmehr sollte explizit gefördert werden, dass sich Fachgesellschaften auch
unabhängig von einer konkreten Studienplanung eines pharmazeutischen
Unternehmers mit der Evidenz zu den Therapieoptionen in einem Anwendungsgebiet
auseinandersetzen können und bei der Erstellung von evidenzbasierten Leitlinien fach-
und sachgerechte Unterstützung erhalten, damit die klinische Expertise im
Zusammenspiel mit aktueller, systematischer Evidenzaufbereitung zu aktuellen
klinischen Fragestellungen sich zeitnah in den medizinischen Empfehlungen
widerspiegelt.
In der Zusammenschau lässt sich eine regelhaft verpflichtende, verfahrensbezogene
Einbindung von Fachgesellschaften in die Beratung von klinischen Studien zu
spezifischen Produkten nicht umsetzen. Deshalb wird vorgeschlagen, den Satz zu
streichen.
Ersetzung des Wortes „anwendungsbegleitend“ durch „versorgungsbegleitend“:
Dabei handelt es sich um eine Folgeanpassung: siehe Begründung zu Artikel 12
Nummer 2 b).
Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, bei der vorgesehenen Ersetzung des § 35a Absatz 7
Satz 3 SGB V den letzten Satz zu streichen und das Wort „anwendungsbegleitend“
durch „versorgungsbegleitend“ zu ersetzen:
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„aa) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Eine Beratung vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase drei zur Planung
klinischer Prüfungen oder zu anwendungsbegleitenden versorgungsbegleitenden
Datenerhebungen soll unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte oder des Paul-Ehrlich-Instituts stattfinden. Zu Fragen der
Vergleichstherapie sollen unter Beachtung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
des pharmazeutischen Unternehmers die wissenschaftlich-medizinischen
Fachgesellschaften schriftlich beteiligt werden.““
17Zu bb):
„Nach dem neuen Satz 5 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Für die pharmazeutischen Unternehmer ist die Beratung gebührenpflichtig. Der
Gemeinsame Bundesausschuss hat dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte und dem Paul-Ehrlich-Institut die Kosten zu erstatten, die diesen im
Rahmen der Beratung von pharmazeutischen Unternehmern nach den Sätzen 1 und 3
entstehen, soweit diese Kosten vom pharmazeutischen Unternehmer getragen
werden.“
Bewertung:
Ebenso wie der G-BA die Erstattung der für Beratungen nach § 35a Abs. 7 SGB V
entstandenen Kosten auf Grundlage einer Gebührenordnung abwickelt, erfolgt der
Aufwandsersatz der Bundesoberbehörden ebenfalls regelmäßig auf der Grundlage
entsprechender Gebührentatbestände.
Mit den vorgesehenen Änderungen wird zutreffend gesetzlich klargestellt, dass der
pharmazeutische Unternehmer auch hinsichtlich der Aufwände einer auf seine Initiative
erfolgenden Beteiligung der jeweils zuständigen Bundesoberbehörde zur
Berücksichtigung der Vorgaben des AMG erstattungspflichtig ist. Dies gilt sowohl
hinsichtlich der Beteiligung an den Beratungen nach § 35a Abs. 7 SGB V wie auch im
Zusammenhang mit der neu vorgesehenen Festlegung von Maßnahmen nach § 35a
Abs. 3b SGB V. Auf der Grundlage einer entsprechend gesetzlich verankerten
Gebührenpflicht ist es den Bundesoberbehörden möglich, den Verwaltungs- und
Kostenaufwand über Gebührentatbestände zu bemessen und entsprechend zu
pauschalieren. Diese Gebührentatbestände wiederum bieten dem G-BA eine sowohl
rechtlich belastbare als auch für die Bemessung praktikable Grundlage einer
gemeinsamen Kostenfestsetzung gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer
und deren Einzug.
Der Umsetzung eines solchen vergleichsweise praktikablen Verfahrens dient die unten
vorgeschlagene Änderung. Sie vermeidet zudem ein mit der pauschalierenden
Gebührenordnung gemäß § 3 Anlage IV zum 5. Kapitel der Verfahrensordnung des G-
BA kollidierendes Einzelabrechnungssystem gemessen an den den
Bundesoberbehörden tatsächlich entstehenden Kosten, worauf die
Gesetzesbegründung und die Bemessung des Erfüllungsaufwandes hindeutet. Einem
solchen Kostenausgleichsverfahren kann sich der G-BA aufgrund der wesentlichen
Änderung gegenüber dem derzeit etablierten Verfahren für den Gebühreneinzug nicht
anschließen.
Ein Kostenausgleich mit den Bundesoberbehörden anhand der im jeweiligen Einzelfall
anhand von Einzelrechnungspositionen zu bemessenden Aufwänden, zudem
abhängig davon, ob und inwieweit der pharmazeutische Unternehmer die Kosten trägt,
verursacht im G-BA mit Blick auf die beispielsweise dazu erforderliche Prüfung der
Einzelabrechnungspositionen einen erheblichen Verwaltungsmehraufwand.
Für den Einzug der Gebühren entsteht dem G-BA zwar ohnedies ein
Verwaltungsmehraufwand, orientiert an dem Prozess der künftig gemeinsamen
Gebührenerhebung beim G-BA kann dieser jedoch durch eine verbindliche
Abstimmung der für die Gebührenfestsetzung erforderlichen Informationenvermittlung
auf Grundlage der von den Bundesoberbehörden herangezogenen
Gebührentatbestände vergleichsweise geringgehalten werden. Die Einzelheiten des
Kostenausgleichsverfahrens unter Berücksichtigung der für die Bundesoberbehörde
18Sie können auch lesen