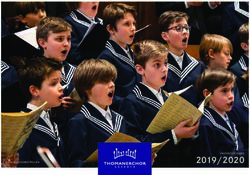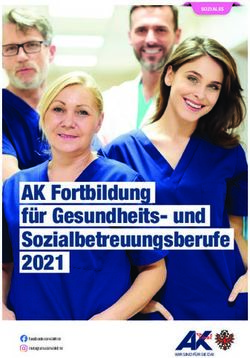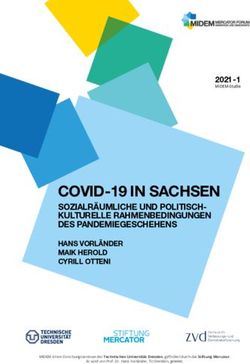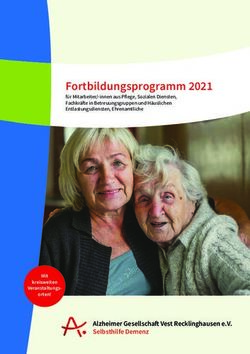Bachelor-Arbeit - iteratec
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Studiengang Informatik
Bachelor-Arbeit
Umsetzung und Wirksamkeitsanalyse einer
Präsentationssimulation in virtuell Reality
Implementation and effectiveness analysis of a presentation
simulation in virtual reality
Eingereicht von
Sebastian Nieder
Studiengruppe: IF 7W
Matrikelnummer: 01854809
Prüfer: Prof. Dr. Zugenmaier
20.09.2017 1 Sebastian NiederAbstract Die Idee zum Thema „Umsetzung und Wirksamkeitsanalyse einer Präsentationssimulation in virtuell Reality“ eine Bachelorarbeit zu schreiben entstand durch das Projekt „SpeakUp“ an der Hochschule München. Bei diesem Projekt wurde der Vermarktungswert einer solchen Simulation analysiert. Das Ziel dieser Arbeit ist Umsetzung und Analyse der Wirksamkeit einer virtuellen Anwendung dessen Aufgabe es ist eine Präsentationssituation realistisch nachzubilden. Dabei waren die Anforderungen an ein effektives Training und die technische Umsetzbarkeit eine Herausforderung. Aus diesem Grund leistet die Bachelorarbeit einen Beitrag zur Wissenschaft, da sie aufzeigt welche Elemente einer Präsentationsimulation wichtig sind. Der Nutzer wird mithilfe einer virtual Reality Brille in die Situation versetzt vor einem Publikum zu sprechen. Es soll die Annahme überprüft werden ob es dem Anwender möglich ist durch das virtuelle Training einen Vortrag zu üben und zu verbessern. Um die Wirksamkeit feststellen zu können werden Testpersonen eine kurze Präsentation in der virtuellen Realität halten und Anschließend die positiven und negativen Aspekte der Erfahrung mit der Trainingshilfe mithilfe eines Fragebogens ermittelt und ausgewertet. Die Ergebnisse können dabei helfen diese und vergleichbare Anwendungen in Zukunft zu verbessern. Zusammenfassend ist zu sagen, das die Präsentationssimulation erfolgreich umgesetzt wurde und sich für ein Training eignet. Die Tests haben gezeigt, dass sie den gewünschten Effekt auf die Anwender hat und sie weiter mit der Trainingshilfe arbeiten wollen. 20.09.2017 2 Sebastian Nieder
Inhaltsverzeichnis
Abstract ........................................................................................................................ 2
Einleitung ..................................................................................................................... 5
Iteratec und das SLab ................................................................................................... 6
1. Literaturrecherche ................................................................................................... 7
1.1 Training ............................................................................................................... 7
1.1.1 Wirksamkeit und Erfolgsfaktoren eines Trainings ....................................... 7
1.1.2 Präsentationstraining ................................................................................ 10
1.2 Virtual Reality ................................................................................................... 11
1.3 Auswertung ...................................................................................................... 12
1.3.1 Fragebogen ................................................................................................ 12
2. Umsetzung ............................................................................................................. 17
2.1 Hardware und Software ................................................................................... 17
2.1.1 Unity ........................................................................................................... 18
2.1.2 Samsung Gear VR ....................................................................................... 19
2.1.3 Samsung Gear 360 ..................................................................................... 19
2.2 Anforderungen ................................................................................................. 20
2.2.1 MUST Anforderungen ................................................................................ 20
2.2.2 SHOULD Anforderungen ............................................................................ 21
2.2.3 COULD Anforderungen .............................................................................. 21
2.3 Hintergrundvideo Aufnahme ........................................................................... 22
2.4 Aufbau .............................................................................................................. 23
2.4.1 Präsentationszene ..................................................................................... 24
2.4.2 Java Client .................................................................................................. 33
20.09.2017 3 Sebastian Nieder3. Durchführung der Wirksamkeitsanalyse ................................................................ 34
3.1 Vorbereitung des Tests ..................................................................................... 34
3.1.1 Durchführung ............................................................................................. 36
3.2 Fragebogen ....................................................................................................... 37
4. Auswertung ............................................................................................................ 40
4.1 Ergebnisse......................................................................................................... 40
4.1.1 Qualität der Präsentationssimulation........................................................ 41
4.1.2 Wirksamkeit des Trainings ......................................................................... 42
Fazit ............................................................................................................................ 44
Literaturverzeichnis.................................................................................................... 45
Wissenschaftliche Quellen: .................................................................................... 45
Webseiten, Zeitschriften und Blogeinträge: .......................................................... 46
Abbildungsverzeichnis................................................................................................ 47
Anhang ....................................................................................................................... 48
A Fragenbogen........................................................................................................ 48
B Ergebnisse der Fragebögen ................................................................................. 50
B.1 Testperson 1 ................................................................................................. 50
B.2 Testperson 2 ................................................................................................. 51
B.3 Testperson 3 ................................................................................................. 52
B.4 Testperson 4 ................................................................................................. 53
B.5 Testperson 5 ................................................................................................. 54
Erklärung .................................................................................................................... 55
20.09.2017 4 Sebastian NiederEinleitung „Günstig ist ein Arbeitsplatz, an dem alle für das Lernen notwendigen Materialien verfügbar sind“ (Metzig und Schuster 2006). Wenn man eine Präsentation trainieren möchte ist das nicht so einfach umzusetzen. Die Schwierigkeit ist die Situation des späteren Vortrags korrekt nach zu empfinden und einen vergleichbaren visuellen Kontext aufzubauen. Um den Arbeitsplatz passgenauer für das Präsentationstraining anzupassen, kann es sinnvoll in den virtuellen Raum auszuweichen. Durch neueste Hardware, wie zum Beispiel die „Gear VR“ von Samsung, ist die virtuelle Realität auch für kleineres Geld erschwinglich geworden. Zeit die neuen Entwicklungen für ihre Eignung zum Training von Präsentationssituationen zu beleuchten. Die iteratec GmbH hat erkannt das virtuell Reality in der Zukunft eine große Rolle spielen wird. Um neue Technologien und Erkenntnisse zu gewinnen soll nun die Präsentationstraining-App „SpeakUp“ umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Mithilfe dieser Anwendung soll der Nutzer die Möglichkeit erhalten seinen Arbeitsplatz anzupassen und in einer realistischen Umgebung üben zu können. Auf der Basis von psychologischen Grundlagen hilft ihm das dabei die maximale Leistung beim Lernen zu erreichen. Die durch die Entwicklung und Vorführung der Applikation gewonnenen Erkenntnisse sollen bei der Umsetzung zukünftiger Projekte helfen und optimieren. Dies soll mit Hilfe eines Prototypens und einer anschließenden Wirksamkeitsanalyse in Form eines Fragebogens umgesetzt werden. Die Arbeit soll zeigen welche Elemente einer solchen Simulation wichtig für einen Lernerfolg sind und welche nicht. Die Bachelorarbeit verbindet das sehr aktuelle Thema virtuell Reality mit dem Thema Training und Präsentieren, welches in vielen Lebenslagen eine große Rolle spielt. Es soll dem Nutzer möglichst einfach sein einen signifikanten Lerneffekt zu erzielen. Das Training muss daher leicht verfügbar, benutzbar und leicht verständlich sein. 20.09.2017 5 Sebastian Nieder
Es existieren bereits einfache Softwarelösungen für diesen Anwendungsfall. (Institute for mental health 2017) Sie zeigen Videoaufnahmen eines großen Auditoriums wie auch ein virtuell erstelltes Publikum. Abgesehen von einer Videoaufnahme eines Publikums sollen nun auch weitere Interaktionsmöglichkeiten angeboten werden. Die Konzeption, Umsetzung und Wirksamkeit einer solchen Anwendung wurde in dieser Bachelorarbeit zusammengefasst. Iteratec und das SLab iteratec ist ein mittelständischer IT-Dienstleister welcher individuelle Softwaresysteme für Automobilhersteller und weitere Branchen entwickelt. Darüber hinaus beraten sie Kunden in architektonisch, technologischen und methodischen Fragestellungen. (Iteratec 2017) Da im Projektalltag oft nicht genug Zeit zum Experimentieren und Forschen bleibt, hat iteratec das Studentenlabor (SLab) gegründet. Hier wird eine Vielzahl von internen Projekten umgesetzt und sich verschiedenen aktuellen Forschungsthemen und Innovationen gewidmet. (Iteratec 2017) 20.09.2017 6 Sebastian Nieder
1. Literaturrecherche In dem folgenden Kapitel werden theoretische Hintergründe zu dieser Arbeit aus literarischen Quellen bearbeitet und zusammengefasst. Dabei werden psychologische und technische Hintergründe sowie Begriffe erläutert. 1.1 Training In diesem Abschnitt wird beschrieben welche Elemente wichtig für ein erfolgreiches Training sind und wie diese angepasst werden können, um bei regelmäßigen Wiederholungen die Leistung auf einem optimalen Niveau zu heben. 1.1.1 Wirksamkeit und Erfolgsfaktoren eines Trainings Der Begriff Training oder das Trainieren steht allgemein für alle Prozesse die eine verändernde Entwicklung hervorrufen. Das Training kann dabei auf drei Arten wirken: Es kann zum Wachstum der benötigten Komponenten führen, es kann eine Automatisierung der bewusst durchgeführten Leistung erreichen, es kann zu Entdeckungen führen, die eine Erleichterung und Vereinfachung der geforderten Leistung bringen (Metzig und Schuster 2006). Außerdem sind allgemeinere Bedingungen für einen Lernerfolg entscheidend. So wie für jede Arbeit, sind auch für das Lernen Arbeitsort, Arbeitsplatz, Arbeitsmittel und Arbeitszeit wichtige Einflussgrößen (Metzig und Schuster 2006). Laut der Psychologischen Hochschule Berlin (PHB) macht es Sinn Übungen auf mehrere Tage zu verteilen und zwischendurch Pausen einzulegen (Onckels und Preiser 2017). Dabei ist es wichtig den Lernstoff regelmäßig zu wiederholen. Des Weiteren stellen sie fest das Lernkontrolle bzw. Selbstprüfung regelmäßig stattfinden sollte. Dies kann unter 20.09.2017 7 Sebastian Nieder
anderem durch das halten eines Vortrags erfolgen. Werner Metzig und Martin Schuster stellen fest das einfaches Wiederholen sehr ineffektiv ist. In jedem Fall wirkungsvoller sind Wiederholungen, wenn sie mit tieferer Informationsverarbeitung im Sinne von Neuorganisation, Umstrukturierung, Elaboration und Reduktion verbunden sind (Metzig und Schuster 2006). Lernen bedeutet Anspannung. Die Beziehung zwischen Anspannung (Erregung) und Leistung wurde bereits 1908 von Yerkes und Dodson als umgekehrte U-Kurve beschrieben (siehe Abbildung 1 Yerkes Dodson-Gesetz). Abbildung 1: Yerkes-Dodson-Gesetz. Zusammenhang zwischen Aktivierungsniveau und Reizverarbeitung. (In M. A. Wirtz (Hrsg.) 2014) Auf Abbildung 1 zeigt die Verteilung des Aktivierungsniveaus im Bezug zur Reagibilität. Das Maximum der Lernleistung (optimale Reizverarbeitung) wurde bei mittlerer Erregung (Aktivierungsniveau) erzielt (Metzig und Schuster 2006). Demzufolge ist die Leistung bei sehr niedrigem und sehr hohem Erregungsgrad schlechter als bei mittlerer Erregung (In M. A. Wirtz (Hrsg.) 2014). Ein wichtiger Faktor des Erregungsgrades bei einem Vortrag ist die bloße Anwesenheit anderer Personen. Bei der Bearbeitung leichter oder hoch überlernter Aufgaben sollte die bloße Anwesenheit anderer zu einer Leistungssteigerung führen. Hoch überlernte Aufgaben sind bereits oft wiederholt worden. Bei Aufgaben, die komplex oder neu 20.09.2017 8 Sebastian Nieder
sind oder deren Bewältigung noch nicht gut erlernt wurde, sollte sich die Anwesenheit anderer hingegen negativ auf die Leistung auswirken (Stürmer 2009). Dabei ist zu beachten das „[…] selbst wenn die anwesenden Personen sich passiv verhalten und keinen Versuch unternehmen, die Leistung zu beeinflussen […]“ einen Einfluss auf die individuelle Leistung hat (Stürmer 2009, 152). 20.09.2017 9 Sebastian Nieder
1.1.2 Präsentationstraining Nimmt man nun diese Faktoren und wendet sie am Präsentationstraining an, sind einige Schwierigkeiten erkennbar. Ein wesentlicher Faktor eines Trainings ist der Arbeitsplatz. Dies wäre idealerweise die Umgebung in der der Vortrag letztendlich gehalten wird. Dieser Umgebung kommt man zum Beispiel mit einem Treffen mit Kommilitonen, Kollegen oder Freunden nicht sehr nahe, und außerdem gestaltet sich hier in jedem Fall die Wiederholung des Lernstoffs schwierig. Besser ist es zu Beginn entscheiden zu können, unter welchen Rahmenbedingungen der Vortrag im Zuge des Trainings abläuft. Darunter fallen unter anderem die Anzahl der Zuschauer, der zeitliche Rahmen, Medien sowie die Örtlichkeit des Vortrags selbst. Somit ist garantiert das alle für das Lernen notwendigen Materialien zur Verfügung stehen. Um einfaches Wiederholen zu verhindern sollte es möglich sein, verschiedene Elemente des Trainings so zu verändern, dass wie in „Lernen zu lernen“ steht neue Abrufreize und Abrufstrategien geschaffen werden können um die erlernten Informationen verfügbarer zu machen. Dies kann durch gezieltes ändern der Rahmenbedingen erreicht werden. Außerdem ist die Wahl des richtigen Erregungsgrades entscheidend. Er ist abhängig von der Komplexität der Aufgabe und wird auch durch die Anwesenheit anderer Personen beeinflusst. Dabei spielt es keine Rolle ob die anwesenden Personen sich aktiv beteiligen oder passiv verhalten. Hat der Nutzer ein komplexes oder neues Thema und hat den Vortrag noch nie gehalten ist es wichtig die Möglichkeit zu haben die Anzahl der Anwesenden Personen justieren zu können um die optimale Leistung zu erhalten. Anschließend kann er die Schwierigkeit erhöhen um wieder ein mittleres Aktivierungsniveau zu erreichen. Dem Lernenden soll also die Möglichkeit gegeben werden diese Faktoren bei seinem Training zu berücksichtigen. Diesem Lernumfeld kommt eine Simulation am nächsten. Eine Simulation mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten ist also ideal um einen Zustand der maximalen Leistung zu erreichen. 20.09.2017 10 Sebastian Nieder
1.2 Virtual Reality Die Schaffung einer vom Computer generierten und vom Menschen aufgenommenen Realität steht hinter Virtual Reality. Dabei soll beim Benutzer das Gefühl entstehen, dass diese virtuelle Realität mehr oder weniger der tatsächlichen entspricht, seine Sinne also so arbeiten, wie in seiner natürlichen Umwelt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Sinne des Menschen getäuscht werden. Dazu bedient man sich technischer Hilfsmittel, die sich auf die folgenden Sinne beschränken: Sehsinn, Hörsinn und Tastsinn. (Schwarzbauer 2005) Mit der Virtual Reality Technologie versucht man, eine virtuelle, logisch im Computer vorliegende Umgebung über Geräte auszugeben. Diese sollen die menschlichen Sinne stimulieren, um dem Benutzer das Gefühl zu geben, in die virtuelle Umgebung integriert zu sein. Mit Eingabegeräten kann der Benutzer in die virtuelle Realität eingreifen. Dabei darf vom Benutzer nicht verlangt werden, stark von seinem Verhalten in der realen Welt abzuweichen. (Schwarzbauer 2005) Für den Begriff „virtuelle Realität“, gibt es viele unterschiedliche Definitionen. Der Brockhaus beschreibt die virtuelle Realität als „… eine mittels Computer simulierte Wirklichkeit oder künstliche Welt, in die Personen mithilfe technischer Geräte sowie umfangreicher Software versetzt und interaktiv eingebunden werden.“. (Brockhaus 1997) Zu der Idee dazu eine virtuelle Realität zu Entwickeln haben zwei Bereiche maßgeblichen Einfluss gehabt. Zum einen die Entwicklung im militärisch-technischen Bereich und zum anderen in der Filmtechnik in den dreißiger Jahren, welche das „Kino der Zukunft“ erschaffen wollte. Im Ersten Weltkrieg begann dabei die Ausbildung von Piloten in Flugzeug-Simulatoren. (Brill 2009) Der Stand der heutigen Technik beschränkt sich aber nicht nur auf den visuellen Kontext, sondern bezieht auch die anderen Sinne mit ein. Das schließt Akustische Reize, den Tastsinn, Spracherkennung aber auch die Positionsverfolgung des Körpers mit ein. (Brill 2009) 20.09.2017 11 Sebastian Nieder
1.3 Auswertung In diesem Abschnitt wird behandelt welche Auswertungsmethode verwendet wird um die Wirksamkeit eines virtuellen Präsentationstrainings festzustellen. Die Analyse wird mit Testpersonen denen die Anwendung vorgeführt wird und einem anschließenden Fragebogen durchgeführt. Es wird beschrieben welche allgemeine Faktoren bei dieser Methode eine Rolle spielen und welche zu Verfälschungen der Ergebnisse führen kann. Dabei wird der auch der Aufbau und die Formulierung eines Fragebogens behandelt. Zuletzt ist es wichtig zu klären welche Stichprobe hier sinnvoll ist. 1.3.1 Fragebogen Zur Erstellung eines Fragebogens ist zuerst eine klare Formulierung der Fragestellung wichtig. Es wird auf Basis wissenschaftlicher Fachliteratur eine Hypothese auf Grundlage der Sachebene aufgestellt und anschließend einzelne Variablen bzw. Merkmale gemessen und ausgewertet. Anschließend wird betrachtet wie die resultierenden Messwerte auf Basis der Sachhypothese aussehen müssten. Dabei ist zu beachten das diese Methode der Auswertungen Grenzen hat und nur unter bestimmten Umständen und Rahmenbedingungen durchgeführt werden sollte. Durch unterschiedliche Methoden kann verhindert werden das die Ergebnisse verfälscht oder beeinflusst werden. (Pilshofer 2001) Grenzen und Rahmenbedingungen Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass sich aus den Antworten der Testpersonen auf den eigentlichen Sachverhalt schließen lässt. Sie hängen von unterschiedlichen Faktoren im Umfeld des Befragten ab. Ist der Befragte ausgeruht 20.09.2017 12 Sebastian Nieder
oder beantwortet er die Fragen nach einem langen Arbeitstag hat maßgeblichen Einfluss auf die Antworten. Interessieren sich die Befragten für den Sachverhalt der Frage kann diesem Problem entgegengewirkt werden. Auch Einflüsse während der Befragung können die Ergebnisse verfälschen. Man sollte dabei beachten einen angemessenen Zeitrahmen für die Befragung zu veranlassen und für eine angenehme Situation zu sorgen. Dazu gehört dem Befragten Anonymität zu Gewährleisten und inhaltliche Freiheit zuzusichern. Das bedeutet das seine Antworten nicht von anderen Personen beeinflusst werden dürfen. Die Umgebung in der die Fragen gestellt werden sollte gut beleuchtet und die Testpersonen sollten sich darin wohlfühlen. (Pilshofer 2001, 9) Um diesen Grenzen entgegen zu wirken können unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. Zuerst sollte dem Fragebogen eine möglichst klare Einleitung vorangestellt werden. Sie enthält Instruktionen an die sich der Befragte halten sollte. Die Situation in der die Befragung stattfindet sollte für alle Teilnehmer möglichst gleich sein. Unterschiedliche Aspekte müssen in getrennten Fragen erhoben werden. Letztendlich sollten die Ergebnisse nicht nur in Zahlen, sondern auch durch einzelne Aussagen ergänzt werden. Dabei ist zu beachten den Zahlen, Ergebnissen und dem eigentlichen Befragungsinstrument gegenüber kritisch zu bleiben. (Pilshofer 2001, 9) Verfälschungstendenzen Zu diesen Grenzen kommen weitere Verfälschungstendenzen. Die Befragten versuchen ihre Antworten nach vorrausichtlich gesellschaftlichen Maßstäben zu geben. Das wird auch Tendenz zur „sozialen Erwünschtheit“ genannt. Fragen müssen deshalb möglichst neutral und ohne Wertung formuliert werden. Hier spielen auch wieder die Rahmenbedingungen der Befragung eine Rolle. Sie können sozial erwünschte Antworten hervorrufen, wenn sich zum Beispiel die Beziehung zum Fragesteller dadurch ausdrückten lässt. Außerdem kann es in Einzelfällen sinnvoll sein im Einleitungstext nicht den eigentlichen Untersuchungszweck zu nennen. Hier 20.09.2017 13 Sebastian Nieder
kann es zu Problemen führen, wenn zum Beispiel Ängstlichkeit gemessen werden soll. Außer der „sozialen Erwünschtheit“ gibt es weitere Antworttendenzen. Personen neigen dazu mit Ja oder Nein zu antworten oder gar gänzlich unentschlossen zu sein. Das kommt vor allem vor, wenn aufeinander folgende Fragen in dieselbe Richtung zielen. Es sollte deshalb darauf geachtet werden diese manchmal positiv oder negativ zu formulieren. Das verhindert außerdem das die Befragten aus Gewohnheit zu den vorrangegangenen Fragen antworten. (Pilshofer 2001, 10) Aufbau Der Fragebogen besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, der Einleitung und dem Hauptteil mit den eigentlichen Fragen. Die Einleitung wird dem Hauptteil vorangestellt und enthält unter anderem die wichtigsten Instruktionen für den Befragten. Es kann jedoch während der Befragung sinnvoll sein, weitere Anweisungen vor einer bestimmten Frage zu geben. Der Einleitungstext enthält eine knappe Vorstellung des Fragestellers und dessen Einrichtung. Dem Befragten wird die grobe Fragestellung und eine kurze Erklärung dazu geliefert auf welcher Basis diese Befragung erarbeitet werden soll. Er soll wissen aus welchem Grund er ausgewählt wurde und das seine Antworten wichtig für ein Ergebnis sind. Sie sollen ehrlich und können nicht richtig oder falsch sein. Weiterhin ist es wichtig zu erwähnen das seine Anonymität gewahrt wird. (Pilshofer 2001, 12) Der Hauptteil besteht aus den eigentlichen Fragen und gegeben falls weiteren kurzen Instruktionen die für die nachfolgende Beantwortung wichtig sind. Dabei kann es sich um offene, geschlossen und gemischte Formen handeln. Bei offenen Fragen ist es möglich mit einem freien Text zu beantworten. Der Vorteil dieses Typs ist das die Antworten nicht im Fragesteller abhängen und die Personen sich nicht an Kategorien halten müssen. Personen mit Formulierungsschwierigkeiten haben hier Probleme. Ein weiterer Nachteil ist die schwierige Auswertung dieser Form gegenüber einer 20.09.2017 14 Sebastian Nieder
geschlossenen Fragestellung. Diese werden durch Ankreuzen oder Eintragen von Ziffern beantwortet. Rohrmann (1978) hat dabei festgestellt das folgende sprachlichen Einstufungen als annährend gleichmäßig eingeordnet werden. Er hat diese wie folgt definiert: Häufigkeiten: nie – selten – gelegentlich – oft – immer Intensität: gar nicht – kaum – mittelmäßig – ziemlich – außerordentlich Wahrscheinlichkeit: keinesfalls – wahrscheinlich nicht – vielleicht – ziemlich wahrscheinlich – ganz sicher Bewertung von Aussagen: völlig falsch – ziemlich falsch – unentschieden – ziemlich richtig – völlig richtig (Rohrmann 1978) Die Mischform dieser beiden Typen enthält einen Teil den der Befragte mit eigenen Worten ausfüllen muss. Hier wird nur ein Teil der Antwort vorformuliert und kann dazu führen Kategorien aufzuzeigen die zuvor nicht betrachtet wurden. Wichtig bei der Wahl der geeigneten Form der Frage ist die Möglichkeit des Befragten seine wahre Antwort wiedergeben zu können. (Pilshofer 2001, 15) 20.09.2017 15 Sebastian Nieder
Formulierung Bei allen Formen gelten dieselben Formulierungsregel. Sie sollten eindeutig, einfach zu verstehen und genau formuliert sein. Zu der Eindeutigkeit der Formulierung kommt hinzu, dass alle möglichen Antwortmöglichkeiten und Kategorien abzudecken, also erschöpfend sind. Dabei sollten doppelte Verneinungen sowie Fachbegriffe vermieden werden. Die Fragen müssen ohne zugrundeliegendes Vorwissen zu beantworten sein. Hier ist zu beachten wie die entsprechende Stichprobe an Personen gewählt wurde. Außerdem sollten Verzweigungen innerhalb des Fragebogens nicht verwendet werden. Diese gestalten das Bearbeiten zu kompliziert. Das gilt auch für mathematische Berechnungen und vergleichbar fordernde Aufgaben. In Bezug auf die „soziale Erwünschtheit“ (siehe Absatz Verfälschungstendenzen) ist darauf zu achten keine stark suggestiven Formulierungen zu wählen um die Meinung des Befragten nicht zu beeinflussen. (Pilshofer 2001, 16) Stichprobenwahl „Grundsätzlich werden die Fragebögen den Personen vorgegeben, für welche die Ergebnisse der Erhebung gelten sollen „. (Pilshofer 2001, 21) Handelt es sich dabei und eine begrenzte Anzahl von Teilnehmen auf die man Zugriff hat kann man eine sogenannte Vollerhebung veranlassen. Dabei werden alle Personen erfasst auf die die Fragestellung zutrifft. Sollte es sich um keine begrenzte Anzahl handeln, gilt im Allgemeinen umso mehr Teilnehmer desto besser und genauer ist das Ergebnis. Für große Teilnehmergruppen sollte auch mehr Zeit und Sorgfalt für die Fragebogenerstellung eingeplant werden. Die Größe sollte idealerweise auch bei der Ergebnisdarstellung vermerkt werden. 20.09.2017 16 Sebastian Nieder
2. Umsetzung In diesem Teil der Arbeit wird beschrieben, wie die Anwendung „SpeakUp“ umgesetzt wurde. Es werden die Anforderungen an die Anwendung besprochen und welche Hardware und Softwareentscheidungen auf dieser Basis getroffen wurden. Diese werden jeweils grundlegend erläutert. Es wird die Implementierung und Umsetzung in Unity 3D, sowie das Erarbeiten der dazu notwendigen Assets gezeigt. 2.1 Hardware und Software In den letzten Jahren gab es viele Neuerungen unter den Virtuell Reality Lösungen. Diese umfassen unterschiedliche Preissegmente beginnend bei unter zehn Euro das „Google Cardboard“, fünfzig bis einhundert Euro für ein Headset mit Eingabemöglichkeiten (z.B. Samsung Gear VR) bis hin zu weit über fünfhundert Euro teuren Lösung wie die „VIVE“ von HTC. Für die ersten beiden Lösungen wird zusätzlich ein Smartphone benötigt. Außerdem wird die Anwendung aus zwei Komponenten bestehen. Einer Anwendung auf dem Smartphone und einer Serveranwendung auf einem persönlichen Computer. Die Notwendigkeit dieser beiden Systeme wird in Abschnitt 2.2 Anforderungen genauer erleutert. Die Wahl der Hardware für diese Simulation unterliegt verschiedenen Kriterien. Darunter gehören unter anderem Verfügbarkeit und Machbarkeit. Wichtig für die Entscheidung für eine dieser Lösungen ist unter anderem die Zielgruppe der Präsentationssimulation welche somit die Verfügbarkeit definiert. Vorträge werden von uns in den unterschiedlichen Lebensabschnitten verlangt und darum ist die Zielgruppe sehr breit gefächert. Das Training von Vorträgen ist dabei vor allem in Schulen und Universitäten sehr wichtig, deshalb sollte es einem Schüler oder 20.09.2017 17 Sebastian Nieder
Studenten möglich sein über die notwendige Hardware zu verfügen. Daher stehen die günstigen Varianten mehr im Vordergrund. Die zuvor genannten Systeme bieten alle die nötige Leistung und Qualität um den grafischen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings bietet ein mittleres bis hohes Preissegment technische Aspekte wie Eingabemöglichkeiten während der Simulation, die eine günstige Variante nicht hat. Die Anwendung ist für also nicht für alle der genannten Systeme umsetzbar. Beachtet man alle Argumente bietet sich das mittleres Preissegment am besten an. Zur Entwicklung und Testzwecken wird die Samsung Gear VR eingesetzt. Basierend auf der Hardwareentscheidung wird Unity 5.6.0 als Entwicklungsumgebung der Anwendung gewählt. Es bietet Virtual Reality Support für alle Produkte welche die Oculus SDK unterstützen. Gefordert ist unterdessen ein Java-Server der es uns ermöglicht einen Live-feed von einem Rechner in die Simulation zu projizieren. Da es sich um ein sehr generisches Aufgabenfeld des Servers handelt wurde das Springboot-Framework verwendet. 2.1.1 Unity „Unity bietet ein Tool, mit dem Grafiker & Designer bessere visuelle Geschichten erzählen können, neue Wege zur produktiveren Zusammenarbeit in Teams und mehr Funktionen denn je, um Ihnen in der Spielebranche zum Erfolg zu verhelfen“. (Unity 2017) Die üblichen Zielplattformen sind PC-Betriebssysteme, Spielekonsolen und mobile Endgeräte. Die eingesetzten Programmiersprachen sind C# und Unityscript. Es bietet außerdem auch weitere Anbindungen jenseits der Computerspieleentwicklung. (Unity 2017) Die Anwendung wird in unterschiedliche Szenen unterteilt die dabei unabhängig voneinander bearbeitet werden können. Jede Szene ist als Szenengraphen aus Game- Objekten organisiert. Zu Game-Objekten gehören unter anderem auch die Kamera, Lichtquellen sowie Primitive 3D-Objekte wie Kugeln oder Würfel. Es ist möglich diese 20.09.2017 18 Sebastian Nieder
Game-Objekte zu erzeugen, verschieben und zu skalieren. Ihnen können eine Vielzahl von Komponenten zugeordnet werden die Einfluss auf sie nehmen. Diese Eigenschaften und Komponenten eines Game-Objekts können durch untergeordnete Software manipuliert werden. In der sogenannten Game-View werden alle Objekte simuliert und dargestellt. Zudem können sogenannte Assets eingebunden werden. Das können Bilder sowie auch Video Dateien sein. (Unity 2017) 2.1.2 Samsung Gear VR Die Samsung Gear VR ist eine Virtual Reality Brille die mithilfe eines Samsung Smartphones 360°-Simulationen darstellen kann. Dieser Effekt wird von zwei Linsen innerhalb des Gerätes erzeugt. Durch die Lagemessung des Smartphones kann die Rotation des Kopfes bestimmt und in der Simulation angepasst werden. Dem Nutzer ist es währenddessen möglich Befehle an einem Touchpad an der Seite des Geräts auszuführen. Dabei werden explizit mit der Blickrichtung die einzelnen Befehle gewählt. (Samsung 2017) 2.1.3 Samsung Gear 360 Die Samsung Gear 360 ist ein Fischaugenobjektiv, das für die Zusammenarbeit mit der Samsung Gear VR konzipiert wurde. Es ermöglicht die Aufnahme von 360° Bildern und Videos die mithilfe von zwei Objektiven eingefangen werden. Die Dateien können anschließend vom internen Speicher der Kamera abgerufen werden. Das Gerät wird benötigt um das Hintergrundvideo in der Präsentationsimulation aufzunehmen. (Samsung 2017) 20.09.2017 19 Sebastian Nieder
2.2 Anforderungen
Zu Beginn der Entwicklung wurde zusammengefasst, welche Anforderungen an das
fertige Produkt gestellt werden. Hierbei wurde zwischen folgenden Kategorien
MUST, SHOULD und COULD unterschieden. Dabei wurde beachtet welche
grundlegende Werkzeuge bei einem Vortrag normalerweise zur Verfügung stehen
und welche davon am wichtigsten sind. Es war wichtig festzustellen welche dieser
Werkzeuge mit der gewählten Hardware und Software umzusetzen ist.
Außerdem wurden die Erkenntnisse aus der zuvor stattgefundenen Literaturanalyse
herangezogen und so eingestuft, dass diese in den Zeitplan der Arbeit optimal
hineinpassen. Hier ist wichtig darauf zu achten zu einem Prototyp zu gelangen, der
für eine spätere Analyse und Auswertung aussagekräftige Ergebnisse liefern kann.
Sollten noch weitere Anforderungspunkte zum dem Zeitpunkt der Analyse offen sein,
können diese mithilfe der Auswertung bestätigt und gegeben falls zu einem späteren
Zeitpunkt weiterentwickelt werden. Die Anforderungen wurden außerdem mithilfe
der Ideen von möglichen Nutzern und Mitarbeitern der Iteratec GmbH erarbeitet.
2.2.1 MUST Anforderungen
„Die Umsetzung der Must-Anforderungen ist Mindestvoraussetzung für die
Abnahme des Projekts. Diese können daher als rechtlich verbindliche Anforderungen
angesehen werden. Ohne deren Umsetzung wird das Projekt nicht erfolgreich
abgeschlossen werden können“. (Dietrich 2015)
Für die Must-Anforderungen wurden folgende Punkte definiert:
Startmenü
360° Video (Vollzeit oder 30 sekunden Teile) mögliche Szenarien: leer, kleine
Gruppe und große Gruppe
Zeitanzeige
Kontrollmechanismen innerhalb des Vortrags (Verlassen/Pause)
20.09.2017 20 Sebastian Nieder2.2.2 SHOULD Anforderungen
„Die Should-Anforderungen bilden zusammen mit den Muss-Anforderungen den
gesamten Leistungsumfang des Projekts und werden in der Projektplanung
vollständig berücksichtigt. Das System ist ohne die Umsetzung dieser Anforderung
weniger effizient/effektiv“. (Dietrich 2015)
Für die Should-Anforderungen wurden folgende Punkte definiert:
Einstellungen vor der Simulation (Vortragsdauer/Störfaktoren)
Zufällige Störfaktoren (Ton und Bild)
Live-feed von einem Rechner auf eine Präsentationsfläche innerhalb der
Simulation (Java Client)
2.2.3 COULD Anforderungen
„Diese Anforderungen werden auch als „nice-to-have“ bezeichnet und machen ein
System attraktiver. Sie werden in der Regel erst umgesetzt, wenn alle Must- und
Should-Anforderungen erfüllt sind und noch ausreichend Ressourcen und Zeit zur
Verfügung stehen. Werden diese am Ende des Projekts knapp, sollten nur jene
Funktionen umgesetzt werden, die den größten Mehrwert im Hinblick auf den
Geschäftszweck des Systems bringen und im verbleibenden Zeitrahmen möglich sind.
Could-Anforderungen sind üblicherweise nicht zeitkritisch, können aber durchaus
wichtig sein“. (Dietrich 2015)
Für die Could-Anforderungen wurden folgende Punkte definiert:
Bewertung mit 0-5 Sterne System (ggf. mit Backend)
Sprachaufnahme für spätere Wiedergabe
20.09.2017 21 Sebastian Nieder2.3 Hintergrundvideo Aufnahme Das Hintergrundvideo ist eine Aufnahme einer realen Präsentation. Es wird in der Anwendung verwendet um den Arbeitsplatz des Trainings zu simulieren. Sie wurde mithilfe von SLab Mitarbeitern der iteratec GmbH in einem ihrer Präsentationsräume angefertigt. Zu Beginn ist zu klären in welcher Form die Videos für die Anwendung zur Verwendung kommen. Es ist am sinnvollsten diese in kurze Sequenzen zu unterteilen und diese in einer Folge von Einzelsequenzen abzuspielen. Das ermöglicht es uns dem Anwender die Wahl zu lassen wie lange sein Training und Vortrag sein soll. Alternativ könnte man ein langes Video über den gesamten Vortrag abspielen was aber bei eventuellen weiten Iterationen Schwierigkeiten mit der Einbindung von Störfaktoren oder vergleichbaren Funktionen ergeben kann. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wahl einer geeigneten Länge dieser Sequenzen. Durch die begrenzte Rechenleistung der Smartphones hat sich eine Sequenzlänge von 30 Sekunden als effizienteste Einheit gezeigt. Ein kürzerer Zeitrahmen folgt dazu das die Übergänge zwischen den Sequenzen zu häufig vorkommen und irritierend wirken. Diese Irritationen sind nicht zu vermeiden, da schon kleine Abweichungen der Körperhaltung der Personen zu Beginn und am Ende einer Sequenz einen Effekt haben. Diese kurzen Sequenzen können in zufälliger Reihenfolge nacheinander Abgespielt werden bis die gewünschte Trainingsdauer erreicht ist. Wiederholungen der Abschnitte ist dabei auch möglich solange diese keine signifikanten Elemente enthalten. Den Helfern wurde zu Beginn der Veranstaltung erklärt wie sie sich während der Aufnahme verhalten sollen. Es ist wichtig zu beachten, dass sie Passiv bleiben und keine bewertenden Gesten ausführen (siehe 1.1.1 Wirksamkeit und Erfolgsfaktoren eines Trainings). Sie sollen sich eine Position einprägen die sie am Anfang und am Ende einer Sequenz einnehmen. Um die Zeit der Sequenz zu messen wurde eine Uhr außerhalb des Sichtfelds der Kamera platziert. So konnten die Helfer sich darauf einstellen ihre Position am Ende einer Sequenz wieder einzunehmen. 20.09.2017 22 Sebastian Nieder
2.4 Aufbau Die Anwendung wird in zwei Szenen, das Menu und die eigentliche Simulation unterteilt. Im Menü können die verschiedenen Kriterien der Simulation angepasst werden und gestartet werden. Dabei muss der Nutzer direkt auf die Schaltflächen blicken und diese mithilfe des Touchpads der Samsung Gear VR bestätigen. Diese bestehen aus freischwebenden Schaltflächen innerhalb eines drei dimensionalen Raums. Der Nutzer selbst befindet sich an der Position der Kamera. Abbildung 2: Blickrichtung zum Pult Sind alle Einstellungen vorgenommen wird die Simulation gestartet. Der Nutzer befindet sich nun innerhalb eines Präsentationsraums und kann sein Training beginnen. Er steht hinter einem Pult auf dem sich ein Bildschirm auf dem der Inhalt seines realen Computers dargestellt wird (siehe Abbildung 2). Zu seiner linken befindet sich eine Projektionsfläche auf der das gleiche Bild dargestellt wird. Hier wird versucht die Funktionsweise eines Beamers darzustellen (siehe Abbildung 3). Das Publikum sitzt in zwei Tischreihen vor dem Pult und besteht aus acht Personen. 20.09.2017 23 Sebastian Nieder
Abbildung 3: Blickrichtung zur Projektionsfläche 2.4.1 Präsentationszene Die Präsentationsszene definiert den eigentlichen Aufbau und Ablauf der Präsentationssimulation. Die Szene besteht aus mehreren Game-Objekten. Dazu gehören die Kamera, eine Lichtquelle, zwei Sphären, ein Eventhandler (EventSystem), das Menü, die Screencapturefläche und ein Szenenwechsler. Die Reihenfolge der Game-Objekte im Szenengraphen spielt dabei keine Rolle. In Abbildung 4 kann man die Liste der Objekte in der Präsentationsszene im Szenengraphen sehen. 20.09.2017 24 Sebastian Nieder
Abbildung 4: Game-Objekt Liste der Simulationsszene Kamera Der Nutzer befindet sich an der Position der Kamera innerhalb der zwei Sphären. Der Kamera sind weitere Komponenten untergeordnet die für Interaktion mit der Umgebung notwendig sind. Diese kann man im Inspektor des Kamera Objekt einfügen und bearbeiten. Auf Abbildung 5 sieht man den Inspektor der Kamera und die untergeordneten Komponenten. Für die Nutzerinteraktion werden Standard Skripte von Unity3D verwendet. Darunter gehören der VREyeRaycaster, VRInput und das VRInteractiveItem. Der VREyeRaycaster wird auf der Hauptkamera platziert. Er berechnet in jedem Frame ob sich in der Sichtlinie der Kamera ein Collider mit der VRInteractiveItem Komponente befindet. (Unity 2017) Ist der Raycast auf einen Collider getroffen so wird das VRInteractiveItem auf dem Game-Objekt des Colliders informiert. Von hier aus kann auf die verschiedenen Nutzerinteraktionen reagiert werden. Die verbleibenden Einstellungen der Kamera bleiben auf den Standard Einstellungen. 20.09.2017 25 Sebastian Nieder
Abbildung 5: Inspektor der Main Camera 20.09.2017 26 Sebastian Nieder
Userinterface Der Kamera ist das „UI“ Game-Objekt untergeordnet. Auf Abbildung 6 kann man den Inspector dazu erkennen. Es zeigt die aktuelle Präsentationszeit innerhalb des Sichtfeldes an. Es soll immer im Sichtfeld des Nutzers angezeigt werden und selbst bei einer Kopfbewegung folgen. Dazu wurde der Canvas Komponente die „Main Camera“ als „Event Camera“ zugordnet. Außerdem wird hier ein „Canvas Scaler“ verwendet. Er ermöglicht es uns den Text der anschließend auf dieser Ebene angezeigt werden soll zu schärfen und somit besser darstellen zu können. Abbildung 6: Inspektor des „UI“ Game-Objekt 20.09.2017 27 Sebastian Nieder
Auf dem UI-Gameobjekt können nun verschiedene Informationen im Sichtfeld anzeigen. In diesem Fall wird die aktuelle Präsentationszeit (Timer) angezeigt. Diese wird dem UI Game-Objekt untergeordnet (siehe Abbildung 4). Dem Timer wird ein einfaches Skript hinzugefügt welches eine Text Komponente bearbeitet. Lichtquelle An derselben Position wie auch das Kamera Objekt befindet sich die Lichtquelle. Sie leuchtet die Szene gleichmäßig aus. Dabei handelt sich um eine Punktlichtquelle. Tests mit der Samsung Gear VR haben gezeigt das diese Sorte von Lichtquelle sich am besten eignet um die umschließenden Sphären optimal auszuleuchten. Auf Abbildung 7 wird der Inspector der Lichtquelle und dessen Komponenten gezeigt. Hier ist der „Type“ welcher auf „Point“ gestellt ist zu beachten. Außerdem wird die „Range“ auf 100 gestellt. Das stellt sicher das das Licht auch die Sphären erreicht, welche ebenfalls die Größeneinheit 100 besitzen. Mit der „Intensity“ kann die Helligkeit der Lichtquelle festgelegt werden. Hier zeigt sich das der Wert 2 einen guten Effekt auf dem Endgerät erzielt. 20.09.2017 28 Sebastian Nieder
Abbildung 7: Inspector der Punktlichtquelle Invert-Shader Auf die umschließenden Sphären wird das Videomaterial mithilfe eines Invert- Shaders und des Video-Players projiziert. Der Shader wird in der Material Komponente der Sphären definiert. Der Video-Player ermöglicht es eine Videodatei auf der Oberfläche der Sphäre abzuspielen und sichtbar zu machen. Da sich die Kamera innerhalb der Sphäre befinden muss nun der Invert-Shader das Material auf der Innenseite der Sphäre anzeigen. 20.09.2017 29 Sebastian Nieder
Videosphären Die Sphären befinden sich im Zentrum der Simulation. In ihrem Mittelpunkt befinden sich die Kamera und die Lichtquelle. Es sind zwei Videosphären notwendig, da der Video-Player von Unity eine bestimmte Zeit abhängig von der Qualität und Länge des Videomaterials benötigt um diese zu laden. Die Sphären wechseln sich mit der Wiedergabe des Materials ab. Diese Aufgabe übernimmt der Szenenwechsler. Ist das Ende eines Videoclips erreicht wechselt er die aktive mit der zuvor inaktiven Sphäre auf der der nächste Videoclip bereits geladen ist aus. Zu seinen Aufgaben gehört es unterdessen den nächsten Videoclip zu wählen. Die Kriterien unterliegen dabei größtenteils dem Zufall aber auch den vom Nutzer eingestellten Kriterien der Simulation. Menü Das Menü besteht aus teilweise durchsichtigen Flächen innerhalb der Videosphären. Diese Flächen sind als sogenannte Collider definiert. Sie sind dem Game-Objekt „Menu“ untergeordnet (vgl. Abbildung 4). Es ist wichtig zu beachten das diesen Flächen die „Mesh Collider“ und „Mesh Renderer“ Komponenten zugeordnet sind. Diese werden vom VREyeRaycaster benötigt um eine Kollision mit dem Blickrichtungsvektor feststellen zu können. Abbildung 8 zeigt diese Komponenten im Inspector einer Menü Fläche. Außerdem sind hier drei Skripte untergeordnet welche für die Interaktion eine Rolle spielen. Das „VR Interactive Item“ definiert dieses Game-Objekt als ein Interaktives Element auf das Zugegriffen werden kann. „VR Interaction Test“ lässt uns das Material des Elements beeinflussen um den Nutzer zu zeigen das er sich jetzt mit seiner Auswahl auf dem Objekt befindet oder dieses angeklickt hat. Im „Exit Button“ Skript kann definiert werden wie auf die Interaktion zu reagieren ist. In diesem Fall wird die Simulation verlassen und zum Hauptmenü zurückgekehrt. 20.09.2017 30 Sebastian Nieder
Abbildung 8: Inspector einer Menü Fläche Bildschirmaufnahme In der virtuellen Umgebung soll sich außerdem der Bildschirm des Nutzers anzeigen lassen (siehe Abbildung 2 unten rechts). Dies wird durch einen Java Klienten auf dem Rechner des Nutzers umgesetzt (siehe. 2.4.2, Java Client). Abbildung 9: Screen Game-Objekt im Szenengraphen 20.09.2017 31 Sebastian Nieder
Die Bildschirmaufnahme wird auf das „Screen“ Game-Objekt projiziert. Es ist eine Fläche die sich wie die Menü Interaktionsflächen innerhalb der Sphäre befindet. Auf diesem Objekt befindet sich das „Screenhandler“ Skript das mithilfe der „WWW“ Klasse von Unity ein Bild von einer Netzwerkadresse laden und diese in eine Textur umwandeln kann. Diese Textur kann dann einer „Texture“ Variablen einer „Raw Image“ Komponente zugewiesen werden. Diese Komponente befindet sich auf einem „RawImage“ Game-Objekt das dem „Panel“ Game-Objekt untergeordnet ist (siehe Abbildung 9 und 10). Abbildung 10: Inspector des RawImage Game-Objects 20.09.2017 32 Sebastian Nieder
2.4.2 Java Client
Der Java Client ist ein Webserver auf Basis des Springboot Frameworks. (Spring 2017)
Er stellt eine REST-Schnittstelle zur Verfügung die eine Bildschirmaufnahme des
Rechners erstellt und zurückliefert. Diese wird in regelmäßigen Abständen von der
Unity Anwendung mit einem http Request aus aufgerufen. Abbildung 11 zeigt den
Ablauf einer solchen Anfrage.
REST
Http Request Controller
Schnittstelle
(Client) (Server)
(Server)
Abbildung 11: Ablauf des REST Aufruf durch den Unity Clienten.
Die REST Schnittstelle wertet diese Anfrage aus und erteilt dem Controller die
Aufgabe einen Screenshot anzufertigen. Für die Bildschirmaufnahme wird die
„Robot“ Klasse des java.awt Pakets verwendet. Sie erstellt ein BufferedImage mit der
Auflösung des Zielrechners. Diesem Bild fehlt jedoch der Mauszeiger, der wichtig für
die Steuerung innerhalb der Simulation ist, um sich zu orientieren. Die Position des
Mauszeigers kann mithilfe der „MouseInfo“ Klasse des java.awt Pakets ermittelt und
dem Bild hinzugefügt werden. Um eine bessere Performance zu erreichen wird das
rohe Bildmaterial nun auf eine niedrigere Auflösung skaliert und anschließend an die
REST Schnittstelle zurückgeliefert. Diese fügt das fertige Bild in den Content des Http
Response und versendet diesen.
20.09.2017 33 Sebastian Nieder3. Durchführung der Wirksamkeitsanalyse In den folgenden Kapiteln wird die Durchführung der Wirksamkeitsanalyse beschrieben. Dabei wird zuerst erläutert unter welchen Bedingungen die Tests stattgefunden haben und welche einzelnen Schritte durchgeführt wurden. Außerdem wird der Fragebogen für die spätere Auswertung vorgestellt und begründet. 3.1 Vorbereitung des Tests Um die Wirksamkeit der Simulation zu messen, wird ein Test mit Gear VR und einem Smartphone durchgeführt. Zunächst müssen Inhalt, Ablauf und Rahmenbedingungen der Tests festgelegt werden. Umfeld Der Test findet in einem Umfeld statt, in der sich die Testpersonen wohlfühlen und üblicherweise lernen oder trainieren würden. (vgl. 0 Fragebogen - Grenzen und Rahmenbedingungen) Das kann das Wohnzimmer, aber auch das Arbeitszimmer sein. Um zu verhindern das die Personen währen des Tests sich verletzten oder an Schwindelgefühlen leiden, wird er im Sitzen durchgeführt. Inhalt Der Inhalt des Tests soll die Präsentationssituation mit der Screencapture Funktion sein. Dabei wird eine Simulation mit acht Personen im Publikum in einem Präsentationsraum gewählt. Es finden keine Ablenkungen durch die Zuschauer oder andere Ereignisse statt. 20.09.2017 34 Sebastian Nieder
Zeitlicher Umfang des Vortrags Der zeitliche Umfang des Tests wird auf mindestens zwei Minuten festgelegt. Die Testpersonen sollen sich in dieser Zeit in den Vortrag einarbeiten können und die Simulation auf sich wirken lassen. Da es ein spontaner Vortrag ist, kann dieser Test nicht in einer realistischen Länge simuliert werden. Testpersonen Für den Test wurden fünf Testpersonen befragt. Wie in Abschnitt 1.3.1 Fragebogen – Stichprobenwahl erläutert wird sollte die Anzahl der Befragten bei einer offenen Zielgruppe möglichst hoch sein, doch das war aufgrund der Zeit welche die Entwicklung der Anwendung in Anspruch genommen hat nicht möglich. Es wurden Personen mit einem Alter zwischen zweiundzwanzig und zweiundvierzig Jahren und aus unterschiedlichen Berufsgruppen gewählt. Das durchschnittliche Alter lag dabei bei achtundzwanzig Jahren. Die Stichprobe bestand aus Studenten sowie Berufstätigen welche jeweils eine sehr unterschiedliche Anzahl von Vorträgen in ihrem Alltag halten müssen. Die Testpersonen haben die Anwendung vor der dem Test noch nicht gesehen und konnten ihn somit unvoreingenommen Durchführen. Bei der Auswahl der Testpersonen wurde darauf geachtet ein möglichst breites Spektrum an Alters und Berufsgruppen abzudecken. 20.09.2017 35 Sebastian Nieder
3.1.1 Durchführung
Die Anwender bekommen die VR-Brille mit eingelegtem Smartphone und einen
Rechner mit gestarteter Screencapture Anwendung zur Verfügung. Darauf ist eine
Präsentation vorbereitet die einige Bilder zeigt. Ihnen werden die grundlegenden
Funktionen der Hardware erklärt und wie diese einzusetzen sind. Sollten dabei
Verständnisprobleme aufgetreten und es ist notwendig einige Funktionen genauer
zu erklären werden diese mithilfe von kleinen Beispielprogrammen erläutert.
Dem Tester werden folgende Informationen gegeben und Aufgaben gestellt.
Allgemein
Sie wollen sich auf einen Vortrag vorbereiten und möchten diesen üben.
Das Thema können sie selbst wählen. Beispielsweise können sie von ihrem
letzten Urlaub erzählen.
Simulation
Sie befinden sich nun in einer Vortragssituation. Machen Sie sich mit der
Umgebung vertraut.
Versuchen sie den Rechner zu bedienen und die Präsentation zu steuern.
Haben sie sich mit der Situation vertraut gemacht fangen sie nun an einen
kurzen Vortrag zu halten.
Im Anschluss an die Vortragssimulation wird das Feedback der Tester mittels eines
Fragebogens ermittelt. Dies wurde durchgeführt um den Test messbar zu machen.
Die Befragungen fanden im selben Umfeld wie die Simulation statt. Es befanden sich
dabei nur die Testperson im Raum um Einflüsse durch den Fragesteller und weiterer
Personen zu vermeiden. (siehe Abschnitt 1.3.1 Fragebogen –
Verfälschungstendenzen)
20.09.2017 36 Sebastian Nieder3.2 Fragebogen Es werden zwei Kategorien bewertet und getestet. Die Wirksamkeit des Trainings und die Qualität der Präsentationssimulation. Die Wirksamkeit des Trainings kann nur gegeben sein, wenn die Simulation der Originalsituation so nah wie möglich kommt. Das kann man mit dem Arbeitsplatz vergleichen an dem das Training stattfindet. Frage 1 und 2: Ort und Umgebung Dabei gilt es zu überprüfen ob die Situation in der sich der Nutzer befindet dem Ort und der Umgebung des späteren Vortrags möglichst nahekommt. Dies wird mit der ersten und zweiten Frage festgestellt. (vgl. 1.1.2 Präsentationstraining) Daraus wurden die beiden folgenden Fragen abgeleitet: Frage 1: Die Simulation kam der Situation eines Vortrags im allgemeinen nahe. Frage 2: Können Sie sich vorstellen einen Vortrag in der simulierten Umgebung zu halten? Frage 3: Verbesserungsmöglichkeiten Mit der dritten Frage kann vom Tester erfahren werden wie die Anwendung in der Zukunft weiter verbessert werden kann und ob ihnen bei der Simulation etwas gefehlt hat. Es können dadurch auch weitere wichtige Funktionen festgestellt werden die bei der Entwicklung zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt wurden. Für den Fragebogen wurde die Frage wie folgt formuliert: Frage 3: Was hat Ihnen bei der Simulation gefehlt? 20.09.2017 37 Sebastian Nieder
Frage 4 und 5: Aktivierungsniveau Für ein wirksames Training soll der Tester sich in einem mittleren gereizten Zustand befinden. Das wird erreicht indem die Simulation einen Vortragsraum mit mindestens einer Anwesenden Person zeigt. Die Personen verhalten sich passiv und versuchen den Vortragenden nicht zu bewerten oder zu beeinflussen. Mit der vierten und fünften Frage wird festgestellt ob der Nutzer diesen Zustand erreicht hat oder nicht. Um eventuell weitere Elemente zu sammeln wird außerdem gefragt was außer den simulierten Personen diesen Zustand noch ausgelöst haben könnte. (vgl. 1.1.1 Wirksamkeit und Erfolgsfaktoren eines Trainings) Hier könnte das Ergebnis ein sehr breit gefächertes Antworten Spektrum sein, da die Testpersonen sich in einem sehr unterschiedlichen Trainingszustand befinden. (vgl. 3.1 Vorbereitung des Tests – Testpersonen) Daraus wurden die beiden folgenden Fragen abgeleitet: Frage 4: Ich war während des Vortrags aufgeregt. Frage 5: Welche Elemente haben ihre Aufregung beeinflusst. Frage 6: Vorbereitung Mit der sechsten Frage wird direkt ermittelt ob der Tester sich besser auf den Vortrag vorbereitet fühlt. Hier ist wichtig festzustellen ob sich das Aktivierungsniveau gesenkt hat und er nun bei dem eigentlichen Vortrag eine bessere Leistung abliefern kann und vor allem weniger aufgeregt ist. (vgl. 1.1.1 Wirksamkeit und Erfolgsfaktoren eines Trainings) Für den Fragebogen wurde die Frage wie folgt formuliert: Frage 6: Haben sie das Gefühl auf den eigentlichen Vortrag nun besser Vorbereitet zu sein? 20.09.2017 38 Sebastian Nieder
Sie können auch lesen