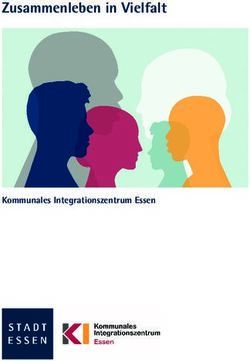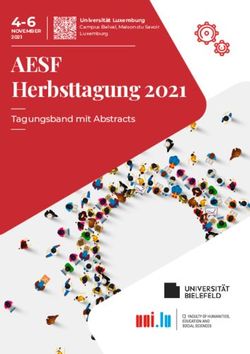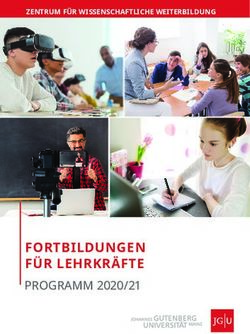TÄTIGKEITSBERICHT 2019 - Gewaltschutzzentrum NÖ
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wir danken allen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern
für die gute Zusammenarbeit!
Das Team des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich
3100 St. Pölten
2700 Wr. Neustadt
3190 Zwettl
2Inhalt
1. DER TAUCHER .................................................................................... 5
2. GEWALTSCHUTZZENTRUM NIEDERÖSTERREICH ................................ 7
a. Verein ........................................................................................ 8
b. Finanzierung ............................................................................... 8
c. Ziele und Aufgaben ...................................................................... 9
d. Kontakt .................................................................................... 10
3. 2019 IM ÜBERBLICK ........................................................................ 12
4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERNETZUNG ................................. 13
a. „20 Jahre GSZ und noch kein bisschen leise“ ................................. 13
b. Eine Zeitreise ............................................................................ 18
c. Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich .......................... 21
d. Neue Wege der institutionellen Zusammenarbeit ............................ 28
e. 16 Tage gegen Gewalt ................................................................ 31
5. HERAUSFORDERUNGEN ................................................................... 35
a. Das „dritte Gewaltschutzgesetz 2019“ .......................................... 35
b. Schutz vor Gewalt durch die Zivilgerichte ...................................... 40
6. STATISTIK ÜBER DAS BERICHTSJAHR 2019 .................................... 45
a. Grafische Darstellung der Statistik 2019 ....................................... 59
b. Tötungsdelikte 2019 ................................................................... 64
7. TÄTIGKEITEN ZU KOOPERATION SOWIE SCHULUNGEN, VORTRÄGE,
FORTBILDUNGEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ................................. 68
31. DER TAUCHER1
„DER TAUCHER ist in jeder Hinsicht ein Film
über unsere Psyche, über unsere Lügen, unser
Schweigen, unsere Angst und Brutalität, aber
auch über unsere Kraft Widerstand zu leisten
und über unseren größten Wunsch: Lieben zu
können und Liebe zu erfahren.“
GÜNTER SCHWAIGER (REGISSEUR)
„Familiäre Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt oder intime Gewalt sind
Ausdruck einer Tatsache: Trotz Zivilisation und Fortschritt sind die vom Partner
oder Ex-Partner ausgeübten Übergriffe Alltag für hunderttausende Frauen in
Europa. Der Film DER TAUCHER des österreichischen Filmemachers Günter
Schwaiger (bekannt von MARTAS KOFFER) behandelt dieses Thema auf
eindringliche Weise: Inmitten der scheinbaren Idylle einer mediterranen Insel
erzählt DER TAUCHER die Geschichte eines Traumas aus den unterschiedlichen
Perspektiven der vier Beteiligten. Ein Psychothriller über familiäre Gewalt, die
Sehnsucht nach Liebe und die unbeugsame Kraft des Aufbegehrens.“2
1
Ein Film von Günter Schwaiger.
2
Mag.a Eva Baumgardinger, Filmladen, Online-Aussendung, 23.10.2019
5Der Filmstart war am 29. November 2019 in den österreichischen Kinos. Im
Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ stellte
der FILMLADEN Verleih das Thema in Kooperation mit Expert*innen aus ganz
Österreich in den Mittelpunkt. Im Cinema Paradiso St. Pölten fand am 3. Dezember
2019 die Filmpremiere statt.
Im Anschluss an den Film diskutierten der Leiter von NeuSTART/Niederösterreich
und Burgenland DSA Alexander Grohs, MSc, die Geschäftsführerin vom
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich Mag.a (FH) Michaela Egger, MA und der
Regisseur und Filmemacher Günter Schwaiger mit dem Publikum über den Film
und das Thema häusliche Gewalt mit den damit verbundenen Auswirkungen.
Foto Credit: Cinema Paradiso/V. Hagenow
Von l. n. r.: Grohs, Egger, Schwaiger
NÖ-Premiere: Der Taucher
Weitere Infos unter:
Website zum Film: https://www.filmladen.at/film/der-taucher
Facebook: https://www.facebook.com/DerTaucherFilm
62. Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
Das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich wurde 1999 als Interventions-
stelle zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt nach Inkrafttreten des
ersten Gewaltschutzgesetzes 1997 eröffnet. Im Laufe der Jahre hat sich die
Interventionsstelle aufgrund ihrer vielfältigen Aufgaben zum
Gewaltschutzzentrum entwickelt und ist für das gesamte Bundesland
Niederösterreich zuständig.
Durch die Gewaltschutzgesetze wurde festgelegt, dass Opfer von häuslicher
Gewalt nicht länger flüchten müssen, sondern die Verursacher*innen haben
die Wohnung, das Haus zu verlassen. Von häuslicher Gewalt sind vor allem
Frauen und ihre Kinder betroffen. Diese geschlechtsspezifische Gewalt gründet
in einem hierarchischen Geschlechterverhältnis, von dem unsere Gesellschaft
nach wie vor geprägt ist. Laut Amnesty International (AI) stellt weltweit Gewalt
gegen Frauen und Mädchen eine der an den häufigsten vorkommenden
Verletzungen der Menschenrechte dar.
Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben frei von Gewalt.
Im Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)3, von
2014 wird deutlich, dass es an der Zeit ist, dass politische
Entscheidungsträger*innen weitere Maßnahmen gegen diese weit verbreitete
Gewalt ergreifen und bestehende Instrumente weiterentwickeln.
Wirkungsvoller Schutz vor häuslicher Gewalt kann jedoch nicht allein durch
gesetzliche Maßnahmen praktiziert werden, sondern diese müssen in der
Praxis umgesetzt und angewendet werden. Häusliche Gewalt betrifft uns alle.
Sie beginnt nicht mit Schlägen, sondern meist mit der großen Liebe und
zerstört in Folge Leben.
Neben den staatlichen Schutzmaßnahmen mit Betretungs- und
Annäherungsverbot (= BV&AV) gegen Gefährder*innen für zwei Wochen und
einem längerfristigen Schutz durch zivilrechtliche Schutzverfügungen (= EV),
bieten in allen österreichischen Bundesländern die Gewaltschutzzentren/
Interventionsstellen Gewaltopfern pro-aktive psycho-soziale und rechtliche
Unterstützung.4
Die Polizei muss die Gewaltschutzzentren/die Wiener Interventionsstelle gegen
Gewalt in der Familie über alle Einsätze von häuslicher Gewalt und Stalking-
Anzeigen informieren. Mitarbeiter*innen der Gewaltschutzzentren/der Wiener
3
Weltweit größten Erhebung über Gewalt gegen Frauen, FRA 2014.
4
Die Interventionsstellen bzw. Gewaltschutzzentren sind gesetzlich verankerte Unterstützungseinrichtungen, die
es in jedem Bundesland in Österreich gibt.
7Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie kontaktieren in der Folge die
Gewaltopfer aktiv, sie bieten ihnen Beratung und Unterstützung und setzen
gewaltpräventive Maßnahmen.
Um effektiven Schutz vor häuslicher Gewalt zu gewährleisten, arbeiten Polizei,
Gerichte sowie Kinder- und Jugendhilfe mit den Gewaltschutzzentren/der
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie eng zusammen. Die
Kooperation ist im Interesse des Opferschutzes und der Gewaltprävention
gesetzlich abgesichert. Zum Symbol dieser aufeinander abgestimmten und
ineinandergreifenden Maßnahmen ist die Interventionskette geworden.
a. Verein
Träger des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich ist der gemeinnützige
Verein, Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Verein für Gewaltprävention,
Opferschutz und Opferhilfe (ZVR 185379172). Im Verein sind seit Jahren
ehrenamtlich tätige Vorstandsfrauen5 engagiert, um gemeinsam mit der
Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich das Weiterbestehen des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich und die Weiterentwicklung der Gewaltschutzarbeit
abzusichern.
Das Team des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich ist multiprofessionell
(vorwiegend Sozialarbeiterinnen und Juristinnen) zusammengesetzt und
verfügt über vielfältige Kompetenzen in verschiedenen Bereichen
(Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenz, Zusatzqualifikationen zu der
Grundausbildung, langjährige Berufserfahrung). Die Mitarbeiterinnen bieten
muttersprachliche Beratung in Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, bzw. wird
zusätzlich Beratung in Türkisch, Rumänisch und Russisch angeboten. Auch
werden Dolmetscher*innen in der Beratungsarbeit zur Unterstützung
beigezogen.
b. Finanzierung
Das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich ist eine gesetzlich verankerte
Opferschutzeinrichtung, die vom Bundeskanzleramt – Sektion für
Frauenangelegenheiten und Gleichstellung – und dem
Bundesministerium für Inneres finanziert wird. Psychosoziale und
juristische Prozessbegleitung für Opfer von Gewalt wird im Rahmen der
Einzelfallförderung vom Bundesministerium für Justiz gefördert.
5
Vielen Dank für die jahrelange, ehrenamtliche Unterstützungstätigkeit im Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich.
8c. Ziele und Aufgaben
Ziele des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich sind es, den Schutz von
Opfern häuslicher Gewalt und Stalking nachhaltig zu verbessern, ihre
subjektive und objektive Sicherheit zu erhöhen und Gewalt zu verhindern. Die
von Gewalt Betroffenen werden von den Mitarbeiterinnen des
Gewaltschutzzentrums Niederösterreich begleitet, damit sie Perspektiven für
ein eigenständiges Leben frei von Gewalt entwickeln können.
Die Unterstützungs- und Interventionsprozesse orientieren sich an den
Bedürfnissen und Rechten der Betroffenen und sind den Standards der
Gewaltschutzarbeit verpflichtet. Die Unterstützung ist kostenfrei und
vertraulich.
Das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich bietet Beratung und Unterstützung
für Gewaltopfer (bei häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt und bei Stalking)
unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Aufenthaltsstatus
und Religion der Betroffenen. Es ist unerheblich, ob die Gewalterfahrungen mit
einer Anzeige öffentlich gemacht wurden oder nicht. Um
geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in der Unterstützungsarbeit
angemessen zu berücksichtigen, wird zur Prävention dieser Gewalt ein
geschlechtsspezifischer Beratungsansatz praktiziert.
Wir bieten rechtliche Beratung und psychosoziale Unterstützung, die
Betroffene ermächtigen soll, fundierte Entscheidungen zu treffen und Wege
aus der Gewalt einzuleiten. Ziel jeder Intervention ist Schutz und Sicherheit
der Gewaltopfer. Daher zählen standardisierte Gefährlichkeitseinschätzungen
und Sicherheitspläne zu unseren grundlegenden Unterstützungs-
instrumenten.
Die Betroffenen erfahren Unterstützung (bei Krisen, bei Stabilisierungs-
prozessen, bei Gefährdungen, bei der Einbringung von Anträgen und Klagen,
…), sie werden zu Zivil- und Strafgerichten wie auch anderen Institutionen
begleitet. Im Rahmen der psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung
können sie auch Unterstützung/Entlastung/ Stärkung/Begleitung in Straf- und
Zivilverfahren erhalten.
9d. Kontakt
Das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich stützt sich auf eine dezentrale
Struktur. Die drei fixen Standorte St. Pölten, Wiener Neustadt und Zwettl
bilden gemeinsam durch die Mitarbeiterinnen das Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich:
St. Pölten Wiener Neustadt Zwettl
AM: Amstetten BA: Baden GD: Gmünd
HL: Hollabrunn BL: Bruck/Leitha KS: Krems Stadt/Land
KO: Korneuburg GF: Gänserndorf HO: Horn
LF: Lilienfeld MI: Mistelbach WT: Waidhofen/Thaya
ME: Melk MD: Mödling ZT: Zwettl
St. Pölten (Stadt/Land) NK: Neunkirchen
SB: Scheibbs WN: Wiener Neustadt
TU: Tulln Stadt/Land
WY: Waidhofen/Ybbs
Nur durch diese Dezentralisierung ist in Niederösterreich, im flächenmäßig
größten Bundesland von Österreich, eine flächendeckende Betreuung von
Gewaltopfern gewährleistet. Zusätzlich bieten wir Unterstützung für
Gewaltbetroffene in der Regionalstelle Amstetten, die sich in der
Frauenberatung Mostviertel befindet, jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr.
Weitere Beratungsangebote können Gewaltopfer anlassbezogen an folgenden
Orten mit großer Regelmäßigkeit wahrnehmen: im Frauenhaus Mistelbach, in
der Frauenberatungsstelle Lilith in Krems (meist einmal pro Woche) sowie in
der BH Krems, in der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
(üblicherweise am Mittwoch nachmittags), in den Räumen des Psychosozialen
Zentrums des Bezirkes Bruck an der Leitha und nach Vereinbarung in der
Bezirkshauptmannschaft Tulln.
Terminvereinbarungen für Unterstützung in der Regionalstelle Amstetten
sowie anlassbezogene Beratung in den genannten Einrichtungen erfolgen über
die Standorte St. Pölten, Wiener Neustadt und Zwettl.
10St. Pölten
Grenzgasse 11/4, 3100 St. Pölten
Telefon 02742/319 66, Fax 02742/319 66-6
Mo, Di, Do, Fr von 9 – 17 Uhr; Mi 14 – 17 Uhr
office.st.poelten@gewaltschutzzentrum-noe.at
Wiener Neustadt
Herrengasse 2a, 2700 Wiener Neustadt
Telefon 02622/243 00, Fax 02622/24300-6
Mo, Do, Fr von 9 – 14 Uhr; Di 14 – 16 Uhr
office.wr.neustadt@gewaltschutzzentrum-noe.at
Zwettl
Landstraße 42/1, 3910 Zwettl
Telefon 02822/530 03, Fax 02822/53155
Mo, Do, Fr von 8 – 12 Uhr; Di 14 – 16 Uhr
office.zwettl@gewaltschutzzentrum-noe.at
Amstetten
in der Frauenberatungsstelle Mostviertel
Hauptplatz 21, 3300 Amstetten
Telefon 02742/319 66
Di 9 – 12 Uhr und nach tel. Vereinbarung
Krems
Frauenberatungsstelle Lilith
Telefon 02742/ 319 66 oder 02822/530 03
Nach tel. Vereinbarung
Mistelbach
Frauenhaus Mistelbach
Telefon 02742/ 319 66
Bruck an der Leitha
PSD – Psychosozialen Dienst
Wiener Gasse 3/Stiege B/2.DG
2460 Bruck an der Leitha
Telefon 02622/243 00
Selbstverständlich sind Terminvereinbarungen auch außerhalb der
Öffnungszeiten des jeweiligen Standorts möglich.
Anrufende werden außerhalb unserer Öffnungszeiten an die Frauenhelpline
unter 0800 222 555 verwiesen.
113. 2019 im überblick
Das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich unterstützte im Auftrag der
Fördergeber*innen, Bundesministerium für Inneres sowie Bundeskanzleramt,
Sektion III – Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
2.822 Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking. Über 81% der Gewaltopfer waren
weiblich, knapp 90% der gefährdenden Personen waren männlich. Im Jahr 2019
ordnete die Polizei in Niederösterreich 1.506 Betretungsverbote an und sprach 116
Mal erweiterte Schutzbereiche für Kinderbetreuungseinrichtungen oder Schulen
aus.
Den Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich
• gelang es in 92% mit der gefährdeten Person Kontakt aufzunehmen
• führten mehr als 9.740 persönliche und telefonische Beratungsgespräche
mit Klient*innen
• unterstützten Klient*innen bei 463 Anträgen auf einstweilige Verfügungen
• verfassten mehr als 3.780 Schriftstücke und Stellungnahmen an andere
Institutionen
• führten mehr als 5.700 Telefonate mit anderen Einrichtungen zum Schutz
und zur Unterstützung der Klient*innen
• unterstützten Gewaltopfer in 479 Straf- und Zivilverfahren
• stießen die Mitarbeiterinnen, aufgrund der hohen Fallzahl und 14 Morde an
Frauen an die Belastungsgrenze
• unterstützten die Durchführung der Evaluation des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich
• waren in MARAC-Bündnissen aktiv, um in multiinstitutionellen
Fallbesprechungen den Schutz von Gewaltopfern in erhöhten
Gefährdungssituationen zu verbessern
• veranstalteten die Fachtagung 20-Jahre Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich
124. Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
a. „20 Jahre GSZ und noch kein bisschen leise“
Am 26. September 2019 feierte das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich im
Cityhotel D&C St. Pölten sein 20-jähriges Jubiläum. Mit zahlreichen
Ehrengästen, Kooperationspartner*innen, Wegbegleiter*innen, Mit-
arbeiterinnen und ehemaligen Mitarbeiterinnen wurde gefeiert, auf 20 Jahre
zurückgeschaut und durch Gespräche und den fachlichen Austausch neue
Wege in die Zukunft eingeschlagen.
Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller,
Landesrat Martin Eichtinger und Geschäftsführerin Michaela Egger bei der
Jubiläumsfeier des Gewaltschutzzentrums.6
Ohne die engagierte Arbeit, und ohne die professionelle Haltung aller
Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich wäre
das Gewaltschutzzentrum nicht möglich.
Vielen Dank.
6
https://www.st-poelten.at/stp-konkret-at-archiv/9666-gewaltschutzzentrum-feiert-20-jaehriges-jubilaeum-
4843, Stand 12.03.2020.
13Frau Mag.a (FH) Michaela Egger, MA Geschäftsführerin und Mag.a Barbara
Prettner7 (Moderation) führten durch einen feierlichen Nachmittag im
Stadtsaal des Cityhotels D&C St. Pölten und schafften einen Einblick in die
Entwicklungen und das Fortbestehen des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich seit der Gründung im Jahr 1999.
Nach den Eröffnungsworten von Michaela Egger, Landesrat Martin Eichtinger,
in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister
Matthias Stadler und dem Vertreter der Landespolizeidirektion
Niederösterreich, Bezirkskommandant Oberstleutnant Johann Neumüller
wurde auf die 20 Jahre des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich
zurückgeblickt.
7
Vielen Dank für die jahrelange Vorstandstätigkeit im Gewaltschutzzentrum Niederosterreich und die Moderation
bei unserer Veranstaltung.
14Begrüßungsworte durch den Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Mit drei fachlichen und praxisnahen Beiträgen wurde der Nachmittag
verfeinert:
15Vortrag: „Männer, das gewalttätige Geschlecht? Wie Männergewalt entsteht
und was wir dagegen tun können?“ – Ass.-Prof. Dr. Paul Scheibelhofer;
Universität Innsbruck, Institut für Erziehungswissenschaft
Vortrag: „Das dritte Gewaltschutzgesetz – zwei Schritte vor und einer zurück?“
– Ass.- Prof.in Mag.a Dr.in Katharina Beclin; Universität Wien, Institut für
Strafrecht und Kriminologie
Vortrag: Forschungsbericht: Evaluation Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich. Ein Projekt im Auftrag des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich - Maria Groinig, MA - Wissenschaftliche Mitarbeiterin; Alpen
Adria Universität, Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung
(IfEB), Arbeitsbereich Sozialpädagogik und Inklusionsforschung
Der musikalische Beitrag: Mira Lu Kovacs8
Teilnehmer*innen an der Veranstaltung
8
https://de-de.facebook.com/miralukovacs/
Vielen Dank dir, Mira für deine Bereitschaft bei unserer 20 Jahr-Feier gegen häusliche Gewalt solo zu performen.
16Mira Lu Kovacs
Maria Imlinger, ehemalige Leiterin Frauenhaus St. Pölten, Marlies Leitner, ehemalige
Geschäftsführerin GSZ Niederösterreich mit Vertretern der LPD Niederösterreich
17b. Eine Zeitreise
Im Gespräch, welches am 21.01.2020 zwischen Maria Reichartzeder9
(Sozialarbeiterin im Frauenhaus Amstetten) und Anna Sonnleitner, BA10
(Sozialarbeiterin im Gewaltschutzzentrum Niederösterreich) geführt wurde, wurde
nochmals in die Vergangenheit geschaut. Es wurde in die Zeit vor 1999 geblickt.
Maria Reichartzeder erzählte wie alles begonnen hat und der Grundstein des
Gewaltschutzzentrums Niederösterreich im Bezirk Amstetten gesetzt wurde. Nach
Inkrafttreten des ersten Gewaltschutzgesetzes Mai 1997 kam es in
Niederösterreich zur Projektvorbereitungsphase und zu Gesprächen darüber,
welche Einrichtung die neue Aufgabe als Opferschutzeinrichtung erbringen könnte.
Erste Bemühungen in Richtung einer damals bezeichneten Interventionsstelle sind
vom Frauenhaus Amstetten vom 3. Mai 1998 zu verzeichnen.
„Die Interventionsstelle Niederösterreich wurde Ende September 1999 in Betrieb
genommen. Das Konzept der Niederösterreichischen Interventionsstelle wurde von
den Frauenhäusern Amstetten, St. Pölten, Mistelbach, Wiener Neustadt,
Neunkirchen und der Frauenberatungsstelle Zwettl erarbeitet. Es hat als Grundlage
das Konzept der Wiener Interventionsstelle von Rosa Logar und Elfriede Fröschl
(1996)“11.
9
Vielen Dank für die jahrelange Zusammenarbeit und dass du dir für die Reise in die Vergangenheit mit Anna
Sonnleitner Zeit genommen hast.
10
Vielen Dank für deine engagierte Arbeit im Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
11
Jahresbericht 2000/Seite 1
18Als Ziel der Interventionsstelle wurde im Konzept für Niederösterreich bzw.
Niederösterreich-West von Frau Reichartzeder 1998 angeführt:
• „Opfer schützen, informieren, beraten, indem rechtl. und soziale
Unterstützung und Information geboten werden.
• Die Opfer schützen, indem rechtlich und soziale Maßnahmen gesetzt oder
beantragt werden, die geeignet sind, den Misshandler vor weiteren
Gewalttaten abzuhalten.
• Die Opfer schützen, in dem die Arbeit der einzelnen, mit dem Fall befassten
Institutionen koordiniert und aufeinander abgestimmt werden.“
Weitere Überlegungen in NÖ zu Interventionsstellen bezogen auf die
Täter*innenarbeit und Gruppenarbeit flossen mit ein (drei Beispiele):
• „[…] Ist der Beschuldigte in Haft, soll er auch dort von einer Mitarbeiterin
der Interventionsstelle aufgesucht werden. […]“
• „Paargespräche mit dem Mann – nur auf Wunsch der Frau.“
• „Unterstützungsgruppen für Frauen. […]“
In diesem Konzept wurde bereits als Hauptbüro St. Pölten festgehalten.
Außenstellen und mehrere Standorte schienen bereits von Beginn an, aufgrund
des flächenmäßig großen Bundeslandes, unumgänglich. Nach allen
Vorüberlegungen und Rücksprachen mit den Ministerien wurde folglich der Verein
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich 1999 gegründet und die Zentrale in St.
Pölten eröffnet. Es folgte im selben Jahr die Gründung des Standortes Wiener
Neustadt. Anfänglich benutzte DSAin Sabine Zehetner12 (Sozialarbeiterin im
Frauenhaus Neunkirchen) die Räumlichkeiten des Frauenhaus Neunkirchen bis das
erste Büro in Wiener Neustadt gefunden wurde.
Laut dem ersten Tätigkeitsbericht des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich –
damals Interventionsstelle Niederösterreich gegen Gewalt an Frauen und Kindern
– wurden 407 Wegweisungen/Betretungsverbote an die sog. Interventionsstelle
Niederösterreich übermittelt13.
Im Jahr 2002 kam der Standort Zwettl hinzu. Im Jahr 2006 kam es zur
Namensänderung in Gewaltschutzzentrum Niederösterreich. 2007 wurden weitere
Regionalstellen in Amstetten, Bruck/Leitha, Waidhofen/Thaya und Wien
ausgebaut. Das Konzept mit den Regionalstellen wurde im Laufe der Zeit neu
organisiert. Die fixen Außenbüros wurden geschlossen, da durch
Mitbenutzungsmöglichkeiten von Beratungsräumen der Kooperations-
partner*innen in den Regionen Alternativen gefunden wurden.
14
12
Vielen Dank für die jahrelange Zusammenarbeit und dass du dir für die Reise in die Vergangenheit in der
Vorbereitung der 20 Jahr-Feier Zeit genommen hast.
13
Jahresbericht 2000/Seite 19.
14
Vielen Dank für die jahrelange Zusammenarbeit und Kooperation.
19Im Jahr 2007/2008 wurde durch den Vertrag mit dem Justizministerium der
Aufgabenbereich durch die Prozessbegleitung erweitert. Das zweiten
Gewaltschutzgesetz 2009 brachte ebenfalls Veränderungen in der Betreuung von
Gewaltopfern mit sich. Die Wirkungsdauer des polizeilichen Betretungsverbot
wurde von 10 auf 14 Tage und die Einstweilige Verfügung nach § 382b EO wurde
von drei auf sechs Monate verlängert. Es wurde ein neuer Straftatbestand
„Fortgesetzte Beeinträchtigung der körperlichen Integrität und der Freiheit“
geschaffen. D.h. es werden bei Gewalt in der Familie nicht nur Einzeltaten zur
Beurteilung des Strafausmaßes herangezogen, sondern mehrere Taten, die z.B. in
der Vergangenheit geschehen sind. Noch zu erwähnen ist, dass Opfer auch das
Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung im Zivilverfahren erhielten, sofern es
ein anhängiges Strafverfahren mit Prozessbegleitung gibt.
2012 wirkte das Gewaltschutzzentrum bei der Gründung der
Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzorientierter Täterarbeit mit und schloss
2014 mit dem Verein NeuStart und der Männerberatung (Caritas/Rat&Hilfe) eine
Kooperationsvereinbarung.15Auch wenn das Gewaltschutzzentrum die
Täter*innenarbeit, nicht wie im Grundkonzept zu den obig angeführten
Überlegungen ausgestaltet und umgesetzt hat, wird eine enge Zusammenarbeit
mit anderen Einrichtungen im Zuge der opferzentrierten Täterarbeit mit NeuStart
und der Männerberatung Caritas/Rat&Hilfe geführt.
Als Wunsch für die Zukunft für gewaltbetroffene Personen und zur Entwicklung des
Gewaltschutzzentrums Niederösterreich führt Frau Maria Reichchartzeder an:
„Ich wünsche mir weniger Gewalt und, dass Betroffene von Gewalt und
Opferschutzeinrichtungen Gehör finden. Ich wünsche mir, mehr öffentliches
Auftreten des Gewaltschutzzentrums und dass jede Mitarbeiterin des
Gewaltschutzzentrums ihren Beitrag zur Weiterentwicklung und Innovation leisten
kann“.
15
Tätigkeitsbericht Gewaltschutzzentrum Niederösterreich 2017, gewaltschutzzentrum-noe.at.
20c. Evaluation Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich
Im Jahr 2012 erstellten die Gewaltschutzzentren Österreichs das Handbuch
„Qualitätsrichtlinien der Gewaltschutzzentren Österreich“.
Die Qualitätsrichtlinie stellt die qualitätspolitischen Grundlagenpositionen, die
Qualitätsprinzipien, die Leistungen und die Qualitätskriterien der
Gewaltschutzzentren Österreich dar. Die Gewaltschutzzentren sind laufend
bestrebt, die bestehenden Angebote an die Klient*innenbedürfnisse anzupassen
und die Qualität der Arbeit zu gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund wurde auf Initiative der Geschäftsführerin des
Gewaltschutzzentrums Kärnten, Mag.a Roswitha Bucher und der teilnehmenden
Gewaltschutzzentren Burgenland, Tirol und Niederösterreich eine
Evaluationsstudie in Auftrag gegeben. Der Forschungsbericht für Niederösterreich
wurde im Rahmen der „20 Jahr-Feier des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich“
durch Maria Groinig, MA einem breiten Publikum präsentiert.
21Die Evaluierung von 4 Gewaltschutzzentren fand parallel in den Gewaltschutz-
zentren Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und Tirol statt. Im Zeitraum
Februar 2018 - Mai 2019 wurde die qualitative Klient*innenbefragung durch offene
Leitfadeninterviews durchgeführt. In allen teilnehmenden Gewaltschutzzentren
ging es um die subjektiven Sichtweisen, Wahrnehmungen und Erfahrungen der
Klient*innen im Hinblick auf die Arbeit und die Angebote der Gewaltschutzzentren.
Jede/r zehnte Klient*in aus dem Verwaltungsprogramm wurde kontaktiert.
Voraussetzung war, dass es keine aktuelle Betreuung gab, sondern der letzte
Kontakt musste ein halbes Jahr zurückgelegen sein. Es wurde versucht eine große
Streuung nach Geschlecht, Alter, erlebter Gewaltform, Selbstmelder*innen,
proaktive Kontaktaufnahme, Migrationserfahrung, Region zu erfassen. Die
Datenauswertung erfolgte nach der grounded theory16, unterstützt durch
Datenanalyseprogramm MAXQDA17.
Neben der Geschäftsführerin und dem gesamten Team waren vor allem drei
Kolleginnen für die Evaluationsstudie verantwortlich. Ein besonderer Dank für
diese großartige Zusammenarbeit gilt hier Mag.a Romana Reisenthaler
(Mitarbeiterin Standort St. Pölten), Karin Melton (ehemalige Mitarbeiterin Standort
Wiener Neustadt) und Mag.a Julia Schlesinger (ehemalige Mitarbeiterin Standort
St. Pölten). Sie koordinierten die gesamte Logistik der Befragung und
unterstützten Maria Groinig, MA in den beiden Interviewwochen.
16
Die Grounded Theory hat das Ziel, mittels Analyse von Interviews, Beobachtungen und anderen empirischen
Daten eine neue Theorie zu formulieren. Dabei wechseln sich Datensammlung und Auswertung so lange
gegenseitig ab, bis neue Auswertungen keine neuen Kenntnisse mehr erbringen. So entsteht ein theoretisches
Modell, das das Forschungsthema vollständig erfasst. Begründet von Anselm Strauss und Barney Glaser.
https://www.scribbr.de/methodik/grounded-theory/10.02.2020.
17
https://www.maxqda.de/ist-computergestuetzte-datenanalyse.
22„Die Sichtweisen und die Wahrnehmungen der Klient*innen, die als Expert*innen
ihrer Lebenswelt gesehen werden, stehen somit im Zentrum der Studie, während
die Fragestellungen auf die Arbeit im Gewaltschutzzentrum und die Erfahrungen
mit der Beratung fokussieren. Die forschungsleitenden Fragestellungen beziehen
sich dabei auf drei Themenkomplexe:
(1) Wahrnehmung der Kontaktaufnahme, des Erstkontaktes und des
Erstbesuches:
• Wie werden die Klient*innen auf das Gewaltschutzzentrum aufmerksam?
• Wie wird die proaktive Kontaktaufnahme erlebt?
• Welche Hürden gibt es für die Klient*innen im Hinblick auf die
Kontaktaufnahme?
• Welche Erwartungen haben die Klient*innen an die Angebote des
Gewaltschutzzentrums?
• Was war während der Kontaktaufnahme und dem Erstbesuch hilfreich,
hinderlich oder störend?
(2) Wahrnehmung der Beratung:
• Welche Erinnerungen haben die Klient*innen an die Beratungsgespräche?
• Wie beschreiben die Klient*innen den Kontakt zu den Beraterinnen?
• Werden die Bedürfnisse der Klient*innen in der Beratung ausreichend
berücksichtigt?
• Haben die Klient*innen das Gefühl während der Beratung über belastende
Themen sprechen zu können?
• Welche Informationen oder Unterstützungsleistungen waren besonders
hilfreich, hinderlich oder störend?
• Gibt es Wünsche im Hinblick auf weitere Informationen oder
Unterstützungsleistungen?
• Wie wird die psychosoziale Prozessbegleitung erlebt?
(3) Veränderungen durch die Beratung:
• Gab es Veränderungen im Alltag durch die Beratung und Unterstützung
des Gewaltschutzzentrums?
• Gab es Veränderungen im Hinblick auf die Gewaltsituation?
• Wie werden Schutz und Sicherheit von den Klient*innen wahrgenommen?
• Gibt es Verbesserungsvorschläge für die Arbeit des
Gewaltschutzzentrums?
• Wie wird die öffentliche Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit des
Gewaltschutzzentrums von den Klient*innen eingeschätzt?
23Übergeordnetes Ziel der Analyse ist es, hilfreiche und hinderliche Aspekte im
Hinblick auf die Angebote des GSZ zu ermitteln und etwaige
Verbesserungsvorschläge abzuleiten.“18
• Wahrnehmung der Kontaktaufnahme, des Erstkontaktes und des
Erstbesuches:
Ein zentrales Element der Arbeit aller Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich sowie aller Mitarbeiter*innen der Gewaltschutzzentren
Österreichs und der Interventionsstelle Wien gegen Gewalt in der Familie ist die
pro-aktive Kontaktaufnahme. Dieses Qualitätsmerkmal und die Aufklärung beim
Erstkontakt über die Arbeitsweise und das Beratungsangebot vermittelt den
Klient*innen Sicherheit und vermindert Ängste und Widerstände.
Klient*innen wissen zumeist im Vorfeld weder über die Existenz noch über die
Unterstützungsangebote des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich Bescheid. In
den Interviews beschreiben Gewaltopfer ihre Situation als belastende Ausnahme-
und Extremsituation, da die Alltagsroutine mit der Gewaltgeschichte zu bewältigen
ist, und dies mitunter zur emotionalen und alltagspraktischen Überforderung führt.
Die Gewalterfahrungen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität und
Leistungsfähigkeit von Menschen. Sie verursachen Krankheit, Arbeitsunfähigkeit
und haben somit eine gesamtgesellschaftliche Auswirkung.
„Weil es war einfach so, dass ich Tag und Nacht überwacht worden bin und alles
(.). Ich hätte mich weder an irgendwen wenden können oder sonst irgendwas, ja.
Und ich bin es auch gar nicht gewohnt, dass ich sage, ich kann aus diesem Käfig
großartig heraus, weil das ist eine so eingeprägte Sache über die Jahre und alles
(.), du (.), man hat die Kraft einfach nicht mehr (.), und man hat auch gar nicht
mehr die Sichtweisen so (.). Man sitzt einfach im Gefängnis und sagt: ‘Ok. das ist
jetzt so.‘“ (11_Elsa: 123f)19
In diesen Ausnahme- und Extremsituationen entwickeln Klient*innen mit
Gewalterfahrungen eine Tendenz sich zurückziehen und sich nicht aktiv um Hilfe
und Unterstützung zu bemühen.
„Naja es ist halt (.), in der Situation ist es so, man ist emotional überfordert mit
allem drum und dran, und da ist es schon ganz gut, wenn sich da wer meldet und
mit dir gleich einen Termin ausmacht für verschiedene Sachen wie Wegweisung
und dass das aufrecht erhalten bleibt und das ist (.), also ich wäre nicht in der
Lage gewesen, dass ich irgendwas von diesen Dingen erledigen hätte können, und
das war für mich sehr angenehm, dass da wer gekommen ist und mir unter die
Arme gegriffen hat. (11_Elsa: 13f)20
18
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 14-15.
19
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 23.
20
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 28.
24• Wahrnehmung der Beratung:
Des Weiteren beschreiben die Gewaltopfer, dass die Beratung im
Gewaltschutzzentrum dazu beiträgt Klarheit über die je individuelle Situation zu
gewinnen. Der akute Stress wird dadurch vermindert, was in weiterer Folge zu
einer ersten Entlastung führt. Klient*innen erlangen ihre Handlungsfähigkeit und
ihre Selbstsicherheit wieder und sind so wieder Entscheidungsfähig.
„Also sehr positiv (.), also wie gesagt sehr schnell einen Termin (.), was in so einer
Situation sehr positiv ist, weil man ja unter Stress steht (.). Es bringt einem
Erleichterung das Erstgespräch (.). Man hat das Gefühl, da hilft mir jemand (.).
Ich stehe nicht alleine auf dieser Welt gegen den Täter (.) und das war schon
erleichternd (.). Ja und man hat auch das Gefühl, es packt auch jemand mit an,
der sich auskennt, mit den rechtlichen Sachen, und da ist man als Laie verloren.“
(07_Jenske: 45f)21
Eine positive Anmerkung der Studienteilnehmer*innen war die Tatsache, dass die
Beraterinnen, erleichternd, verständnisvoll, dem Tempo der Klient*in angepasst
und zielorientiert agieren.
„Es war einfach nur hilfreich, weil ich eben das Gefühl gehabt habe, es wird mir
etwas abgenommen, weil ich habe mir gedacht um Gottes Willen, was da jetzt
alles auf mich zukommt und wie schafft man das, was macht man da überhaupt,
ja und das war natürlich schon also diese große Hilfe.“ (01_Helga: 152f)22
Qualitätsmerkmale, wie z.B. Empathie, Aspekte des Redens, Präsenz, die Fähigkeit
des Zuhörens, jedoch nicht mitleidig, verurteilend oder bewertend handeln, das
fachliche Wissen sind Auswahlkriterien in der Personalauswahl. Die Haltung und
Arbeitsweise der Beraterinnen in den Beratungsgesprächen wurden als durchwegs
positiv rückgemeldet.
„Also die positivste Erfahrung war, dass ich so behandelt worden bin, wie ich bin,
und dass nicht das Ganze halt nicht auf gepusht worden ist (.) … Also ich kann das
halt ganz schlecht beschreiben, aber natürlich die Herzlichkeit und das Zuhören
war für mich ganz wichtig, dass ich ernst genommen worden bin und dass im
Hintergrund, weil ich kann in Menschen schon ein bisschen reinschauen und ich
sehe, ob mich jetzt einer innerlich auslacht oder sagt oder sich denkt, du hast es
eh verdient, du schaust eh so aus, als ob du es verdient hättest.“ (22_Herta:
197f)23
21
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 26.
22
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 54.
23
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 47.
25• Veränderungen durch die Beratung:
Das Gewaltschutzzentrum versteht sich als Opferschutzeinrichtung und als tertiäre
Präventionsmaßnahme in Hinblick auf häusliche Gewalt. Die Zielgruppe sind
Personen die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Vor diesem Hintergrund ist
davon auszugehen, dass durch die Intervention der Mitarbeiterinnen ein
Veränderungsprozess, z.B. in der Wahrnehmung von Gewalt bei betroffenen
angeregt wird.
„(.) ich habe einige Dinge (.), einige Dinge habe ich gar nicht als Gewalt
wahrgenommen, wo ich gesagt habe, o.k., es ist halt so, das nimmst du halt so
(.), aber es ist Gewalt, wenn dich einer permanent zu irgendwas (.) unterdrückt
oder irgendwas verbietet oder sonst irgendwas. Das ist Gewalt, weil man hat kein
freies Leben, wenn man fragen muss, ob man zu einer Freundin gehen darf (.),
oder wenn ständig das Telefon von dir kontrolliert wird, ob irgendwer angerufen
hätte, oder sonst irgendwas (.). Ob du ein Verhältnis hast oder sonst irgendwas,
ich meine das ist (.), wenn deine Handtaschen durchsucht wird (.). […] Man nimmt
es anders wahr, ja man nimmt mehr wahr (.), weil ich war schon so [unv.], dass
ich nur mehr die ganz schlimmen Sachen als Gewalt wahrgenommen habe (.), es
war für mich (.), die Alltagssachen waren für mich keine Gewalt mehr, das war
natürlich,(.)“ (11_Elsa: 343f)24
Ein wichtiger Aspekt liegt darin, dass durch die Unterstützung durch das
Gewaltschutzzentrums von Gewalt betroffene Personen bestärkt werden aktive
Handlungen zu setzen, die dazu beitragen, z.B. aus Gewaltdynamiken aussteigen
zu können. Des Weiteren wird der Polizeischutz von manchen
Studienteilnehmer*innen als zentrale Maßnahme thematisiert, die Schutz- und
Sicherheitsgefühle vermittelt.
„Man wird selbstbewusster und man weiß, man muss sich nicht verstecken, weil
das passiert ist (.), man muss es auch nicht jedem an die Nase binden (.),aber
man weiß, man ist nicht alleine damit.“ (28_Nicole: 481f)25
Das Gewaltschutzzentrum trägt ebenso dazu bei, dass Klient*innen die soziale
Isolation verlassen und im Zuge dessen das Schweigen ein Ende findet. Das
Wissen, dass jemand über die Situation Bescheid weiß, hat einen zentralen
Stellenwert. Durch das Verlassen von Ohnmacht und Hilflosigkeit werden
Klient*innen wieder handlungsfähig.
24
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 57.
25
Evaluation Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Forschungsbericht 2018/19, Seite 59.
26„Das Leben an und für sich (.), dieses sich nicht mehr verstecken zu müssen (.),
nicht mehr wie soll ich sagen. Man lebt auch jetzt wieder zu Hause (.), das ist das
(.), wir haben ziemlich viel umstrukturiert daheim, … weil wir jetzt ja unser Leben
leben und nicht an ihm ausgerichtet, in dem Sinn und freier nicht mehr in dieser
Angst.“ (28_Nicole: 463f)
In der Gesamtbetrachtung macht die Erhebung sichtbar, dass die Arbeit des
Gewaltschutzzentrums Niederösterreich von den Klient*innen überwiegend positiv
und als äußerst notwendig eingeschätzt wird, was uns als Mitarbeiterinnen in der
Arbeit mit Klient*innen motiviert und vorantreibt für die Durchsetzung ihrer Rechte
einzutreten.
20 Jahre Gewaltschutzzentrum Niederösterreich und noch kein bisschen leise wird
auch in Zukunft der Antrieb unserer Arbeit sein. Es gibt, schaut man sich die
Verbesserungsvorschläge der Klient*innen an, noch viel zu tun. Alles werden wir
nicht umsetzen können, aber wir werden nicht müde werden daran zu arbeiten -
nicht leise sein, um die Perspektiven der Gewaltopfer sichtbar zu machen - nicht
leise sein, um Häusliche Gewalt und die damit verbundenen Folgen und
Auswirkungen zu enttabuisieren und das Thema gesellschaftsweit zu positionieren.
27d. Neue Wege der institutionellen
Zusammenarbeit
Zu Beginn des Jahres 2019 wurden in Österreich 18 Frauen getötet. Gesamt hat
Österreich 2019 als ernüchternde Gesamtbilanz 34 Frauenmorde zu verzeichnen.
Polizeiliche Kriminalstatistik zu Frauenmorden (2014-2019)26:
Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Weibliche 19 17 28 36 41 34
Mordopfer
In Niederösterreich starben fünf Frauen innerhalb eines Monats durch den
Ehemann oder Ex-Lebensgefährten. Die Anzahl erhöhte sich im Laufe des Jahres
in Niederösterreich auf 14 Frauenmorde. Diese unfassbare Zahl wird vom Jahr
2019 in Erinnerung bleiben und brachte die Mitarbeiterinnen des
Gewaltschutzzentrums, aber auch Mitarbeiter*innen aus den Frauenhäusern und
Frauenberatungsstellen, der Polizei, Justiz (Staatsanwaltschaft, Bezirks- und
Landesgericht), Kinder- und Jugendhilfe, Bewährungshilfe um nur einige
Stakeholder in der Arbeit mit häuslicher Gewalt aufzuzählen an die
Belastungsgrenze. Die Mordfälle haben die Schlagzeilen der Medien beherrscht.
Österreich hat 2013 die Istanbul-Konvention27 ratifiziert. Das „Übereinkommen des
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt gilt als das derzeit wichtigste Rechtsinstrument gegen Gewalt
an Frauen28 in Europa. Durch das Übereinkommen wurden verbindliche
Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt geschaffen. Unter
anderem setzt die Konvention auf verbindliche Standards für die Verhinderung von
häuslicher Gewalt an Frauen und den Schutz von Opfern. Das Übereinkommen legt
„die Rechte des Opfers in den Mittelpunkt aller Maßnahmen“ (Art 7). Die Istanbul-
Konvention sieht z.B. die institutionelle Zusammenarbeit bei der Analyse der
Gefahren zum Schutz von Betroffenen als zentrale Maßnahme vor. Schon im Laufe
des Inkrafttretens des Gewaltschutzgesetzes war die Kooperation zwischen den
beteiligten Institutionen ein unverzichtbares Element für eine institutionelle
Zusammenarbeit.
26
Bericht des Bundesministeriums für Inneres: Im Jahr 2019 wurden 34 Frauen, häufig von ihren (Ex-)Partnern
oder Familienmitgliedern ermordet. Quelle: https://www.aoef.at/index.php/zahlen-und-daten.
27
Quelle: https://www.coe.int.
28
Der Begriff Frauen in der Konvention umfasst auch Mädchen
28Seit Bestehen des Gewaltschutzzentrums wird diese Kooperation kontinuierlich
gepflegt und weiter ausgebaut. Durch das Gewaltschutzzentrum wurden zwei
Fallbesprechungen in St. Pölten als auch in Wiener Neustadt organisiert und
abgehalten. Auf einer gegenseitig wertschätzenden Ebene wurde über eine
Optimierung von Abläufen und strukturelle Gegebenheiten diskutiert.
Auch das Land Niederösterreich lud am 22. Jänner 2019, auf Initiative der beiden
Landesrätinnen, Christiane Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger-Ludwig zu
einem „Runder Tisch gegen Gewalt“ ein. Ziel dieser Expert*innen-Runden war und
ist es, Strategien zur Verbesserung und Stärkung von Präventionsmaßnahmen zu
arbeiten. Die „Runden Tische“ wurden im Laufe des Jahres durch Expert*innen
aus dem Bildungswesen, Schulsozialarbeit, Männerberatung, Kinder- und
Jugendhilfe erweitert und fanden im Sommer und Herbst 2019 statt. In Zukunft
sollen die Bereiche Gesundheit, Bildung und Kinder- und Jugendarbeit in das
gemeinsame und vernetzte Vorgehen gegen Gewalt an Frauen miteinbezogen
werden.
Quelle: http://www.stadtlandzeitung.com Nathalie Hörndler - 23. Januar 2019
Zudem wurde durch die zuständige Landesrätin auf politischer Ebene dahingehend
interveniert, dass die Aufnahme von hoch gefährdeten Frauen auch
Bundeslandübergreifend, durch Sicherstellung der Finanzierung möglich wird.
29Ein Ergebnis dieser „Runden Tische“ ist der Folder „Du hast ein Recht auf ein …
Gewaltfreies Leben“. Dieser wurde für die jeweiligen Viertel Niederösterreichs
individuell gestaltet und großflächig aufgelegt. Die Informationsfolder liegen an
Orten auf, die im Alltagsgeschehen von Frauen oft frequentiert werden, wie in
Filialen von Supermärkten, aber auch in öffentlichen Einrichtungen wie
Gemeinden, Kliniken und Arztpraxen.
Auf der Homepage der Niederösterreichischen Landesregierung:
http://www.noe.gv.at/noe/Frauen/Gewaltschutz.html
können die Folder je nach Region auch als PDF heruntergeladen werden.
Das Ziel der „Runden Tische“ ist es, alle Berufsgruppen die mit den Themen
„Häusliche Gewalt“ und Gewalt an Frauen zu tun haben, an einen Tisch zu holen.
Um Lücken in der Bekämpfung von häuslicher Gewalt aufzuzeigen und mit einem
gemeinsamen vernetzten Vorgehen diese Lücken zu schließen.
30e. 16 Tage gegen Gewalt
Seit 1999 ist der 25. November auch von den Vereinten Nationen als offizieller
internationaler Gedenktag anerkannt. Der Gedenktag geht auf die Ermordung der
drei Schwestern Mirabal zurück, die am 25. November 1960 in der
Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger
Folter getötet wurden. Weltweit finden im Kampagnenzeitraum zwischen dem
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und dem Internationalen Tag für
Menschenrechte Aktionen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt.
Seit vielen Jahren nehmen Kolleginnen des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich in vielen Regionen an Aktionen im Rahmen der „16 Tage gegen
Gewalt“ teil. In Wiener Neustadt wurden mit dem traditionellen Fahne hissen „frei
leben, ohne Gewalt“ die 16. Tage gegen Gewalt eingeleitet.
Fotocredit "Stadt Wiener Neustadt/Pürer
31Am 9. Dezember 2019 fand ein Gespräch anlässlich der Kampagne „16 Tage ohne
Gewalt an Frauen“ im Gewaltschutzzentrum Niederösterreich mit den
Niederösterreichischen Landesrätinnen Petra Bohuslav und Christine Teschl-
Hofmeister sowie der Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl statt. An diesem
Tag wurde der 14. Frauenmord in Niederösterreich bekannt. Landesrätin Petra
Bohuslav betonte: „Wir dürfen nicht müde werden Zeichen gegen Gewalt an
Frauen zu setzen, jede Frau hat ein Recht auf gewaltfreies Leben.“
Michaela Egger, Petra Bohuslav, Christiane Teschl-Hofmeister und Sonja Fiegl im Gespräch. Wir
Niederösterreicherinnen29
Wie schon bei den drei „Runden Tischen gegen Gewalt“ wurde auch bei der
Pressekonferenz im Gewaltschutzzentrum Niederösterreich betont, wie wichtig die
Präventionsarbeit im Bildungsbereich ist und wie sehr ein guter Opferschutz auch
nur funktionieren kann, wenn mit den Tätern gearbeitet wird. Seit 2015 besteht
eine Kooperationsvereinbarung im Interesse des Opferschutzes zwischen dem
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, der Männerberatung Caritas „Rat und
Hilfe“ und NeuSTART. Vorgesehen ist, dass das Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich und die Bewährungshilfe, bzw. die Männerberatung
Informationen zu Gefährlichkeitsfaktoren und zu gefährlichen Situationen
austauschen und Sicherheitsmaßnahmen erarbeiten.
29
NÖN Artikel, Sophie Seeböck. Erstellt am 9. Dezember 2019.
32Beide Einrichtungen bieten opferschutzorientierte Täterarbeit, nach den Standards
der BAG-OTA30 was bedeutet, dass ein fallspezifischer Informationsaustausch
zwischen Täterarbeit und Opferschutz gewährleistet ist. NeuSTART ist in ganz
Niederösterreich tätig. Die Caritas- Männerberatung ist derzeit nur in St. Pölten
und an neun weiteren Standorten (Amstetten, Gmünd, Horn, Krems, Scheibbs,
Tulln, Waidhofen/Ybbs, Waidhofen/Thaya, Zwettl) vertreten.
Weitere Aktionen an denen Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums
Niederösterreich beteiligt waren tragen einen wichtigen Beitrag dazu bei, dass über
das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen gesprochen wird. Die Enttabuisierung
und die Präventionsarbeit ist ein wichtiger Beitrag häuslicher Gewalt
entgegenzutreten.
Teilnehmerinnen am Hauptplatz Amstetten
Am Hauptplatz in Amstetten wurde im Rahmen der 16. Tage gegen Gewalt
parteiübergreifend und mit Vertreterinnen von NGOs eine Kundgebung: „Stimmen
gegen Gewalt an Frauen“ veranstaltet. Gewalt ist immer eine Verletzung der
persönlichen Grenzen, dagegen müssen wir geschlossen und konsequent auftreten
und sichtbare Zeichen in der Gesellschaft setzen.
30
Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzorientierte Täterarbeit, gegründet 2012.
33Die UN-Kampagne „Orange The World“ findet ebenfalls in den 16. Tagen gegen
Gewalt statt. Weltweit erstrahlen Gebäude in oranger Farbe, um gemeinsam ein
sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Gewalt an Frauen sichtbar
machen ist ein wichtiger öffentlicher Beitrag.
Am 25. November stand die Evangelische Kirche in Gmünd ganz im Zeichen der
Farbe Orange. Der Soroptimist-Club Waldviertel31 organisierte die Veranstaltung
in der Evangelischen Kirche mit einem Vortrag von Elisabeth Eckhart32. Danach
fand eine Podiumsdiskussion, mit dem Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks,
Sylvia Zwettler vom Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Standort Zwettl, der
Spitalsärztin Julia Dlask, Nicole Mayerhofer, Mitarbeiterin der
Frauenberatungsstelle, Bereich Frauennotwohnung sowie Christian Scheidl
Männerberatung (Caritas/Rat&Hilfe) statt.
In Österreich beteiligten sich 2019 rund 130 Gebäude, darunter erstmals auch 60
Krankenhäuser an der Aktion „Orange The World“.33
31
https://waldviertel-schrems.soroptimist.at/
32
https://www.fbwv.at/
33
https://www.unwomen.at/unserearbeit/kampagnen/orange-the-world/orange-the-world-2019/, Stand
12.05.2020.
345. Herausforderungen
a. Das „dritte Gewaltschutzgesetz 201934“
Dem im vorliegenden Beitrag behandelten „dritten Gewaltschutzgesetz 2019“35
gehen zwei Gewaltschutzgesetze voraus. Das sogenannte „erste
Gewaltschutzgesetz aus dem Jahr 1996“ 36
in Kraft getreten 1997, ist kein
einheitliches Gesetzeswerk, vielmehr ist es eine Sammlung von einzelnen
Bestimmungen in den diversen Gesetzen. Die zentralen Bestimmungen sind
diejenigen im Sicherheitspolizeigesetz betreffend dem ursprünglich erlassenen
„Rückkehrverbot“ (jetzt bekannt als „Wegweisung“) und dem dazu geregelten
Antragsrecht auf die Erlassung einer einstweiligen Verfügung in der
Exekutionsordnung. Ein zentraler Bestandteil war die gesetzliche Etablierung zur
Schaffung von Interventionsstellen (so auch das jetzige Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich).
Dem ersten Gewaltschutzgesetz gehen die Reformbestrebungen der
Frauenhausbewegung voran. Das Tabuthema „häusliche Gewalt“ wurde durch die
37
vorangegangene autonome Frauenbewegung öffentlich diskutiert. Die
Auswirkungen der häuslichen Gewalt gegen Frauen wurden kritisiert und
Zufluchtsorte für betroffene Frauen wurden gefordert. In Österreich entstand das
erste Frauenhaus in Wien im Jahre 1978.38
Im April 2009 wurde das „zweite Gewaltschutzgesetz 2009“39 erlassen. Es brachte
insbesondere eine Ausweitung des polizeilichen Betretungsverbotes auf vier
Wochen, Ausweitung der einstweiligen Verfügung nach § 382b EO auf sechs
Monate, Ausweitung der einstweiligen Verfügung nach § 382e EO auf ein Jahr,
einen verbesserten Schutz bei Stalking nach § 382g EO mit sich. Eine gesetzliche
Grundlage findet die psychosoziale Prozessbegleitung und die abgesonderte
Vernehmung nach § 73b ZPO und zudem die Geheimhaltung nach § 75a ZPO.
Eingang in die österreichische Rechtsordnung bekommt der § 2 Z 10 und § 6a
VOG, womit ein Anspruch auf Schmerzensgeld – als Pauschalbetrag – für eine
schwere Körperverletzung gesetzlich verankert wird.40 Allen drei – bis dato von
1996 bis 2019 erlassenen – Gewaltschutzgesetzen liegt das gemeinsame Ziel:
Schutz vor Gewalt im sozialen Nahraum zu Grunde.
34
BGBl I 2019/105.
35
Verfasst wurde der vorliegende Beitrag zum „dritten Gewaltschutzgesetz“ von der stellvertretenden
Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrum Niederösterreich Mag.a Hanna Salicites. Vielen Dank
36
BGBl 1996/759 iZm BGBl 1996/759.
37
Siehe zur Frauenhausbewegung in Niederösterreich und deren umfassenden Beitrag zur Frauenhausbewegung
eingehend „Punkt 4. b. Zeitreise“ im gegenständlichen Tätigkeitsbericht.
38
Eingehend dazu siehe Schwarz-Schlöglmann, in Deixler-Hübner/Fucik/Mayrhofer (Hrsg), Gewaltschutz und
familiäre Krisen (2018), Einleitung, Rz2 ff;
39
BGBl I 2009/40.
40
Schwarz-Schlöglmann, in Deixler-Hübner/Fucik/Mayrhofer (Hrsg), Gewaltschutz und familiäre Krisen (2018),
Einleitung, Rz 6 ff; Dearing, Das (Erste) Gewaltschutzgesetz – Rückblick und Bewertung, in Mayrhofer/Schwarz-
Schlöglmann, Gewaltschutz (2017), 1 (1 ff).
35Der Nationalrat fasste im September 2019 den Beschluss über das dritte
Gewaltschutzgesetz. Eine Arbeitsgruppe, die sog. Task Force41 – bestehend ua.
auch aus Expert*innen des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren und
Interventionsstelle Österreichs – erörterte im Vorfeld die Gesetzesentwürfe zum
Gewaltschutzgesetz 2019.42
Das Betretungsverbot nach § 38a SPG43 fand eine Erweiterung durch das neu
eingeführte „Annäherungsverbot“. Damit verbunden sind Änderungen im
zivilrechtlichen Bereich bei Anträgen auf eine einstweilige Verfügungen nach den
§§ 382b - g EO und Anträgen nach den §§ 382b in Kombination mit § 382e EO.
Nunmehr steht es etwa der von der Gewalt betroffenen Person frei, zusätzlich ein
Annäherungsverbot nach §§ 382e Abs. 1 Z. 3 oder 382g Abs. 1 Z. 8 EO zu
beantragen, welches im jeweiligen Antrag seine inhaltliche Spezifizierung findet.
Allein im flächenmäßig größten Bundesland Österreichs – Niederösterreich – belief
sich die Gesamtzahl der durch das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
beratenen Personen im Jahr 2019 auf 2.983 Personen (1.506 ausgesprochene
Betretungsverbote und 116 erweitere Schutzbereiche für Kinderbetreuungs-
einrichtungen und Schulen).
Insgesamt wurden 60 Stellungnahmen zum „Dritten Gewaltschutzgesetz 2019“ iR
des parlamentarischen Verfahrens eingebracht.44 Beclin45 führte als Kritik an, dass
es keinen wissenschaftlich belegten Konnex zwischen der Erhöhung von
Strafdrohungen und der Entfaltung einer abschreckenden Wirkung gebe. Vielmehr
würden Opfer von Gewalt aufgrund einer höheren Strafdrohung von einer Anzeige
absehen. Dies hänge mit der emotionalen oder finanziellen Abhängigkeit zum Täter
zusammen.
In der Stellungnahme der Gewaltschutzzentren Österreichs und Interventionsstelle
für Betroffene des Frauenhandels46 wird die Schaffung eines Straftatbestandes des
„fortgesetzten psychischen Gewaltausübung“ gefordert, damit eine jahrelange
seelische Gewaltausübung – im familiären Kontext – bestraft werden könnte.
Begrüßt wird in der eben genannten Stellungnahme47 die wesentliche
Verbesserung des Opferschutzes mit der Novellierung des § 382b Abs. 2 Satz 2
EO. Das Gericht kann „zusätzlich die Dauer mit dem rechtskräftigen Abschluss des
anhängigen oder eines binnen der angeordneten Dauer einzuleitenden Verfahrens
in der Hauptsache festsetzen.“
41
Zum Bericht der Taskforce umfassend https://www.bmi.gv.at/Downloads/files/Task_Force_Strafrecht_-
_Bericht_Kommission_Opferschutz_und_Taeterarbeit.pdf (Stand 20.4.2020).
42
Mayrhofer, Das neue Annäherungsverbot: Änderungen im Sicherheitspolizeigesetz aus Sicht einer
Opferschutzeinrichtung, iFamZ 2019, 372ff mwN. Die genannte Autorin Mag.a Mariella Mayrhofer, MA war als
Juristin und psychosoziale Beraterin des Gewaltschutzzentrums Oberösterreichs eine Vertreterin der Task Force.
43
Aufgrund der Lesbarkeit wird auf die Anführung der jeweiligen Bundesgesetzblätter verzichtet und generell auf
die Homepage ris.bka.gv.at (Stand 20.4.2020) verwiesen.
44
Siehe hier ausführlich alle Stellungnahmen:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/ME/ME_00158/index.shtml#tab-Stellungnahmen (Stand
12.5.2020).
45
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_05059/imfname_758390.pdf (Stand 12.5.2020).
46
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_04980/imfname_758053.pdf (Stand 12.5.2020).
47
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_04980/imfname_758053.pdf (Stand 12.5.2020).
36Sie können auch lesen