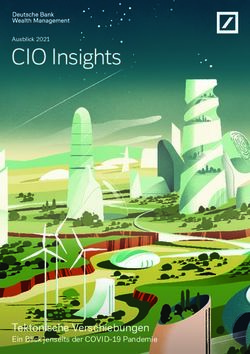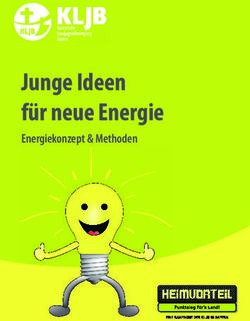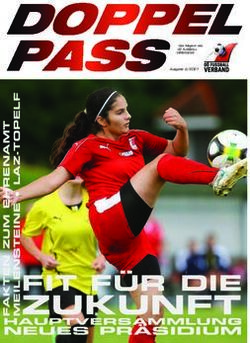Tätigkeits ericht 2017 G s- und Wär e-Institut Essen e.V - D s Energie-Institut in Essen - Gas- und Wärme-Institut Essen eV
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
D�s Energie-Institut in Essen
www.gwi-essen.de
Tätigkeits�ericht 2017
G�s- und Wär�e-Institut Essen e.V.INHALT
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
Allgemeiner Überblick ........................................................................................................................... 4
Bildungswerk ......................................................................................................................................... 6
Prüflaboratorium ................................................................................................................................... 8
Marktraumumstellung ........................................................................................................................... 9
Forschung und Entwicklung ................................................................................................................... 9
Industrie- und Feuerungstechnik ............................................................................................. 9
Brennstoff- und Gerätetechnik ............................................................................................... 15
Publikationen und Vorträge ................................................................................................................. 22
Impressum ........................................................................................................................................... 26TÄTIGKEITSBERICHT 2017
ALLGEMEINER ÜBERBLICK
ALLGEMEINER ÜBERBLICK
Das Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) kann Am 28. Juni 2017 fand zum 80-jährigen Bestehen
auf ein erfolgreiches und bewegtes Jahr 2017 zu- des GWI im Anschluss an die Mitgliederversamm-
rückblicken. Die wirtschaftlichen Rahmendaten des lung eine Jubiläumsveranstaltung statt, zu der neben
GWI haben sich weiterhin positiv verstetigt, für eine Vertretern der Mitgliedsunternehmen auch Kunden,
nachhaltige Gestaltung der Zukunftsfähigkeit konn- Partner und Freunde des Instituts eingeladen wur-
ten zudem wichtige Projektakquisitionen erfolgreich den. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vor-
abgeschlossen werden. Auch thematisch sieht sich stand Dr. Rolf Albus und Prof. Klaus Görner mit ei-
das GWI für die Zukunft gut aufgestellt, insbesonde- nem kleinen Streifzug durch die Geschichte des GWI
re konnten Projekte bei unterschiedlichen Projekt- entrichtete der 1. Bürgermeister Herr Rudolf Jelinek
trägern zum übergeordneten Thema „Sektorenkopp- die Grußworte der Stadt Essen. Der neu gewählte
lung“ initiiert werden. Verwaltungsratsvorsitzende Herr Dietmar Spohn be-
tonte in seinen Grußworten die Unabhängigkeit des
Am 28.06.2017 wurde Herr Dipl.-Ing. Dietmar Spohn, GWI als Branchenforschungsinstitut mit den Schwer-
Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bo- punkten F&E, Prüfung, Weiterbildung und Beratung.
chum GmbH, von der Mitgliederversammlung des Die starke Bindung zum Branchenverband DVGW er-
GWI zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden ge- möglicht es dem GWI, die Themen der DVGW-Inno-
wählt. Herr Spohn ist seit 2004 Mitglied des Verwal- vationsoffensive Gas (2009-2015) sowie der neu auf-
tungsrates und bestens mit der strategischen Aus- gesetzten Innovationsforschung Gas (seit 2016) kon-
richtung und den Aktivitäten des GWI vertraut. Die- sequent in die breite Anwendung weiterzuverfolgen.
ser Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates steht
auch für Kontinuität, die für die weitere strategische Das GWI ist mit seinen zentralen Bereichen For-
Entwicklung des GWI erforderlich ist. Herr Spohn folgt schung & Entwicklung, Prüflabor, Marktraumum-
im Verwaltungsratsvorsitz Herrn Dipl.-Ing. Dietmar stellung (seit 01.07.2017 eigener Bereich) sowie
Bückemeyer, ehemals Vorstandsmitglied der Stadt- Beratung und Weiterbildung (Abbildung 1) Motor
werke Essen AG. für Innovationen und arbeitet gemeinsam mit sei-
nen Mitgliedern und Kunden an der Zukunftsfähig-
1) Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik an der Universität Duisburg-Essen
2) Stabstelle Vorstand (Nachfolge ab 01.01.2019: Dr. Manfred Lange)
3) seit 01.07.2017
Abbildung 1: Organisation des GWI (Quelle: GWI, 2017)
Seite 4 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
keit der Energiebranche in einem sich rasant verän- austausch mit Akteuren der Branche basiert, sich
dernden Umfeld. Durch die enge Verzahnung der als Begleiter der Energiewende und Experte für die
interdisziplinär aufgestellten Bereiche versteht sich Politik klar für den Energieträger Gas positioniert.
das GWI als Motor für Innovationen und fokussiert
seine Forschungsschwerpunkte auf die Themen Das GWI titt als „technischer“ Komplettdienstleister
Gasbeschaffenheiten (LNG-Potenzialstudien, sowie sowie als Bindeglied zwischen „Grundlagenforschung
Projektmanagement und Qualitätssicherung bei L/H- und Praxis“ auf. Es versteht sich als Brancheninstitut
Gasanpassungsmaßnahmen), Versorgungssicherheit und hat sich immer mehr zu einem anwendungs-
und Gasanwendungstechnologien (Gas-Plus-Techno- technischen Energie-Institut weiterentwickelt (Gas,
logien und Kraft-Wärme-Kopplung), die vom privaten Wärme, Strom). Für die Zukunft will sich das GWI als
Haushalt bis hin zum industriellen Maßstab reichen. „Das Energie-Institut in Essen“ darstellen und posi-
Gestützt auf seine Kompetenz und Neutralität in der tionieren.
Branche bringt sich das GWI als technologisch fun-
dierte „Stimme pro Gas“ aktiv in die öffentliche Dis- Das Themenspektrum ist breit gefächert und reicht
kussion ein. von der Gebäudeenergieversorgung über Gewerbe
bis hin zu industriellen Anwendungen. Der Gesamt-
Rund um das branchenübergreifende hochaktuelle systemaspekt bestimmt nun das „Denken“, z.B. in der
Thema Energiewende werden Forschungsvorhaben Gebäudeenergieversorgung verliert die Gebäudehül-
zu „Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung“, „Speichertech- le ihre Bedeutung als Bilanzgrenze, die vorgelagerten
nologien in der Erdgasinfrastruktur und Gebäude- Netze dagegen gewinnen an Bedeutung. Neben in-
energieversorgung“, Verwertung von schwach- und novativen Technologien werden umfassende Infor-
niederkalorigen Gasen und „Konvergenz der Strom- mations- und Kommunikationselemente immer be-
und Gasnetze“ bearbeitet. Die Arbeitsschwerpunkte deutender. Das Tätigkeitsspektrum in der Abteilung
liegen u.a. auf Fragestellungen zu Auswirkungen von Industrie- und Feuerungstechnik reicht von der Bren-
Gasbeschaffenheitsschwankungen auf Industriepro- nereinstellung bis hin zur Optimierung der gesamten
zesse und Gasanwendungstechnologien, der Integra- Prozesskette. Im Fokus liegen immer eine „saubere“
tion der erneuerbaren Energien in bestehende En- Verbrennung und eine Verbesserung der Energieef-
ergieversorgungsstrukturen sowie der Kraft-Wärme- fizienz.
Kopplung in der häuslichen und gewerblichen Ener-
gieversorgung, wobei hier aufgrund der Komplexität Mit dem seit Jahren zunehmenden Themen- und
interdisziplinäre Lösungsansätze verfolgt werden. Tätigkeitsspektrum und dem damit verbundenen Zu-
Das im Zusammenhang mit der Energiewende immer wachs an Personal sind Engpässe aufgetreten. Das
bedeutender werdende Thema Sektorenkopplung Institutsgelände, das im Jahr 1970 erworben und
wird vom GWI im Rahmen verschiedener F&E-Ver- 1999 erweitert wurde, lässt mittlerweile keine Aus-
bundvorhaben intensiv bearbeitet, insbesondere die baumöglichkeiten mehr zu. Daher wird ein unmittel-
Verknüpfung der Strom-, Wärme- und Verkehrssek- bar zur Hafenstraße angrenzendes Grundstück mit
toren unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur- einer Fläche von ca. 1.113 m² von der Stadt Essen
systeme. Hierzu kann das GWI mit seinem fundierten erworben, um darauf ein Verwaltungs- und Weiter-
Know-how über verschiedene Sektorenkopplungs- bildungszentrum zu errichten. Erste grundlegende
technologien wie z.B. KWK(K), Power-to-X sowie LNG / Planungen wurden bereits abgeschlossen. Zurzeit
Mobilität einen wichtigen Beitrag liefern. laufen letzte Abstimmungen mit der Stadt Essen zum
Grundstückskauf. Nach jetziger Planung ist der Bau-
Das GWI konnte sein Netzwerk in der Forschungs- beginn für Herbst 2018 vorgesehen.
landschaft im Energieland NRW und darüber hin-
aus weiter ausbauen, insbesondere zu den The- Neben verschiedenen Veröffentlichungen und Vor-
men Gasbeschaffenheit, Wasserstoff und KWK/ trägen hat das GWI wiederum die E-world energy
Brennstoffzelle. Auch im DVGW konnte sich das & water in Essen genutzt, um die Leistungen und
GWI weiter einbringen und ist integraler Bestand- Dienstleistungsangebote einem breiten Fachpubli-
teil der DVGW-Forschungsaktivitäten. Der DVGW kum vorzustellen. Auf der gat in Essen präsentierte
selbst hat mit einem Grundlagenpapier „Der En- das GWI auf dem DVGW-Gemeinschaftsstand For-
ergie-Impuls | Ein Debattenbeitrag für die nächste schungsschwerpunkte sowie aktuelle Themen der
Phase der Energiewende“, das auf Ergebnissen der Branche.
DVGW-Forschung und einem intensiven Meinungs-
Seite 5 | 28TÄTIGKEITSBERICHT2017
TÄTIGKEITSBERICHT 2017
Das sehr erfolgreiche Jahr 2017 zeichnete sich für West der DVGW Berufsbildung wurden die bereits
das GWI-Bildungswerk dadurch aus, dass die Zusam- langjährig bewährten Bildungsprogramme der bei-
menarbeit im Bildungsverbund mit DVGW und rbv den Partner neu strukturiert und aus der Historie
erstmals konkret durchgeführt werden konnte. heraus entstandene Parallelentwicklungen inhaltlich
abgeglichen. Ziel ist und bleibt es, den Interessenten
Das Ziel des Strategieprojekts „DVGW 2025“ be- ein abgestimmtes und umfassendes Angebot präsen-
steht darin, durch ein neues Leitbild die Position des tieren zu können.
DVGW als anerkannter Regelsetzer sowie als innova-
tiver Gestalter und Dienstleister für seine Mitglieder DVGW und GWI brachten dazu ihre jeweiligen Stär-
weiter auszubauen. Ein wichtiger Baustein dazu sind ken ein. Der DVGW steht für die Umsetzung der Fach-
verstärkte Kooperationen mit Partnern, im Sinne der und Gremienarbeit in zielgruppengerechte Bildungs-
Entwicklung und Unterstützung innovativer Verfah- angebote und für die Analyse der relevanten Regel-
ren, Produkte und Dienstleistungen. werke mit Qualifikationsrelevanz (z.B. im Hinblick auf
die Arbeitssicherheit im Bereich der Gasversorgungs-
In diesem Prozess wurden strategische Ziele und kon- systeme). Das GWI arbeitet einerseits aus seiner
krete Maßnahmen konzipiert und anschließend um- Rolle als Forschungsinstitut in den Fachgremien des
gesetzt. Dazu gehört auch, die Umsetzung des Quali- DVGW an der Weiterentwicklung der Regelwerke mit
täts- und Schutzniveaus durch Bildung zu gewährlei- und hält andererseits über konkrete Projekt- und Be-
sten sowie die Branchenbedürfnisse im Hinblick auf ratungsdienstleistungen den Kontakt zu den Alltags-
Aus-, Fort- und Weiterbildung angemessen abzubil- problemen der Unternehmen der Branche.
den. Mit dem Bildungsverbund aus DVGW, GWI und
rbv steigt der Branchennutzen durch bedarfsgerech- Der Standort des GWI wird mittlerweile auch für
te, vielfältige und spezifische Bildungsangebote. DVGW Veranstaltungen genutzt, indem die bewähr-
ten Schulungsanlagen des GWI, an denen praktisch
Dazu wurde ein gemeinsames Bildungsprogramm zu- demonstriert und geübt werden kann, auch bei
nächst von GWI und DVGW für das Jahr 2017 vorge- DVGW Veranstaltungen zum Einsatz kommen. Der
stellt. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Center Praxisbezug von Bildungsinhalten, insbesondere
Seite 6 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
durch Erhöhung des Praxisanteils in Schulungen, ist Die Akzeptanz des DVGW Regelwerks als „anerkann-
eines der ausdrücklichen Ziele des Bildungsverbun- te Regeln der Technik“ bzw. als „Stand der Technik“
des. ist nicht selbstverständlich. Die Regeln müssen in
den Unternehmen entsprechend umgesetzt, ange-
GWI und DVGW haben im Berichtsjahr eine gemein- wendet und „verinnerlicht“ werden. Dies zu vermit-
same Schulungsanlage für Praxistrainings im Be- teln, ist eine der Hauptaufgaben der Veranstaltungen
reich der Gas-Hausinstallation aufgebaut. Aus der des GWI, eingebettet in den größeren Rahmen des
Erfahrung verschiedener Vorläuferprojekte wurde Bildungsverbundes.
damit in den Versuchshallen des GWI eine von bei-
den Partnern nutzbare Einrichtung geschaffen, die Das GWI kann, aus seiner Praxisnähe heraus, für sich
unterschiedliche Installationskonzepte von der Tra- in Anspruch nehmen, bei den brancheninternen Dis-
dition bis hin zu modernen Systemen realisiert und kussionen zu den Regelwerken pragmatische Inter-
anschaulich macht. Parallel dazu konnten für die pretationshilfen geliefert zu haben. Dies resultiert
Ausbildung der Anpassungsmonteure für die L-H- dann in praxisnahen Schulungskonzepten, die die
Marktraumumstellung eine Anzahl unterschiedlich- branchentypischen Besonderheiten bei Gasanlagen
ster Gasgeräte beschafft und für Schulungszwecke erfasst und die mit erfreulicher Resonanz durch die
installiert werden. Die zukünftigen Anpassungsmon- Unternehmen wahrgenommen werden. Daher ist
teure üben hier konkret und unter Aufsicht und An- die Arbeit in den Gremien des DVGW zur Erstellung
leitung das korrekte und regelwerkskonforme Vor- des Regelwerks für die Veranstaltungen des GWI von
gehen bei der Erhebung und Anpassung von Gasver- großer Bedeutung. Die konkrete und ehrenamtliche
brauchseinrichtungen. Mitarbeit bei der Regelwerkserstellung bietet die
Möglichkeit, bei der Konzeption von Schulungsver-
anstaltungen nicht nur den offiziellen Text der Ar-
beitsblätter zu berücksichtigen, sondern vor allem
auch die Diskussionen und Hintergründe vor der Re-
gelwerksverabschiedung und -veröffentlichung mit
einfließen zu lassen.
Aber auch aus der umgekehrten Perspektive des
DVGW sind die Veranstaltungskonzepte des GWI sehr
interessant, weil durch die Arbeit des Instituts das
reine Regelwerk handhabbar gemacht wird auf Basis
konkreter Projekterfahrungen und der Spiegelung an
den Alltagserfahrungen in den Unternehmen.
Die Übertragung der technischen Regeln in die Praxis
ist auch deswegen von Bedeutung, weil das DVGW-
Regelwerk und seine Anwendung in vielen Unter-
Wirtschaftlich gesehen konnte der Ertrag des GWI- nehmen, vor allem außerhalb des eigentlichen Gas-
Bildungswerks 2017 zum wiederholten Male gestei- fachs, nicht von vornherein als gegeben akzeptiert
gert und damit die Erfolge der Vorjahre fortgesetzt ist. Hier existieren mit der aktuellen Betriebssicher-
werden. Die Weiterbildungsveranstaltungen ge- heits- und Gefahrstoffverordnung, den zugehörigen
hören zu den gemeinnützigen Aktivitäten des GWI technischen Regeln sowie mit der zunehmenden
und generell dienen die hier erwirtschafteten Erlöse europäischen Normung weitere gewichtige Regel-
dazu, die satzungsgemäßen Forschungsaktivitäten werke, die deutlich im Wettbewerb zur Relevanz der
des eigenen Hauses zu unterstützen. Im Gegensatz DVGW-Arbeitsblätter stehen. Um hier Akzeptanz-
zu anderen, kommerziell orientierten Veranstaltern, problemen und einer Abschwächung des anerkannt
werden diese Gelder damit zur Lösung der Zukunfts- hohen sicherheitstechnischen Niveaus des DVGW
aufgaben der Branche verwendet. Diese Situation Regelwerks entgegenzuwirken, ist das GWI als Part-
trägt sicherlich auch zur hohen Nachfrage nach un- ner im Bildungsverbund sehr wichtig. Einerseits auf-
seren Veranstaltungen durch unsere Mitgliedsunter- grund seines direkten Zugangs zu den Unternehmen
nehmen und Kunden bei. als praxisorientiertes Forschungsinstitut und ande-
rerseits aufgrund der Tatsache, als neutrales Institut
kein eigenes Regelwerk vermarkten zu müssen.
Seite 7 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
Ziel ist auch eine höhere Akzeptanz bei kleinen und dule für die Heranführung an öffentlich-rechtliche
mittleren Unternehmen (KMU) durch zielgruppenori- Abschlüsse oder Verbandsabschlüsse. Daneben wer-
entierte Angebote in Form eines „Bildungsfahrplans“ den branchen- oder spartenübergreifende Angebote
für die Entwicklung und Sicherung von Handlungs- erarbeitet und durch verstärkte Kooperationen mit
kompetenzen. Dies führt zu modular aufgebauten weiteren Institutionen, z.B. der EnergieAgentur.NRW
Qualifikationen, z.B. spezifische Qualifizierungsmo- in die Öffentlichkeit gebracht.
PRÜFLABORATORIUM
PRÜFLABORATORIUM
Das GWI-Prüflaboratorium konnte im Jahr 2017 sei- Weiterhin umfasst das Prüfangebot des GWI-Prüfla-
ne gesteckten Ziele errichen, insbesondere konnte boratoriums Produkte der Gas- und Wasserinstalla-
das Auftragsvolumen im klassischen Prüfgeschäft tion, der Feuerungstechnik mit den Energieträgern
auf Vorjahresniveau gehalten werden. Im Bereich Gas, Öl und Strom einschließlich der heute üblichen
der konventionellen Heiztechnik herrscht weiterhin Sicherheitselektronik in den Wärmeerzeugern sowie
eine deutliche Zurückhaltung bei der Entwicklung diverse Bauprodukte im Bereich der Abgastechnik.
bzw. Weiterentwicklung. Ebenfalls ist im Bereich der Das Angebot zur Prüfung von KWK-Anlagen besteht
Kraft-/Wärmekopplungstechnik (KWK) eine zögerli- weiterhin.
che Haltung seitens der Hersteller erkennbar.
Ein weiteres Angebot – wie auch schon in der Ver-
Die Umstellung von der Gasgeräterichtlinie auf die gangenheit – ist die Kapazitätsunterstützung von
neue, ab dem 21. April 2018 geltende Gasgerätever- Hersteller, in Form von entwicklungsbegleitenden
ordnung, lief im dritten Quartal sehr zögerlich an. Prüfungen.
Das Prüfgeschäft bei Armaturen und sonstigen Aus-
rüstungen verlief zufriedenstellend.
Weiterhin wird die DVGW-Anpassungsdatenbank
vom Prüflabor gepflegt. Hier wird GWI-Wissen per-
manent und gezielt eingesetzt, um die Anpassdaten-
bank auf einem qualitativ hochwertigen Stand zu hal-
ten. Durch diese „Pflegearbeiten“ wird gewährleistet,
dass der Datenbestand qualitativ immer besser und
genauer wird – Grundvoraussetzung für eine hohe
Akzeptanz dieser Problemlösung. Seit dem Frühjahr
2017 wurde in diesem Bereich ein neuer Mitarbei-
ter eingearbeitet, um die Bearbeitung effizienter und
reibungsloser zu gestalten.
In der Marktraumumstellung ist das Prüflaboratori-
um weiterhin zu allen Fragestellungen rund um die
Gerätetechnik für Netzbetreiber und auch das GWI-
Projektmanagement beratend tätig.
Auf dem Gebiet der Akustikprüfungen wurden wei-
tere Geräteprüfungen durchgeführt.
Die durch die DAkkS-Akkreditierung des GWI-Prüfla-
boratoriums vorgegebenen Qualitätsstandards wer-
den angewendet und gelebt.
Abbildung 2: Fallversuch an Straßenkappen (Quelle: GWI, 2017)
Seite 8 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
MARKTRAUMUMSTELLUNG
MARKTRAUMUMSTELLUNG
Die Förderung von niederkalorischem Erdgas L aus 676-B1 für die Gruppen B (Qualitätssicherung und
deutschen und niederländischen Quellen ist stark Kontrolle) und Gruppe C (Projektmanagement). Das
rückläufig. Bis zum Jahr 2030 muss daher die Gasver- GWI hat die für die Branche richtungsweisenden Pi-
sorgung in den entsprechenden Gebieten im Norden lotprojekte in Schneverdingen und Böhmetal mittler-
und Westen Deutschlands auf hochkalorisches Erd- weile abgeschlossen, die Erfahrungen fließen in die
gas H umgestellt werden. Der Netzentwicklungsplan Weiterentwicklung des DVGW-Regelwerkes mit ein,
Gas in der aktuellen Fassung 2016 sowie der Umset- z.B. G 680, G 695. Das GWI konnte sich weiter in der
zungsbericht 2017 geben einen genauen Überblick Marktraumumstellung etablieren und betreut in di-
über den exakten zeitlichen Ablauf der Anpassung versen Projekten bis zum Jahr 2023 mittlerweile über
in den Netzgebieten. Insgesamt müssen 5,0 Mio. 400.000 Gasgeräte.
häusliche und zusätzlich gewerbliche und industriel-
le Gasverbrauchsgeräte unter der Federführung des Folgende Tätigkeiten führt das GWI durch:
jeweiligen ansässigen Netzbetreibers angepasst wer-
den. Um diese große Anzahl an anzupassenden Gas- ■■ Technische Beratung und organisatorische Un-
verbrauchsgeräten bis zum Jahr 2030 bewältigen zu terstützung von Netzbetreibern zur Vorberei-
können, müssen – nach einem kontinuierlichen An- tung, Begleitung und Abschluss der Marktrau-
stieg bis zum Jahr 2020 – jährlich ca. 500.000 Gasver- mumstellung.
brauchsgeräte angepasst werden. ■■ Technische Beratung von Industrie- und Gewer-
bekunden bei der Organisation und Durchfüh-
Das GWI befasst sich schon seit vielen Jahrzehnten rung.
mit der Marktraumumstellung, in den 60er Jahren ■■ Unterstützung bei der Auswahl und Weiterent-
war das GWI in die Umstellung von Stadtgas auf wicklung der eingesetzten Software.
Erdgas im Projektmanagement und in der Qualitäts- ■■ Pflege der DVGW-Anpassungsdatenbank.
kontrolle eingebunden – Tätigkeiten, die das GWI ■■ Einbindung des GWI-Prüflabors bei Fragestellun-
auch heute mit einer langjährigen Erfahrung und gen rund um die Gerätezulassung.
umfassenden Know-how erledigt. Der Firmensitz ■■ Schulung von Monteuren gemäß Merkblatt
des GWI in Essen befindet sich mitten im Geschehen DVGW G 106 (M).
in Westdeutschland, hier wird der Löwenanteil der
Marktraumumstellung ablaufen. Seit dem 01.07.2017 werden die Aktivitäten des GWI
in der Marktraumumstellung in einem eigenen Be-
Das GWI ist seit 2014 in der Marktraumumstellung reich gebündelt. Als Leiterin wurde Frau Sabine Gil-
aktiv und ist zertifiziert nach Arbeitsblatt DVGW G Roemer bestellt.
FORSCHUNG UND
FORSCHUNG ENTWICKLUNG
UND ENTWICKLUNG
Industrie- und Feuerungstechnik
Die Energiewende ist das aktuelle Thema unserer to-X, Digitalisierung. Jedoch kann eine erfolgreiche,
Zeit und stellt Deutschland in den nächsten Jahren nachhaltige und auch wirtschaftliche Energiewende
vor große Herausforderungen. Dass der Erhalt unse- nicht nur allein über den „Strompfad“ funktionieren.
rer Umwelt, eine nachhaltige Nutzung der Ressour- Erdgas ist von den fossilen Brennstoffen der klima-
cen und der Klimaschutz uns alle angeht, steht außer freundlichste und ein „greening of gas“ sowie ein
Frage. Demgegenüber steht aber auch der Erhalt der sinnvoller und effizienter Einsatz hebt diesen Ener-
Arbeitsplätze und des Industriestandortes Deutsch- gieträger in einem ganz besonden Maß hervor.
land. Die Energiewende ist geprägt von den Schlag-
worten Sektorenkopplung, Flexibilisierung, Power- Verschiedene Energieprognosen gehen von einem
Seite 9 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
Abbildung 3: Prognose des Primärenergieverbrauchs in Deutschland bis 2040 (Quelle: ExonMobil, 2015)
generellen Rückgang des Primärenergieeinsatzes in rung und andererseits den „klassischen“ Themen:
der Industrie in Deutschland aus, siehe Abbildung 3. Steigerung der Energieeffizienz, Minderung der
Dies wird durch den effizienten Einsatz der Energie- Schadstoffemissionen mit der gleichen Intensität
träger trotz steigender Wirtschaftsleistung erreicht. widmen muss. Diesen Mix aus verschiedenen Aufga-
Neben einer Zunahme der Nutzung erneuerbarer benstellungen, einer sinnvollen Verschmelzung der
Energien wird der Erdgasverbrauch bis 2040 entge- manchmal gegenläufig erscheinenden Ziele zeigt die
gen dem generellen Trend jedoch gegenüber 2014 nachfolgende Auswahl der Forschungsthemen der
um mehr als 25 % steigen. In der Industrie wird von Abteilung IFT.
einer Steigerung des Erdgaseinsatzes von mehr 11 %
bis 2040 ausgegangen. Erneuerbare Energien
Diese Zahlen zeigen, dass sich die Abteilung Indu- 2017 wurden mehrere AiF-Forschungsprojekte ab-
strie- und Feuerungstechnik (IFT) des GWI einerseits geschlossen, die sich mit dem Thema Einbindung
den aktuellen Herausforderungen: Sektorenkopp- erneuerbarer Gase in den Feuerungsprozess von
lung, Power-to-X, erneuerbare Energien, Flexibilisie- Thermoprozessanlagen beschäftigten. Dabei wurde
z.B. die Umsetzung einer
Rohbiogaszufeuerung in
einer Glasschmelzwanne
realisiert und untersucht,
siehe Abbildung 4.
Die wichtigste Erkennt-
nis aus dem Versuchs-
betrieb an einer realen
Glasschmelzwanne mit
bis zu 30 % Rohbiogaszu-
mischung war, dass kein
Einfluss auf die Glas- bzw.
Produktqualität und den
Energieeinsatz erkenn-
bar war. Dies war jedoch
Abbildung 4: Gegenüberstellung der konventionellen und der untersuchten (Roh)Biogasnutzung nur durch die Schaffung
(Quelle: GWI, 2017)
Seite 10 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
geeigneter Rahmenbedingungen, den Einsatz von die „reine Erdgasverbrennung) bestimmt. In Abbil-
MSR-Technik und den manuellen Eingriff in diesen dung 5 sind die Ergebnisse einer 10- und 50-prozenti-
Betrieb möglich. Für die ständige Nutzung von Roh- gen Wasserstoffzumischung zum Erdgas auf den HTIF
biogas sind jedoch einerseits die Gewährleistung der (Abbildung 5a) und die NOx-Emissionen (Abbildung
Versorgungssicherheit und andererseits eine ent- 5b) für 2 verschiedene Regelszenarien dargestellt.
sprechende Ausstattung der Mess- und Regeltechnik Szenario 1 bedeutet: Keine Regelung von Luftzahl
bzw. ein entsprechendes Mischsystem notwendig. und Leistung, d.h. Volumenströme von Gas und Luft
Hierzu sind jedoch weiterführende Untersuchungen bleiben konstant („worst case“). Szenario 3 bedeutet:
nötig. Außerdem müssen noch einige verwaltungs- Luftzahl und Leistung konstant, d. h. Volumenstrom
technische (Rohbiogas wird zurzeit als Abfallstoff und Gas und Luft werden angepasst („best case“).
nicht als Brennstoff behandelt) und ökonomische
(aktuell ist Rohbiogas um den Faktor 4 teurer als Erd- Abbildung 5 zeigt anschaulich, dass mit einer an-
gas) Hemmnisse überwunden werden. gepassten Mess- und Regelungstechnik sowie der
Mit diesem Projekt werden ein sinnvoller Ansatz ei- Möglichkeit der separaten und nicht gekoppelten
ner Sektorenkopplung und der Einsatz von erneuer- Regelung der Luft- und Gasvolumenströme die Zumi-
baren Gasen in der Industrie, die Steigerung der Fle- schung von Wasserstoff ins Erdgasnetz auf den Ver-
xibilisierung von Biogasanlagen bei einem Überange- brennungsprozess von industriellen Thermoprozess-
bot an Strom sowie alternative Nutzungsmöglichkeit anlagen beherrschbar ist.
nach Wegfall der EEG-Vergütung für Biogasanlagen-
betreiber aufgezeigt. Mit diesen Untersuchungen sind die Fragen der In-
dustrie jedoch noch nicht vollkommen beantwortet.
Die Themen der Rohbiogasnutzung, die Potentiale Eine große Befürchtung seitens der Industrie ist, dass
der Flexibilisierung und die Anwendung in anderen der Wasserstoff Auswirkungen auf die Produktquali-
Industriebranchen werden in weiteren Forschungs- tät z.B. von metallischen Erzeugnissen haben könnte.
projekten fortgeführt. Diese Fragestellung wird in einem Nachfolgeprojekt
zusammen mit Werkstoffwissenschaftlern intensiv
Ein weiterer Themenschwerpunkt der Energiewende untersucht.
und der Themen des GWI ist die Nutzung von Was-
serstoff aus Power-to-Gas-Anlagen, dem zurzeit viel- Steigerung der Energieeffizienz
versprechendsten Weg zur Speicherung von regene-
rativ erzeugtem Strom aus Solar- und Windkraftanla- Die Untersuchung, Analyse und Optimierung von
gen. Im Rahmen eines AiF-Forschungsprojekts wur- Prozessen der Thermoprozessindustrie aus den un-
den die Auswirkungen der Wasserstoffzumischung terschiedlichen Industriebranchen, z.B. Aluminium,
ins Erdgasnetz auf die Verbrennungsprozesse (Wär- Stahl, Keramik, Glas gehört zu den Kernkompetenzen
meübertragung, Flammengeometrie, Schadstoffe- der Abteilung IFT.
missionen) in industriellen Thermoprozessanlagen,
auf Messgeräte zur Messung der Gasqualität und Ein im Jahr 2017 gestartetes BMWi-Forschungspro-
Flammenüberwachungseinrichtungen untersucht. jekt, welches zusammen mit dem Institut für Ziegel-
Die Übertragung der experimentellen Erkenntnisse forschung und weiteren Industriepartnern durchge-
der Untersuchungen an den semiindustriellen Te- führt wird, beschäftigt sich mit der Energieeffizienz-
stanlagen der Industrie- und Feuerungstechnik auf steigerung in der Ziegelindustrie durch Entwicklung
großindustrielle Anlagen wurde mit Hilfe von CFD- und Einsatz eines neuen Verbrennungskonzeptes.
Simulationen durchgeführt. Damit können die Aus-
wirkungen von höheren Wasserstoffkonzentrationen Bei modernen Tunnelöfen der Ziegelindustrie han-
auf die Wärmeübertragung und die Gesamteffizienz delt es sich verfahrenstechnisch um die Kopplung
des Prozesses anhand der simulierten Fälle detailliert zweier nacheinander ablaufender Teilprozesse, sie-
analysiert werden. Der „normale“ thermische Wir- he Abbildung 6a. Der erste Teil besteht aus dem
kungsgrad allein reicht hier nicht aus, da der Wärme- Aufheizprozess bis zur Garbrandtemperatur, bei der
strom in das Produkt, der für die Produktqualität not- ein Temperaturausgleich innerhalb der Besatzpake-
wendig ist, nicht berücksichtigt wird. Daher wird eine te (Ziegel) stattfindet. Im Anschluss daran werden
zusätzliche Größe, der „Heat Transfer Impact Factor“ die Ziegel im zweiten Teilprozess in einem ein- oder
(HTIF), verwendet. HTIF wird als Verhältnis des über- mehrstufigen Gegenstromkühler auf Ausfahrtem-
tragenen Wärmestroms des betrachteten Falls zum peratur gebracht. Die hierbei erhitzte Kühlluft wird
übertragenen Wärmestrom eines Referenzfalls (hier aus dem Ofenprozess ausgekoppelt und an anderer
Seite 11 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
99,51 101,10
100 Referenzfall = 100 %
95 97,74
93,89
HTIF [%]
90
HTIF [%]= 100
85
80
Szenario 1 Szenario 3
10 % H 2 in NG 50 % H 2 in NG
a) Heat Transfer Impact Factor (HTIF)
800
716,30
700
600
100
500
400
300
204,92
200
98,52 110,61
Referenzfall = 100 % 100
0
Szenario 1 Szenario 3
b) NOx-Emissionen
10 % H 2 in NG 50 % H 2 in NG
Abbildung 5: Auswirkung der Wasserstoffzumischung zum Erdgas auf den Heat Transfer Impact Factor und die NOx-Emissionen einer
simulierten Glasschmelzwanne (Quelle: GWI, 2018)
Stelle zur Trocknung der Ziegelrohlinge verwendet. Gasbeschaffenheit
Durch diese Verfahrensweise besteht der Zwang zur
größtmöglichen Synchronisation von Ofen und Trock- Seit Jahren wird das Thema Gasbeschaffenheits-
nerbetrieb, sodass die energetische Optimierung der schwankungen vor allem im Kontext der Auswirkun-
Einzelprozesse nahezu unmöglich wird. gen auf industrielle Endanwender bearbeitet. Dies
geschieht auf vielen Ebenen: Im Rahmen von For-
Ziel des Projektes ist, im Ofen befindliche heiße Luft schungsprojekten einerseits zur Erarbeitung von Lö-
aus der Kühlzone als vorgewärmte Verbrennungs- sungsmöglichkeiten für einzelne Industriebranchen
luft zu nutzen und somit den energetischen Zwang z.B. für die Glasindustrie, und andererseits in einem
zur größtmöglichen Synchronisation von Ofen und branchenübergreifenden DVGW-Projekt „Hauptstu-
Trocknerbetrieb abzubauen, ohne die Vorteile mo- die Gasbeschaffenheit Phase I und II“. Hier soll ein
derner Tunnelöfen aufzugeben, siehe Abbildung 6b. verträgliches Wobbe-Index-Band für die einzelnen
Entwickelt wird ein Brennerkonzept, welches nur Sektoren Haushalt, Gewerbe, Industrie bestimmt wer-
Brennstoff zuführt und die im Ofen befindliche hei- den, sowie eine volkswirtschaftliche Analyse vorge-
ße Luft nutzt. Die Energieeinsparungen liegen schon nommen werden. Abschließend wird eine Roadmap
bei geringen Vorwärmtemperaturen im zweistelligen „Gasbeschaffenheit“ mit Handlungsempfehlungen
Prozentbereich. Bei diesen Einsparungen und den erarbeitet. Diese Ergebnisse werden dann durch die
geringen Investitionskosten (keine isolierten Leitun- Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien
gen oder geänderte Ventile und Armaturen etc.) ist in die Überarbeitung z.B. der H-Gas Norm EN 16276
mit sehr kurzen Amortisationszeiten von unter 2 Jah- übernommen. Das GWI dient aber auch als neutrale
ren zu rechnen. Plattform zum Austausch zwischen den verschiedenen
Stakeholdern im Rahmen eines Runden Tisches Gas-
beschaffenheit, der bereits zum 5. Mal stattfand.
Seite 12 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
Rauchgas
Heißluft zum
Trockner
Verbrennungsluft
Brennstoff
Kühlluft
Ziegel
Brennstoff beheizte Erwärmung Gegenstromkühler
(Aufheiz- und Brennzone) (Kühlzone)
a) Konventionelles Tunnelofenkonzept der Ziegelindustrie (Quelle: IZF)
Rauchgas
Teilstrom zum
Brennstoff Trockner
Kühlluft
heiße
Verbrennungsluft Ziegel
Wärmeaustausch Energieeinkopplung Wärmeaustausch
(Aufheizzone) (Brennzone) (Kühlzone)
b) Geplantes Tunnelofenkonzept (Quelle: IZF)
Abbildung 6: Konventionelles und geplantes Tunnelofenkonzept im Forschungsprojekt Zie-Ver
In einer Befragung der Industrie im Rahmen der Weitere Highlights
Hauptstudie Gasbeschaffenheit Phase I gaben nur
ca. ¼ der befragten Industriefirmen an, dass ihnen Die Ergebnisse der vielfältigen Forschungsarbeiten
Gasbeschaffenheitsdaten in Echtzeit vorliegen, siehe werden von den GWI-Mitarbeitern auf zahlreichen
Abbildung 7. Dem überwiegenden Anteil liegen nur nationalen und internationalen Kongressen und Ta-
Monatsmittelwerte vor bzw. haben gar keine Kennt- gungen sowie Fachzeitschriften veröffentlicht. Auch
nis von der anliegenden Gasbeschaffenheit. Dass in den relevanten Fachausschüssen der verschiede-
solche Monatsmittewerte für die Kompensation von nen Branchen der Thermoprozesstechnik und Gas-
Gasbeschaffenheitsschwankungen an industriellen wirtschaft werden regelmäßig Forschungsergebnisse
Anlagen nicht geeignet sind, verdeutlicht Abbildung vorgestellt.
8. Der Monatsmittelwert des am GWI verteilten Erd-
gases (schwarze Linie) ist den mit einem Gaschro- Das GWI ist aber auch Ausrichter bzw. Gastgeber für
matografen gemessenen Heizwertdaten (stündlich zahlreiche Tagungen und Veranstaltungen. Hervorzu-
gemittelt) für das Jahr 2016 gegenübergestellt. heben sei hier die traditionsreiche Praxistagung „Effi-
ziente Brennertechnik für Industrieöfen“.
Frage: In welcher Form haben Sie Zugriff auf Gasbe-
schaffenheitsdaten? Weiterhin war das GWI im März 2017 Gastgeber des
TOTeM 44 mit dem Titel „Gaseous Fuels for Industry
and Power Generation – Challenges and Opportuni-
ties“, bei dem Experten aus allen Teilen Europas über
die Zukunft gasförmiger Brennstoffe in großtechni-
schen Anwendungen der Thermoprozess- und Kraft-
werkstechnik diskutierten. Die Veranstaltung wur-
de vom GWI und der International Flame Research
Foundation (IFRF) gemeinsam organisiert, einem in-
ternationalen Verbund von Organisationen, die sich
mit der anwendungsorientierten Verbrennungsfor-
schung, insbesondere für die großtechnische Feue-
Abbildung 7: Ergebnis der Industriebefragung in der rungstechnik in Industrieöfen und Kraftwerkern, be-
Hauptstudie Gasbeschaffenheit Phase I (Quelle: GWI, 2017)
Seite 13 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017 fassen (www.ifrf.net). TOTeM steht für „Topic-Oriented Technical Mee- ting“ und ist ein IFRF-eigenes Kon- zept, das durch genau abgegrenzte Themenkomplexe, anwendungsna- he und praxisorientierte Vorträge aus Forschung und Industrie sowie ausführliche Diskussionen zwischen Referenten und Publikum charak- terisiert wird. Schwerpunktthemen der Veranstaltung in Essen waren Fragen der Erdgasbeschaffenheit, gerade auch im Kontext großtechni- scher Verbrennungsprozesse, sowie der Nutzung regenerativer Gase wie Abbildung 8: Heizwertverlauf im Jahr 2016 am GWI (Quelle: GWI, 2016) Biogas und Wasserstoff in der Ther- moprozess- und Kraftwerkstechnik. Neben Forschung und Entwicklung zählt die Aus- Vol.-%) auf Flammenform, Wärmeübertragung und und Weiterbildung des studentischen Nachwuchses Prozesseffizienz in einem Industrieofen auswirken, ebenfalls zu den Kernaufgaben des GWI. Zahlreiche und in welchem Maße fortschrittliche Mess- und Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten werden im Regelungstechnologien (MSR) helfen können, diese Rahmen der laufenden Forschungsprojekte regel- Veränderungen zu kompensieren. mäßig angefertigt. Die hohe Qualität dieser Arbeiten wurde 2017 auf der gat 2017 durch die Verleihung Neben der aktiven Forschung und Entwicklung ar- des DVGW-Studienpreises an Herrn Oliver Stope beitet die Abteilung IFT in mehreren nationalen und honoriert, Abbildung 9. Herr Stope untersuchte in internationalen Gremien der Gaswirtschaft mit und seiner Masterarbeit mit dem Titel „Numerische Un- bringt dort ihr Kow-how zur industriellen Erdgasnut- tersuchungen zu den Auswirkungen erhöhter Was- zung ein. Zu nennen wären hier die Arbeitsgruppe serstoffgehalte im Erdgas auf industrielle Verbren- „Gas Quality / Biogas“ von MARCOGAZ und die Ko- nungsprozesse“ die Auswirkungen der Einspeisung mitees für „Research, Development and Innovation“ von Wasserstoff in das Erdgasnetz auf industrielle und „Utilization“ der International Gas Union (IGU). Feuerungsprozesse mit Hilfe moderner CFD-Simula- Auch an Arbeitsgruppen der aktuellen prä-normati- tionsverfahren, ein im Kontext der aktuellen Diskus- ven „Pilot Study 2.0“ zur Harmonisierung der euro- sionen über „power-to-gas“ hochspannendes und päischen Gasbeschaffenheitsregelwerke (EN 16726) relevantes Thema. Im Rahmen seiner Arbeit zeigte ist die Abteilung beteiligt. er auf, wie sich erhöhte Wasserstoffgehalte (bis 50 % Abbildung 9: Preisträger des DVGW-Studienpreis Gas und Wasser auf der gat 2017 in Köln (unten in der Mitte Oliver Stope (Quelle: GWI, 2017)) Seite 14 | 28
TÄTIGKEITSBERICHT 2017
Brennstoff- und Gerätetechnik
Der Umbau des bestehenden, von fossilen Energie- wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung. In Form von
trägern dominierten Energieversorgungssystems, zu Power-to-Gas kann die Gasinfrastruktur als Speicher
einem klimaneutraleren System durch die Integra- für überschüssige regenerative Energien dienen.
tion eines größeren Anteils erneuerbarer Energien Wasserstoff, CNG, LNG und LBG können mittelfristig
(EE) schreitet stetig voran. Für das Jahr 2017 wird ein Feinstaub- und NOx-Emissionen im Mobilitätssektor
Anteil von ca. 35 % an der Bruttostromerzeugung ge- reduzieren. Die optimierte Abstimmung auf die je-
nannt, 5 Prozentpunkte mehr als in 2016 [Fraunhofer weiligen Anwendungen und die konsequente Nut-
ISE]. Der Anteil der erneuerbaren Energien am En- zung der Synergien führt auf hocheffiziente Gas-Plus-
denergieverbrauch für Wärme und Kälte betrug im Technologien und in größeren vernetzten Strukturen
Jahr 2016 bereits 13,1 Prozent und rund 5,2 Prozent auf ein zukünftig zunehmend digitalisiertes, flexibili-
des Kraftstoffverbrauchs in Deutschland [BMWi]. siertes Energieversorgungssystem mit Optionen wie
PtG, Power-to-Fuel (PtF), Power-to-Chemicals (PtC),
Durch eine zunehmende Elektrifizierung in den Sek- und Power-to-Heat (PtH) in einer energetischen und
toren Wärme (Power-to-Heat/Wärmepumpen) und strukturellen Sektorenkopplung, bei der die Ver-
Mobilität wächst der Bedarf an Windkraft und Pho- knüpfung der Strom-, Wärme-, Gasnetze einschließ-
tovoltaik weiter an. Die Bruttostromerzeugung von lich des Mobilitätssektors mit den Verbrauchssek-
heute ca. 654 TWh müsste vervielfacht werden, wo- toren Haushalt, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen
bei der Speicherbedarf durch die volatilen EE gleich- und Industrie erfolgt.
sam ansteigt. Die einfachen Lösungen liegen in der
Einsparung und der Effizienzsteigerung auf der Ver- Die Abteilung BGT arbeitete im Jahr 2017 an einer
wendungs- und Erzeugungerseite (z.B. Sanierungs- Vielzahl von Projekten zu folgenden Themen:
maßnahmen im Gebäude). Da sich Wirkunsgrade
einzelner Prozesskettenglieder nur noch schwer stei- ■■ Adaptive Energiesysteme, Sektorenkopplung,
gern lassen, liegt hier das Hauptaugenmerk auf Nut- Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung, thermische und
zungsgraden von Ketten und Optimierungen dieser elektrische Speicher, Systemanalyse, GIS (Geoin-
sowie Verknüpfungen von Sektoren, um Primären- formationssysteme), Quartierslösungen.
ergie maximal zu nutzen. Die Emissionsreduktion ist ■■ Integration von Mobilitätslösungen und Digitali-
eine automatische Folge dessen und wird weiterhin sierungsansätzen.
durch den zunehmenden Einsatz EE, Kohlenstoffär- ■■ PtX, Flexibilisierungsoptionen, Gasbeschaffen-
merer Kraft- und Brennstoffe und letztlich nicht ein- heitsfragen, L-H-Gas-Anpassung, H-Gas Harmo-
gesetzte Energie bestimmt. nisierung, LNG/LBG, Biogase inkl. Wasserstoff.
Die Identifikation der optimalen, zukunftssicheren Das „Virtuelle Institut Strom zu Gas und Wärme
Pfade im Zielkonflikt einer versorgungssicheren, öko- NRW“ wurde 2017 weitergeführt und wird 2018 bis
logischen und ökonomischen Bereitstellung ist die 2020 vom Land NRW gefördert. Für eine Fortführung
Herausforderung und stellt sowohl einzelne Ener- des virtuellen Instituts KWK.NRW, dessen Koordina-
gieträger als auch Technologien auf den Prüfstand. tor Prof. Görner ist, wurde eine Forschungsagenda
Teil der Lösung sind adaptive Systeme, die die nicht unter den Konsortialpartnern abgestimmt.
immer gleichzeitige Verfügbarkeit der EE und der
Bedarfe an elektrischer Energie, Wärme und Treib- Mit den Abteilungen IFT (Industrielle Feuerungstech-
stoffen bei möglichst umfassender Integration der EE nik), PL (Prüflabor) und Bildungswerk bestehen Schnitt-
und möglichst geringem Primärenergieeinsatz durch stellen zu den Themen Flexibilisierungsoptionen, Net-
traditionelle Energieträger verbinden. Erdgas und ze, Gasbeschaffenheit, L-H-Anpassung und LNG.
Biogase – auch in komprimierter (CNG, Compressed
Natural Gas) und verflüssigter Form (LNG , Liquefied Mit dem Projekt LNG-Pilots ist das GWI bei einem
Natural Gas, bzw. LBG, Liquefied Biogas) für den Mo- Niederländisch-Deutschen Kooperationsprojekt zur
bilitäts- bzw. Transportsektor oder Wasserstoff aus Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für den
der Elektrolyse mit elektrischer Energie aus Wind- Einsatz von LNG/LBG beteiligt. Das GWI hat in 2017
kraftanlagen – Power-to-Gas (PtG) – liefern in Ergän- zum vierten Mal den Workshop „LNG Roadmap –
zung zu und in Kombination mit den regenerativen LNG as a driving force for cross-border cooperation
Energien und ihren vielfältigen Anwendungstechno- within the EU“ zusammen mit der EnergieAgentur.
logien zur Wärme- und Strombereitstellung einen NRW ausgerichtet – die Veranstaltung für 2018 ist
Seite 15 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
in Planung. Der etablierte Runde Tisch Gasbeschaf- startet. Das Projekt führt das Anlagen-Monitoring
fenheit diente zum 5. Mal als Austauschplattform für aus dem Projekt „100 KWK-Anlagen in Bottrop“ über
aktuelle Themen aus dem erweiterten Gas-Umfeld. zusätzliche Heizperioden weiter und beinhaltet die
Integration, den Betrieb und die Einbindung in das
2017 wurde aus dem Themenbereich Gasbeschaf- messtechnische Monitoring von bis zu 20 markt-
fenheit ein DVGW-Projekt zur möglichen Beeinträch- verfügbaren Stromspeichern mit unterschiedlichen
tigung von Bauteilen der Gasinstallation durch Was- Kapazitäten in KWK-Systeme im Projektgebiet. Ziel
serstoff (Sicherheitskonzept TRGI – Technische Re- ist eine Verminderung der Stromeinspeisung bzw.
geln Gasinstallation) bearbeitet, für das AIF-Projekt Erhöhung der Eigennutzung des KWK-Stroms. Weite-
zur Sensorik AIF-Projekt „Entwicklung eines kosten- re Themen sind die Weiterentwicklung, Herstellung
günstigen und eichfähigen, thermischen, integrier- und Untersuchung der Zell-Chemie in Abhängigkeit
ten Sensorsystems“ – FuelPowerSens – gefördert der Anforderungen an Stromspeicher beim Einsatz
mit Mitteln der Arbeitsgemeinschaft industrieller mit KWK, die Bewertung der Wirtschaftlichkeit und
Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. eine sozialwissenschaftliche NutzerInnen-Analyse
(AIF), Köln wird aufgrund des aussichtsreichen Ent- zur standardisierten Erfassung von strom- und hei-
wicklungsstandes eine Weiterführung angestrebt. zungsbezogenen psychologischen Variablen.
Nach der Fertigstellung der NRW-Projekte „100-KWK- Verknüpft mit den KWK-Projekten in der Innova-
Anlagen in Bottrop“ und „roadmap KWK.NRW – Ein- tionCity ist das vom Bund im Förderprogramm
satz von KWK-Technologien in NRW – Detailfragestel- „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda
lungen und Forschungsagenda“ wurden die Aktivitä- für die Energiewende“ (SINTEG) geförderte Projekt
ten zu KWK und Sektorenkopplung mit den Projekten DESIGNETZ. Das Ziel von DESIGNETZ ist die Erstellung
„demoKWK3.0 – wissenschaftliche Begleitung zur einer Blaupause für das Stromnetz der Zukunft und
ganzheitlichen Evaluation des Anlagenpools aus 100 eine gelungene Energiewende. Dafür soll das intel-
KWK-Anlagen in Bottrop“ und „Transfer4.0@KWK. ligente Stromnetz der Zukunft Schwankungen der
NRW“ weitergeführt. Stromerzeugung aufgrund von zum Beispiel Wind-
und Sonnenenergie flexibel ausgleichen. Es werden
Das Projekt „demoKWK3.0 – wissenschaftliche Be- etwa 30 Demonstrations- und Hebelprojekte betrach-
gleitung zur ganzheitlichen Evaluation des Anlagen- tet, um Flexibilisierungsoptionen zu untersuchen.
pools aus 100 KWK-Anlagen in Bottrop –“ führte die Ziel ist die Gewährleistung von Versorgungssicher-
wissenschaftliche Begleitung der Demonstration in heit während gleichzeitig der Netzausbau möglichst
Bottrop weiter. Hier wurden die Objektanalysen über geringgehalten werden soll, damit die Energiewen-
einen erweiterten Messzeitraum durchgeführt und de kosteneffizient gelingt. Das GWI hat im Rahmen
Auswirkungen der geänderten wirtschaftlichen Rah- des Gesamtprojektes seinen Schwerpunkt auf der
menbedingungen auf Basis des novellierten KWKG Erfassung und Charakterisierung der individuellen
(2016) mit Realdaten betrachtet. Zur weiteren Effi- Demonstrator-Technologien, unter anderem, um
zienzsteigerung der Energieversorgung in Wohnbe- deren Flexibilitätspotenziale im Hinblick auf das ge-
ständen sowie zur nachhaltigen Sicherung angemes- samte Flexibilitäts-Portfolio vergleichbar zu machen.
sener Strompreise für private Haushalte wurden er- Dies beinhaltet die Koordination der verschiedenen
gänzend Mieterstromkonzepte bewertet. Demonstratoren und Hebel-Projekte, sowie die Aus-
wertung verschiedener Daten und Erfahrungen, die
Das Forschungsprojekt „Transfer4.0@KWK.NRW“ im im Projekt gesammelt werden. Darüber hinaus wird
Rahmen des Virtuellen Instituts | KWK.NRW ist ein das Projekt „Energiewabe InnovationCity“ als ein
zentrales Forschungsprojekt zur Etablierung gekop- Demonstrator ins Projekt DESIGNETZ eingebracht.
pelter Technologien in der Energieversorgung des Übergeordnetes Ziel des Demonstrators „Energiewa-
Landes NRW. Das Projekt wurde 2017 fertiggestellt be InnovationCity“ ist die Analyse und Bewertung ei-
(vi-kwk.nrw). nes potenziellen Wärmemarkts, welcher von einem
größeren Anteil dezentraler, häuslicher Mikro-KWK
Mitte 2017 wurde das Projekt „KWK plus Speicher, geprägt ist. Dies erfolgt u.a. durch die aktive Einbin-
Anlagen- und Betriebsoptimierung zur Flexibilisie- dung von bis zu 15 KWK-Geräten aus dem bereits
rung des KWK-Betriebs mit innovativen Speicher- bestehenden Hebelprojekt „100 KWK in Bottrop“ in
technologien“ zusammen mit dem Batteriefor- DESIGNETZ. Ziel ist die Flexibilisierung aktiver Erzeu-
schungsinstitut (meet), der Hochschule Ruhr-West ger von Strom (nicht nur Last-Element) zur Ergän-
(HRW), der TU Dortmund und InnovationCity ge- zung der Netz-Stabilisierungsmaßnahmen auf der
Seite 16 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017
Anschlussebene und die Untersuchung des Beitrags boten, denen durch das Herunterregeln der erneu-
dieser Technologien für das Gesamtsystem. Weitere erbaren Energieerzeuger entgegengewirkt werden
Geräte in dem Projekt werden ebenfalls hinsichtlich muss. Zusätzliche lokale Ungleichgewichte entstehen
ihres Flexibilitätspotenzials sichtbar gemacht. durch die Stilllegung der Kernkraftwerke bis zum Jahr
2022 und ggf. durch die Stilllegungen weiterer großer
In einem weiteren Bundesprojekt erfolgt eine Inte- fossiler Kraftwerke (z.T. aus wirtschaftlichen Grün-
grierte Betrachtung von Strom-, Gas- und Wärmesy- den). Hier sei im Rahmen aktueller Ereignisse auf die
stemen zur modellbasierten Optimierung des Ener- von der Bundesregierung beschlossene Stilllegung
gieausgleichs- und Transportbedarfs innerhalb der mehrerer Braunkohlekraftwerke mit einer installier-
deutschen Energienetze – IntegraNet (integranet. ten Leistung von 2,7 Gigawatt bis 2019 hingewiesen.
energy). Mit voranschreitender Energiewende wird Dieser Umstand verdeutlicht, dass keine generellen
der Einfluss der volatilen erneuerbaren Energien auf Aussagen für das gesamte Bundesgebiet getroffen
die deutschen Energienetze (Strom, Gas, Wärme) werden können. Vielmehr muss es eine Differenzie-
stetig steigen. Die beiden dominierenden erneuer- rung auf verschiedenen Ebenen geben. Ein besonde-
baren Quellen sind dabei die Solar- und Windener- rer Fokus in der aktuellen Forschungslandschaft liegt
gie. Beide weisen ein hohes Maß an zeitlicher und auf der Untersuchung der Auswirkungen der erneu-
witterungsbedingter Variabilität auf, welche nicht erbaren Energie auf die einzelnen Netzebenen. Ziel
nur auf Stunden- oder Tagesbasis schwanken, son- dieser Betrachtungen ist es, den Anteil EE in den End-
dern auch große saisonale Unterschiede aufweisen. verbrauchssektoren stetig zu steigern. Insbesondere
Gleichzeitig ist eine geografische Entkopplung von auf den Verteilnetzebenen (Gas, Strom und Wärme)
Energiebedarf und Energieproduktion festzustel- ergeben sich neue Herausforderungen und Poten-
len. Mittel- bis langfristig ist ein zusätzlicher Bedarf ziale. Im Hinblick auf diese Fragestellungen werden
an Energieausgleichs- und Speichertechnologien zu am GWI gekoppelte Netze modelliert und zeitauf-
erwarten. Des Weiteren erfolgt der Ausbau der er- gelöst simuliert. In der folgenden Abbildung 10 sind
neuerbaren Energieerzeuger nicht homogen verteilt exemplarisch ein im ländlichen Gebiet verortetes
über ganz Deutschland. Im Norden, insbesondere an Niederdruckgasnetz und Niederspannungsstromnetz
den Küstenregionen, und im Osten werden verstärkt abgebildet. Die Netze sind über eine PtG-Anlage ge-
Windkraftanlagen gebaut, während im Süden die So- koppelt, die Überproduktion der quartiersinternen
larenergieerzeugung dominiert. Während die BMWi- Photovoltaik-Anlagen wird mittels dieser in Wasser-
Leitstudie (Leitstudie 2010) deutschlandweit einen stoff umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist.
Ausgleichsbedarf erst ab dem Jahr 2030 prognosti-
ziert, kommt es durch den regional unterschiedlichen Zur Stabilisierung des Energiesystems und zum
Ausbau von Wind- und Solarstromerzeugern bereits Energieausgleich können zukünftig insbesondere
jetzt in verschiedenen Regionen zu Stromüberange- gas- und wärmebasierte Ausgleichsoptionen eine
Abbildung 10: Gekoppeltes Strom- und Gasverteilnetz (Abbildung in Modelica (Quelle: GWI, 2018))
Seite 17 | 28TÄTIGKEITSBERICHT 2017 Abbildung 11: Typische Gebäude in der Siedlung (Quelle: IWB) besondere Bedeutung gewinnen, da sie bereits auf In den Themenbereich Sektorkopplung/Quartiere gut ausgebaute Transport- und Speicherinfrastruktu- fällt auch das Projekt „Energieeffiziente Wohnsied- ren zurückgreifen können. Denkbar wären hier der lungen durch zukunftsfähige Konzepte für den denk- Einsatz bereits etablierter Technologien wie motori- malgeschützten Bestand – Energieoptimiertes Quar- sche KWK und die Biogaseinspeisung aber auch die tier Margarethenhöhe Essen (EnQM)“ unter Leitung zukünftige Nutzung innovativer Technologien wie die der Universität Stuttgart – Institut für Werkstoffe im Brennstoffzellen-KWK, Power-to-Gas Konzepte (PtG), Bauwesen mit der Margarethe-Krupp-Stiftung für Power-to-Heat (PtH) und Pyrolysetechnologien. Dar- Wohnungsfürsorge und der RWTH Aachen. über hinaus müssen in eine gesamtheitliche Betrach- tung aber auch die bereits vorhandenen bzw. in der Bis 2050 sieht die Bundesregierung einen nahezu Entwicklung befindlichen Technologien zur direkten klimaneutralen Gebäudebestand vor. Bereits 2020 Stromspeicherung und zum stromsystembasierten sollen Erneuerbare Energien (EE) 14 Prozent des En- Energieausgleich wie z.B. Smart-Grids, Demand Side denergieverbrauchs für Wärme und Kälte decken. Management, Batteriespeicher oder Druckluftspei- Im Vergleich zum heutigen Stand muss folglich die cher in das Konzept mit eingebunden werden. Ein Sanierungsrate verdoppelt werden. Hierbei können Schwerpunkt des Projektes wird die Entwicklung Effizienzsteigerungen im Gebäudebestand nicht nur eines Modellierungssystems für die Quartiersebe- durch die Sanierung von einzelnen Gebäuden erzielt ne sein. Hier wird auf Basis der objektorientierten werden, sondern auch durch die smarte Vernetzung Modellierungssprache Modelica ein Werkzeug ge- von Gebäuden innerhalb eines Quartiers. Um den schaffen, welches es ermöglicht, verschiedene Ge- Ansatz der energieeffizienten Quartierslösung vor- meinde- bzw. Quartiersstrukturen abzubilden. Bei anzutreiben, greift die vom Bundesministerium für der Entwicklung wird ein Austausch mit schon beste- Wirtschaft und Energie veröffentlichte „Energieeffizi- henden Modelica Bibliotheken angestrebt (z.B. aus enzstrategie Gebäude“ den Gedanken der ganzheit- dem Projekt TransiEnt.EE – Transientes Verhalten lichen Sanierung und Modernisierung im Gebäude- gekoppelter Energienetze mit hohem Anteil Erneuer- bestand auf. barer Energien). Hiermit können bereits vorhandene Im Verbundhaben EnQM wird das GWI gemeinsam Modelle gleichzeitig einem weiteren Praxistest un- mit den Projektpartnern den Ansatz der ganzheitli- terzogen und ihre Anwendung und Anwendbarkeit chen energetischen Ertüchtigung von Gebäuden zur weiterentwickelt werden. Steigerung der Energieeffizienz im Quartier aufgrei- Seite 18 | 28
Sie können auch lesen