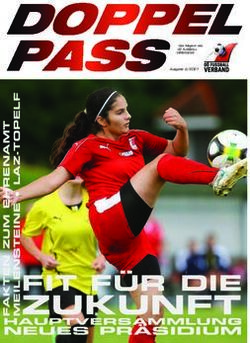Heinrich Best und Wilhelm Heinz Schröder: Quantitative historische Sozialforschung.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 1 von 21
Prof. Dr. Wilhelm Heinz Schröder
Vorlesung
„Was heißt und zu welchem Ende studiert man
Historische Sozialforschung?“
WS 2007 / 2008
Text 1
Heinrich Best und
Wilhelm Heinz Schröder:
Quantitative historische Sozialforschung.
Aus:
Christian Meier und Jörn Rüsen (Hrsg.)
Historische Methode.
München 1988, S. 235-266
(= Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik, Band 5)
1Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 2 von 21
HEINRICH BEST
WILHELM HEINZ SCHRÖDER
Quantitative historische Sozialforschung
I. Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft:
Zwischen methodologischem Rigorismus und wissenschaftspolitischer
Pragmatik
Als Jürgen Kocka auf dem Mannheimer Historikertag im Jahr 1976 davor warnte,
"daß wir hierzulande, auch was die geschichtswissenschaftliche Quantifizierung an-
belangt, die Kritik vor der Sache selbst hervorbringen"1, war dies ein Ausdruck der
Erwartung, daß die Verbreitung quantitativer Methoden in der Bundesrepublik
Deutschland eine kontroverse Debatte über den Gegenstand und die Wahrheitskrite-
rien der Geschichtsforschung auslösen werde. Diese Prognose schien begründet,
denn in den USA waren die Quantifizierer bereits etwa 10 Jahre zuvor in klarer Ab-
grenzung und als entschiedene Opposition zur "traditionellen" Historiographie aufge-
treten und hatten den Anspruch erhoben, nur auf der Grundlage numerischer Evi-
denz und bei Anwendung formaler Verfahren könne Geschichtsforschung als Wis-
senschaft betrachtet werden, während Arthur Schlesinger als prominentester Spre-
cher der "Traditionalisten" bereits sein berühmtes Verdikt formuliert hatte, daß alle
bedeutsamen Fragestellungen gerade deshalb bedeutsam seien, weil es auf sie kei-
ne quantitative Antwort gebe2. Ungefähr in dem Augenblick, in dem in der Bundesre-
publik Deutschland quantitative Methoden zum Thema wurden, hatten die Debatte in
den USA ihren Höhepunkt erreicht. Es war deshalb naheliegend, daß mit den Me-
thoden auch die Kontroverse in die Bundesrepublik importiert werden würde.
Tatsächlich vollzog sich jedoch die Adaption und Verbreitung quantitativer Me-
thoden hier eher unauffällig und unkontrovers. Die Gründe für diesen „deutschen
Sonderweg zur Quantifizierung“ können in diesem Beitrag nur skizziert werden. Be-
sonders bedeutsam war der Umstand, daß in der Bundesrepublik gerade zu diesem
Zeitpunkt der Methodenstreit in der Soziologie verebbte, in dem – auf deutlich höhe-
rem intellektuellem Niveau als in den USA, wenn auch in prägnanterer politisch-
ideologischer Polarisierung – der Erfahrungsbegriff der Sozialwissenschaften disku-
tiert worden war3.
Da es dabei auch um die erkenntnistheoretische Dignität analytischer und
hermeneutischer Verfahren gegangen war, hatte die amerikanische Quantifizie-
rungsdebatte für ein methodologisch interessiertes deutsches Publikum kaum Er-
kenntniswert außer vielleicht der Konfrontation mit einem hier selten so undifferen-
ziert vertretenen Szientismus. Ein weiteres Erklärungsmoment ist, daß die Auseinan-
dersetzungen in der deutschen Historiographie während der sechziger und begin-
1
Jürgen Kocka, Quantifizierung in der Geschichtswissenschaft. In: Heinrich Best und Reinhard Mann (Hrsg.), Quantitative
Methoden in der historisch-sozialwissenschaftlichen Forschung. Stuttgart 1977, S. 4.
2
Einen guten Überblick über die amerikanische Debatte aus der Sicht eines Quantifizierers gibt ein Sammelband mit den Auf-
sätzen von Allan G. Bogue, Clio and the Bitch Goddess. Quantification in American Political History. Beverly Hills u.a. 1983; vgl.
auch Robert W. Fogel, Scientific and Traditional History. In: L. J. Cohen u. a. (Hrsg.), Logic, Methodology and Philosophy of
Science. Amsterdam 1982; J. Morgan Kousser, Quantitative Social Scientific History. In:H. Kammen (Hrsg.), The Past Before
Us. Contemporary Historical Writing in the United States. Ithaca 1980, S.433-56. Der Ausspruch Arthur Schlesingers findet sich
in C.V. Woodward, History and the Third Culture. In: Journal of Contemporary History 3(1968), S. 29. Einen guten Überblick
über Entwicklung und Stand der internationalen Diskussion bietet Konrad H. Jarausch, (Inter)national Styles of Quantitative
History. In: Konrad H.Jarausch u. Wilhelm Schröder (Hrsg.), Quantitative History of Society and Economy: Some International
Studies. St. Katharinen 1987, S. 5-18.
3
Einige der wichtigsten Beiträge wurden in dem seit Mitte der sechziger Jahre immer wieder neu aufgelegten Sammelband von
Ernst Topitsch (Hrsg.), Logik der Sozialwissenschaften. Königstein/Ts., zuletzt 1984 veröffentlicht.
2Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 3 von 21
nenden siebziger Jahre hauptsächlich um die Auswahl und Interpretation historischer
Sachverhalte in konkreten Problemzusammenhängen geführt wurden, während die
methodischen Grundlagen der Geschichtswissenschaft äußerstenfalls ein Neben-
thema bildeten. Der Streit um die Verantwortlichkeit der deutschen Machteliten für
den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist ein Beispiel für diese Orientierung. In den
heftigen Kontroversen um die Umdeutung der deutschen Geschichte vermochte eine
vermeintlich esoterische methodische Innovation nicht zu provozieren, vor allem
dann, wenn sie – wie die Quantifizierung – keinem politischen Lager und keiner his-
toriographischen Schule zuzurechnen war. Die Quantifizierung konnte tatsächlich als
Mittel zur Perfektionierung positivistischer Faktensammlung und -aufbereitung4, als
ein Instrument, um die „stummen Massen“ zum Sprechen zu bringen5, oder als Teil
des Methodenkanons einer marxistischen Historiographie6 beansprucht werden.
Auch vermieden ihre frühen Exponenten bewußt einen methodischen Rigorismus,
der sie in das Abseits "reinen" Spezialistentums geführt hätte. Die Zusammenset-
zung des Beirats der 1975 gegründeten »Arbeitsgemeinschaft für Quantifizierung
und Methoden in der historisch-sozialwissenschaftlichen Forschung« (QUANTUM)
dokumentiert nachdrücklich den Pluralismus der politischen Orientierungen und wis-
senschaftlichen Schulen, die an der Wiege der deutschen quantifizierenden Ge-
schichtsforschung standen7.
Doch bedeutete Pluralismus nicht Abwesenheit von Differenzierungen und
programmatischen Zuspitzungen. Tatsächlich steht die Anwendung quantitativer Me-
thoden in einem wissenschaftshistorischen Entwicklungszusammenhang, der eine
sich im weitesten Sinne als „Gesellschaftsgeschichte“ verstehende Forschungsrich-
tung immer weiter der Forschungslogik und den methodischen Standards der syste-
matischen Sozialwissenschaften annäherte8. Die Leitbegriffe, nach denen sich die
Etappen dieser Entwicklung gliedern lassen, sind Sozialgeschichte, Strukturge-
schichte, Historische Sozialwissenschaft und Historische Sozialforschung. Die Ord-
nung, in der sie hier genannt sind, entspricht der Abfolge, in der sie in die Diskussion
eingeführt wurden. Die Historische Sozialforschung steht dabei für eine mit methodo-
logischem Programm und nicht lediglich als historische Hilfswissenschaft betriebene
Quantifizierung.
Am Anfang stand die Sozialgeschichte, die Werner Conze allgemein definiert
als „Geschichte der Gesellschaft, genauer der sozialen Strukturen, Abläufe, Bewe-
gungen“9. Diese sehr globale Bestimmung erlaubt allerdings noch keine klare Ab-
grenzung zu den anderen hier zu diskutierenden Ansätzen. Eine eindeutigere Unter-
scheidung läßt sich aus der inhaltlichen Orientierung der Sozialgeschichte ableiten:
Das traditionelle Forschungsfeld der Sozialgeschichte ist die Gesellschaft unter Aus-
klammerung der Politik, oder – wie es George M. Trevelyan klassisch formulierte – :
„the history of a people with the politics left out“10. Der zweite Unterschied liegt in der
Methode und den Wahrheitskriterien. Werner Conze stellte noch gegen Ende der
sechziger Jahre fest: „Die Arbeitsweise der Sozialgeschichte ist durch die in der Ge-
4
Vgl. u.a. Carl August Lückerath, Prolegomena elektronischer Datenverarbeitung im Bereich der Geschichtswissenschaft. In:
HZ 207 (1968), S. 265-296.
5
Vgl. u.a. Richard Tilly, Sozialer Protest als Gegenstand historischer Forschung. In: ders., Kapital. Staat und Protest in der
deutschen Industrialisierung.Göttingen 1980, S. 175.
6
Hierzu jetzt umfassend: Don Karl Rowney (Hrsg.), Soviet Quantitative History. Beverly Hills u.a. 1984.
7
Vgl. Historical Social Research/Historische Sozialforschung 17 (1981), S. 96 f.
8
Vgl. hierzu auch Heinrich Best, Histoire sociale et méthodes quantitatives en Allemagne Federale. In: Histoire moderne et
contemporaine informatique 7 (1985) S. 3-28 und demnächst: ders., Historische Sozialforschung als Erweiterung des Soziolo-
gie. Zur Konvergenz sozialwissenschaftlicher und historischer Erkenntniskonzepte.In: Gerhard Botz u.a. (Hrsg.), Quantität und
Qualität. Frankfurt a.M., New York 1988.
9
Werner Conze, Sozialgeschichte. In: Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Moderne deutsche Sozialgeschichte. 3. Aufl. Köln u. Berlin
1979, S. 19.
10
George M. Trevelyan, Illustrated English Social History. New York 1962 (zuerst 1944), S. XI.
3Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 4 von 21
schichtswissenschaft allgemeingültige historisch-quellenkritische und historisch-
verstehende Methode gekennzeichnet.“11 Doch an beiden Abgrenzungspunkten setz-
te bereits zu diesem Zeitpunkt die Fortentwicklung ein. Zunächst und mit größerem
Nachdruck geschah dies in Form einer Ausweitung des inhaltlichen Geltungsbe-
reichs der Sozialgeschichte. So betonte auch Werner Conze, daß Sozialgeschichte
nicht minder als die Geschichte der Ereignisse und Entscheidungen „politische“ Ge-
schichte sei12. In ähnlicher Weise kennzeichnete sie Hans Mommsen in Anlehnung
an Otto Brunner als eine „allgemeine Betrachtungsweise“, die auf den „inneren Bau,
die Struktur der menschlichen Verbände“ gerichtet sei13.
Mit dem Begriff „Struktur“ ist der Leitbegriff der folgenden Diskussion gefallen.
Das in Frankreich von Fernand Braudel vorgeschlagene und in vielen Beiträgen der
Zeitschrift >Annales< weiterentwickelte Konzept einer „histoire des structures“ (Struk-
turgeschichte) beinhaltete – ohne explizite Eingrenzung auf bestimmte Bereiche ge-
schichtlicher Wirklichkeit, aber noch mit einer de facto weitgehenden Ausklamme-
rung des politischen Systems – die Rekonstruktion von historischen „Verhältnissen“
und „Zuständen“ von überindividuellen Entwicklungen und Prozessen14. Damit ver-
bunden war vielfach die Forderung nach einer Erfassung des gesamtgeschichtlichen
Prozesses in seinem synchronen wie diachronen Zusammenhang. Aber gerade an
den Ansätzen zu einer “histoire totale“, die eine Gesamtdarstellung von Wirtschaft,
Gesellschaft, Politik und Kultur großer Räume über lange Zeiträume hinweg versuch-
ten, wurden auch die spezifischen Schwächen einer „Strukturgeschichte“ erkennbar:
Es zeigte sich, daß eine „scharfe Trennung von Strukturen und Nicht-Strukturen (Er-
eignisse, Entscheidungen und Handlungen) in der Geschichte sowohl theoretisch-
begrifflich wie auch in der Praxis historischer Arbeit äußerst schwierig und problema-
tisch“ ist15. Als eine weitere Schwäche strukturgeschichtlicher Ansätze wurde die Be-
liebigkeit bei der Auswahl und „Montage“ von Fakten zu integralen Gesamtdarstel-
lungen erkannt. Tatsächlich hatte der „strukturgeschichtliche Ansatz als solcher keine
inhaltliche Theorie zur Verfügung, die die Auswahl der relevanten Fakten ermögli-
chen, Hypothesen zur Interdependenz zwischen Wirtschaft, Politik und anderen
Wirklichkeitsbereichen bereitstellen sowie die kausalen und funktionalen Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Momenten der zu untersuchenden historischen Wirk-
lichkeit und die wichtigsten Veränderungskräfte hypothetisch und überprüfbar identi-
fizieren würde“16. Polemisch wurde dieses Vorgehen gelegentlich als „Sandwich-
Methode“ und „Schubladen-Historie“ kritisiert. Es lieferte gelegentlich brillante Be-
schreibungen von zum Teil hoher literarischer Qualität, während die Stringenz und
Reichweite der Erklärungen weit dahinter zurückblieb.
An diesem Punkt führte das Programm der Historischen Sozialwissenschaft
über die Strukturgeschichte hinaus: „Wesentlichen Anteil an der Entwicklung zur His-
torischen Sozialwissenschaft hat die wachsende Einsicht in die vielberufene >Theo-
riebedürftigkeit< der Geschichtswissenschaft.“17 Dabei wurde und wird fast aus-
schließlich auf die Theorieleistungen der systematischen Sozialwissenschaften zu-
rückgegriffen. Das geschieht typisch in der Weise, daß einzelne Begriffe, Kategorien
und Modelle in die historischen Argumentationszusammenhänge eingebaut werden.
Dabei wird der Anspruch an die Reichweite und Erklärungskraft theoretischer Aussa-
11
Conze, Sozialgeschichte, S. 25.
12
Ebd., S. 24.
13
Hans Mommsen, Sozialgeschichte. In: Moderne deutsche Sozialgeschichte,S. 34.
14
Jürgen Kocka, Sozialgeschichte. Begriff – Entwicklung – Probleme. Göttingen 1977, S. 70f.; Michael Erbe, Zur neueren
französischen Sozialgeschichtsforschung. Die Gruppe um die "Annales". Darmstadt 1979; zur Rezeption in Deutschland insbe-
sondere die Einleitung, S. 27ff.
15
Kocka, Sozialgeschichte, S. 73.
16
Ebd., S. 79.
17
Reinhard Rürup, Zur Einführung. In: ders. (Hrsg.), Historische Sozialwissenschaft. Göttingen 1977,5. 8.
4Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 5 von 21
gen weit zurückgenommen: Die Historische Sozialwissenschaft zielt auf „Verände-
rungen in der historischen Zeit unter je spezifischen Umständen“18 und nicht auf zeit-
übergreifende Gesetzmäßigkeiten. Die theoretischen Aussagen der Historischen So-
zialwissenschaft sind weit überwiegend „ad-hoc-Theorien“, d. h. „Hypothesen, die
ausschließlich dazu dienen, die vorliegenden (begrenzten) Regelmäßigkeiten auf
einen Zusammenhang von theoretischen Sätzen zu bringen, ohne daß diese in wei-
tere Zusammenhänge integriert wurden, noch ohne daß sie in ihrem Geltungsbereich
auf weitere Räume oder Zeiten angewandt wurden“19. Die Vermutung mancher Ex-
ponenten der Historischen Sozialwissenschaft, „Theorien mittlerer Reichweite“ zu
formulieren, widerspricht dem Anspruch an die Reichweite derartiger Aussagen-
systeme. „Um eine ad-hoc-Theorie zu einer Theorie mittlerer Reichweite auszudeh-
nen, müßte die behandelte Serie von Invarianten und Regelmäßigkeiten mit anderen
vergleichbaren Invarianten konfrontiert werden, anders in Raum und Zeit. Das wird
dann entweder zu einer einheitlichen Theorie mittlerer Reichweite führen oder zu ei-
ner typologischen Differenzierung ... , so daß dann die Entwicklung einer Theorie von
höherem Abstraktionsgrad nötig wird, die die verschiedenen Typen gleichermaßen
umfaßt und erklärt.“20 Dieses Vorgehen wäre aber nach dem Selbstverständnis der
Historischen Sozialwissenschaft „unhistorisch“ und damit zurückzuweisen. Doch
auch wenn es wünschenswert ist, daß die Historische Sozialwissenschaft schärfer
als bisher ihre Theorieansprüche bestimmt, so ist die Verwendung von ad-hoc-
Theorien selbst legitim und fruchtbar. Auch die Empirische Sozialforschung greift ü-
berwiegend auf Aussagen dieses Typs zurück, deren Reichweite meistens den je-
weiligen Problemstellungen angemessen ist. Bedenklicher ist die in der historisch-
sozialwissenschaftlichen Forschung häufige Übernahme einzelner Begriffe und Ka-
tegorien der Soziologie, losgelöst von ihren theoretischen Zusammenhängen, und
ein Gebrauch von Theorie, bei dem „Erklärungen“ nachträglich an die Befunde „he-
rangetragen“ werden. Dieses induktive Vorgehen bedingt Beliebigkeit, denn beo-
bachteten „Wirkungen“ kann eine theoretisch unendliche Zahl von „Ursachen“ zuge-
ordnet werden und ein logischer Schluß von der Beobachtung auf theoretische Aus-
sagen ist nicht möglich21. Die schwerwiegendste Kritik richtet sich gegen die metho-
dische Praxis der Historischen Sozialwissenschaft. Zwar wird von ihren Vertretern
eine Verbindung von „historisch-hermeneutischen“ und „sozialwissenschaftlich-
analytischen“ Methoden gefordert, doch geht die Historische Sozialwissenschaft in
der Praxis selten über hermeneutische Vorgehensweisen hinaus und quantitative
Methoden werden nur vereinzelt und vorwiegend illustrativ eingesetzt. Eine deskripti-
ve Kasuistik reicht jedoch nicht hin, um Theorien zu testen, sondern bewirkt Diskre-
panzen zwischen der angestrebten Reichweite theoretischer Aussagen über gesell-
schaftliche Sachverhalte in der Vergangenheit und ihrer empirischen Fundierung.
An diesem Punkt setzt die Fortentwicklung der Historischen Sozialwissen-
schaft zur Historischen Sozialforschung ein. Allgemein läßt sich Historische Sozial-
forschung definieren als „die theoriengeleitete Erforschung sozialer Sachverhalte in
zeitlicher Tiefe mit gültigen Methoden, wobei hier unter Gültigkeit die Entsprechung
zwischen der Reichweite der Forschungsoperationen und der Reichweite theoreti-
scher Aussagen verstanden wird„22, oder bezogen auf unseren Kontext als „die theo-
18
Ebd.; vgl. auch Winfried Schulze, Soziologie und Geschichtswissenschaft. Einführung in die Probleme der Kooperation bei-
der Wissenschaften. München 1974. S. 188.
19
Rene König, Grundlagenprobleme der modernen soziologischen Forschungsmethoden (Modelle, Theorien, Kategorien). In:
Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gerhard Weisser. Berlin 1963, S. 26.
20
Ebd., S. 30.
21
Heine von Alemann, Der Forschungsprozeß. Eine Einführung in die Praxis der empirischen Sozialforschung. Stuttgart 1977,
S. 25.
22
Heinrich Best, Quantifizierende Historische Sozialforschung in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Überblick. In: Geschich-
te in Köln, H. 9 (1981), S.147.
5Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 6 von 21
retisch und methodisch reflektierte, empirische, besonders auch quantitativ gestützte
Erforschung sozialer Strukturen und Prozesse in der Geschichte“23. Diese Art von
Forschung ist weder „neopositivistisch“, denn sie geht von theoretischen Aussagen
aus, noch bedeutet sie einfach eine Ausweitung der Empirischen Sozialforschung in
die Vergangenheit, denn die Eigenschaften historischer Daten und die Erfordernisse
an Theorien, die gesellschaftliche Sachverhalte in historischer Tiefe erfassen, unter-
scheiden sich in vieler Hinsicht von einer gegenwartsbezogenen Soziologie. Das
Verhältnis von Empirischer und Historischer Sozialforschung läßt sich kennzeichnen
als die Übernahme der methodischen Standards der Empirischen Sozialforschung
(nicht unbedingt der Methoden selbst!) durch die Historische Sozialforschung. Da es
die Historische Sozialforschung mit Kollektivphänomenen zu tun hat, impliziert die
Übernahme dieser Standards den Einsatz quantitativer Methoden. Von der Verwen-
dung von Statistiken, wie sie in der Sozialgeschichte seit jeher üblich ist, unterschei-
det sich die Quantifizierung in der Historischen Sozialforschung insofern, als sie 1.
zunächst nur in qualitativer Form vorliegende Informationen in numerische Daten
transformiert, die dann Gegenstand mathematischer Kalküle werden, und 2. quantita-
tive Evidenz nicht akzidentiell oder illustrativ, sondern als das ausschlaggebende
Beweismittel zum Test von Hypothesen und Theorien einsetzt.
2. Theorie als Erkenntnisziel und Forschungsinstrument in der quantitativen
Historischen Sozialforschung
Der Theoriekomponente unserer Definition von Historischer Sozialforschung liegen
zwei erläuterungsbedürftige Vorentscheidungen zugrunde: Die Historische Sozialfor-
schung orientiert sich an einer Strategie des Forschungsprozesses, die 1. durch the-
oretische Annahmen gesteuert wird und 2. auf die Bestätigung möglichst allgemeiner
Gesetzesaussagen zielt. Ein Blick auf die Praxis der quantitativen Geschichtsfor-
schung macht deutlich, daß bereits die erstgenannte Vorentscheidung keineswegs
selbstverständlich ist. Quantifizierung wird nicht notwendigerweise mit Konzeptuali-
sierung und theoretischer Orientierung verbunden, wie sie für die Empirische Sozial-
forschung heute weitgehend verbindlich sind. Von vielen Anwendern wurde und wird
Quantifizierung in Verbindung mit der EDV eher als eine Weiterentwicklung grundle-
gender Verfahren traditioneller Geschichtsforschung gesehen, die darauf zielt, die
alte historiographische Forderung zu erfüllen, daß das gesamte Quellenmaterial und
alle verfügbaren Interpretationsmöglichkeiten genutzt werden müssen, um eine mög-
lichst detaillierte, vollständige und objektive Kenntnis vergangener Sachverhalte zu
gewinnen. Der Computer wäre damit ein Instrument zur Rekonstruktion vergangener
Wirklichkeit, „wie sie wirklich gewesen ist“. Dahinter verbirgt sich eine zumeist implizi-
te methodologische Annahme: Verständnis von historischen Ereignissen, Prozessen
und Personen könne erreicht werden durch die Berücksichtigung aller als relevant
erkannten Quellen. Ein bezeichnender Ausdruck dieser Auffassung ist es, daß die
EDV in den ersten deutschen Publikationen zum Thema als neue Hilfswissenschaft
eingeführt wurde, die lediglich die Funktion habe, die Kapazität der Historie zur Ver-
arbeitung von Massenquellen zu erweitern24.
Sehr bald stellte sich dann jedoch heraus, daß die größere Kapazität und Fle-
xibilität elektronischer Datenverarbeitung den Forschungsprozeß in eine Richtung
23
Wilhelm H. Schröder, Kollektive Biographien in der historischen Sozialforschung. In: ders. (Hrsg.), Lebenslauf und Gesell-
schaft. Stuttgart 1985, S. 8.
24
Vgl. u. a. Rolf Gundlach u. Carl August Lückerath, Historische Wissenschaften und elektronische Datenverarbeitung. Frank-
furt a. M. 1976; vgl. auch Lückerath, Prolegomena.
6Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 7 von 21
verändert, die von vielen Anwendern weder gewollt noch erwartet worden war: Die
Auswahl einer Datenbasis mit angemessener Indikatorenqualität, die Notwendigkeit,
das Material im Vorfeld der Datenverarbeitung in teilweise rigider Weise vorzuklassi-
fizieren, und schließlich die Auswahl angemessener statistischer Analyseverfahren
machten es erforderlich, eine entsprechende Konzeptualisierung der beobachteten
historischen Prozesse und Phänomene an den Beginn des Forschungsprozesses zu
stellen. Ein Verzicht auf Theorie würde sehr unmittelbar die Qualität der Forschung
beeinträchtigen, denn die gesammelten Fakten können nicht gleichzeitig die Informa-
tionen mitliefern, nach welchen Kriterien eine Auswahl, Klassifikation und Verknüp-
fung unter ihnen vorzunehmen ist. Das Postulat einer theorieunabhängigen Tatsa-
chenbasis steht damit im Widerspruch zu wesentlichen Prämissen quantifizierender
Vorgehensweisen. Ein Sachverhalt, der in die prägnante Formel gefaßt wurde: „Es
gibt kein Messen ohne Theorie.“25
Daß theoretische Überlegungen am Anfang der quantitativen Forschung ste-
hen, gilt demnach nicht nur für die anspruchsvollere hypothesentestende Forschung,
sondern auch für jede Art von systematischer Sammlung und selbst für eine „bloß“
deskriptive Darstellung empirischer Daten. Da keine Beschreibung eines realen Tat-
bestands die Wirklichkeit in ihrer gesamten Komplexität abbilden kann, muß sich je-
de Deskription auf einen bestimmten Ausschnitt dieser Wirklichkeit beschränken. Die
Entscheidungen, welcher Teil dieser Wirklichkeit untersucht werden soll bzw. welche
Merkmale für die Untersuchung relevant und entsprechend zu erheben sind, können
nur nach theoretischen Kriterien getroffen werden; erst danach können die weiteren
Entscheidungen über den Fortgang der Forschung (Art und Weise von Quellenaus-
wahl, Datenerhebung etc.) angemessen festgelegt werden. Diese prinzipielle, logisch
bedingte Priorität expliziter theoretischer Überlegungen bedeutet für die alltägliche
Forschungspraxis nicht, daß der Forscher – völlig losgelöst von dem konkreten Kon-
text seiner Forschung – zunächst nur „reine“ Theoriebildung betreibt, sondern selbst-
verständlich wird der Forscher die Vorgaben seines Forschungskontextes (Verfüg-
barkeit von Literatur, Quellen, Methoden, Techniken etc.) bei der Theoriebildung be-
rücksichtigen, um die Realisierung seiner Forschung zu gewährleisten.
Damit wird nun der traditionale Gang des historischen Forschungsprozesses
umgekehrt. Theorie ist nicht mehr der nur zögernd angestrebte und häufig nie er-
reichte Endpunkt positivistischer Faktensammlung, sondern wird zum Ausgangs-
punkt des Erkenntnisprozesses. Es wird also nicht mehr von Beobachtungstatsachen
auf Gesetzesaussagen oder Hypothesen geschlossen, sondern es werden umge-
kehrt theoretische Sätze mit der Realität konfrontiert. Anders und idealtypisch aus-
gedrückt: an die Stelle des wissenschaftstheoretischen Modells der Induktion tritt das
der Deduktion; eine unvermutete Eigendynamik einer zunächst in vielen Fällen unre-
flektiert übernommenen Technologie, die manche Anwender in die undankbare Situ-
ation des „Zauberlehrlings“ versetzte, der die Geister, die er rief, nun nicht mehr los
wird.
Ein weiterer Aspekt unserer wissenschaftstheoretischen Vorentscheidung er-
gibt sich aus der Maxime, daß es das Ziel des Erkenntnisprozesses in der Histori-
schen Sozialforschung sei, möglichst allgemeine Gesetzesaussagen zu formulieren.
Auch diese Vorentscheidung ist keineswegs selbstverständlich oder unbestritten. Die
Auffassung, daß im historischen Bereich keine Gesetzesaussagen wie in den Natur-
wissenschaften möglich seien, ist für einen großen Teil der Historiker unverändert
verbindlich. Begründet wurde diese Auffassung unter anderem damit, daß menschli-
ches Handeln und folglich auch jede historische Erscheinung Symbolcharakter habe,
25
Michael Drake u. Peter Hammerton, Exercises in Historical Sociology. Walton Hall 1974, S. 12.
7Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 8 von 21
aufgrund von Intentionen existiere und durch Entstehung und Wirkungsgeschichte
stets mit anderen historischen Phänomenen verbunden sei26.
Es war der deutsche Philosoph Wilhelm Windelband, der zu Ausgang des 19.
Jahrhunderts die sich hier gegenüberstehenden wissenschaftstheoretischen Positio-
nen systematisch voneinander abgegrenzt hat. Seine Definition eines nomotheti-
schen und eines idiographischen wissenschaftlichen Denkens besitzt noch heute
Bedeutung für die wissenschaftstheoretische Diskussion27. Während Windelband
diese Unterscheidung auf die Bereiche der Naturwissenschaften und Geisteswissen-
schaften angewandt sehen wollte, in dem Sinne, daß Naturwissenschaften nomothe-
tischen Charakter haben, während Geisteswissenschaften- oder allgemeiner „Hu-
manwissenschaften“- idiographischen Charakter haben, setzte im Verlauf der weite-
ren Entwicklung eine zunehmende Orientierung der Gesellschaftswissenschaften am
Erfahrungsbegriff der Naturwissenschaften ein. Heute ist der „Newtonsche Gesetzes-
typ“ auch für weite Bereiche der Soziologie das verbindliche Erkenntnisziel. Bestim-
mend für diese Entwicklung war die Maxime der „Einheit der Erfahrungswissenschaf-
ten“, deren prominenteste Vertreter Carl Gustav Hempel und Karl Popper sind: Ist
Wissenschaft auf Wahrheit ausgerichtet und Wahrheit ungeteilt, gibt es auch die Ein-
heit der wissenschaftlichen Anstrengungen, diese Wahrheit zu erkennen. Das Ziel
des Erkenntnisprozesses kann dann nicht darin liegen, bestenfalls theoretische Beg-
riffe und Strukturtypen zu entwickeln und anzuwenden (womit sich auch viele traditi-
onell orientierte Historiker einverstanden erklären können), sondern Gesetzesaussa-
gen zu formulieren und zu überprüfen. Dabei werden unter Gesetzesaussagen
„streng universelle, naturnotwendige (d. h. nomologische) Behauptungen über kon-
stante Verbindungen wenigstens zweier Ereignisklassen“28 verstanden.
Ein weiterer Aspekt, der hier erwähnt werden sollte, ist die Frage nach der tat-
sächlichen Theorielosigkeit einer sich selbst als atheoretisch etikettierenden Ge-
schichtsforschung. Gegen sie wurde zu Recht eingewandt, daß auch eine narrative
und assoziative Geschichtsdarstellung implizit oder latent theoretisch ist. Dies zu-
mindest in zweierlei Hinsicht: 1. wird die Relevanz der berichteten Sachverhalte für
das behandelte Thema unterstellt (Relevanzprinzip), 2. läßt sich der Gang der Erzäh-
lung selbst als eine fortgesetzte Kausalkette, als ein Geflecht von Zusammenhängen
betrachten. Dieser Sachverhalt wird in der Diskussion gelegentlich als das „Paradig-
ma des geschichtlichen Zusammenhangs“ gekennzeichnet. Zugrunde liegen diesem
Paradigma theoretische Annahmen im weitesten Sinne. Sie lassen sich auf der all-
gemeinsten Ebene kennzeichnen durch Kategorien wie Determinismus, Kausalität,
Zufall und Freiheit, im Hinblick auf die Antriebskräfte des Geschichtsprozesses durch
Agenzien und Akteure wie Ideen, große Männer, göttliches Wirken, sittliche Mächte,
Klima, Geographie und durch die sozialen und ökonomischen Zustände, im Hinblick
auf Verlaufsformen historischer Prozesse durch Prozeßkategorien wie Irreversibilität
der Entwicklung, Wiederkehr des Gleichen, Fortschritt und Stufenlehren. „Zumeist
bleiben diese Paradigmen bei der Formulierung von Zusammenhängen implizit, den-
noch sind sie in den Ereignisdarstellungen anwesend und strukturieren den Nach-
weis von Zusammenhängen in historischen Arbeiten.“29 Der Unterschied zwischen
26
Peter Christian Ludz u. Hans-Dieter Rönsch, Theoretische Probleme empirischer Geschichtsforschung. In: Theodor Schieder
u. Kurt Gräubig (Hrsg.), Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft. Darmstadt 1977, S. 63; zum Stand der allgemeinen
Theoriediskussion in der deutschen Geschichtswissenschaft sei hier exemplarisch auf die vier vorangehenden Bände der Reihe
>Theorie der Geschichte< verwiesen. Zu den Leistungen und Funktionen vor allem sozialwissenschaftlicher Theorien in der
Geschichtswissenschaft vgl. jetzt Josef Meran, Theorien in der Geschichtswissenschaft. Die Diskussion über die Wissenschaft-
lichkeit der Geschichte. Göttingen 1985; vgl. auch Dieter Ruloff, Geschichtsforschung und Sozialwissenschaft. Eine verglei-
chende Untersuchung zur Wissenschafts- und Forschungskonzeption in Historie und Politologie. München 1984.
27
Wilhelm Windelband, Präludien, Aufsätze und Reden zur Einführung in die Philosophie. Bd. 2, 4. erw. Aufl. Tübingen 1911,
S. 145.
28
Bernhard Giesen u. Michael Schmid, Erklärungsprobleme in den Sozialwissenschaften. In: dies. (Hrsg.), Theorie, Handeln
und Geschichte. Hamburg 1975, S. 14.
29
Ebd., S. 11.
8Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 9 von 21
einer Geschichtsforschung mit theoretischem Anspruch und narrativ orientierter Ge-
schichtsschreibung besteht dann zunächst in der Explizitheit der Hypothesen und
Gesetzesaussagen. Wenn wir als eine heute weitgehend akzeptierte Forderung an
jede Art von Forschung unterstellen können, daß der Erkenntnisprozeß möglichst
lückenlos rekonstruierbar und damit kritisierbar bleiben muß (Intersubjektivität), ist
einer explizit theoretischen Geschichtsforschung sicherlich der Vorzug zu geben. Für
Intuition und Assoziation ist dann bei der eigentlichen wissenschaftlichen Beweisfüh-
rung, oder anders ausgedrückt: im Begründungszusammenhang, kein Platz.
Ein anderer Punkt, von dem aus gegen den Charakter der Geschichtsfor-
schung als theoretische Wissenschaft argumentiert wird, ist die Frage nach ihrem
eigentlichen Erkenntnisziel. In diesem Zusammenhang wird argumentiert, daß es die
Aufgabe der Geschichtsforschung sei, historische Sachverhalte zu verstehen, nicht
sie kausal zu erklären. Für die Geschichte wird damit der hermeneutische Erfah-
rungsmodus für verbindlich erklärt30. Ihre Aufgabe sei die Vermittlung von kulturellen
Inhalten und nicht die Formulierung von Gesetzesaussagen. Damit ist – unter verän-
derter Perspektive – erneut der Gegensatz zwischen idiographischer und nomologi-
scher Methode angesprochen, wie er von Windelband formuliert wurde. Hiergegen
läßt sich nun einwenden, daß auch für eine theorieorientierte Sozialforschung dieser
Gegensatz eigentlich nie die Bedeutung hatte, die ihm von manchen Wissenschafts-
theoretikern unterstellt wurde. Ein Beispiel hierfür ist Max Webers klassische Defini-
tion von Soziologie als einer Wissenschaft, „welche soziales Handeln deutend ver-
steht und dadurch in seinem Ablauf und in seinen Wirkungen ursächlich erklären
will“31. Auch in einer sich als Gesetzeswissenschaft verstehenden Soziologie kann
der Forscher nur dann Mitteilungen des Materials aufnehmen, wenn er das System
sprachlicher Zeichen, die Symbolsprache, in der diese Mitteilungen abgefaßt sind,
kennt. „Dabei spielt es, erkenntnistheoretisch gesehen, keine Rolle, ob diese Mittel-
barkeit direkt, durch unmittelbaren sozialen Kontakt (wie z. B. im Interview) erfolgt,
oder indirekt durch historische Dokumente.“32 Soziologie und Geschichte sind beide
an den hermeneutischen Erfahrungsmodus gebunden, ohne daß dies im Wider-
spruch zu ihrer Theorieorientierung stehen müßte. Oder anders ausgedrückt: die
Frage „wie etwas gewesen ist“ steht in einem unauflösbaren Zusammenhang mit der
Frage „warum etwas gewesen ist“.
Ein Argument, das vorzugsweise gegen eine theorieorientierte quantitative
Geschichtswissenschaft gerichtet wird, sind die Defekte und Überlieferungsstörun-
gen historischer Daten. Historische Daten sind „vorgefundene“ Daten, d. h. sie wur-
den im allgemeinen nicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten erhoben und
überliefert, und wenn Wissenschaftler in die zeitgenössische Datenproduktion invol-
viert waren, dann unter den Gesichtspunkten, die sie interessierten, und nicht im
Hinblick auf mögliche Forschungsinteressen späterer Generationen. Historische Da-
ten sind also Nebenprodukte wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Pro-
zesse. Weder ihre Produktion noch ihre Überlieferung unterliegen in der Regel einer
wissenschaftlichen Kontrolle. Eine Ausnahme bilden allenfalls retrospektive Inter-
views, gegen die allerdings schwerwiegende methodische Bedenken anderer Art
vorgetragen wurden. Angesichts dieser Probleme haben sich manche Beobachter
gefragt, ob Historische Sozialforschung jemals mehr sein kann als ein „verdünnter
Aufguß konkreter wissenschaftlicher Erfahrung, gewürzt mit einigen Prisen passen-
der Theorie und vermischt mit großen Anteilen von Intuition, Unterstellung und vor-
30
Peter Christian Ludz, Soziologie und Sozialgeschichte. Aspekte und Probleme. In: ders. (Hrsg.), Soziologie und Sozialge-
schichte. (Sonderheft 16 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie), Opladen 1972, S. 16.
31
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe, Tübingen 1972, S. 1.
32
Ludz, Aspekte, S. 16.
9Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 10 von 21
wissenschaftlichen Erfahrungen“33. Gegen diesen Einwand spricht jedoch, daß auch
eine gegenwartsbezogene Soziologie heute zunehmend Daten verwendet, auf deren
Entstehung sie keine oder nur sehr begrenzte Kontrolle ausüben kann. Hierunter fal-
len z.B. die sogenannten prozeß-produzierten Daten, unter denen man solche Daten
versteht, die als Aufzeichnungen öffentlicher und. privater Organisationen im Rah-
men ihrer Tätigkeit und nicht nur zum Zweck wissenschaftlicher Auswertung gesam-
melt wurden bzw. werden34. Gleiches gilt für die Dokumente und Texte, die die Da-
tenbasis der, computerunterstützten Inhaltsanalyse bilden35. Für diese Materialien
entwickelte und entwickelt die Empirische Sozialforschung systematische „Fehlerleh-
ren“, die eine Bewertung der Zuverlässigkeit, Gültigkeit und Reichweite dieser Daten
ermöglichen. Dieses Wissen vermag im Idealfall die mangelnde Kontrolle der For-
schung über Prozesse der Datenerhebung und -überlieferung zu kompensieren. Auf
der anderen Seite wächst die Skepsis der Sozialforschung auch gegenüber den Da-
ten, die von ihr selbst erhoben wurden, insbesondere den Umfragedaten. In der Kon-
sequenz greift heute auch die Empirische Sozialforschung zunehmend auf „vorge-
fundene“ Daten zurück, ohne daß dies zum Anlaß genommen wird, ihre Theorieori-
entierung aufzugeben. Grundsätzlich gilt, daß sich die Sozialwissenschaftler heute
zunehmend darüber im klaren sind, mit ihren Daten über soziale Sachverhalte nur
ein unscharfes Abbild sozialer Wirklichkeit liefern zu können. Das gilt auch für die
Daten, die von den Forschern selbst erhoben werden. Damit ist die Soziologie bes-
tenfalls in einer graduell, nicht aber in einer prinzipiell besseren Situation als die Ge-
schichtsforschung, die schon seit jeher ihre Quellen als unvollständig und defekt be-
trachtet. Man kann hier sogar noch weiter ausgreifen: Auch die Naturwissenschaften
sind letztlich in keiner prinzipiell besseren Lage als die Humanwissenschaften. Auch
hier weiß man, daß Meßvorgänge auf bestimmten Untersuchungsebenen die zu
messenden Phänomene beeinflussen. Ein Sachverhalt, der mit dem Begriff „Un-
schärferelation“ belegt wurde und einige Verwandtschaft zu dem Konzept aufweist,
das in den Sozialwissenschaften unter dem Etikett „Gültigkeit“ eingeführt ist.
3. Der Gang des Forschungsprozesses in der quantifizierenden Historischen
Sozialforschung
Nach all dem vorher Gesagten ist es nicht überraschend, daß der Gang einer quanti-
fizierenden Historischen Sozialforschung sich weitgehend an der in der Empirischen
Sozialforschung üblichen Vorgehensweise orientiert36. Abweichungen ergeben sich
jedoch aus der Besonderheit des Primärmaterials des Historischen Sozialforschers
und seinem gewöhnlich nicht unmittelbar biographisch, sondern kognitiv vermittelten
33
Jerome M. Clubb, The ‘New’ Quantitative History: Social Science or Old Wine in New Bottles?. In: ders. u. Erwin K. Scheuch
(Hrsg.), Historical Social Research. The Use of Historical and Process-Produced Data. Stuttgart 1980, S. 370f.
34
Wolfgang Bick u. Paul J. Müller, The Nature of Process-Produced DataTowards a Social Scientific Source Criticism. In:
Clubb u. Scheuch, Historical Social Research, S. 370ff.; umfassend jetzt: Wolfgang Bick u.a. (Hrsg.), Socialforschung und
Verwaltungsdaten. Stuttgart 1984.
35
Heinrich Best, Analysis of Content and Context of Historical Documents – The Case of Petitions to the Frankfurt National
Assembly 1848149. In: Clubb u. Scheuch, Historical Social Research, S. 244
36
Inzwischen liegt eine stattliche Anzahl solcher Einführungen vor, die mit unterschiedlichen Intentionen die Bereiche Theorie,
allgemeine Methodik, spezifische Forschungsmethoden und Anwendungspraxis in Forschung und Lehre entsprechend gewich-
ten, vgl. u. a.: Jürgen Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung. 12. Aufl. Stuttgart 1984; Peter Atteslander, Methoden
der empirischen Sozialforschung. 5.Aufl. Berlin 1985; Rolf Prim u. Heribert Tilmann, Grundlagen einer kritisch-rationalen Sozi-
alwissenschaft. 5. Aufl. Stuttgart/Hei-delberg 198;; Erwin Roth (Hrsg.), Sozialwissenschaftliche Methoden. München
1984; Franz Krompka, Sozialwissenschaftliche Methodologie. Paderborn 1984; Horst Kern, Empirische Sozialforschung. Opla-
den 1982; Jürgen Kriz, Methodenkritik empirischer Sozialforschung. Stuttgart 1981; Helmut Kromrey, Empirische Sozialfor-
schung. Opladen 1980. – Soweit sich in der Folge Aussagen auf die Methoden der empirischen Sozialforschung beziehen, sei
pauschal auf die vorgenannte Literatur verwiesen.
10Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 11 von 21
Bezug zur Epoche, über die er arbeitet. Die Recherche nach Aussagekraft und Über-
lieferungszustand der Quellen hat eine noch größere Bedeutung als in der Empiri-
schen Sozialforschung, die über standardisierte – wenn auch sicherlich nicht voll-
kommene – Erhebungsinstrumente verfügt. Während der Empirische Sozialforscher
Inspirationen zur Bildung von Theorien und Maßstäbe zur Bewertung von Befunden
auch aus seinem Alltagsverständnis bezieht, muß der Historische Sozialforscher sol-
che intensive Kenntnis historischer Gesellschaften erst mühsam erwerben. Techno-
logie kann diese nicht ersetzen, denn einen Theorie- oder Interpretationengenerator
hat auch das elektronische Zeitalter nicht zur Verfügung. Wenn in der Folge kurz die
Hauptschritte einer Forschungsstrategie (vgl. dazu die Übersicht im Anhang und das
Diagramm)37, die einer deduktivistischen Forschungslogik folgt, beschrieben werden,
dann ist dies demnach als die modellhafte Darstellung einer Vorgehensweise zu ver-
stehen, an der sich die quantifizierende Forschung prinzipiell ausrichtet, in der aber
induktive „Rückkoppelungen“ durchaus üblich sind und die mit hermeneutischen Ver-
fahren verknüpft werden kann.
Den Ausgangspunkt der Strategie einer Historischen Sozialforschung bildet
die Absicht, eine „empirische Theorie“ zu formulieren; dies heißt zunächst nichts an-
deres, als daß der Forscher seine Hypothesen (Fragestellungen) sammelt und sie
möglichst systematisch und logisch widerspruchsfrei miteinander verknüpft. Theo-
rien/Hypothesen müssen insofern einen Bezug zur Realität besitzen, als sie an der
Erfahrung scheitern können. Wie wir oben ausführlich begründet haben, muß die
Bildung von Theorien/Hypothesen zu Beginn der Forschung erfolgen, erst danach
kann über den notwendigen Einsatz von Methoden und Instrumenten der Forschung
entschieden werden. Diese Theorie/Hypothesen-Bildung unterliegt den strengen Re-
geln der Aussagen- und Quantorenlogik, denn nur logisch konsistente Theorien und
Hypothesen können in der Folge auch zu gültigen Forschungsergebnissen führen.
37
Die in der Übersicht genannten Elemente entsprechen weitestgehend den Lerninhalten des von uns konzipierten Basiscurri-
culums: Heinrich Best u. Wilhelm H. Schröder, Basiscurriculum für eine quantitative historische Sozialforschung. In: Historical
Social Research/Historische Sozialforschung 17 (1981), S.3-50.
11Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 12 von 21
In einem zweiten Schritt werden wesentliche Voraussetzungen für die inter-
subjektive Überprüfbarkeit von Aussagen über Realität, d.h. über den zu untersu-
chenden Objektbereich, durch eine präzise Begriffsbildung und durch eine angemes-
sene Operationalisierung dieser Begriffe geschaffen. Die in den theoretischen Aus-
sagen verwandten Begriffe müssen vor der empirischen Überprüfung eindeutig defi-
niert werden. Jedem Begriff wird eine Reihe von Merkmalen mit Hilfe semantischer
Regeln zugeordnet; Merkmale sind hierbei beobachtbare Ereignisse und/oder Wör-
ter, deren Bedeutung bekannt ist. Um einen Begriff definieren zu können, ist es oft
unerläßlich, den Begriff einer systematischen Bedeutungsanalyse bzw. die dem Beg-
riff zugeschriebenen Merkmale einer empirischen Analyse zu unterziehen. Üblicher-
weise werden in der empirischen Forschung Nominaldefinitionen bevorzugt, da sie
sich besonders gut zur Ordnung eines Objektbereichs eignen; bei der Nominaldefi-
nition wird der zu definierende Begriff (Definiendum) ersetzt durch einen schon be-
kannten Begriff (Definiens).
Die Operationalisierung ist der entscheidende Teilschritt im Gang der Histori-
schen Sozialforschung; hier erfolgt die Verknüpfung von theoretischer und empiri-
scher Ebene. Von der Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Operationalisierung hängt
entscheidend die Güte der wissenschaftlichen Beweisführung ab. Ziel der Operatio-
nalisierung ist die Verknüpfung der zuvor präzise definierten Begriffe für die empiri-
sche Untersuchung mit messbaren Daten. Operationale Definitionen legen diejeni-
gen Forschungsoperatoren fest, anhand derer sich der Forscher entscheiden kann,
ob der durch den Begriff beschriebene Sachverhalt vorliegt oder nicht. Die konkrete
Vorgehensweise bei der Operationalisierung ist abhängig vom empirischen Bezug
des zu operationalisierenden Begriffs. Bei Begriffen mit direktem Bezug lassen sich
die durch den Begriff bezeichneten Sachverhalte unmittelbar beobachten bzw. wahr-
nehmen, so daß die Forschungsoperationen (z. B. die Angabe, was, wo, wann und
wie gezählt werden soll) direkt festgelegt werden können. Bei Begriffen mit indirek-
tem empirischen Bezug müssen zunächst Indikatoren gebildet werden. Indikatoren
sollen durch empirisch feststellbare Sachverhalte auf das Vorhandensein der nicht
unmittelbar beobachtbaren, mit dem Begriff bezeichneten Sachverhalte verweisen.
Diese Indikatoren werden dann durch die Angabe der notwendigen Forschungsope-
rationen ebenfalls operationalisiert. Die Gültigkeit der Indikatorenbildung hängt ent-
scheidend davon ab, wie genau die durch den Indikator beobachtbaren Sachverhalte
die mit dem Begriff bezeichneten Sachverhalte abbilden: Die Indikatorenbildung ist
daher anhand einer sorgfältigen Indikatorenanalyse hinreichend zu begründen.
In einem dritten Schritt gilt es vor allem, die zur Untersuchung geeigneten (his-
torischen) Daten zu bestimmen und gegebenenfalls Auswahlverfahren und Auswahl-
techniken festzulegen. Bei diesem Forschungsschritt finden sowohl genuine Ver-
fahren der Geschichtswissenschaft (vor allem die Quellenkritik) als auch der Empiri-
schen Sozialforschung (Auswahlverfahren) konkrete und sich wechselseitig ergän-
zende Anwendung38. Die herkömmliche Vorgehensweise des Historikers läßt sich
pointiert folgendermaßen zusammenfassen: Er legt für die Untersuchung einen histo-
rischen Problembereich fest, bestimmt den für seine Fragestellung geeigneten Quel-
lentyp, reflektiert die tatsächliche Quellenlage und bearbeitet nach Maßgabe der his-
torischen Quellenkritik (zumindest grundsätzlich) alle verfügbaren Quellen. Die bei
dieser Vorgehensweise meist implizite Annahme ist bekannt: „Irgendwie“ lassen sich
Quellenbasis und historische Realität zur Deckung bringen, die Probleme von Reprä-
sentativität und Selektivität von Quellen werden gewöhnlich am Rande in kasuistisch-
38
Vgl. Harald Rohlinger, Quellen als Auswahl- Auswahl aus Quellen. In: Historical Social Research/Historische Sozialforschung
24 (1982)2 S. 34-62; Paul J. Müller, Improving Source Criticism to Cope witb New Types of Sources and Old Ones Better. In:
ebd., S. 25-33; anwendungsbezogen: Erdmann Weyrauch, Datenverarbeitung als Quellenkritik? In: Paul I. Müller (Hrsg.), Die
Analyse prozeß produzierter Daten. Stuttgart 1977, S. 141-198.
12Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 13 von 21
deskriptiver, nicht aber in statistischer Form thematisiert. Auch eine virtuose Hand-
habung der Quellenkritik reicht jedoch für die Quellenbearbeitung in der Historischen
Sozialforschung nicht aus. Deren Quellenbearbeitung wird durch eine doppelte Prob-
lemstellung gekennzeichnet: Einerseits liegen historische Quellen oft unvollständig,
d. h. nur in Auswahl vor, andererseits muß oft aus den vorliegenden historischen
Quellen eine Auswahl getroffen werden.
Liegen historische Quellen im Hinblick auf die zu untersuchenden Fragestel-
lungen unvollständig und/oder selektiv vor, hängt die Gültigkeit der weiteren For-
schung davon ab, daß sich der Historische Sozialforscher Rechenschaft darüber ab-
legt, welche Art von „Auswahl“ aus dem nicht (mehr) verfügbaren „vollständigen“
Quellenbestand der vorhandene Quellenbestand darstellt oder anders ausgedrückt:
welche Teilmenge von Objekten aus der Gesamtmenge von Objekten (Grundge-
samtheit), auf die sich die Aussagen der Untersuchung beziehen, wird durch die
Quellen abgebildet? Da aber über die historische Grundgesamtheit oft keine hinrei-
chenden und zudem keine quantifizierbaren Informationen vorliegen, muß der Histo-
rische Sozialforscher aus den verfügbaren Daten über die Grundgesamtheit und
nach Maßgabe der zuvor formulierten empirischen Theorie die Repräsentanz der
durch die historischen Quellen abgebildeten Teilmenge beurteilen. Der weiteren Sy-
stematisierung und der erhöhten (auch statistisch verwertbaren) Exaktheit solcher
Urteile gilt seit Jahren die besondere Aufmerksamkeit der Methodenentwicklung in-
nerhalb der Historischen Sozialforschung.
Beim zweiten Problem, der Anwendung von Auswahlverfahren auf historische
Quellen, kann erneut – wenn auch nicht immer zur vollen Zufriedenheit des Histori-
schen Sozialforschers – auf das entsprechende Methodenangebot der Empirischen
Sozialforschung zurückgegriffen werden39. Liegen historische Quellenbestände voll-
ständig vor oder läßt sich bei unvollständigen Beständen die Grundgesamtheit hin-
reichend exakt abschätzen, dann ist der Einsatz von Auswahlverfahren sinnvoll und
bei massenhaft vorliegenden Quellen meist auch notwendig. Inwieweit der Histori-
sche Sozialforscher bei der Bearbeitung von Quellen Auswahlkriterien benutzt, ist in
erster Linie eine Frage der Arbeits- und Ressourcenökonomie bzw. hängt von der
gestellten Forschungsaufgabe ab. Entgegen dem Vollständigkeitsstreben mancher
Historiker ist es für die Gültigkeit empirischer Forschung nicht notwendig und oft
auch nicht sinnvoll, den gesamten verfügbaren Quellenbestand zu bearbeiten (mit
allen Konsequenzen für die Höhe des zu erbringenden Forschungsaufwands), wenn
der Quellenbestand die Voraussetzungen für die Anwendung von Auswahlverfahren
erfüllt.
In einem weiteren Schritt werden nun die Merkmale der Untersuchungsobjekte
(Analyseeinheiten) in meßbare Variablen transformiert. Die Variablenbildung ist ein
Resultat der Operationalisierung der präzise definierten Begriffe; Variablen sind – in
diesem Zusammenhang – begrifflich definierte Merkmale (Eigenschaften) von Objek-
ten, die mehrere Ausprägungen (Werte) aufweisen. Unter Messen versteht man die
Zuordnung einer Menge von Zahlen oder Symbolen zu den Ausprägungen einer Va-
riablen. Diese Zuordnung muß systematisch, d. h. für alle Objekte gleich und nach
gleichbleibenden Zuordnungsregeln durchgeführt werden. Sie folgt dem Kriterium der
Eindeutigkeit (sie ist eindeutig, wenn jedem Objekt die Merkmalsausprägung eines
Merkmals zugeschrieben werden kann), Ausschließlichkeit (sie ist ausschließlich,
39
Vgl. u. a.: Ferdinand Böltken, Auswahlverfahren. Stuttgart 1976; Gabriele Kaplitza, Die Stichprobe. In: Kurt Holm (Hrsg.), Die
Befragung. Bd. 1, München 1975, S. 136-186; Erwin K. Scheuch, Auswahlverfahren in der Sozialforschung. In: Rene König
(Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung. Bd. 3 a, Stuttgart 1974, S. 1-96; Manfred Sturm u. Th. Vanja, Planung und
Durchführung von Zufallstichproben. In: Jan van Koolwijk u. Maria WiekenMayser (Hrsg.), Techniken der empirischen Sozialfor-
schung. Bd. 6, München 1974, S. 40-80; Jan van Koolwijk, Das Quotenverfahren. Paradigma sozialwissenschaftlicher Aus-
wahlpraxis. In: ebd., S. 81-99; Roger S. Schofield, Sampling in Historical Research. In: E. A. Wrigley (Hrsg.), Nineteenth-
Century Society. Cambridge 1972.
13Best / Schröder: Quantitative historische Sozialforschung: Seite 14 von 21
wenn nur eine, also nicht mehrere Ausprägungen eines Merkmals zutreffen) und
Vollständigkeit (sie ist vollständig, wenn die beiden vorgenannten Bedingungen für
alle Objekte erfüllt sind, also keine Objekte ohne eine Merkmalsausprägung sind).
Sind diese Bedingungen vollständig erfüllt, spricht man von einer Klassifikation, sind
sie nur unvollständig erfüllt, von einer Typologie. In diesem Sinne läßt sich eine Vari-
able auch als eine Menge von Werten (Ausprägungen), die eine Klassifikation (oder
gegebenenfalls eine Typologie) bilden, definieren.
Die Zuordnung soll außerdem in der Weise erfolgen, daß die Relationen unter
den Zahlenwerten den Relationen unter den Objekten entsprechen. Die Exaktheit
des Messens hängt nicht nur von der systematischen Zuordnung, sondern auch vom
Meßniveau bzw. Skalenniveau (Skala = Achse mit zugeordneten Ausprägungen) ei-
ner Variablen ab. je nach Meßniveau einer Skala sind unterschiedliche statistische
Verfahren zulässig. Vier relevante Skalenniveaus lassen sich abgrenzen:
- Nominalskala (Qualitative Merkmale): Eine Menge metrisch nicht geordneter
Ausprägungen, die sich untereinander nur logisch ausschließen und die den
jeweiligen Objekten nach dem Kriterium des Besitzes oder Nichtbesitzes
(Gleichheit/ Ungleichheit) einer Variablenausprägung zugeordnet werden kön-
nen.
- Ordinalskala (Rangmerkmale): Eine Menge metrisch nicht geordneter Ausprä-
gungen, deren Rangordnung untereinander festgelegt ist und die den jeweiligen
Objekten nach dem Kriterium größer oder kleiner (nicht jedoch die exakte Grö-
ße der Abstände zwischen zwei Ausprägungen) einer Variablenausprägung
zugeordnet werden können.
- Intervallskala (Metrische Merkmale): Eine Menge metrisch geordneter Ausprä-
gungen, wobei der Abstand (Unterschied) zwischen den Werten (Ausprägun-
gen) gleich groß ist (Kriterium: Gleichheit der Intervalle).
- Ratioskala (Metrische Merkmale): Eine Menge metrisch geordneter Ausprä-
gungen, wobei die Verhältnisse der Werte (Ausprägungen) gleich sind und der
Wert Null (absoluter Nullpunkt) einen empirischen Sinn hat.
Jede höhere Skala (aufsteigend von der Nominal- zur Ratioskala) schließt die
niedrigere ein. Messungen in der Historischen Sozialforschung erfolgen sehr oft nur
auf dem Nominalskalenniveau, so daß lange Zeit die statistische Auswertung solcher
Daten überwiegend auf einfache (deskriptive) statistische Verfahren wie Randvertei-
lungen und Kreuztabellen beschränkt blieb. Erst in den letzten Jahren wurden auch
für die Analyse nominalskalierter Variablen anspruchsvollere statistische Verfahren
entwickelt, die – über die Analyse zweidimensionaler Zusammenhänge durch Asso-
ziationsmaße hinaus – auch die Analyse mehrdimensionaler Zusammenhänge z. B.
anhand von loglinearen Modellen und die Analyse von Anteilswerten mit linearen
Modellen und Logit-Modellen erlauben40.
Im Zusammenhang mit nominalskalierten Variablen, auch qualitative Variablen
genannt, taucht in der Diskussion innerhalb der Geschichtswissenschaft oft eine
mißverständliche Unterscheidung nach „qualitativen“ und „quantitativen“ Methoden
auf. Häufig wird Quantifizierung nur in einem engeren Sinn verstanden, nämlich als
die Anwendung quantitativer Methoden auf metrische Variablen. Diese engere Auf-
fassung entspricht z. B. der herkömmlichen Quantifizierungspraxis innerhalb der
deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, wo schon in quantitativer Form vorlie-
gendes Quellenmaterial bearbeitet und ausgewertet wird. Gegenüber diesem enge-
ren Sinn erstreckt sich in der Historischen Sozialforschung – wie oben erläutert –
Quantifizierung nicht nur auf metrische, sondern auch auf nichtmetrische Variablen,
40
Zum Einstieg. das von Gerhard Arminger verfaßte Kap. Zusammenhänge zwischen nichtmetrischen Variablen. In: Konrad H.
Jarausch u.a., Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft. Eine Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung und
Statistik. Darmstadt 1985, S. 162-181 (mit weiterführender Literatur).
14Sie können auch lesen