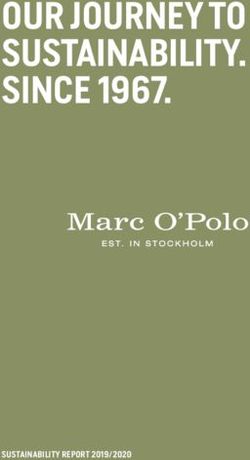TRAININGSKONZEPTE UND ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR DIE BETRIEBSFÜHRUNG VON OFFSHORE WINDPARKS - MEDIA SUUB BREMEN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Abschlussbericht Trainingskonzepte und Anwendungsbeispiele für die Betriebsführung von Offshore‐ Windparks Berichtsserie Werkzeuge zur Unterstützung des Betriebs von Offshore‐Windparks Forschungsprojekt: KrOW! Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore Windparks
Autoren: Lena Milchert, Hochschule Bremen Saskia Greiner, Hochschule Bremen Silke Eckardt, Hochschule Bremen Nane Denker, EWE Offshore Service & Solutions GmbH Roland Rogalski, EWE Offshore Service & Solutions GmbH Der Abschlussbericht „Trainingskonzepte und Anwendungsbeispiele für die Betriebsführung von Offshore‐Windparks“ ist Teil der Berichtsserie „Werkzeuge zur Unterstützung des Betriebs von Offshore‐Windparks“ erschienen in: Technische Informationsbibliothek (TIB) Welfengarten 1B 30167 Hannover des Forschungsprojekts „KrOW! – Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore Windparks“ (gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, Förderkennzeichen 0325728). Die Verantwortung für den Inhalt dieses Berichts liegt bei den Autoren. November 2018
Einzelberichte der Berichtsserie „Werkzeuge zur Unterstützung
des Betriebs von Offshore‐Windparks“:
„Heuristik und Simulation als Entscheidungsunterstützung bei der operativen Einsatzplanung für
Offshore‐Windparks“
von Philip Joschko, Johannes Göbel und Stanislav Rockel
„Entscheidungshilfe zur strategischen Planung der Instandhaltung“
von Paul Grazin und Torsten Renz
„Umwelt‐ und Qualitätsmanagement in der Betriebsführung von Offshore‐Windparks“
von Vanessa Spielmann, Mandy Ebojie, Silke Eckardt, Stanislav Rockel, Nane Denker, Roland
Rogalski und Ewald Heyen
„Risikoanalyse zur Aufdeckung von Prozessschwachstellen“
von Torsten Renz und Vanessa Spielmann
„Trainingskonzepte und Anwendungsbeispiele für die Betriebsführung von Offshore‐Windparks“
von Lena Milchert, Saskia Greiner, Silke Eckardt, Nane Denker und Roland RogalskiKrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Einleitung KrOW! ............................................................................................................. 1
1.1 Forschungsprojekt KrOW! ‐ Rahmeninformationen .................................................................. 1
1.2 Motivation .................................................................................................................................. 1
1.3 Zielsetzung .................................................................................................................................. 2
1.4 Vorstellung der Verbundpartner ................................................................................................ 3
1.5 Projektstruktur ........................................................................................................................... 4
1.6 Berichtserie Werkzeugkiste mit „Werkzeugen zur Unterstützung eines kosten‐ und
risikogesteuerten Betriebs von Offshore‐Windparks“ des Forschungsprojekts KrOW! ............ 5
2 Aus‐ und Weiterbildung in der Betriebsführung von OWP ................................................................ 9
2.1 Status Quo .................................................................................................................................. 9
2.2 Leitfaden und erste Konzepte für die Entwicklung von Trainingsmodulen ............................. 10
3 Die berufliche Weiterbildung ........................................................................................................... 11
3.1 Lehren und Lernen im beruflichen Umfeld der Betriebsführung von Offshore‐Windparks .... 12
3.2 E‐Learning ................................................................................................................................. 12
4 Vorgehen zur Entwicklung eines Trainingskonzeptes ...................................................................... 15
5 Aufgabenprofile und Trainingsbedarfe in der technischen Betriebsführung von OWPs................. 17
5.1 Charakterisierung der OWP‐Betriebsführung .......................................................................... 17
5.1.1 Charakteristische Arbeitsprozesse im OWP‐Betrieb ........................................................... 17
5.1.2 Operative Einheiten in der OWP‐Betriebsführung .............................................................. 18
5.2 Aufgaben‐ und Kompetenzprofile in der technischen Betriebsführung .................................. 20
5.2.1 Kompetenzprofile für das Einsatzmanagement .................................................................. 22
5.2.2 Berufliche Handlungskompetenz im Einsatzmanagement ................................................. 24
5.3 Trainingsbedarfe....................................................................................................................... 25
5.4 Identifikation und Einordnung der Lernziele in Taxonomiestufen ........................................... 27
6 Trainingskonzepte ‐ Umsetzungsbeispiele ....................................................................................... 30
6.1 Trainingsmodul 1 (TM1): Einführung in die Abläufe des Betriebs von OWPs .......................... 32
6.1.1 Didaktisches Konzept .......................................................................................................... 32
6.1.2 Trainingsaufgaben – Theoretischer Teil .............................................................................. 34
6.1.3 Lehr‐/Lerneinheit zu Prozessen im Offshore‐Windpark TM 1.1 ......................................... 34
6.1.4 Lehr‐/Lerneinheit zu den Arbeitsprozessen des Einsatzmanagements TM 1.2 .................. 35
6.1.5 Trainingsaufgaben – Praktischer Teil .................................................................................. 37
IKrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
6.1.6 Übungsaufgaben „Situationen des Einsatzmanagements eines Offshore‐Windparks“...... 38
6.1.7 Planspiel „Koordination und Durchführung eines Instandsetzungseinsatzes an einer
OWEA“ ................................................................................................................................. 38
6.2 Trainingsmodul 2 (TM2): Operative Einsatzplanung mit Hilfe eines Schedulingtools ............. 40
6.3 Trainingsmodul 3 (TM3): Einführung in die Identifikation von Kennzahlen für die
Betriebsführung und ihre Berichtserstattung .......................................................................... 42
6.3.1 Didaktisches Konzept .......................................................................................................... 43
6.3.2 Trainingsaufgaben – Theoretischer Teil .............................................................................. 45
6.3.3 Trainingsaufgaben‐Praktischer Teil ..................................................................................... 46
7 Evaluation ......................................................................................................................................... 47
7.1 Allgemeine Hinweise ................................................................................................................ 47
7.2 Evaluationsergebnisse .............................................................................................................. 48
8 Zusammenfassung und Ausblick ...................................................................................................... 49
9 Quellenverzeichnis ........................................................................................................................... 51
10 Anhang ................................................................................................................................................ i
IIKrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zusammenarbeit und Teilprojekte (TP) der Verbundpartner ............................................ 4
Abbildung 2: Architektur eines Lernmanagementsystems nach SCHULMEISTER (e‐teaching.org
redaktion 2013) ................................................................................................................ 13
Abbildung 3: Ablaufdiagramm "Entwicklung des Trainingskonzepts" .................................................. 16
Abbildung 4: Prozesse der Betriebsführung von OWPs in Anlehnung an (Greiner et al. 2015) ........... 18
Abbildung 5: Operative Einheiten der Betriebsführung von Offshore‐Windparks (in Anlehnung an
Experteninterviews OWP‐betriebsführender Gesellschaften (im KrOW!‐Projekt
erarbeitet))........................................................................................................................ 19
Abbildung 6: Verknüpfung der operativen Einheiten (Aufzählung in den Kästchen) der technischen
Betriebsführung mit den Betriebsprozessen .................................................................... 20
Abbildung 7: Einordnung des Trainings für die Betriebsführung von Offshore‐Windparks ................. 27
Abbildung 8: Darstellung des Trainingsmoduls TM 1.2 in ILIAS Umgebung ......................................... 31
Abbildung 9: Beispiel für eine Übungsaufgabe in TM 1.1 ..................................................................... 35
Abbildung 10: Umsetzungsbeispiel der Prozessbeschreibung der Personalqualifikationsüberwachung
(modelliert mit IYOPRO, Intellivate GmbH 2018) ............................................................. 36
Abbildung 11: Umsetzungsbeispiel der Darstellung der HSE‐Qualifikationen offshore‐gehender
Techniker .......................................................................................................................... 36
Abbildung 12: Umsetzungsbeispiel der Organisation der technischen Betriebsführung in der E‐
Learning‐Umgebung ......................................................................................................... 37
Abbildung 13: Der im Projekt KrOW! für das Planspiel entwickelte Arbeitsplatz der Leitwarte .......... 40
IIIKrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Allgemeine Aufgabenprofile der operativen Einheiten in der technischen Betriebsführung
.................................................................................................................................................. 21
Tabelle 2: Berufliche Handlungskompetenz für den Arbeitsprozess „Anlagenüberwachung“............. 24
Tabelle 3: Trainingsbedarfe des Personals im Einsatzmanagement ..................................................... 25
Tabelle 4: Lernzieltaxonomie nach Anderson und Krathwohl (Riemer 2009, Kompetenzteam
Hochschuldidaktik 2015) .......................................................................................................... 28
Tabelle 5: Übersicht der Trainingsmodule und deren Inhalte .............................................................. 30
Tabelle 6: Lernzieltaxonomie nach Anderson und Krathwohl (Riemer 2009; Kompetenzteam
Hochschuldidaktik 2015) .......................................................................................................... 33
Tabelle 7: Zuordnung der Methoden zu den Sozialformen des Unterrichts (in Anl. an Meyer 2014 ;
Riemer 2016) ............................................................................................................................ 34
Tabelle 8: Lernzieltaxonomie nach Anderson und Krathwohl (Riemer 2009, Kompetenzteam
Hochschuldidaktik 2015) .......................................................................................................... 41
Tabelle 9: Zuordnung der Methoden zu den Sozialformen des Unterrichts (in Anl. an Meyer 2014,
Riemer 2016) ............................................................................................................................ 42
Tabelle 10: Lernzieltaxonomie nach Anderson und Krathwohl (Riemer 2009, Kompetenzteam
Hochschuldidaktik 2015) .......................................................................................................... 43
Tabelle 11: Zuordnung der Methoden zu den Sozialformen des Unterrichts (in Anl. an Meyer 2014,
Riemer 2016) ............................................................................................................................ 44
IVKrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Abkürzungsverzeichnis
AP Arbeitspakete
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BOSIET Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training
BTC BTC Business Technology Consulting AG
CTV Crew Transfer Vessel
EWE OSS EWE Offshore Service & Solutions GmbH
GOWOG German Offshore Wind Operation Guide
HSB Hochschule Bremen
HSE Health, Safety and Environment
HUET Helicopter Underwater Escape Training
IZP IZP Dresden mbH
MTTR Mean Time to Repair
LMS Lernmanagementsoftware
OTS Operating Training System
OWEA Offshore‐Windenergieanlagen
OWP Offshore‐Windpark
TM Trainingsmodul
TP Teilprojekt
Uni HH Universität Hamburg
WFMS Windfarmmanagementsystem
WoWED Women of Wind Energy Deutschland Bremerhaven/Bremen
VKrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
1 ALLGEMEINE EINLEITUNG KROW!
1.1 FORSCHUNGSPROJEKT KROW! ‐ RAHMENINFORMATIONEN
Das Forschungsprojekt KrOW! Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore Windparks ist ein
Verbundprojekt der Hochschule Bremen, EWE Erneuerbare Energien GmbH, BTC Business Technolo‐
gy Consulting AG, IZP Dresden mbH und Universität Hamburg. Das Projekt wurde durch das Bundes‐
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im 6. Energieforschungsprogramm der Bundesregie‐
rung gefördert; Projektlaufzeit vom 01.12.2014 bis 31.05.2018. Es wird unter dem Förderkennzei‐
chen 0325728 geführt.
1.2 MOTIVATION
Etwa dreißig Prozent der Stromgestehungskosten von Offshore‐Windparks (OWP) entfallen auf die
Betriebsphase (Berger 2013). Eine Senkung der Kosten erfordert effizientere Abläufe unter wech‐
selnden Randbedingungen, bspw. Wetter, sowie Verfügbarkeiten von Mensch und Material (Hobohm
et al. 2013). Der Windparkbetrieb erfolgt in einem vielschichtigen Geflecht aus technischen, logisti‐
schen und organisatorischen Prozessen. Betriebliche Entscheidungen müssen unter gleichzeitiger
Betrachtung der beiden Kriterien Kosten und Risiko getroffen werden. Nach Aussagen von Betreibern
sind an die Betriebsbedingungen adaptierbare sowie nach den Maßstäben Kosten und Risiken ge‐
steuerte Abläufe eher die Ausnahme.
Um diese Abhängigkeiten bei Entscheidungen im laufenden Betrieb zu berücksichtigen und das Effizi‐
enzpotenzial unter den ständig wechselnden Bedingungen ausschöpfen zu können, sind die unter‐
schiedlichen Leistungselemente, wie Techniken, Prozesse, Aktivitäten, Schnittstellen, Akteure, Res‐
sourcen, etc. systematisch und dynamisch miteinander zu verknüpfen.
In anderen klassischen Industriezweigen finden Instrumente zur Erhöhung der Flexibilität von Ge‐
schäftsprozessen durch Vernetzung, dezentrale Steuerungsmechanismen sowie intelligente Daten‐
aufnahme und Integration inzwischen Anwendung (moderne industrie 2018). Dies muss der Offsho‐
re‐Branche gleichermaßen gelingen, um die aktuell noch hohen Betriebskosten kontrollieren und
senken zu können.
Die operative Betriebsführung eines OWP ist maßgeblich für die Koordination und Durchführung
dieser Prozesse unter Nutzung aller verfügbaren Daten und Informationen verantwortlich. Projekter‐
gebnisse aus dem Forschungsvorhaben SystOp Offshore Wind ‐ Optimierung des Leistungssystems
Offshore‐Windpark1 haben gezeigt, dass das Know‐how der Betriebsführung größtenteils auf der
Erfahrung einzelner Personen beruht. Entscheidungen über die Durchführung der Einsatzplanung
werden spontan und personenabhängig getroffen. Insbesondere Instandhaltungsprozesse bergen ein
erhebliches Optimierungspotenzial durch strukturierte Arbeitsabläufe (Greiner et al. 2015).
1
Gefördert durch das BMWi, Förderkennzeichen 0325283
1KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Bis 2021 benötigt die Branche Tausende zusätzliche Fachkräfte (Berger 2013). Bei der Deckung von
Personalbedarfen ist in der OWP‐Branche davon auszugehen, dass nur in geringem Umfang erfahre‐
nes Personal aus dem Bereich der Offshore‐Windenergienutzung zur Verfügung steht. Für eine
schnellere Einarbeitung bzw. das Training von Sondersituationen fehlen Trainingssimulatoren, wie sie
in anderen Bereichen mit hoher Komplexität und hohen Sicherheitsanforderungen wie z.B. der Schiff‐
fahrt oder der Kernenergienutzung erfolgreich eingesetzt werden.
Instandsetzungsaktivitäten für einzelne OWP‐Komponenten können nach unterschiedlichen Strate‐
gien festgelegt werden: Instandsetzung ausschließlich nach Schadenseintritt, Instandsetzung bei Er‐
reichen einer bestimmten Betriebszeit respektive kalendarischen Zeitpunktes sowie Instandsetzung
bei Erreichen eines Grenzwertes eines beobachteten Zustandes. Hierbei gilt es die zu erwartenden
resultierenden Kosten, Fehlerhäufigkeiten und Verfügbarkeiten für die jeweiligen Alternativen quan‐
tifizieren zu können, wobei auf komponentenspezifische Merkmale wie Zuverlässigkeit und Instand‐
haltbarkeit, Kosten und Dauer je Instandhaltungsaktivität und systemspezifische Merkmale wie Aus‐
fallfolgen eingegangen werden muss. Außerdem ist mit der Verknüpfung von Einzelprozessen zu
Prozessfolgen (z.B. gleichzeitige Ausführung von Inspektions‐ und Instandsetzungstätigkeiten) ein
hohes Einsparpotenzial zu erwarten. Weiterhin stellt dieses Wissen die Basis für mögliche betreiber‐
übergreifende Instandhaltungskonzepte dar und liefert hiermit eine wesentliche Unterstützung für
die strategische Betriebsführung (Hobohm et al. 2013).
1.3 ZIELSETZUNG
Ziel des Projektvorhabens KrOW! ist es, die Prozessorganisation der strategischen und operativen
Betriebsführung von OWPs durch Entscheidungsunterstützungen zu verbessern.
Ein wesentliches Teilziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines Werkzeuges zur Unter‐
stützung des Betriebspersonals. Über eine Reporting‐Funktion werden einerseits realistische und
zuverlässige Aussagen über den Zustand des aktuellen Betriebs angeboten und andererseits Hinwei‐
se zur strategischen Ausrichtung des Betriebsführungskonzeptes gegeben. Mit Hilfe von Performanz‐
kriterien werden Instandhaltungsstrategien und Prozesse bewertet. Der Betriebsführung werden
damit Wahlmöglichkeiten offeriert, so dass kosten‐ und risikooptimierte Entscheidungen erleichtert
getroffen werden können.
Wesentliche Koordinierungsaufgaben im Vorfeld der Einsatzplanung werden mit dem Werkzeug ge‐
prüft sowie standardisiert und festgelegt. Die Anwendung zieht damit einen geringeren Koordinati‐
onsaufwand und somit eine Einsparung an Ressourcen nach sich.
Durch die Aufnahme, Modellierung und Parametrierung der Betriebsprozesse werden vorhandene
Erfahrungen dokumentiert und transparent dargestellt. Damit wird der interne und etwaige externe
Wissenstransfer sichergestellt. Für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter_innen aber auch für die Pla‐
nung und Durchführung von Einsätzen ist dies von unschätzbarem Wert.
Mit der Anbindung an Qualitäts‐ und Umweltmanagementsysteme sowie der Konzeption eines Trai‐
ningswerkzeugs wird die Grundlage zur Steigerung der Prozessqualität, der Wirtschaftlichkeit, der
Umweltverträglichkeit sowie Kunden‐ und Mitarbeiterzufriedenheit des OWP‐Betriebes geschaffen.
2KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
1.4 VORSTELLUNG DER VERBUNDPARTNER
Die Projektpartner decken mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten den gesamten Bereich von
der Datenerhebung über den Betrieb und seine Prozesse bis hin zur Erstellung von IT‐Lösungen für
den Windparkbetrieb ab. Durch die Kombination der verschiedenen Expertisen der Partner erfolgt
die Umsetzung der Ziele des Forschungsprojekts KrOW!.
Das Forschungsprojekt wurde von der Hochschule Bremen koordiniert. Die Hochschule verfügt über
umfangreiche Erfahrung in der Darstellung, Analyse und Bewertung von Prozessen komplexer Syste‐
me. Dies wurde bereits für die Optimierung des Betriebs und der Instandhaltung von OWP im Rah‐
men des Forschungsprojekts SystOp Offshore Wind ‐ Optimierung des Leistungssystems Offshore‐
Windpark angewendet.
Die EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH ist das Kompetenzzentrum im EWE‐Konzern für das Ge‐
schäftsfeld Erneuerbare Energien. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Anlagen zur regenerati‐
ven Stromerzeugung aus Wind, Biomasse, Photovoltaik und Wasserkraft in Norddeutschland. Der
Fokus der Geschäftstätigkeit liegt in den Bereichen Wind Onshore und Offshore sowie Biomasse. Die
EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH ist eine 100‐prozentige Tochter der EWE AG.
Bereits in den 1980er Jahren gehörte EWE zu den ersten kommerziellen Windkraft‐Betreibern welt‐
weit und ist heute federführend an Deutschlands erstem Offshore‐Windpark alpha ventus beteiligt.
Die EWE Offshore Service & Solutions GmbH (OSS) bietet fundiertes Fachwissen und langjährige
Erfahrung zu den Themen Planung, Realisierung und Betrieb von Offshore‐Windenergieparks an. Um
den vielfältigen Marktanforderungen gerecht werden zu können, hat EWE die Offshore‐
Kompetenzen in der EWE Offshore Service & Solutions GmbH zusammengefasst. Ein interdisziplinä‐
res Team von Offshore‐Spezialisten mit Einsatzerfahrung im In‐ und Ausland unterstützt Kunden
während der gesamten Umsetzung von Offshore‐Projekten – von der Planungsphase bis zur Betriebs‐
führung.
Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der führenden deutschen IT‐Consulting‐
Unternehmen und insgesamt an 14 Standorten in Deutschland, der Schweiz, der Türkei sowie in Po‐
len und in Japan vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oldenburg beschäftigt 1.600 Mitarbei‐
ter.
BTC hat ein ganzheitliches, branchenorientiertes IT‐Beratungsangebot und eine führende Position
sowie hohe Kompetenz in ihren Geschäftsgebieten Energie, Industrie, Telekommunikation, Öffentli‐
cher Sektor und Private Dienstleistungen. Zu den zentralen energiebezogenen Produkten des Unter‐
nehmens zählen u.a. das Prozessleitsystem BTC PRINS, der BTC Grid Agent zur dynamischen Anpas‐
sung der elektrischen Eigenschaften von Windparks an die Anforderung der Netzanschlusspunkte
und Geographische Informationssysteme zur Verwendung bei netzbezogenen Planungs‐ und In‐
standhaltungsarbeiten. Im Kontext der Digitalisierung ist BTC ein wichtiger Partner für die Identifika‐
tion des Potenzials neuer Technologien zur Effizienzsteigerung und zur Einführung durchgängiger, IT‐
unterstützter Dienstleistungen, sogenannter Smart Services.
Im Fachbereich Informatik der Universität Hamburg werden seit mehr als 25 Jahren vielfältige FuE‐
und Technologietransfer‐Projekte der Simulationstechnik, insb. in Umwelt und Logistik, durchgeführt.
3KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
U.a. wurde das quelloffene Simulationsrahmenwerk DESMO‐J entwickelt, welches in verschiedenen
kommerziellen Softwareprodukten integriert ist. Auf dem Gebiet der Modellierung und Simulation
wurden mit verschiedenen Industriepartnern Kooperationsprojekte durchgeführt sowie Studien und
Empfehlungen für Investitionsentscheidungen erarbeitet. Neben dem bereits genannten For‐
schungsprojekt SystOp Offshore Wind wurden auch In mehreren Projekten der Containerterminallo‐
gistik Simulationsexperimente durchgeführt, welche Fragestellungen wie Ladestrategien, Layout‐
Planung und den Einsatz neuartiger Lademittel beinhalteten.
Die Ingenieurgesellschaft für Zuverlässigkeit und Prozessmodellierung Dresden mbH bringt umfang‐
reiches Know‐how zur statistischen Datenanalyse, zu Zuverlässigkeitsuntersuchungen und zur Opti‐
mierung von Prozessen aus anderen Technikbranchen sowie umfassende Kenntnisse und Erfahrun‐
gen mit softwaretechnischen Umsetzungen mit. Im Bereich der Erneuerbaren Energien hat die IZP
Dresden mbH die Projektleitung im Verbundprojekt EVW II übernommen.
1.5 PROJEKTSTRUKTUR
Zum Erreichen der Ziele haben die Projektpartner im Verbund folgende acht Teilprojekte (TP) bear‐
beitet:
Abbildung 1: Zusammenarbeit und Teilprojekte (TP) der Verbundpartner
Die EWE EE hat zu Beginn des Projekts die Betreiberanforderungen in einem Pflichtenheft zusam‐
mengetragen, diese bilden die Grundlage zur Entwicklung aller nachfolgenden Methoden und Werk‐
zeuge. Anschließend wurden durch die Hochschule Bremen ausgewählte Betriebsprozesse model‐
liert. Durch die BTC AG wurden die Daten und Informationen aufbereitet und in einer Datenbank
hinterlegt. Auf Grundlage dieser Datenbank wurden von der Universität Hamburg und der IZP Dres‐
den mbH Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung bei der operativen und strategischen Betriebs‐
führung entwickelt. Kennzahlen und Dokumente des Umwelt‐ und Qualitätsmanagements wurden
von der Hochschule Bremen mit Prozessen des Betriebs und der Instandhaltung von Offshore‐
Windparks verknüpft und über ein von der BTC AG entwickeltes Reporting darstellt. Die Ergebnisse
der Prozessabläufe, der Entscheidungsunterstützung, des Reportings und der Kennzahlen wurden in
4KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
dem von der Hochschule Bremen entwickelten Trainingswerkzeug zur Aus‐ und Weiterbildung von
Mitarbeiter_innen der operativen Betriebsführung eingearbeitet.
1.6 BERICHTSERIE WERKZEUGKISTE MIT „WERKZEUGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG EINES KOSTEN‐
UND RISIKOGESTEUERTEN BETRIEBS VON OFFSHORE‐WINDPARKS“ DES FORSCHUNGSPRO‐
JEKTS KROW!
Bei der Ausarbeitung der Teilprojekte wurden fünf Themenschwerpunkte für Werkzeuge zur Unter‐
stützung der Betriebsführung von Offshore‐Windparks identifiziert. Das Projekt ist als Werkzeugkiste
vorstellbar, in der sich die verschiedenen Werkzeuge in Form der Einzelberichte befinden. Je nach
Zielgruppe und Anwendungsbereich können die benötigten Werkzeuge herausgenommen werden
und bei der Umsetzung eines kosten‐ und risikogesteuerten Betriebs von Offshore‐Windparks die‐
nen.
Die Berichte, die sich in der Werkzeugkiste befinden sind:
Heuristik und Simulation als Entscheidungsunterstützung bei der operativen Einsatzplanung
für Offshore‐Windparks
Entscheidungshilfe zur strategischen Planung der Instandhaltung
Umwelt‐ und Qualitätsmanagement in der Betriebsführung von Offshore‐Windparks
Risikoanalyse zur Aufdeckung von Prozessschwachstellen
Trainingskonzepte und Anwendungsbeispiele für die Betriebsführung von Offshore‐
Windparks
Für die Projektergebnisse „Betreiberanforderungen“, „Datenmanagement und –analyse“, „Prozess‐
dokumentation“ und „Reporting“ wurden keine gesonderten Berichte erstellt, da sie der Unterstüt‐
zung der übrigen Projektthemen dienen und somit in den jeweiligen Berichten beschrieben werden.
Nachfolgend sind die Informationen zu den Autoren, der Zielgruppe und den Inhalten der verschie‐
denen Berichte dargestellt. Die Berichte stehen zum Download auf der Homepage www.krow‐
wind.de zur Verfügung.
5KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Heuristik und Simulation als Entscheidungsunterstützung bei der operativen Einsatzplanung für
Offshore Windparks
Autoren: Philip Joschko, Universität Hamburg
Johannes Göbel, Universität Hamburg
Stanislav Rockel, BTC Business Technology Consulting AG
Zielgruppe: Hersteller
Betriebsgesellschaften
Alle Instandhaltungsunternehmen, die mit einer großen Zahl an Ressourcen
eine Vielzahl von Maßnahmen durchführen und dabei eigenverantwortlich
planen können
Inhalte: Funktionsmuster einer Software als Entscheidungsunterstützung bei der Pla‐
nung von Instandhaltungsarbeiten
Datenstruktur als unverzichtbare Basis für Optimierungsansätze
Ganzheitlicher, heuristischer Ansatz zur Generierung von Einsatzplänen
Simulation als Vergleichsmethodik für mögliche Einsatzpläne
Entscheidungshilfe zur strategischen Planung der Instandhaltung
Autoren: Paul Granzin, IZP Dresden mbH
Zielgruppe: Instandhaltungsplaner
Betreiber
System‐ und Komponentenlieferanten
Inhalte: Entwicklung und Implementierung eines Software‐Tools zur datengestützten
Evaluierung von Instandhaltungsstrategiealternativen bezüglich der Kenngrö‐
ßen ‚Verfügbarkeit‘, ‚Fehlerhäufigkeit‘ und ‚Kostenrate‘. Hierbei wurden fol‐
gende Alternativen untersucht: Die rein korrektive Erneuerung (Run‐To‐Fail),
die prophylaktische Erneuerung bei Erreichen eines bestimmten Alters res‐
pektive kalendarischen Zeitpunktes sowie die zustandsabhängige Erneuerung.
6KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Umwelt‐ und Qualitätsmanagement in der Betriebsführung von Offshore Windparks (HSB)
Autoren: Vanessa Spielmann, Hochschule Bremen
Mandy Ebojie, Hochschule Bremen
Silke Eckardt, Hochschule Bremen
Stanislav Rockel, BTC Business Technology Consulting AG
Nane Denker, EWE Offshore Service & Solutions GmbH
Roland Rogalski, EWE Offshore Service & Solutions GmbH
Ewald Heyen, EWE Erneuerbare Energien GmbH
Zielgruppe: Qualitäts‐, Umwelt und Prozessmanagementbeauftragte der Betriebsführung
Prozessverantwortliche
Leitung der Betriebsführung
Inhalte: Ermittlung relevanter Qualitäts‐ und Umweltmanagementkennzahlen in der
OWP‐Betriebsführung
Einbindung dokumentierter Informationen in den Betrieb von OWP
Risikoanalyse zur Aufdeckung von Prozessschwachstellen
Autoren: Torsten Renz, IZP Dresden mbH
Vanessa Spielmann, Hochschule Bremen
Zielgruppe: Abteilungsleiter der Akteure (z.B. Betriebsservice) in den Teilprozessen
Qualitätsmanager
Prozessverantwortliche
Inhalte: Beschreibung des Funktionsmusters (Auswertemöglichkeiten, Eingaben)
Zu Grunde liegende Datenbank
7KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Trainingskonzepte und Anwendungsbeispiele für die Betriebsführung von Offshore‐Windparks
Autoren Lena Milchert, Hochschule Bremen
Saskia Greiner, Hochschule Bremen
Silke Eckardt, Hochschule Bremen
Nane Denker, EWE Offshore Service & Solutions GmbH
Roland Rogalski, EWE Offshore Service & Solutions GmbH
Zielgruppe: Aus‐ und Weiterbildungseinrichtungen
Offshore‐Windpark‐Betreiber
Leitung Technische Betriebsführung
Inhalte: Leitfaden zur Entwicklung von Trainingskonzepten für die technische Betriebs‐
führung am Beispiel bereits umgesetzter Trainingsmodule
8KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
2 AUS‐ UND WEITERBILDUNG IN DER BETRIEBSFÜHRUNG VON OWP
Mit dem Ausbau der Offshore‐Windenergie steigt der Bedarf an qualifizierten Beschäftigten. In dem
vergleichsweise neuen Offshore‐Windsektor ergeben sich Tätigkeitsfelder, die durch die bestehen‐
den Aus‐ und Weiterbildungsangebote nicht vollständig abgedeckt werden. Es gibt bereits eine Viel‐
zahl an Fort‐ und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Windenergie und auch speziell im Offshore‐
Bereich. Diese beziehen sich weitestgehend auf die Anlagen‐ und Komponentenfertigung sowie die
Servicetechnik im Bereich der Errichtung und Instandhaltung von OWEA und nicht auf die strategi‐
sche und operative Betriebsführung (BMWI 2013).
2.1 STATUS QUO
Die strategische und operative Betriebsführung von Offshore‐Windparks ist derzeit kein Bestandteil
der Aus‐ und Weiterbildungsangebote in der Windenergie (Spöttl und Molzow‐Voit 2012, Frey 2017).
Die Ausbildung zum bzw. zur Windenergieanlagentechniker_in beruht auf bestehenden gewerblich‐
technischen Ausbildungen und praktischen Erfahrungen in der Windenergie (Spöttl und Molzow‐Voit
2012). Weiterbildungen zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Windparks orien‐
tieren sich hauptsächlich an Onshore‐Windparks und weisen meist keine oder nur einen geringen
offshore‐bezogenen Anteil auf (WAB 2017, HdT 2017, DNV‐GL 2017). Hier stehen technische Weiter‐
entwicklungen, Sicherheitsaspekte, Trends zur Normung und Standardisierung sowie wichtige Para‐
meter zur Auswertung des Anlagenbetriebs im Vordergrund (BWE 2015). Die komplexen Strukturen
und Abläufe im Offshore‐Windparkbetrieb sowie die OWP‐spezifischen Aufgaben wie die Einsatzpla‐
nung, nautische Beobachtung oder der Umgang mit verschiedenen Akteuren und deren Koordination
sind nicht Bestandteil der Seminare. Die Einarbeitung der Mitarbeiter_innen erfolgt durch „Learning‐
by‐doing“, durch Hospitationen in den verschiedenen Abteilungen der Betriebsführung und durch die
Begleitung eingearbeiteter und erfahrener Kollegen oder Kolleginnen. Es fehlt noch an einem ganz‐
heitlichen Einarbeitungs‐ und Ausbildungskonzept, das die Inhalte strukturiert und systematisch
vermittelt. Dadurch ergeben sich längere und intensivere Einarbeitungszeiten und eine starke Ab‐
hängigkeit neuer Mitarbeiter_innen von der zugeteilten Person für die Einarbeitung. Für die Unter‐
nehmen geht mit der Abhängigkeit der Einarbeitungsqualität von einzelnen Personen auch die Ge‐
fahr einher, dass sie die Expertise in der Einarbeitung durch Kündigungen entsprechender Mitarbei‐
ter_innen verlieren.
Aktuell beruhen demnach der unternehmensinterne Wissenstransfer und das Training des Personals
auf dem individuellen und subjektiven Austausch zwischen den Mitarbeiter_innen. Es fehlt an einem
System zur schnellen, zielorientierten Einarbeitung und effizienten Weiterbildung in die technische
und strategische Betriebsführung von OWPs. Trainingssimulatoren oder Operating Training Systems
(OTS), die bei komplexen und risikoreichen Betriebsprozessen z.B. in Kernkraftwerken (Replika‐
Simulationen) zum Einsatz kommen, finden im Offshore‐Windpark‐Betrieb noch keine Anwendung
(Schneider Electric Software 2016). Diese Systeme können vor allem in der Einsatzplanung und im
Umgang mit den vielfältigen IT‐Systemen die Einarbeitung und Weiterbildung aber auch das Trainie‐
ren von Ausnahmesituationen wesentlich unterstützen.
9KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
2.2 LEITFADEN UND ERSTE KONZEPTE FÜR DIE ENTWICKLUNG VON TRAININGSMODULEN
Dieser Leitfaden zeigt auf, wie Trainingsmodule konzeptionell entwickelt und in einem E‐Learning‐
Modul umgesetzt werden können, um dem zuvor beschriebenen Defizit an Aus‐ und Weiterbildungs‐
angeboten zu begegnen. Die Darstellung erfolgt anhand eines im Forschungsvorhaben KrOW! entwi‐
ckelten didaktischen Konzepts für die Aus‐ und Weiterbildung sowie die Einarbeitung in die techni‐
sche Betriebsführung. In der beruflichen Weiterbildung, zu der auch die Einarbeitung in neue Aufga‐
bengebiete gehört, ist aufgrund unterschiedlichster Arbeitsstrukturen häufig eine hohe zeitliche Fle‐
xibilität und Dezentralität in der Durchführung von Lehr‐ und Lerneinheiten gefordert. Um diesen
Ansprüchen zu genügen, ist eine Umsetzung der erarbeiteten Inhalte in einer Online‐Lernplattform
zielführend.
Im Mittelpunkt des entwickelten Trainingswerkzeugs steht das Erlernen der Abläufe der OWP‐
Betriebsführung, die korrekte Bedienung und Anwendung von Software oder anderen Tools zur Ent‐
scheidungsunterstützung sowie die Interpretation der gewonnenen Ergebnisse. Es gliedert sich in
drei Trainingsmodule:
Einführung in die Abläufe des Betriebs von OWPs
Operative Einsatzplanung mit Hilfe eines Schedulingmoduls
Einführung in die Identifikation von Kennzahlen für die Betriebsführung und die Berichtserstat‐
tung
Das hier vorgestellte, didaktische Konzept richtet sich in erster Linie an betriebsunabhängige Weiter‐
bildungseinrichtungen, Vereine oder Einrichtungen, die sich mit der Qualifizierung von Mitarbei‐
ter_innen befassen, aber auch an die Betreiber von Windparks zur betriebsinternen Einarbeitung und
Weiterbildung. Zur bedarfsgerechten Anwendung muss das beschriebene Konzept aufgenommen,
angepasst und weiterentwickelt werden. Die Adressaten und Interessenten dieses Leitfadens sollen
so dabei unterstützt und befähigt werden den Lernenden eine eigenständige, ortsunabhängige und
zeitlich flexible Möglichkeit zur schnellen und zielgerichteten Einarbeitung in den Betrieb zu bieten.
10KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
3 DIE BERUFLICHE WEITERBILDUNG
Bildungsangebote für Erwachsene haben im Gegensatz zum Schulsystem weder einen staatlichen
Bildungsauftrag noch einen Erziehungsauftrag und damit auch kein Disziplin‐ und Disziplinierungs‐
problem. Es besteht keine (Weiter‐)Bildungsverpflichtung, die Nutzung von Bildungsangeboten ist
weitestgehend als „freiwillig“ anzusehen und häufig durch berufliche Anforderungen und Notwen‐
digkeiten gesteuert. Das Bildungsangebot wird auf die Bildungsbedürfnisse abgestimmt. (Siebert
2009)
In den 1990er Jahren haben sich die Anforderungen an die berufliche Bildung aufgrund veränderter
Qualifikationsanforderungen insbesondere gewerblich‐technischer Berufsfelder stark verändert.
Mitarbeiter_innen sollen selbstständig handeln und im hohen Maße qualitäts‐ und verantwortungs‐
bewusst sein. Hierzu werden Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und ein Ver‐
ständnis für betriebliche Zusammenhänge und Abläufe erwartet. Außerdem sollen Mitarbeiter_innen
flexibel, kreativ und hoch motiviert arbeiten. Die Lehr‐ und Lernkonzepte werden daher direkt an den
Arbeitsprozessen orientiert und die berufliche Handlungskompetenz ist Teil der Ausbildungs‐ und
Rahmenlehrpläne. Die berufliche Handlungskompetenz steht dabei im Fokus der Bildungsangebote,
sie ist „die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und pri‐
vaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“
(KMK 2007). Sie wird in die Teilbereiche fach‐, methoden‐ und sozialbezogene Kompetenz unterteilt.
„Die Fachkompetenz beinhaltet die Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben auf Basis theoretischen
Wissens und fachlich richtig zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen. Die Methodenkompetenz
beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft unterschiedliche Techniken, Verfahren und Methoden fach‐
lich und sachlich korrekt zur Bearbeitung von Aufgaben einzusetzen. Die Sozialkompetenz umfasst die
Fähigkeit und Bereitschaft, soziale Beziehungen zu erfassen und zu verstehen, sowie sich mit anderen
rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen.“ (Howe und Knutzen 2011b). Diese Kon‐
zepte sind nicht nur in der Erstausbildung, sondern auch in der Weiterbildung einsetzbar (Howe und
Knutzen 2011a).
In der Erwachsenenbildung steht weniger das Neuerlernen, sondern das Aufbauen und Vertiefen des
vorhandenen Wissens und der eigenen Erfahrungen im Vordergrund (Anschlusslernen). Erwachsene
lernen insbesondere was als sinnvoll, subjektiv bedeutsam und/oder praxisrelevant empfunden wird,
wobei das Lernen nach gelernten und bewährten Mustern erfolgt. Die Lernenden gehen demzufolge
mit dem gelehrten Stoff eigenständig um, wobei Motivation und Interesse ausschlaggebend für die
Lernleistung sind (Siebert 2009, Brinker und Schumacher 2014).
Trotz der beschriebenen Unterschiede zwischen Erwachsenenbildung in Aus‐ und Weiterbildungs‐
maßnahmen und Schulsystem oder Hochschulen, liegen der beruflichen Bildung die gleichen päda‐
gogischen Fundamente zugrunde (Siebert 2009):
Zielgerichtetes und zweckbestimmtes Lehren und Lernen
Lernen in Gruppen, auch im Fernstudium werden Präsenzphasen integriert
Lernen erfolgt hauptsächlich durch Aneignung von Fakten‐, Orientierungs (Reflexion von Wer‐
ten) ‐ und Erfahrungswissen
11KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Lernen wird organisiert, wozu u.a. Veranstaltungszeiten, zugängliche Lernorte und Curricula
sowie vertragliche Vereinbarungen mit Lehrkräften und Teilnehmenden gehören.
3.1 LEHREN UND LERNEN IM BERUFLICHEN UMFELD DER BETRIEBSFÜHRUNG VON OFFSHORE‐
WINDPARKS
Aufgrund der zuvor beschriebenen Besonderheiten und Merkmale der beruflichen Bildung steht für
die Entwicklung eines Trainingswerkzeugs für die Betriebsführung von Offshore‐Windparks die Ver‐
mittlung der beruflichen Handlungskompetenz im Vordergrund. Durch eine Arbeitsprozessanalyse
lassen sich berufliche Handlungsfelder ableiten, aus denen Lern‐ und Arbeitsaufgaben entwickelt
werden können. HOWE und KNUTZEN haben für die gewerblich‐technische Ausbildungs‐ und Unter‐
richtspraxis einen Werkzeugkasten entwickelt, der vom Rahmenplan bis zum softwaregestützten
beruflichen Lernen reicht. Die Ermittlung beruflicher Handlungsfelder, die Erarbeitung von Arbeits‐
und Lernaufgaben bis hin zur Entwicklung von Lernsoftware werden erläutert und anwendungsge‐
recht beschrieben (Howe und Knutzen 2011). Aufgrund der Arbeitsprozessorientierung und der An‐
wendungsnähe stellt das Konzept eine gute methodische Grundlage für die Entwicklung eines Trai‐
ningswerkzeugs dar.
Die verschiedenen Arbeitsformate in der Betriebsführung, wie Schichtpläne und On‐/Offshore‐
Einsatzzeiten sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte erfordern, für eine kostengünstige und zeitlich
effektive Einarbeitung neuer Mitarbeiter_innen, flexible Lernmethoden und ‐umgebungen. Der Ein‐
satz von digitalen Medien steigert die Ausbildungs‐ und Unterrichtsqualität und ermöglicht zudem
(Howe und Knutzen 2011a) eben jenes ortsunabhängige und zeitlich flexible Lernen. Eine wichtige
Grundvoraussetzung ist dabei, dass die digitalen Hilfsmittel in die vorhandenen IT‐Systeme gut ein‐
zubinden und ausführbar sind.
3.2 E‐LEARNING
Im Zusammenhang mit Kommunikations‐ und Informationsmedien für die Unterstützung bei der Aus‐
und Weiterbildung wird hier der Begriff E‐Learning verwendet. Er beschreibt den Einsatz von elektro‐
nischen bzw. digitalen Medien und virtuellen Lernräumen, durch die die Lerninhalte vermittelt wer‐
den.
Lernmanagementsysteme
Zur Unterstützung von Lehr‐ und Lernprozessen im E‐Learning sowie zur Verwaltung von Lernmateri‐
alien und Nutzerdaten stehen Lernmanagementsysteme (LMS) zur Verfügung. Webbasierte Systeme
stellen nicht nur Lerninhalte bereit, sondern ermöglichen auch die Organisation von Lernvorgängen
und die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden. Die Aufgaben eines LMS liegen in der
Erstellung, Archivierung, Wiederverwendung und Distribution von Lerninhalten. Folgende Funktionen
sollten in einer Lernmanagementsoftware verfügbar sein (e‐teaching.org redaktion 2013):
Benutzerverwaltung (Anmeldung mit Verschlüsselung)
Kursverwaltung (Kurse, Inhalte und Dateien)
12KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Rollen‐ und Rechtevergabe mit differenzierten Rechten
Kommunikationsmethoden (Chat und Foren)
Lernwerkzeuge (Whiteboard, Notizbuch, Annotationen, Kalender,…)
Darstellung der Kursinhalte, Lernobjekte und Medien in einem netzwerkfähigen Browser
Werkzeuge zur Erstellung von Lehrmaterialien
Werkzeuge zur Erstellung von Prüfungen und Tests mit gängigen Aufgabentypen (Multiple
Choice, Lückentext, Drag&Drop,…)
Abbildung 2: Architektur eines Lernmanagementsystems nach SCHULMEISTER (e‐teaching.org redaktion 2013)
Vorteilhaft ist die Nutzung webbasierter Lernmanagementsysteme, da so von den Lehrenden und
Lernenden nur eine Internetverbindung und ein Webbrowser benötigt werden. Grundsätzlich ist die
serverseitige Installation und Administration eines LMS technisch anspruchsvoll und deshalb eine
Betreuung durch die jeweiligen IT‐Abteilung ratsam (e‐teaching.org redaktion 2013).
Die Auswahl eines für das Unternehmen geeigneten Systems ist von den Anforderungen an die tech‐
nische Infrastruktur sowie die Lehr‐ und Lernfunktionen abhängig. (e‐teaching.org redaktion 2013)
Für das Projekt KrOW! wurde das in der Hochschullehre häufig verwendete Lernmanagementsystem
ILIAS eingesetzt. Die Abkürzung ILIAS steht für Integriertes Lern‐, Informations‐ und Arbeitskoopera‐
tions‐ System. ILIAS eignet sich für die Erstellung und Administration webbasierter Lernumgebungen.
Es bietet folgende Funktionen (e‐teaching.org redaktion 2013):
Persönlicher Schreibtisch als Informationsdrehscheibe mit „Wer‐ist‐online?“‐Funktion
Umfangreiches Kursmanagementsystem
Asynchrone und synchrone Kommunikation wie internes Nachrichtensystem, Diskussionsforen
und Chat
integriertes und leicht bedienbares Wiki
13KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
ILIAS‐ Lehr‐/Lernmodule (HTML ‐Kenntnisse nicht erforderlich)
Lehr‐/Lernmodule anderer Formate importierbar: SCORM, HTML‐Module, AICC
RSS (Rich Site Summary) ‐Feed
Mediacast (Podcast, Videodateien)
Kontextsensitives Notizbuch, mit dem Annotationen an Dokumente angefügt werden können
Persönliche Ordner und Bookmarks
Glossar und Kalender
Gruppensystem für kooperatives Arbeiten
Test‐ und Bewertungswerkzeug, Umfragen
Integriertes Autorenwerkzeug
Benutzer‐ und Systemadministration
Definition von Rollen (u. a. Lernende, Autoren, Administratoren)
Schnittstellen zu Virtual‐Classroom‐Systems (iLinc) und zu den Lernportalen Stud.IP und HIS‐LIF
(kombinierte Nutzung möglich)
ILIAS ist eine kostenlose OpenSource‐Software und wird laufend von den Kooperationspartnern so‐
wie den Lehr‐ und Forschungsinstitutionen weiterentwickelt. Es liegen vielfältige Erfahrungen im
Einsatz an Schulen und Hochschulen, Verwaltung und Unternehmen sowie in jeder Art der betriebli‐
chen Weiterbildung vor. Ein bestimmtes didaktisches Lernmodell liegt nicht zugrunde, sodass es für
viele Methoden und Nutzungsszenarien eingesetzt werden kann. Zudem unterstützt ILIAS Metadaten
auf allen Inhaltsebenen und verwendet E‐Learning‐Standards, wie z.B. LOM metadata und SCORM.
Darüber hinaus steht eine kontextsensitive Hilfe zur Verfügung und es sind über 20 Systemsprachen
integriert. Das Erscheinungsbild des Systems ist der Corporate Identity des Unternehmens flexibel
anpassbar. (e‐teaching.org redaktion 2013)
14KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
4 VORGEHEN ZUR ENTWICKLUNG EINES TRAININGSKONZEPTES
Das nachfolgende Ablaufdiagramm (siehe Abbildung 3) zeigt das schematische Vorgehen zur Entwick‐
lung, eines Trainingskonzepts für die Betriebsführung von Offshore‐Windparks. Im ersten Schritt fin‐
det die Grundlagenermittlung statt. Mit Hilfe von Experteninterviews, aktuellen Stellenausschreibun‐
gen und Übersichten über Unternehmensstrukturen werden die Arbeitsprozesse mit den zugehöri‐
gen Aufgabenprofilen in der technischen Betriebsführung identifiziert. Aus den Arbeitsprozessen und
Aufgabenprofilen können dann die erforderlichen beruflichen Handlungskompetenzen abgeleitet
und ergänzt werden. Grundlage hierfür bilden Fragen wie:
Welche berufliche Qualifikation braucht der/die Mitarbeiter_in, um in bestimmten Situationen
sachgerecht zu handeln?
Welche Informationen benötigt der/die Mitarbeiter_in für die Ausführung der bestimmten
Aufgabe, um diese eigenverantwortlich auszuführen?
Anhand der Verknüpfung der Arbeitsprozesse mit den beruflichen Handlungskompetenzen können
daraufhin die Trainingsbedarfe formuliert werden.
Im Anschluss daran erfolgt die Entwicklung der Trainingsmodule. Hierfür müssen das didaktische
Konzept und die Lehrinhalte festgelegt werden. Die Kernaufgabe der Didaktik liegt in der Schnittstelle
zwischen Lehren und Lernen. Mit Hilfe eines didaktischen Konzepts werden die zu vermittelnden
Inhalte strukturiert und die Intention und der Ablauf der Lehre beschrieben. (Zach et al. 2013) Es
müssen Entscheidungen über die Art und die Methoden der Umsetzung des Trainingswerkzeugs ge‐
troffen werden, also welches Format soll das Trainingswerkzeug haben und wie soll das Wissen ver‐
mittelt werden. Innerhalb des Trainingswerkzeugs müssen Trainingsmodule benannt und die thema‐
tische Zuordnung der Inhalte festgelegt werden. Fragen, die in diesem Rahmen beantwortet werden
müssen sind:
Wer sind die Adressaten des Trainings?
Welche Lehr‐/Lernziele werden angestrebt?
Welche Prozessebene/Detailtiefe wird benötigt? (Diese Frage ist besonders für unabhängige
Weiterbildungseinrichtungen von Bedeutung, da von der gewählten Prozesstiefe auch ab‐
hängt, ob die Inhalte OWP‐spezifisch oder allgemeingültig sind.)
Wie sieht der Aufbau des Trainingswerkzeugs aus?
▫ Wie wird der theoretische Teil aufgebaut (Struktur, gemeinsamer Lernraum für mehre‐
re Teilnehmende, Videoelemente, Quizfragen, etc.)?
▫ Gibt es einen Praxisanteil? Wenn ja, wie hoch ist dieser und welches Format hat er
(Planspiel, Präsenzveranstaltungen, Workshops etc.)?
Welche Software unterstützt die gewünschten Features?
Um die Tauglichkeit des entwickelten Trainingswerkzeuges zu untersuchen, sinnvoll zu ergänzen und
weiterentwickeln zu können, müssen die verschiedenen Module testweise durchlaufen und evaluiert
werden. Hierfür sind besonders Personen aus der Zielgruppe und Personen mit Arbeitserfahrung in
dem jeweiligen Bereich geeignet. Aktualisierungen müssen fortlaufend in das anwendungsreife Trai‐
15KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
ningswerkzeug einfließen, eine kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der Module ist für
ein zeit‐ und fachgerechtes Training unbedingt erforderlich.
Abbildung 3: Ablaufdiagramm "Entwicklung des Trainingskonzepts"
Innerhalb des Forschungsprojekts KrOW! wurden drei Module entwickelt, in denen der theoretische
Anteil als E‐Learning‐Anwendung ausgearbeitet wurde, das erste Modul wurde außerdem um einen
praktischen Anteil, ein interaktives Planspiel, ergänzt.
16KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
5 AUFGABENPROFILE UND TRAININGSBEDARFE IN DER TECHNISCHEN BETRIEBS‐
FÜHRUNG VON OWPS
In diesem Kapitel wird das zuvor erläuterte Vorgehen zur Konzeptionierung eines Trainingswerkzeugs
für den OWP‐Betrieb näher beschrieben.
5.1 CHARAKTERISIERUNG DER OWP‐BETRIEBSFÜHRUNG
Die Arbeitsprozesse im OWP‐Betrieb werden ermittelt und anschließend mit den operativen Einhei‐
ten in der Betriebsführung verknüpft.
5.1.1 CHARAKTERISTISCHE ARBEITSPROZESSE IM OWP‐BETRIEB
Für die Aufstellung der Prozesse der OWP‐Betriebsführung wird das FAU‐Prozessmodell verwendet.
Es handelt sich dabei um eine branchenneutrale Methode unternehmensspezifische Prozessmodelle
zu entwickeln. Das FAU‐Prozessmodell unterteilt Prozesse in drei Cluster: Führungs‐, Ausführungs‐
und Unterstützungsprozesse. In den Ausführungsprozessen findet die Wertschöpfung statt. Die Un‐
terstützungsprozesse stellen den Ausführungs‐ und Führungsprozessen die erforderlichen Ressour‐
cen, wie Informationen, Personen, Sachmittel etc. bereit. Mit Hilfe der Führungsprozesse werden die
anderen beiden Prozesscluster koordiniert. (Fischermanns 2012)
Die Arbeitsprozesse des Einsatzmanagements bestehen aus: Anlagenüberwachung, Seeraumüberwa‐
chung, Seebefeuerungsüberwachung, HSE‐Qualifikationsüberwachung, Einsatzplanung, Vorberei‐
tung, Durchführung der Maßnahmen und Nachbereitung. Sie fügen sich in die Betriebs‐ und Instand‐
haltungsprozesse des Offshore‐Windparks ein. Bei der Ermittlung des Arbeitsbedarfs, der Einsatzpla‐
nung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung handelt es sich um die wertschöpfenden Pro‐
zessschritte, die daher den Ausführungsprozessen zugeordnet werden, in Abbildung 4 grau darge‐
stellt. Zu den Unterstützungsprozessen zählen unter anderem die Lagerbestands‐, Anlagen‐ und See‐
raumüberwachung sowie die kaufmännische Betriebsführung, in dieser Darstellung braun hinterlegt.
Das Qualitätsmanagement ist Teil der Führungsprozesse, in der Abbildung grün markiert.
Die ausführliche Beschreibung der einzelnen Prozesse ist im German Offshore Wind Operation Guide
(GOWOG)2 (Greiner et al. 2015) und im Bericht Umwelt‐ und Qualitätsmanagement in der Betriebs‐
führung von Offshore‐Windparks (Spielmann et al. 2018) zu finden. Die Prozessdarstellung wurde in
Anlehnung an Greiner et al. 2015 vorgenommen.
2
Abschlussbericht des Forschungsprojektes SystOp Offshore Wind –Optimierung des Leistungssystems Offshore Windpark,
gefördert durch BMWi, Förderkennzeichen 0325283A
17KrOW!
Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks
Abbildung 4: Prozesse der Betriebsführung von OWPs in Anlehnung an (Greiner et al. 2015)
5.1.2 OPERATIVE EINHEITEN IN DER OWP‐BETRIEBSFÜHRUNG
Das Asset‐Management des OWP‐Betreibers übernimmt die Verantwortung und die Verwaltung der
Anlagen in den verschiedenen Lebenszyklusphasen. Es ist für steuernde Aufgaben in der Betriebsfüh‐
rung zuständig und wird in planerische und unternehmerische Entscheidungen eingebunden.
Die Betriebsführung von Offshore‐Windparks unterteilt sich in die technische und kaufmännische
sowie das Qualitäts‐ und HSE‐Management.
Die technische Betriebsführung überwacht und dokumentiert den Betrieb und die Instandhaltung
der Windparkgewerke (WAB 2014). Sie setzt sich aus verschiedenen operativen Einheiten zusammen
(Abbildung 5), die in Abhängigkeit der betriebsführenden Gesellschaft unterschiedlichen organisati‐
onsinternen Einheiten zugeordnet sind. Zur technischen Betriebsführung gehören neben der Leitwar‐
te (Überwachung und Steuerung Windenergieanlagen, Umspannwerk und Innerparkverkabelung),
das Onshore Site Station Management (u.a. Festlegung der auszuführenden Maßnahmen) sowie das
Offshore Site Management (Planung und Koordination der Einsätze an den Gewerken). Die Haupt‐
aufgabe der Marine Coordination liegt im Tracking des Personals bspw. der Servicetechniker und der
Fahrzeuge im Windpark. Am Einsatzmanagement, d.h. der Planung, Begleitung und Nachbereitung
von Einsätzen im OWP, sind im Wesentlichen die Leitwarte, das Offshore Site Management und die
Marine Coordination beteiligt. Das technische Backoffice übernimmt die Zustandsanalyse der Anla‐
gen und ordnet mittel‐ bis langfristige Instandhaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise Wiederkeh‐
rende Prüfungen (WKP) und Wartungsintervalle im OWP an. Zudem sind hier die IT‐ und Kommunika‐
tionsexperten angesiedelt, die für den einwandfreien Betrieb der Informations‐ und Kommunikati‐
18Sie können auch lesen