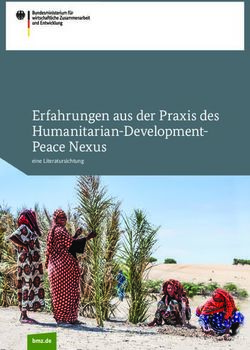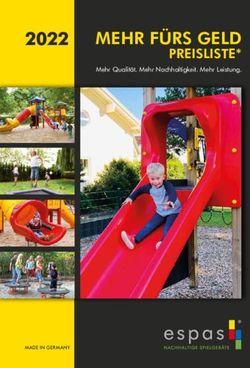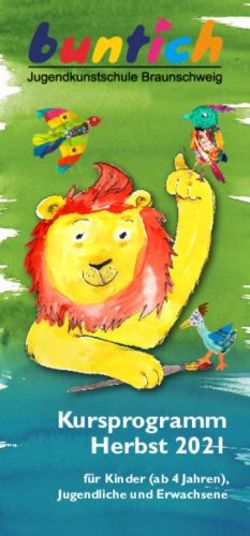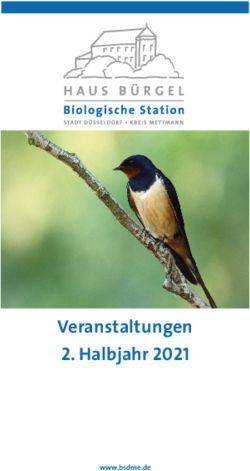Trauma, psychische Belastungen und Familiensituation von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung: Implikationen für Hilfen zur Erziehung und Therapie1 ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Trauma, psychische Belastungen und Familiensituation von
Vätern mit Jugendhilfeerfahrung: Implikationen für Hilfen zur
Erziehung und Therapie1
Katja Nowacki, Silke Remiorz, Vanessa Mielke und Alexander Gesing
Summary
Trauma, Psychological Stress and Family Situation of Fathers who Experienced Child and Youth
Welfare Services: Implications for Youth Welfare Interventions and Therapy
This paper explores the current family situation and psychological stress of fathers who ex-
perienced trauma and different kinds of youth welfare services including out-of-home place-
ment during their childhood. The main group consisted of n = 119 fathers and was compared
to a group of n = 36 fathers whose families never received services from the child and youth
welfare authority. In the main group, a high correlation was found between trauma and cur-
rent psychological stress, albeit the out-of-home care intervention or intensive home-support
by child and youth welfare services during childhood. The higher stress level in the main
group of fathers in contrast to the comparison group effects their current family situation,
especially concerning the contact between fathers and their children. Fathers with higher
stress levels were less likely to be in contact with their children. Acting on the assumption that
fathers are important for their children, the results implicate a heightened focus on earlier
trauma-informed interventions in families with difficulties and out-of-home care settings,
to reduce stress levels and prevent intergenerational transmission of problematic family ex-
periences. Current child and youth welfare services, in particular out-of-home placements,
should take these trauma-informed approaches and therapy into account.
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70/2021, 154-169
Keywords
out-of-home placement – trauma – psychological stress – family situation – father-child contact
Zusammenfassung
Der Beitrag untersucht die aktuelle Familiensituation und die psychische Belastung von Vä-
tern, die in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben und Hilfen zur Erzie-
hung inklusive stationärer Unterbringungen erlebt haben. Die Hauptstichprobe besteht aus
n = 119 Vätern und wird mit einer Gruppe von n = 36 Vätern verglichen, deren Familien nie
1 Diese Studie wurde im Rahmen des Central European Network on Fatherhood (CENOF) durchgeführt
und von der Jacobs Foundation (AZ: 2013-1049) finanziert.
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021
https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.2.154Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
155
Hilfen zur Erziehung durch das Jugendamt erhalten haben. In der Hauptstichprobe zeigt sich
ein deutlicher Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen in der Kindheit und ho-
her aktueller psychischer Belastung trotz der Hilfen zur Erziehung, die ihre Familien in Form
von Fremdunterbringungen oder intensiver ambulanter Begleitung erhalten hatten. Die hohe
psychische Belastung der Väter aus der Hauptstichprobe hat im Gegensatz zur Vergleichs-
stichprobe Auswirkungen auf ihre aktuelle Familiensituation, insbesondere im Hinblick auf
den Kontakt zum eigenen Kind. Väter mit hoher Belastung haben deutlich häufiger keinen
Kontakt zu ihrem leiblichen Kind. Ausgehend davon, dass Väter einen bedeutsamen Einfluss
auf die Entwicklung ihrer Kinder haben, zeigen die Ergebnisse, wie wichtig Unterstützungs-
maßnahmen und traumaorientierte Interventionen in Familien mit erhöhten psychischen
Belastungen sind, um eine gestärkte Vater-Kind-Beziehung zu fördern und eine transgenera-
tionale Weitergabe von schwierigen familiären Erfahrungen zu vermindern. Aktuelle Maß-
nahmen der Jugendhilfe, insbesondere Fremdunterbringungen, sollten traumapädagogisch
und therapeutisch flankiert werden.
Schlagwörter
Kindeswohl – Hilfen zur Erziehung – psychische Belastung – Familienkonstellation – Vater-Kind-
Kontakt
1 Hintergrund
Väter sind für die Entwicklung ihrer Kinder wichtig. Wenn sie im Leben ihrer Kinder
anwesend sind, führt dies zu positiven Effekten für deren kognitive und soziale Entwick-
lung (Lamb, 2010). Sie können in schwierigen Familiensituationen negative Auswir-
kungen mildern, wie z. B. McKelvey et al. (2012) für Kinder alkoholabhängiger Mütter
zeigen konnten, bei denen unterstützendes, väterliches Verhalten zu geringerem exter-
nalisierenden Problemverhalten führte. Was ist aber mit Vätern, die in ihrer Kindheit
traumatischen Ereignissen ausgesetzt waren und deren Familien Hilfen zur Erziehung
in Form von Fremdunterbringung oder intensiver ambulanter Familienhilfe erhalten
haben? Gerade Väter, die selbst Gewalterfahrungen gemacht haben, zeigen ein erhöhtes
Risiko für eigenes gewalttätiges Verhalten, wobei die empirischen Befunde hierzu unein-
heitlich sind (Ellonen, Peltonen, Pösö, Janson, 2017). Insgesamt werden Väter seltener
in Hilfen für Familien adressiert (Nygren, Walsh, Ellingsen, Christie, 2018; Skarstadt-
Storhaug u. Oien, 2012), da zum einen die Mütter traditionell als die primäre Bezugs-
person für die Kinder gesehen werden und Väter teilweise auch als gefährlich für ihre
Kinder eingestuft werden (Maxwell, Scourfield, Featherstone, Holland, Tolman, 2012;
Scourfield 2003). Die Forschung empfiehlt jedoch, dass Väter in die Soziale Arbeit mit
Familien besser integriert werden sollten, um einen positiven Kontakt zu ihren Kindern
zu fördern und tatsächliche Gefährdungsmomente schneller erkennen und abwehren zu
können (Brown, Callahan, Strega, Walmsley, Dominelli, 2009; Taylor u. Daniel, 2000).
Der Kontakt zu ihren Kindern verringert die Gefahr von gewalttätigen Erziehungsme-
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021156 K. Nowacki et al. thoden (Lee, Guterman, Lee, 2008) und ist auch für die Väter ein wichtiger Schutzfak- tor, insbesondere im Hinblick auf ihre psychische Verfassung (Evenson u. Simon, 2005). Deshalb ist es wichtig, sich mit Vätern zu beschäftigen, die in ihrer Kindheit eine schwie- rige Familiengeschichte und traumatische Erfahrungen erlebt haben und aufgrund des- sen fremduntergebracht waren bzw. intensive ambulante Hilfe erhalten haben. Interes- sant ist es, wie sich diese Kindheitserfahrungen auf ihre aktuelle Familiensituation und den Kontakt zu ihren Kindern auswirken und ob die Hilfemaßnahmen ausreichend ihre psychische Belastung reduziert haben. 1.1 Kindeswohl und Hilfen zur Erziehung Die Pflege und Erziehung ihrer Kinder sind das Recht und die Pflicht der leiblichen Eltern. Wenn aber Gefahr für das Wohl des Kindes besteht, greift die staatliche Ge- meinschaft ein und macht von ihrem Wächteramt Gebrauch (Art. 6 Abs. 2 u. 3 GG). Kinder können in der stationären Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden, wenn eine akute Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, körperliche und emotionale Misshandlung oder sexuellen Missbrauch besteht (§1666 BGB). Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 91.640 Kinder und Jugendliche Hilfen in Pflegefamilien (§ 33 SGB VIII) und 143.316 in Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII) gewährt (Stati- stisches Bundesamt, 2019a). Darüber hinaus gibt es in Deutschland eine Reihe gesetz- licher ambulanter Hilfen für Familien, um die Eltern bei der Erziehung der Kinder zu unterstützen und eine Fremdunterbringung zu vermeiden. Eine sehr häufig einge- setzte Form ist z. B. die Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 28 SGB VIII, die im Jahr 2018 in 126.025 Fällen gewährt wurde (Statistisches Bundesamt, 2019a). Die gesetzlichen Hilfen nach § 27 ff. SGB VIII räumen Familien, im Unterschied zu vielen anderen westlichen Ländern wie zum Beispiel England, ein Recht auf Unterstützung ein (Simpson u. Nowacki, 2018). Kinder und Erwachsene, die in Fremdunterbringung aufwachsen bzw. aufgewachsen sind, weisen deutlich häufiger eine erhöhte psychische Belastung und ein hohes Stresslevel auf, was auf traumatische Erlebnisse in der Fa- milie oder anderen Formen der Fremdunterbringung sowie auf damit verbundenen Beziehungsabbrüche zurückgeführt werden kann (Lehman, Havik, Havik, Heiervang, 2013; Nowacki u. Schölmerich, 2010; Pérez, Di Gallo, Schmeck, Schmid, 2011). 1.2 Trauma, psychische Belastung und ihre Auswirkungen Studien zeigen einen hohen Einfluss früher traumatischer Erfahrungen auf die so- zioemotionale und psychische Belastung der betroffenen Kinder auf (z. B. Horan u. Widom, 2015). Insbesondere kumulierte Risikofaktoren, wie das Auftreten verschie- dener Misshandlungs- und Missbrauchserfahrungen führen häufiger zu Belastungs- reaktionen (Witt et al., 2016). Fergusson, Geraldine, McLeod und Horwood (2013) fanden eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Depression, Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen und Suizidversuchen im Erwachse- Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online) © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021
Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
157
nenalter, wenn sexueller Missbrauch im Kindesalter berichtet wurde. Turner, Tail-
lieu, Cheung und Afifi (2017) konnten dies für eine Gruppe von Männern zeigen,
bei denen auch vor allem sexueller Missbrauch die Wahrscheinlichkeit psychischer
Störungen im Erwachsenenalter deutlich erhöhte. Sie vermuten ein hohes Maß an
Scham und Gefühlen von Hilflosigkeit bei den Männern, die durch das klassische
stereotype Männerbild von Dominanz und Stärke verstärkt werden.
1.3 Familienformen und ihre Auswirkungen auf Kinder
Die traditionelle Kleinfamilie, mit verheirateten Paaren und mindestens einem leib-
lichen Kind, ist in Deutschland im Jahre 2018 mit 68.4 %, immer noch die verbrei-
tetste Familienform (Statistisches Bundesamt, 2018).
Es gibt jedoch eine steigende Zahl von Familienformen, die unter dem Begriff „nicht-
traditionell“ zusammengefasst werden können (Stephens, 2013). Hierzu gehören unter-
schiedliche Konstellationen, die verschiedene Unterstützungs- und Fürsorgeleistungen
im Sinne des „doing family“ übernehmen (Jurczyk, 2014, S. 51; Schier u. Jurczyk, 2007,
S. 10). Dazu zählen z. B. gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften oder auch die so-
genannten „Patchwork-Familien“ („blended families“) (Hofferth, 2006), die häufig aus
Paaren mit gemeinsamen und Kindern aus vorherigen Partnerschaften bestehen. Stief-
familien umfassen meistens die Mutter und ihre leiblichen Kinder sowie ihren neuen
Partner und gegebenenfalls seine weiteren Kinder. Da in den überwiegenden Fällen die
Kinder nach der Trennung bei der leiblichen Mutter verbleiben, hat der leibliche Vater
in der Folge oft nur noch an Wochenenden Kontakt. Damit wird er zum „Teilzeitvater“
(„part-time father“) für seine eigenen Kinder (Troilo u. Coleman, 2012); in nur 16 %
der Fälle ist er in Deutschland hauptsächlich als Alleinerziehender für die Erziehung des
leiblichen Kindes zuständig (Statistisches Bundesamt, 2019b).
Gleichzeitig muss bedacht werden, dass ein Risikofaktor für eine negative sozial-
emotionale Entwicklung von Kindern und spätere psychische Belastung im Erwach-
senenalter der fehlende Kontakt zum leiblichen Vater ist (McLanahan, Tach, Schnei-
der, 2013; Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera, Lamb, 2004).
1.4 Zusammenhänge zwischen schwierigen familiären Erfahrungen und
Beteiligung von Vätern
Das Aufwachsen unter schwierigen Bedingungen und eine höhere psychische Bela-
stung sind Risikofaktoren für eine geringere Beteiligung der Väter an der Fürsorge
ihrer Kinder (Jaffee, Caspi, Moffitt, Taylor, Dickson, 2001).
Trotzdem gibt es Schutzfaktoren, die diese Effekte verringern, wie z. B. alternative
Beziehungserfahrungen, die die Auswirkungen traumatischer Kindheitserfahrungen
deutlich abmildern können (Sperry u. Widom, 2013). In einer Gruppe junger Männer
zeigte sich, dass die Dauer ihres Aufenthaltes in einer Pflegefamilie positiv mit der
Intensität des Kontaktes zu ihren eigenen Kindern assoziiert war (Hook u. Courtney,
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021158 K. Nowacki et al. 2013). Auch die Männer, die eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater hatten, zeigten in einer Studie dann ein stärkeres Engagement gegenüber ihren Kindern, wenn sie in gesicherten finanziellen Verhältnissen lebten (Shannon, McFadden, Jolley-Mitchell, 2009). Stabile finanzielle und soziale Verhältnisse, in denen die wichtigsten Bedürf- nisse der Familienmitglieder befriedigt werden, können auch ein Schutzfaktor gegen die Auswirkungen eigener psychischer Misshandlungserfahrungen sein. Männer, die in ihrer Kindheit physische Misshandlung erlebten, haben zwar ein höheres Risiko, ge- fährdendes Verhalten gegenüber ihren Kindern zu zeigen, dies wird aber stark durch andere Faktoren wie schwierige Lebensverhältnisse durch geringes Einkommen, un- günstige Wohnverhältnisse und andere soziale Probleme beeinflusst (Buisman et al., 2020; Malinowsky-Rummell u. Hansen, 1993; Pears u. Capaldi, 2001). Insgesamt zeigten bisherige Studien, dass das Engagement von Vätern stark von ei- genen Kindheitserfahrungen abhängt. Wenn es sich um gravierende traumatische Er- lebnisse und Beziehungsabbrüche handelt, können die Auswirkungen durch alterna- tive Beziehungserfahrungen und abgesicherte Lebensverhältnisse gemildert werden. Jugendhilfemaßnahmen sollen die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen för- dern und helfen, vor Gefahren zu schützen und positive Lebensbedingungen zu schaf- fen (§1 SGB VIII). Damit können sie auch dabei helfen, die negativen Auswirkungen möglicher früher traumatischer Erfahrungen abzumildern. In der vorliegenden Studie wird untersucht, inwieweit dies gelingt und welche weiteren Interventionsformen not- wendig sein könnten, um die Vater-Kind-Beziehung zu stärken. 1.5 Hypothesen (H) Im ersten Schritt wird der Unterschied zwischen der Hauptstichprobe und einer Vergleichsstichprobe untersucht. H 1: Die Väter in der Hauptstichprobe, die in ihrer Kindheit Hilfen zur Erziehung erhalten haben, zeigen einen höheren Anteil traumatischer Erfahrungen und eine hö- here psychische Belastung als Väter einer Vergleichsstichprobe, deren Familien keine Jugendhilfe erhalten haben. Im zweiten Schritt wird die Hauptstichprobe genauer betrachtet. H 2a: Es wird angenommen, dass ein höheres Maß an traumatischen Erfahrungen zu einer höheren aktuellen psychischen Belastung der Väter führt, die sich wiederum negativ auf ihre heutige Familiensituation auswirken und dazu führen, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind haben (abwesende Väter). H 2b: In der Hauptgruppe wird angenommen, dass die Art der Hilfe für die Fami- lien der Väter in ihrer Kindheit eingriffsintensiver (ambulant bis stationär) war, wenn die traumatischen Erfahrungen stärker ausgeprägt waren. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die Art der Hilfen, die die Väter in ihrer Kindheit erlebt haben, ei- nen Einfluss auf ihre aktuelle psychische Belastung und die Familiensituation haben. H 2c: Zusätzlich wird angenommen, dass das väterliche Einkommen einen Einfluss auf die aktuelle psychische Belastung und die Familiensituation hat. Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online) © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021
Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
159
2 Methode
2.1 Stichprobe und Erhebung
Die Hauptstichprobe besteht aus n = 119 Vätern mit schwierigen familiären Erfahrungen,
die in ihrer Kindheit und Jugend intensive ambulante und/oder stationäre Hilfen zur Er-
ziehung durch das kommunale Jugendamt erhalten haben. Sie wurden im Wesentlichen
im erweiterten Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, über verschiedene Medien sowie di-
rekt über pädagogische Fachkräfte rekrutiert. Die Väter waren zum Zeitpunkt der Erhe-
bung alle volljährig, gaben ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme und erhielten
zum Abschluss einen Wertgutschein. Diese Studie wurde im Rahmen von CENOF
(Central European Network on Fatherhood) durchgeführt, ethische Fragen wurden vor
der Antragsstellung überprüft. Die Väter bestimmten den Ort der Durchführung des
circa zweistündigen Interviews (z. B. bei sich zu Hause oder an der Fachhochschule). Die
meisten Väter (n = 111) haben mindestens ein biologisches Kind (89 %), in 9 % der Fälle
auch ein Stiefkind (n = 11) und in 2 % ein Dauerpflegekind (n = 3). Das durchschnitt-
liche Alter der Väter betrug zum Zeitpunkt der Befragung 35.4 Jahre (SD 9.8).
Eine Vergleichsstichprobe von 36 Vätern (Durchschnittsalter 35.4 Jahre, SD 7.1)
wurde auf dieselbe Weise und in denselben Gebieten rekrutiert wie die Hauptstich-
probe. Sie wurden aufgenommen unter Berücksichtigung eines vergleichbaren Alters-
durchschnitts und nur, wenn ihre Herkunftsfamilie keine Hilfen zur Erziehung durch
das Jugendamt erhalten hat.
Für jeden Probanden der beiden Stichproben konnte eindeutig ein Kind identifiziert
werden, mit dem der Vater den meisten Kontakt hat oder hatte. Das durchschnittliche
Alter dieser Kinder betrug zum Zeitpunkt der Erhebung 6.5 Jahre (SD 6.7) in der
Hauptstichprobe (davon n = 56 Mädchen) und 5.3 Jahre (SD 4.4) in der Vergleichs-
gruppe (davon n = 20 Mädchen). Es gab keine bedeutsamen Alters- oder Geschlechte-
runterschiede zwischen den ausgewählten Kindern der beiden Gruppen.
2.2 Instrumente
Zu Beginn wurden soziodemografische Variablen des Vaters erhoben (u. a. auch
die aktuelle Wohnsituation und das Einkommen) und nach der Art und Dauer der
Hilfen zur Erziehung gefragt, die die Familie in seiner Kindheit erhalten hat. Zudem
wurde die aktuelle Familiensituation des Vaters erfasst und hierbei insbesondere der
Kontakt zum identifizierten Zielkind erfragt.
Im Anschluss wurde das Erwachsenenbindungsinterview (George, Kaplan, Main,
1985) durchgeführt und im Hinblick auf traumatische Erfahrungen mit der Maltreat-
ment Classification Scale (Barnett, Manly, Cicchetti, 1993) vergleichbar zu den Ar-
beiten von Madigan, Vaillancourt, McKibbon und Benoit (2012) sowie Madigan et
al. (2014) ausgewertet. Die Kodierungen variieren auf verschiedenen Intervallskalen
(von 0 = keine traumatischen Erfahrungen bis 5 = regelmäßig aufgetretene trauma-
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021160 K. Nowacki et al. tische Erfahrungen). 15 % der Interviews wurden durch zwei unabhängige Rater/in- nen ausgewertet und ein Summenscore (Min 0 bis Max 15) über die drei folgenden Skalen mit befriedigender Interraterreliabilität gebildet: körperliche Misshandlung (k = .81), sexueller Missbrauch (k = 1) und emotionale Misshandlung (k = .28). Während körperliche Misshandlung und sexueller Missbrauch eindeutiger zuzuordnen sind, ist emotionale Misshandlung oft schwieriger zu verstehen (MacMillan et al., 2009). Zum Abschluss der Datenerhebung füllten die Väter die deutsche Version von Franke (2000) des Brief Symptom Inventory-18 (Derogatis, 1993) aus, einen Selbst- auskunftsfragebogen mit drei fünfstufen Likert-Skalen für Angst, Somatisierung und Depression (von 0 = gar nicht bis 4 = extrem) bestehend aus jeweils sechs Items. Für weitere Analysen wurde der Global Severity Index (GSI) als intervallskalierte Variable verwendet, der aus dem Mittelwert der drei Skalen gebildet wurde und die Höhe der aktuellen psychischen Belastung angibt. 2.3 Datenanalyse Die IBM SPSS Version 24 (IBM, Armonk, NY, USA) wurde für die deskriptive Sta- tistik sowie die Varianzanalyse verwendet, während mit dem Programm R Version 3.42 (R Core Team, 2017) die Pfadanalyse berechnet wurde. In der Bewertung unser Modelle entspricht ein guter Fit einem Wert von mindestens 0.95 für die CFI bzw TLI nach Hu und Bentler (1999). Gemäß Browne und Cudek (1993) entspricht ein Wert von weniger als 0.5 für die RMSEA sowie SRMR einem guten und, ein Wert zwischen 0.8 und 0.5 einem akzeptablen Fit. 3 Ergebnisse 3.1 Soziodemografische Variablen 3.1.1 Hilfen zur Erziehung 17.6 % der Väter (n = 21) der Hauptstichprobe berichten von intensiven ambu- lanten Maßnahmen (mehrmals pro Woche) aufgrund massiver Probleme in ihrer Herkunftsfamilie. 14.3 % (n = 17) sind überwiegend, mit einer kurzen vorherigen Unterbringung in einer Heimgruppe, in Pflegefamilien aufgewachsen, 56.3 % (n = 67) wuchsen in Heimgruppen auf und 11.8 % (n = 14) haben häufige Unterbrin- gungswechsel zwischen Pflegefamilien und Heimeinrichtungen erlebt. 3.1.2 Familiensituation In der Hauptstichprobe sind 24.4 % (n = 29) der Väter mit der Mutter des ausgewähl- ten Kindes der Untersuchung verheiratet und leben gemeinsam in einer traditionellen Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online) © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021
Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
161
Kleinfamilie. 35.3 % leben in nicht-traditionellen Familienverhältnissen, wie z. B. al-
leinerziehend, getrennt lebend, Patchwork- oder Stieffamilie (n = 42). In allen Fällen
hatte der Vater regelmäßigen Kontakt zum Kind, das in Fällen von Trennung minde-
stens für zwei volle Wochenenden pro Monat bei ihm lebte. 40.3 % (n = 48) der Väter
hatten keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind und lebten in den meisten Fällen auch
nicht (mehr) mit der Mutter des Kindes zusammen (abwesende Väter). Es wurden
verschiedene Gründe genannt, aber in den meisten Fällen wurde der Kontakt zum
Kind durch deren leibliche Mutter oder das Jugendamt nicht gestattet, wobei 8.4 % der
Kinder (n = 10) fremduntergebracht waren. Es gab keine Altersunterschiede zwischen
den Vätern in den drei Gruppen der Familienkonstellation. Die Väter der Vergleichs-
stichprobe wurden so rekrutiert, dass sie mit ihrem Kind zusammenlebten, davon
50 % in traditionellen Familiensettings.
3.1.3 Väterliches Einkommen
Das Einkommen der Väter in der Hauptstichprobe beträgt 899,80 Euro netto pro
Monat (SD 930.18), in der Vergleichsstichprobe liegt es bei 1.428,69 Euro netto pro
Monat (SD 1164.22). Die Gruppen unterscheiden sich hier signifikant (t(47.599) =
-2.46, p = .017). In der Hauptstichprobe haben die „abwesenden Väter“ im Schnitt
ein deutlich geringeres Einkommen (M = 611,45, SD 661,54) als die Väter in tradi-
tionellen (M = 1.239,61, SD = 1.127,26) und nicht-traditionellen Familiensettings
(M = 1.002,82, SD 971,36) (F(118,2) = 4.71 p = .011*, R² = .28).
3.2 Traumatische Erfahrungen
In der Hauptstichprobe gaben n = 99 an, körperliche Misshandlung erlebt zu haben
(M = 2.43; Median = 3; SD = 1.53), n = 111 berichteten von emotionaler Miss-
handlung (M = 2.96; Median = 3; SD = 1.22) und n = 27 von sexuellem Missbrauch
(M = 0.60, Median = 0, SD = 1.21). Im Durchschnitt lag der Wert traumatischer
Erfahrungen über die drei Skalen bei 5.9 (SD 3.0) der Väter aus der Hauptstichprobe
(n = 119) und nur vier Väter (3.4 %) erwähnten keine traumatischen Erfahrungen.
Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen der verschiedenen
aktuellen Familiensituationen (F(2, 115) = 1.215; n.s. p = .300, R2 = 0.02).
In der Vergleichsstichprobe (n = 36) gaben n = 8 an, körperliche Misshandlung
(M = 0.33, Median = 0, SD 0.76), n = 8 emotionale Misshandlung (M = 0.47, Medi-
an = 0, SD = 1.08) und niemand, sexuellen Missbrauch erlebt zu haben. Hier lag der
durchschnittliche Wert genannter traumatischer Erfahrungen bei 0.8 (SD 1.6), wobei
26 (72.2 %) angaben, keine traumatischen Erfahrungen gemacht zu haben.
Damit gab es einen signifikanten Unterschied zwischen der Haupt- und der Ver-
gleichsstichprobe (t(109) = 13.26, p < .000**).
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021162 K. Nowacki et al.
3.3 Psychische Belastung
Die psychische Belastung, gemessen mit dem BSI-18, ist in der Hauptstichprobe
deutlich höher (M = 0.66; Median = 0.44, SD .65; n = 112) als in der Vergleichsstich-
probe (M = 0.36, Median = 0.22, SD 4.2; n = 34) (t(144) = 2.5; p = .013*). Innerhalb
der Hauptstichprobe zeigen die Männer aus der Gruppe der abwesenden Väter eine
Tendenz zu höherer psychischer Belastung (M = 0.82; SD .78; n = 44) als die Väter
aus traditionellen (M = 0.51; SD .45; n = 28) und nicht-traditionellen Familienset-
tings (M = 0.58; SD .57; n = 40) (F(2,109) = 2.44; p = .092; R = .21).
Hypothese 1, dass Väter mit schwierigen familiären Vorerfahrungen mehr Trauma-
tisierungen und eine höhere psychische Belastung angeben, kann bestätigt werden.
Daher wurden weitere Analysen durchgeführt, um die Zusammenhänge der frühen
Erfahrungen und ihren Auswirkungen auf die aktuelle Situation zu überprüfen.
3.4 Überprüfung von Zusammenhängen
Mit den Daten der Hauptstichprobe wurde in R mit der Software Lavaan (Rosseel,
2012) eine Pfadanalyse durchgeführt. Die ordinalskalierten Variablen wurden als
„ordered variables“ kodiert und fehlende Werte listenweise aus der Analyse gelöscht.
Das Pfadmodell bestätigte die Hypothese 2a, dass traumatische Erfahrungen in der
Kindheit ein signifikanter Prädiktor für die aktuelle psychische Belastung sind (p =
.004) und diese einen direkten Einfluss auf die aktuelle Familiensituation (traditio-
nell-nicht-traditionell/modern-abwesend) haben (p = .022). Das Modell zeigt einen
sehr guten Fit (χ2/df = .058, CFI = 1, TLI = 1.27, SRMR = .003, RMSEA = 0) und
wird in Abbildung 1 dargestellt.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die traumatischen Erfahrungen keinen di-
rekten Einfluss auf die Familiensituation hatten. Dies wurde durch eine ordinale Re-
gression mit Method „probit“ (t(115) = 0.981, p = 0.296, Deviance = 252.58) geprüft.
Summe der β= 0.294* β= 0.235*
traumatischen Psychische Belastung Familiensituation
Erfahrungen
Abbildung 1: Pfadmodell zur Überprüfung der Zusammenhänge zwischen traumatischen Erfahrun-
gen, psychischer Belastung und aktueller Familiensituation (* p < .05)
Eine zweite Pfadanalyse wurde durchgeführt, um zu überprüfen (Hypothese 2b),
inwieweit die Art der Hilfen zur Erziehung durch die Intensität der traumatischen
Erfahrungen beeinflusst wurde. Hier fand sich zwar kein signifikanter Unterschied,
allerdings eine starke Tendenz (p = .054). Die anderen Faktoren des ersten Modells
waren weiterhin signifikant (p = .002) bezüglich der Annahme, dass traumatische Er-
fahrungen die psychische Belastung beeinflussen, und bestätigen mit einem p-Wert
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
163
von .035, dass die psychische Belastung die aktuelle Familiensituation beeinflusst.
Dieses Modell weist einen akzeptablen aber schwächeren Fit auf (χ2/df = 1.207, CFI =
.967, TLI = .901, SRMR = .053, RMSEA = .052) und wird in Abbildung 2 dargestellt.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Muster der Hilfen keinen signifikanten
Einfluss auf die aktuelle Familiensituation hatten (t(113) < -1.94, p > 0.05). Die ak-
tuelle psychologische Belastung wird jedoch durch die Art der Hilfen der Erziehung
beeinflusst (F(3,107) = 2.962, p = 0.036*, R2 = 0.08). Die Hypothese 2b konnte zum
Teil bestätigt werden.
Muster der Hilfe
β= 0.239
Summe der β= 0.294* β= 0.235*
traumatischen Psychische Belastung Familiensituation
Erfahrungen
Abbildung 2: Pfadmodell zur Überprüfung der Zusammenhänge zwischen traumatischen Erfahrun-
gen und Muster der Hilfen sowie psychischer Belastung und aktueller Familiensituation (* p < .05)
Zusätzlich wurde untersucht, ob das Einkommen des Vaters ein signifikanter Medi-
ator für die Beziehung zwischen aktueller psychischer Belastung und der Familiensi-
tuation ist. Das gesamte Modell der Mediationsanalyse (s. Abb. 3) hat einen guten Fit
(χ2/df = 2.316/2, CFI = 0.973 TLI = 0.960, SRMR = 0.015, RMSEA = 0.038). Der Pfad
zwischen Einkommen des Vaters und Familiensituation ist signifikant mit p = .008
(t: -2.665) und der Pfad zwischen psychischer Belastung und Einkommen ist gerade
unter dem Signifikanzniveau mit p = .051 (t: -1.948). Der Pfad zwischen psychischer
Belastung und Familiensituation ist nicht mehr signifikant. Das bedeutet, dass sich die
psychische Belastung negativ auf das Einkommen des Vaters auswirkt, was wiederum
die Familiensituation negativ beeinflusst. Die Hypothese 2c konnte bestätigt werden.
Väterliches
Einkommen
β= -0.186 β= -0.279*
Summe der β= 0.311** β= 0.184
traumatischen Psychische Belastung Familiensituation
Erfahrungen
Abbildung 3: Mediationsmodell zur Überprüfung des Einflusses von Einkommen auf den Zusam-
menhang zwischen psychischer Belastung und aktueller Familiensituation (** p < .001; * p < .05)
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021164 K. Nowacki et al. 4 Diskussion Insgesamt kann festgestellt werden, dass Väter mit traumatischen Kindheitserlebnissen auch als Erwachsene noch eine hohe psychische Belastung angeben, was wiederum zu einem geringeren Kontakt mit ihren Kindern führt. Die Art der eingesetzten Hilfe zur Erziehung hat nicht genügend zur Abnahme der aktuellen psychischen Belastung bei- getragen, die sich wiederum negativ auf die aktuelle Familiensituation auswirkt und zu einer Reduktion des Kontaktes zu den eigenen Kindern führt. Nur sehr wenige Väter gaben an, eine Therapie durchlaufen zu haben. Hieraus könnten sich Hinweise erge- ben, dass frühe traumatherapeutische und auch traumapädagogische Ansätze stärker in die Arbeit der ambulanten und vor allem auch stationären Jugendhilfe einbezogen werden sollten (z. B. Lang et al., 2013). Dies könnte helfen, die erhöhte Gefahr für eine dauerhafte psychische Belastung zu reduzieren und die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen an die nächste Generation zu verhindern (Ellonen et al., 2017), denn Väter, die noch stark durch die traumatischen Erfahrungen belastet sind, sind gegebe- nenfalls weniger sensitiv für die Bedürfnisse ihrer Kinder. Hierauf gibt es Hinweise in einer kleinen Substichprobe der Väter der Hauptstichprobe, bei denen noch zusätzlich die Vater-Kind-Interaktion erfasst wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere In- tensität traumatischer Kindheitserfahrungen mit einer geringeren Qualität im Spiel mit ihren Kindern einherging (Ahnert et al., 2017). Neben den traumatischen Erfahrungen in der eigenen Kindheit, die in unserer Stichprobe zu deutlich geringerem Kontakt mit den Kindern führten, sind noch wei- tere Faktoren bedeutsam: beispielsweise das Einkommen des Vaters. Insbesondere die Gruppe der Väter, die keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben („abwesende Vä- ter“), weisen im Schnitt ein besonders niedriges Einkommen auf (nahe der Armuts- grenze) und haben eine deutlich höhere psychische Belastung. Wie bereits herausge- stellt, kann eine gesicherte soziale und monetäre Situation ein wichtiger Schutzfaktor für den Kontakt zwischen Vätern mit frühen traumatischen Erfahrungen und ihren Kindern sein (Shannon et al., 2009). Wichtig ist es, an dieser Stelle zu betonen, dass auch „abwesende“ Väter das Beste für ihre Kinder wünschen (Tamis-LeMonda u. McFadden, 2010). Die Väter unserer Studie haben den Kontakt oft nicht freiwillig eingestellt, die Kontakte wurden teilweise durch das Jugendamt nicht zugelassen und 8.4 % Fremdunterbringung der Kinder in der Stichprobe kann auf eine unzureichende Erziehung durch die leiblichen Eltern hindeuten. Auch die leiblichen Mütter der Kinder ließen, nach Angaben der Väter, den Kontakt teilweise nicht zu. Um die genauen Hintergründe für fehlenden Kontakt herausstellen zu können, müssten zusätzliche Informationen eingeholt werden. Insgesamt zeigt die Studie, dass es bedeutsam ist, genauer auf Väter mit trauma- tischen Erfahrungen und schwierigem familiären Hintergrund zu schauen. 60 % der Väter der Hauptstichprobe in der vorliegenden Studie hatten noch regelmäßigen Kon- takt mit ihrem Kind und lebten wenigstens zeitweise mit ihm zusammen. Damit wer- den einerseits ein Engagement und eine Ressource deutlich, gleichzeitig ist es wichtig, Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online) © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021
Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
165
insbesondere bei einer höheren Intensität traumatischer Erfahrungen, die Väter stär-
ker für die Bedürfnisse der eigenen Kinder zu sensibilisieren, um diese zu schützen.
Hierfür sind spezifische Programme geeignet, die Väter insbesondere aus benach-
teiligten Verhältnissen integrieren, deren schwierige Vorerfahrungen berücksichtigen
und versuchen, die Vater-Kind-Beziehung zu verbessern (z. B. Cowan, Cowan, Pruett,
Pruett, Gillette, 2014; Scourfield, Allely, Coffey, Yates, 2016).
Auch die Rolle der ökonomischen Situation, die einen Schutzfaktor bezüglich der
Auswirkungen schwieriger Kindheitserfahrungen darstellt, sollte sozialpolitisch be-
rücksichtigt werden und im Einzelfall sollten neben der therapeutisch ausgerichteten
Intervention auch Hilfen im Hinblick auf die Arbeits- und Einkommenssituation mit-
bedacht werden.
5 Grenzen der Studie
Eine Grenze dieser Studie ist die ungleiche Verteilung und der damit teilweise ver-
bundene geringe Stichprobenumfang in den einzelnen Gruppen der Hilfen zur
Erziehung. Insbesondere die Gruppe derjenigen, die in einer Pflegefamilie aufge-
wachsen sind, ist verhältnismäßig klein. Dafür haben sich viele Väter gemeldet, die
zumindest teilweise in Heimeinrichtungen aufgewachsen sind. Hierbei handelt es
sich allerdings auch um eine Hilfeform, die in Deutschland häufig und vor allem bei
älteren Kindern und Jugendlichen mit stärkeren Herausforderungen im Verhalten
eingesetzt wird, was bei Jungen häufiger auftritt als bei Mädchen (Günder u. No-
wacki, 2020). Trotzdem muss berücksichtigt werden, dass keine flächendeckende
Erfassung von Vätern durch kommunale Jugendhilfeträger erfolgte und die Rekru-
tierungsstrategie eine bestimmte Gruppe von Vätern angesprochen haben kann.
Zudem muss beachtet werden, dass das Ausmaß der Traumatisierung und die Art
der Hilfen durch ein Interview zu den Erinnerungen der Väter an die eigene Kindheit
erfasst wurde und nicht darüber hinaus Daten z. B. über die zuständigen kommu-
nalen Träger erhoben wurden. Eine Akteneinsicht bei den Jugendämtern war aus Da-
tenschutzgründen nicht möglich, zudem war teilweise nicht nachvollziehbar, welche
Kommune für den jeweiligen Probanden und die gewährte Hilfe zuständig war.
In zukünftigen Projekten sollten außerdem die Mütter von vornherein gleichbe-
rechtigt adressiert werden, um von diesen ebenfalls eine Einschätzung bezüglich der
Partnerschaft und der Vater-Kind-Beziehung zu erhalten. In der vorliegenden Studie
gestaltete sich der Einbezug der Frauen schwierig, vermutlich aufgrund der primären
Ansprache an die Väter.
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021166 K. Nowacki et al. Fazit für die Praxis • Es wurde deutlich, dass Väter mit traumatischen Kindheitserfahrungen psy- chisch stark belastet sind und sich dies negativ auf den Kontakt zu ihren Kin- dern auswirkt. • Maßnahmen der Jugendhilfe scheinen häufig nicht auszureichen, um diese Effekte ausreichend zu mildern. Daher sollten generell auch traumapädagogische und traumatherapeutische Ansätze in den Hilfen zur Erziehung von den Fachkräften der Sozialen Arbeit, in Zusammenarbeit mit Psychotherapeut/innen, berücksich- tigt werden, um eine effektivere Aufarbeitung zu ermöglichen. • Väter sollten stärker in Präventions- und Interventionsprojekte zum Beispiel im Rahmen ambulanter Jugendhilfe einbezogen werden, um mögliche Gefährdungs- momente schneller adressieren zu können, den Kontakt zu ihren Kindern zu för- dern und sie damit stärker als Ressource für ihre Familien einzubeziehen. Literatur Ahnert, L., Teufl, L., Ruiz, N., Piskernik, B., Supper, B., Remiorz, S., Gesing, A., Nowacki, K. (2017). Father-child play during the preschool years and child internalizing behaviors: Bet- ween robustness and vulnerability. Infant Mental Health Journal, 38, 1-13. Barnett, D., Manly, J. T., Cicchetti, D. (1993). Defining child maltreatment: The interface bet- ween policy and research. In D. Cicchetti, S. L. Toth (Hrsg.), Child abuse, Child Develop- ment, & Social Policy (S. 7-73). Norwood: Ablex. Brown, L., Callahan, M., Strega, S., Walmsley, C., Dominelli, L. (2009). Manufacturing ghost fathers: the paradox of father present and absence in child welfare. Child and Family Social Work, 14, 25-34. Browne, M. W., Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen, J. S. Long (Hrsg.), Testing structural equation models (S. 136-162). Newbury Park, CA: Sage. Buisman, R. S., Pittner, K., Tollenaar, M. S., Lindenberg, J., van den Berg, L. J. M., Compier-de Block, L. H. C. G., van Ginkel, J. R., Alink, L. R. A., Bakermans-Kranenburg, M. J., Elzinga, B. M., van IJzendoorn, M. H. (2020). Intergenerational transmission of child maltreatment using a multi-informant multi-generation family design. PLoS ONE 15(3): e0225839. Cowan, P. A., Cowan, C. P., Pruett, M. K., Pruett, K., Gillette, P. (2014). Evaluating a couples group to enhance father involvement in low-income families using a benchmark compari- son. Family Relations, 63, 356-370. Derogatis, L. R. (1993). Brief Symptom Inventory (BSI), administration, scoring, and proce- dures manual, third edition. Minneapolis: National Computer Services. Ellonen, N., Peltonen, K., Pösö, T., Janson, S. (2017). A multifaceted risk analysis of fathers’ self-reported physical violence toward their children. Aggressive Behavior, 43, 317-328. Evenson, R. J., Simon, R. W. (2005). Clarifying the relationship beween parenthood and de- pression. Journal of Health and Social Behavior, 46, 341-358. Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online) © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021
Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
167
Fergusson, D. M., Geraldine, F. H., McLeod, L., Horwood, J. (2013). Childhood sexual abuse
and adult developmental outcomes: Findings from a 30-year longitudinal study in New
Zealand. Child Abuse and Neglect, 37, 664-674.
Franke, G. H. (2000). Brief Symptom Inventory von L. R. Derogatis (Kurzform der SCL-90
-R). Göttingen: Beltz Test GmbH.
George, C., Kaplan, N., Main, M. (1985). Adult Attachment Interview protocol. Unpublished
manuscript. Berkeley, CA 1985.
Günder, R., Nowacki, K. (2020). Praxis und Methoden der Heimerziehung. Entwicklungen, Ver-
änderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe. Freiburg i. Br.: Lambertus.
Hofferth, S. L. (2006). Residential father family type and child well-being: Investment versus
selection. Demography, 43, 53-88.
Hook, J. L., Courtney, M. E. (2013). Former foster youth as fathers: risk and protective factors
predicting father-child contact. Family Relations, 62, 571-583.
Horan, J. M., Widom, C. S. (2015). Cumulative childhood risk and adult functioning in ab-
used and neglected children grown up. Development and Psychopathology, 27, 927-941.
Hu, L., Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis:
Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM
Corp.
Jaffee, S. R., Caspi, A., Moffitt, T. E., Taylor, A., Dickson, N. (2001). Predicting early father-
hood and whether young fathers live with their children: Prospective findings and policy
reconsiderations. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 803-815.
Jurczyk, K. (2014). Familie als Herstellungsleistung. Hintergründe und Konturen einer neuen
Perspektive auf Familie. In K. Jurczyk, A. Lange, B. Thiessen (Hrsg.), Doing Family. Warum
Familienleben nicht mehr selbstverständlich ist (S. 51-70). Weinheim: Beltz Juventa.
Lamb, M. (2010). How do fathers influence children’s development? Let me count the ways. In
M. E. Lamb (Hrsg.), The role of the father in child development (S. 1-26). New Jersey: Wiley.
Lang, B., Schirmer, C., Lang, T., Andreae de Hair, I., Wahle, T., Bausum, J., Weiß, W., Schmid,
M. (Hrsg.) (2013). Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik. Weinheim: Beltz.
Lee, S., Guterman, N., Lee, Y. (2008). Risk factors for paternal for paternal physical child abu-
se. Child Abuse and Neglect, 32, 846-858.
Lehman, S., Havik, O. E., Havik, T., Heiervang, E. R. (2013). Mental disorders in foster child-
ren: A study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry
and Mental Health, 7, 39.
Madigan, S., Vaillancourt, K., McKibbon, A., Benoit, D. (2012). The reporting of maltreat-
ment experiences during the Adult Attachment Interview in a sample of pregnant adoles-
cents. Attachment and Human Development, 14, 119-143.
Madigan, S., Wade, M., Plamondon, A., Vaillancourt, K., Jenkins, J. M., Shouldice, M., Benoit, D.
(2014). Course of depression and anxiety symptoms during the transition to parenthood for
female adolescents with histories of victimization. Child Abuse and Neglect, 38, 1160-1170.
Malinowsky-Rummell, R., Hansen, D. J. (1993). Long-Term Consequences of Childhood
Physical Abuse. Psychological Bulletin, 114, 68-79.
Maxwell, N., Scourfield, J. Featherstone, B. Holland,S., Tolman, R. (2012). Engaging fathers
in child welfare services: A narrative review of recent research evidence. Child and Family
Social Work, 17, 160-169.
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021168 K. Nowacki et al. MacMillan, H. L., Wathen, C. N., Barlow, J., Fergusson, D. M., Leventhal, J. M., Taussig, H. N. (2009). Child Maltreatment 3: Interventions to prevent child maltreatment and associated impairment. The Lancet, 373, 250-266. McKelvey, L. M., Burrow, N. A., Mesman, G. R., Pemberton, J. L., Bradley, R. H., Fitzgerald, H. E. (2012). Supportive fathers lessen the effects of mothers´ alcohol problems on children’s externalizing behaviors. Family Science, 3, 189-200. McLanahan, S., Tach, L, Schneider, D. (2013). The Causal Effects of Father Absence. Annual Review of Sociology, 39, 399-427. Nowacki, K., Schölmerich, A. (2010). Growing up in foster families or institutions: Attach- ment representations and psychological adjustment of young adults. Attachment and Hu- man Development, 12, 551-566 Nygren, K., Walsh, J., Ellingsen, I. T., Christie, A. (2018). What about the fathers? The pre- sence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway and Sweden. A comparative study. Child and Family Social Work, 24, 148-155. Pears, K. C., Capaldi, K. M. (2001). Intergenerational transmission of abuse: A two-generatio- nal prospective study of an at-risk sample. Child Abuse and Neglect 25, 1439-1461. Pérez, T., Di Gallo, A., Schmeck, K., Schmid, M. (2011). Zusammenhang zwischen interper- soneller Traumatisierung, auffälligem Bindungsverhalten und psychischer Belastung bei Pflegekindern. Kindheit und Entwicklung, 20, 72-82. R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for statistical computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Stati- stical Software, 48, 1-36. http://www.jstatsoft.org/v48/i02/. Schier, M., Jurczyk, K. (2007). „Familie als Herstellungsleistung“ in Zeiten der Entgrenzung. Aus Politik und Zeitgeschichte, 34, 10-17. Scourfield, J., Allely, C., Coffey, A., Yates, P. (2016). Working with fathers of at-risk children: Insights from a qualitative process evaluation of an intensive group-based intervention. Children and Youth Services Review, 69, 259-267. Scourfield, J. (2003). Gender and Child Protection. London: Palgrave Macmillan. Shannon, J. D., McFadden, K. E., Jolley-Mitchell, S. (2009). Men in the mirror: A qualitative examination of low-income men’s perceptions of their childhood relationships with their fathers. Family Science, 3, 215-228. Simpson, G., Nowacki, K. (2018). Kevin and Peter: responses to two ‘preventable deaths’. Eu- ropean Journal of Social Work, 21, 778-790. Skarstadt-Storhaug, A., Oien, K. (2012). Father’s encounters with the child welfare service. Children and Youth Services Review, 34, 296-303. Sperry, D. M., Widom, C. S. (2013). Child abuse and neglect, social support, and psychopa- thology in adulthood: A prospective investigation. Child Abuse and Neglect, 37, 415-425. Statistisches Bundesamt (2018). Familie, Lebensformen und Kinder. https://www.destatis.de/ DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2018-kap-2.pdf?__ blob = publicationFile Statistisches Bundesamt (2019a). Hilfen zur Erziehung, einschließlich Hilfen für junge Volljäh- rige in Deutschland nach Art der Hilfe. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-Jugendhilfe/Tabellen/hilfen-erziehung-jungevolljaehrige.html Statistisches Bundesamt (2019b). Kinderlosigkeit, Geburten und Familien. Ergebnisse des Mikrozensus 2018. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelke- Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online) © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021
Trauma
������������������������������������������������
von Vätern mit Jugendhilfeerfahrung������
169
rung/Haushalte-Familien/Publikationen/Downloads-Haushalte/geburtentrends-tabellen-
band-5122203189014.pdf?__blob = publicationFile
Stephens, M. E. (2013). The non-traditional family: An introduction. The Review of Black
Political Economy, 40, 27-29.
Tamis-Lemonda, C. S., McFadden, K. E. (2010). Fathers from low-income backgrounds. My-
ths and evidence. In M. Lamb (Hrsg.), The role of the father in child development (S. 296-
318). New Jersey: Wiley.
Tamis-LeMonda, C. S., Shannon, J. D., Cabrera, N., Lamb, M. E. (2004). Fathers and mothers
at play with their 2- and 3-year olds: Contribution to language and cognitive development.
Child Development, 75, 1806-1820.
Taylor, J., Daniel, B. (2000). The rhetoric vs. the reality in child care and protection: ideology
and practice in working with fathers. Journal of Advanced Nursing, 31, 12-19.
Troilo, J., Coleman, M. (2012). Full-time, part-time full-time, and part-time fathers: father
identities following divorce. Family Relations, 61, 601-614.
Turner, S., Taillieu, T., Cheung, K., Afifi, T. C. (2017). The relationship between childhood
sexual abuse and mental health outcomes among males: Results from a nationally repre-
sentative United States sample. Child Abuse and Neglect, 66, 64-72.
Witt, A., Münzer, A., Ganser, H.G., Fegert, J.M., Goldbeck, L., Plener, P.L. (2016). Experience
by children and adolescents of more than one type of maltreatment: Association of different
classes of maltreatment profiles with clinical outcome variables. Child Abuse and Neglect,
57, 1-11.
Korrespondenzanschrift: Prof. Dr. Katja Nowacki, Fachhochschule Dortmund, Fach-
bereich Angewandte Sozialwissenschaften, Emil-Figge-Str. 44, 44227 Dortmund;
E-Mail: katja.nowacki@fh-dortmund.de
Katja Nowacki, Silke Remiorz, Vanessa Mielke und Alexander Gesing, Fachbereich Angewandte Sozialwis-
senschaften, Fachhochschule Dortmund.
Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 154 – 169 (2021), ISSN: 0032-7034 (print), 2196-8225 (online)
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2021Sie können auch lesen