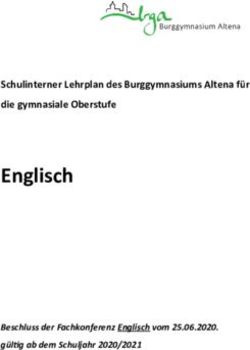Vor 100 Jahren wurde die Odenwaldschule gegründet Anfang und Erfolge, Krise und Zukunft eines "pädagogischen Laboratoriums"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ulrich Herrmann
Vor 100 Jahren wurde die Odenwaldschule gegründet
Anfang und Erfolge, Krise und Zukunft eines „pädagogischen
Laboratoriums“
Ansprache am 17. April 2010 anlässlich der 100. Wiederkehr des Eröffnungstages der Odenwaldschule (14.
April 1910) im Kurfürstensaal zu Heppenheim
Am 14. April 1910 wurde die Odenwaldschule von Paul und Edith Geheeb eröffnet. Man
muss, will man die Odenwaldschule (im allgemeinen OSO genannt) würdigen, immer beide
Personen nennen. Paul („Paulus“) war der pädagogische Kopf, sozusagen das pädagogische
Kraftzentrum der OSO, Edith war in allen Alltagsfragen die Erhalterin der Schule, und nicht
nur dies: Martin Wagenschein hat sie einmal die „pädagogische Herdflamme“, denn sie war
eine geduldige und kundige Begleiterin vieler Kinder und junger Leute, die ohne ihre leib-
liche Mutter in der OSO lebten. Deshalb habe ich auch der soeben erschienenen Ausgabe von
Schriften Geheebs und einigen Äußerungen der Mitarbeiter und Schüler der OSO das Bild
von Paul und Edith vorangestellt.
Paul Geheeb hielt eine kleine Ansprache, die er mit Goethes Versen des Prooemions
von „Gott und Welt“ begann und in denen jene Begriffe enthalten sind, die für das Schul-,
Erziehungs- und Bildungswerk das hier begann, kennzeichnend sind – Vertrauen, Liebe,
Tätigkeit und Kraft –, in einem „anmutigen Tal“, „zwischen Bergen und blumigen Wiesen“.
In einer solchen pädagogischen Idylle den Gedenktag an die Eröffnung der OSO be-
gehen zu dürfen, ist uns nicht vergönnt. Über dem „anmutigen Tal“ liegt der düstere Schatten
verratenen und missbrauchten Vertrauens – und nicht nur das, sondern auch der lange dunkle
Schatten von tiefem Leid und beschädigtem Leben, jungen Menschen angetan, die in eine
Falle geraten waren, bei Menschen, die ihnen hätten Schutz und Schirm bieten sollen und sich
in verantwortungsloser oder gar verbrecherischer Weise an ihnen vergingen.
Licht und Schatten liegen eng beieinander, wie es Amelie Fried in ihren Erinnerungen
an ihre OSO-Zeit formuliert hat. Die finsteren Kapitel sind aber nicht die ganze OSO-
Geschichte eines wechselvollen Jahrhunderts, in der es viele Lehrerinnen und Lehrer, Er-
zieherinnen und Erzieher, Helfer und Berater, Lehrmeister und all die anderen Mitarbeiter
gegeben hat, die ihr Bestes für die der OSO anvertrauten jungen Menschen taten, so dass
1diese das erleben durften, was die OSO ja sein wollte: ein „zweites Zuhause“; ein Ort er-
füllten Lebens und Strebens im Jugendalter, zusammen mit förderlichen Pädagogen und vor
allem mit den Kameradinnen und Kameraden (der eigentlichen Familie), woraus lebenslange
Freundschaften erwuchsen; vielleicht auch der letzte Rettungsanker in einem jungen Leben,
das zu entgleisen drohte.
Dass die OSO aber selber auch der Ort wurde, an dem junge Menschen beschädigt und
aus der Bahn geworfen wurden, muss auch am heutigen Tag Anlass sein, danach zu fragen,
was die Doppelgesichtigkeit und damit das Gefährdungspotential derjenigen Institutionen
ausmacht, die ähnlich konstruiert sind wie die OSO. Und die Antworten auf diese Frage
können dann sicherlich zugleich Hinweise darauf enthalten, wie die OSO den Start in ihr
zweites Jahrhundert gestalten muss.
So dient der heutige Gedenktag der Erinnerung an den Anfang der OSO und ihrer
großen Zeiten, und er dient dem Dank für viel Gutes, das hier bewirkt werden konnte. Dieser
Gedenktag soll aber auch helfen, Aufklärung zu bringen in das Dunkel eines bedrückenden
Teils der OSO-Vergangenheit und dadurch die Odenwaldschule unterstützen helfen, aus
diesem Dunkel heraustreten zu können. Salvador de Madariaga sagte einmal: Wer seine
Geschichte nicht kenne, sei dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und es gilt der andere Sinn-
spruch: Erinnerung ist das Medium der Befreiung. „Herr, befreie uns“ hören wir von einem
OSO-Chor.
Für die neu zu gewinnende Freiheit der Wahrhaftigkeit gibt es zwei Maximen: „Das
Geheimnis der Freiheit ist der Mut“ (ein Wort von Berthold Beitz) und „Wachsamkeit ist der
Preis der Freiheit“ (ein Wahlspruch des freien Westens zur Zeit des Kalten Krieges). Deshalb
ist der heutige Gedenktag auch ein Gedenktag an die Opfer und die Betroffenen. Frau Kauf-
mann hat dafür bewegende Worte gefunden, weil sie uns im Innersten angerührt haben; auch
ihr selber hat es schier die Sprache verschlagen. Es ehrt das gesamte Kollegium der OSO,
dass es heute – endlich – ein Bekenntnis abgelegt und eine Entschließung verabschiedet hat,
die an Entschiedenheit nichts zu wünschen übrig lassen.
Allen ist die Verpflichtung erwachsen, Lehren zu ziehen, wenn die OSO unein-
geschränkt das leisten können soll, was das Gründerehepaar sich gewünscht hat: dass hier
junge Menschen zu selbständigem Denken und Handeln angeleitet werden, dass sie sich zu
gefestigten Persönlichkeiten und aus erfahrener Verantwortung füreinander zu Staatsbürgern
entwickeln können. Dass dies Gelingen und Misslingen kann, dass in Erziehungs- und
Bildungsprozessen Ergebnisse nicht technisch verfügbar sind, wusste Geheeb nur zu gut.
Kinder und junge Leute müssen gewagt werden, und dieses Wagnis legt den Lehrern und Er-
2ziehern besondere Verpflichtungen auf, erst recht dann, wenn die jungen Lebensentwürfe in
Turbulenzen geraten und in ruhigere Gewässer zu leiten sind. Mithin: Vor welchen Heraus-
forderungen steht die OSO heute?
Der mir freundschaftlich verbundene taz-Redakteur Christian Füller hat am 14., also
am eigentlichen 100. Gründungsjahrestag, in SPIEGEL ONLINE geschrieben: „man mag sich
kaum vorstellen, wie der Festredner [ich bin gemeint] das Besondere der Reformpädagogik
im Festsaal [in dem wir uns hier befinden] unfallfrei herausheben könnte: dass sich der Lehrer
den Kindern mit besonderer Nähe zuwendet.“ Während Christian Füller seinen Text schrieb,
telefonierten wir und ich klärte ihn auf, (1) es handele sich nicht um eine „Festrede“; (2) dass
sexueller Missbrauch von Heranwachsenden im Repertoire reformpädagogischer Praxis nicht
vorkäme, sondern ein Straftatbestand sei, der ohne jedes Wenn und Aber zu Hausverbot, ge-
richtlicher Verurteilung und Berufsverbot führen müsse; (3) dass „besondere Nähe“ kein
reformpädagogisches Prinzip sei und dass (4) das Problem von Nähe und Distanz zwischen
den Geschlechtern und Generationen, zwischen Kindern und Eltern in „natürlichen“ und in
„pädagogischen [Ersatz-]Familien“ (Geheeb) kein „unfallfreies“ Terrain sei, am wenigsten
übrigens, wie die Statistik belegt, in „natürlichen“ Familien (wie gestern auf dem Podium
Frau von Weiler dargelegt hat) und nicht in deren institutionalisierten „Ersatz“-Formen,
worauf ich schon am Beginn der Kommentierung der jetzt wieder ans Licht gekommenen
OSO-Vorfälle hingewiesen habe.
1.
Ein Blick auf den Anfang und auf die Erfolge
des „pädagogischen Laboratoriums“ Odenwaldschule
Wie war denn nun der Anfang der OSO? Man dürfe nicht annehmen, erzählte Paul Geheeb im
Frühjahr 1958 dem damaligen OSO-Leiter Walter Schäfer,
„dass, als ich am 14. April 1910 die Odenwaldschule eröffnete, so Schwarz auf Weiß ein
genaues Programm vorlag. Die Eingabe, die ich dem Ministerium [in Darmstadt] eingereicht
habe, hatte sich ja nur in sehr allgemeinen Gedankengängen und Ausführungen bewegt. Nach
dieser Eingabe konnte man sich absolut kein Bild unseres wirklichen Schullebens, Gemein-
schaftslebens machen. Sondern wir fingen einfach an, mit einander zu leben. Es war zunächst
naturgemäß ein kleiner Kreis gleichgestimmter Menschen, die glückliche Fügung, dass sich
so gleichgestimmte Menschen zusammenfanden. Und sozusagen instinktiv lebten wir mit-
einander. Ich war nur ängstlich darauf bedacht, nichts zu dulden, nicht zuzulassen, dass sich
irgendwelche Gebräuche, irgendwelche Einrichtungen aus den traditionellen Schulen oder
[aus dem] Internatsleben einschlichen, die für uns einfach keinen Sinn hatten […] Erst nach-
dem wie monatelang, jahrelang existiert hatten, da kamen die Überlegungen intellektuell
3hinterher.“ „Von da aus bitte ich Sie zu beachten, dass ich immer überwiegend unbewusst
gelebt habe und dass das verstandesmäßige Reflektieren eine sehr geringe Rolle in mir spielte,
meistens eben erst eine nachträgliche.“
Eine Schulgründung heute wäre mit einem Antrag, wie ihn Geheeb eingereicht hatte, gänzlich
aussichtslos. Damals genügte es, dass der Antragsteller auf eigene erfolgreiche pädagogische
Erfahrungen, auch als Schulgründer verweisen konnte. Zum Schulprogramm führte der An-
tragsteller aus, der Lehrplan der Oberrealschule solle zugrunde gelegt werden, aber eigentlich
auch wieder nicht: „Die neue Schule will […] einen eigenen Lehrplan schaffen, der den
Forderungen der modernen Pädagogik entspricht und aus den Erfahrungen der öffentlichen
Realgymnasien und Reform-Realgymnasien gelernt hat.“ Einzelheiten und Begründungen
fehlen; es solle ein „pädagogisches Laboratorium“, eine „Zukunftsschule“ entstehen.
Mit einem solchen Antragstext würde heute ein Kultusministerium oder eine Ge-
nehmigungsbehörde einen Antragsteller als Hochstapler oder Spinner oder beides einstufen
und eine Genehmigung nicht nur wegen fehlender Begründung ablehnen, sondern um Eltern
und Schüler vor einem nicht zu verantwortenden Risiko zu bewahren. Und dann hatte die
Sache ja noch eine weitere Pointe, die das Darmstädter Ministerium nicht einmal ahnen
konnte: der Schulgründer war weder gewillt noch in der Lage, diese Lehrplanarbeit selber in
die Hand zu nehmen, sondern er gedachte, damit einen befreundeten jungen Lehrer aus Darm-
stadt, Otto Erdmann, zu beauftragen, und der wiederum solle sich mit dem eigentlichen Er-
finder des neuen Lehr- und Arbeitssystems der neuen Schule in Verbindung setzen: einem
ehemaligen Schüler aus Haubinda und Wickersdorf und jetzigen Studenten in Paris, Mario
Jona. Beide haben darüber berichtet.
„Damals“, schreibt Jona im Rückblick auf seine Zeit in Wickersdorf so um 1908, „entwarf
ich, von der Erfahrung ausgehend, dass der übliche Stundenplan zu keiner stetigen Eigen-
arbeit kommen lässt, für Unter- und Oberprima in Wickersdorf einen Arbeitsplan, der einen
dreiwöchentlichen Zyklus umfasste. Eine Woche war der Sprache vorbehalten; dem
deutschen Aufsatz 2 bis 3 aufeinander folgende Tage, die für die Lektüre, Vorbereitung und
Niederschrift dienten; dann ebenso zusammenhängende Zeiten für die fremden Sprachen. Die
zweite Woche war historischen Arbeiten im weitesten Sinne bestimmt, und die dritte den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Dann begann der Zyklus von neuem. […]
Im Sommer 1912 arbeitete ich einen ausführlichen Plan für die Unterrichtsorga-
nisation aus, der Otto Erdmann die Anregung zur Aufstellung seiner Grundzüge für die
Arbeitsorganisation der Odenwaldschule gab. In gemeinsamer Arbeit entwickelten wir im
Herbst des Jahres alle Einzelheiten der neuen Arbeitsorganisation, die die angemessene Form
für die Arbeitsschule werden sollte und die folgerichtige Fortsetzung des durch Einführung
der ‚Fachzimmer’ eingeschlagenen Weges war. Lehrerkollegium und Schülerschaft wurden in
die Gedanken eingeführt, die Fächer mit den Fachlehrern in die in sich abgeschlossenen
Fachgebiete, in die ‚Kurse’ eingeteilt. Weihnachten 1912 war Otto Erdmann bei mir in meiner
Studentenwohnung in Paris. Fieberhaft haben wir nach den vorliegenden Berichten der Lehrer
4über den Wissens- und Interessensstand der Schüler die erste Kurseinteilung vorgenommen
und den Arbeitsplan festgelegt. Januar 1913, nach den Ferien, begann die Arbeit nach der
Kursorganisation.“
Wie das nun eröffnete „pädagogische Laboratorium“ arbeitete, schilderte Otto Erdmann
folgendermaßen:
„Schöne Aufgaben stellte die neue Form dem Lehrer. Er hatte sein ganzes Unterrichtsgebiet
in sachlich abgeschlossene Teilaufgaben zu zerlegen, für jeden solchen ‚Kurs’ eine klare
Inhaltsaufgabe aufzustellen. Dem Schüler musste ja im voraus gesagt werden, was er in dem
einzelnen Kurs zu erwarten hatte. Ungemein belebt wurde das Schulbild durch den monat-
lichen Abschluss aller gleichzeitigen Kurse in einer Schulgemeinde, die jedem Lehrer und
Schüler einen Querschnitt durch die ganze Arbeit, Ausblick auf das Kommende, Rückblick
auf das Gewonnene bot. Besondere Möglichkeiten taten sich auf. Es konnten Lehrer
monateweise ausscheiden, um den Zusammenhang mit Wissenschaft und Leben zu pflegen.
Andere konnten gastweise für einzelne Kurse herangezogen werden. Ein Kurs konnte auch
auf Reisen abgehalten werden, z.B. ein Fremdsprachenkurs in England oder Frankreich, ein
geologischer auf Wanderung. Dem einzelnen Schüler war die Gelegenheit gegeben, innerhalb
des einheitlichen Schulganzen sich verschiedene Ausbildungswege zu wählen. […] Auch
konnte der in einem Fach weniger Erfolgreiche durch Wiederholung eines Kursus sein Ziel
erreichen ohne das pädagogisch und zeitökonomisch gleich verdammenswerte ‚Sitzenbleiben’
des gewöhnlichen Klassensystems, durch das der Schüler auch in allen übrigen Fächern nutz-
los zurückgehalten und gelangweilt wird.“
Als erstes wurde also der Lehrplan außer Kraft gesetzt. In einem Kurs, wo nicht nur zugehört,
sondern gearbeitet werden soll – das Prinzip der Arbeitsschule war der reformpädagogische
Kern der OSO als Schule – geht es um Themen bzw. Fragestellungen. Sie mussten erarbeitet
und begründet und in eine Abfolge gebracht werden. Einzelne Kursteile mussten in sich ab-
geschlossen sein, um eine Einsicht in einen Sachverhalt zu gewähren. Die Verbindung der
Kurse musste einen einigermaßen kohärenten Überblick über ein größeres Thema bzw. ein
Fachgebiet ermöglichen, mit den hier charakteristischen Fragestellungen und Arbeitsweisen
vertraut machen und zu einem abschließenden Arbeitsergebnis führen. Von den Lehrerinnen
und Lehrern wurde also gefordert, was ihre eigentliche Qualifikation im Hinblick auf „Unter-
richt“ ausmachen sollte: nicht diesen „zu erteilen“, sondern Themen und Kurse zu
konstruieren und mit Arbeitsmaterialien auszustatten, anhand derer die Schülerinnen und
Schüler sich (fallweise auch unter Anleitung der Lehrkraft) einarbeiten können. Geheeb in
seiner Programm- und Werbeschrift von 1910: „Wir schätzen daher den Lehrer am höchsten,
der sein Dozieren am weitesten zurücktreten lässt hinter dem selbständigen Arbeiten eifrig
interessierter Kinder und sich selbst mehr und mehr überflüssig zu machen versteht.“
Die Odenwaldschule ging damit von der Angebots- zur Nachfrage-Orientierung über:
die Kursangebote mussten, sollten sie gewählt werden, Neugier und Interesse wecken; dann
5war man der Schwierigkeit überhoben, Motivation zu wecken, denn diese ist die Folge von
Neugier und Interesse, dann aber auch von Erfolgserlebnissen, die sich dadurch einstellen,
dass jeder Schüler nach seinem Vorwissen, nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten
arbeitet und das Ergebnis der Schulgemeinde vorweisen kann. Präsentation heißt das heute.
Daraus können sich dann neue Anschlussthemen ergeben, die mit neuem Elan angegangen
werden können, und wo sich ein Arbeitsvorhaben als Sackgasse erwies, muss keine Zeit und
Energie auf eine sinnlose Fortsetzung verschwendet werden, sondern ein neues Thema in
einem neuen Kurs setzt einen neuen Anfang. Kein Schüler versackt in seinen Schwächen,
sondern kann einem Anlauf nehmen zu neuen Erfolgen und damit zur Stärkung seiner
Erfolgszuversicht.
Wichtig ist bei diesem Verfahren natürlich die genaue Beobachtung und
Dokumentation der Fähigkeiten und Fortschritte der einzelnen Schülerinnen und Schüler –
denn es gab ja keine „Klassen“ und deshalb auch keine „Klassen“- als Vergleichsarbeiten.
Auf diese schriftlichen Dokumentationen, vor allem auch zur Unterrichtung der Eltern, hat
Geheeb viel Aufmerksamkeit, Mühe und Zeit verwandt.
Otto Erdmann hat aber auch die weiterreichenden Ziele und Konsequenzen dieses
Kurssystems dargelegt, das sich eben nicht im Lernpsychologischen und Methodisch-
Didaktischen erschöpfte, sondern Reformpädagogik als Schulstruktur-Reformpolitik verstand:
„Aktivität, eigene Initiative des Schülers, das war der Leitgedanke. Darum individuelle
Differenzierung des Studienganges, darum die Möglichkeit der Kurswahl, Beseitigung der
Mosaikgestalt des üblichen Stundenplans, der 10 und mehr Fächer in löffelweisen Gaben von
je 40 Minuten bunt und willkürlich miteinander wechseln lässt. Konzentration der Arbeits-
kraft auf nur 2 Hauptgegenstände während einer 4-wöchigen Periode – das war der Weg, den
wir wählten. […]
Dem einzelnen Schüler war die Gelegenheit gegeben, innerhalb des einheitlichen
Schulganzen sich verschiedene Ausbildungswege zu wählen. Der humanistische Typ hatte
Platz neben dem realistischen und dem realgymnasialen. […] Aber auch ganz abweichende
Wege waren denkbar, etwa eine vorwiegend handwerkliche, vorwiegend musikalische oder
künstlerische Ausbildung. […]
Die Arbeitsorganisation der Odenwaldschule könnte als Modell dienen für die Ge-
staltung jener einen Schule, die wir ersehnen, einer wahren Volksschule und Einheitsschule,
einer vielgestaltigen Jugendakademie, die nicht nur dem ganzen Volk geöffnet ist, sondern
auch vom ganzen Volk als gemeinsame, ja als die höchste gemeinsame Angelegenheit
empfunden und getragen wird.“
So viel zur Odenwaldschule als Schule. Die OSO sollte aber auch Landerziehungsheim sein.
Erich Lehmensick, damals Dozent an der Pädagogischen Akademie Kiel, hat 1930 das
„Wesen“ der Landerziehungsheime und damit auch Geheebs pädagogische Konzeption in
folgender Weise treffend charakterisiert:
6„Die Landerziehungsheime bilden den neuen Typus einer höheren Schule: meist Oberreal-
schule, in Internatsform, auf dem Lande gelegen, mit reformpädagogischen und kultur-
reformerischen Zielen. Im Gegensatz zur öffentlichen Schule, die die Schüler stets nur für
Stunden hat und wesentlich nur den Intellekt erfasst und bildet, wird hier eine Erziehungs-
stätte, eine pädagogische Provinz entwickelt, die sich des ganzen Lebens des Schülers an-
nimmt. Neben den Unterricht treten handwerkliche Beschäftigungen, Gemeinschaftsstunden,
Feste, Sport und Reisen als wichtige Erziehungsfaktoren. Zwischen Lehrer und Schüler ent-
wickeln sich Freundschafts- und Führer-Gefolgschaftbeziehungen [das ist die Sprache der
Bündischen Jugend, die der NS übernahm], die häufig als ‚Familien’ oder ‚Kameradschaften’
die innere Gliederung der Schulen darstellen. Mitbeteiligung der Schüler am ganzen Er-
ziehungswerk verstärkt die auf Vertrauen und Gemeinschaftsgesinnung gegründete
pädagogische Atmosphäre und verwirklicht das Ziel einer echten Schulgemeinde. Gegenüber
Verweichlichung, Genusssucht, Egoismus und Scheinkultur eines modernen großstädtischen
Lebens wird hier versucht, eine neue und zugleich jugendgemäße Lebensform zu entwickeln.
Einfachheit der Lebensführung in Kleidung und Nahrung (alkohol- und nikotinfrei), gesunde
Durchbildung des Körpers (täglicher Dauerlauf am Morgen, Sport), eine auf kameradschaft-
liche Hilfe und Toleranz eingestellte Gesinnung und ein das ganze Heimleben befestigender
und erhöhender Lebensstil werden angestrebt. […]“
An dieser Charakterisierung ist eingangs der Hinweis wichtig, dass sich die Landerziehungs-
heime aus zwei Impulsen speisten: aus Kulturkritik und Lebensreform sowie aus der Reform-
pädagogik. Erstere betraf u.a. die Lebensformen des Zusammenlebens der Generationen und
der Geschlechter (Koedukation) mit dem Ziel, einen „erhöhenden Lebensstil“ zu finden,
letztere die Lernorganisation der Arbeitsschule, die Rhythmisierung des Tages, die Ver-
bindung von Lernen und praktischem Arbeiten, von intellektueller und musischer Bildung.
Deshalb lege ich Wert darauf, dass mit dem Fehlverhalten und Straftatbestand „sexueller
Missbrauch“ nicht die Reformpädagogik auf dem Prüfstand steht, sondern die Lebensform
des Internats. Richtig wiederum ist, dass es zwischen Lebensreform und Reformpädagogik
eine innere Verbindung gibt, nämlich der Gedanke – den die heutige Neurowissenschaft auf
eindrucksvolle Weise bestätigt –, dass förderliche zwischenmenschliche Beziehungen z.B.
zwischen Lehrer und Schüler, bei denen der Schüler erfährt, dass er als Person im Mittelpunkt
des Interesses und der Aufmerksamkeit steht, eine entscheidende Voraussetzung bilden für
Motivation, Engagement und Leistungsbereitschaft. Daraus entsteht das Problem von Nähe
und Distanz, dessen Handhabung – anders als in den üblichen Schulen – im Landerziehungs-
heim bzw. im Internat immer eine prekäre Gratwanderung darstellt. Ich komme im nächsten
Teil meiner Ausführungen darauf zurück.
Von den Zeitgenossen wurde die OSO als der „kühnste Schulversuch“ in Deutschland
wahrgenommen, vor allem wegen ihres Kurssystems. Die Blütezeit der OSO endete 1934. Sie
überlebte die Nazi-Zeit durch Anpassung und Camouflage, sogar jüdische Kinder wurden hier
versteckt. Paul und Edith Geheeb gingen mit einigen Mitarbeitern und Kindern ins
7schweizerische Exil, wo sie eine neue Schule eröffneten, die spätere und bis heute in Blüte
stehende Ecole d’Humanité in Goldern im Berner Oberland. Der Eröffnungstag der neuen
Schule, des Institut Monnier in Versoix bei Genf, war auf den Tag genau vor 76 Jahren am
17. April 1934.
Die prominente Sozialistin und Reformpädagogin Minna Specht – sie hatte 1918
schon in Haubinda als Lehrerin gearbeitet und von 1922 bis 1933 das Landerziehungsheim
Walkemühle (bei Melsungen) geleitet – übernahm 1945 die Leitung der neu eröffneten
Odenwaldschule. Sie knüpfte an die Traditionen der Odenwaldschule vor 1933 an und setzte
neue zeitgemäße Akzente, vor allem bei der Reform der Gymnasialen Oberstufe (Arbeits-
gruppen, Epochenunterricht) und durch die Einführung der Werkstudienschule und des poly-
technischen Werkfachs mit Gesellenprüfung. Unter ihren Nachfolgern Kurt Zier (seit 1951)
und Walter Schäfer (seit 1962) wurde die Odenwaldschule wieder ein „pädagogisches
Laboratorium“, eine „Laborschule“, nicht zuletzt auch durch das Wirken von Wolfgang Edel-
stein, seit 1954 Lehrer, ihr Studienleiter von 1961 bis zu seinem Überwechseln im Jahre 1963
in das von ihm mitbegründete Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Überaus
beeindruckend ist die Titelliste der 30 Hefte umfassenden „Schriftenreihe der
Odenwaldschule“ von Mitte der 50er bis Anfang der 60er Jahre im Eigenverlag und die Hefte
im Hirschgraben-Verlag, in denen nicht nur die pädagogische und unterrichtliche Praxis der
OSO sozusagen umgepflügt wurde, sondern Schulreform und Schulstrukturreform durchdacht
und umgesetzt wurde. Die OSO wurde eine „differenzierte Gesamtschule“ (so das von
Wolfgang Edelstein 1967 vorgelegte Heft), und sie erfüllte damit gewissermaßen eine
Voraussage von Otto Erdmann. Es sei, schrieb er 1930,
„wohl angemessen hervorzuheben, dass die Kursorganisation der Odenwaldschule das Modell
geben kann zu einer weit sinnvolleren Gestaltung der Einheitsschule. Denn eine Schule,
welche nach dem System der frei wählbaren Kurse aufgebaut ist, vereinigt in sich nicht nur
die Ausbildungswege dieser Schultypen [der verschiedenen weiterführenden Schulen bzw.
Gymnasien], sondern auch unzählige andere. […] In einer derartigen Einheitsschule ist die
Entscheidung für diesen oder jenen Bildungsweg nicht an bestimmte Termine und eng be-
grenzte Möglichkeiten gebunden; es ist nie zu früh und nie zu spät für eine dem wahren Be-
dürfnis des Lernenden angepasste Wahl.“
Es ist offensichtlich, dass man sich in manchen Ministerien der Bundesrepublik in Sachen
Schulpolitik erst mal wieder auf die Höhe der Vergangenheit zu begeben hätte, um zu ver-
stehen, wie man Schulen in der Demokratie zu differenzierten Leistungsschulen ausgestaltet,
zu Schulen für alle, in der jeder seinen für ihn optimalen Abschluss für den von ihm an-
gestrebten Anschluss erwerben kann – was die OSO, zu ihrem Ruhme sei es gesagt, mit einer
8Vielzahl von Abschlüssen auch in der Kombination mit einer beruflichen Grundausbildung
bis heute ermöglicht.
Ich beende hier meinen kleinen Streifzug durch die Erfolgsgeschichte der OSO und
wende mich dem Thema zu, das uns heute bedrängt und bedrückt und mit Trauer und mit Ent-
setzen erfüllt.
2.
Düstere Schatten über der Odenwaldschule
Ich hatte für das Austarieren von Nähe und Distanz von einer prekären Gratwanderung ge-
sprochen, d. h. dass sie in der einen wie der anderen Richtung auch scheitern kann: zu große
Nähe kann als entwicklungshemmende Abhängigkeit, zu große Distanz als Desinteresse oder
gar Ablehnung erlebt werden. Die pädagogische Aufgabe besteht mithin darin, beides zu
vermeiden und die sich entwickelnde und entfaltende junge Persönlichkeit auf ihren Weg zu
bringen. Pindars „Werde, der du bist, durch Lernen“ war bekanntlich Geheebs Wahlspruch.
Die Reformpädagogik übernahm aus der Jugendbewegung das Erlebnis der Freund-
schaft und Kameradschaft als Leitbild des Lehrers als Vorbild und Erzieher, und die Land-
erziehungsheime übernahmen das Prinzip der „pädagogischen Familie“ anstelle der Form
einer Unterbringung wie in Heimen oder Klosterschulen: die Kinder/Schüler in Schlafsälen,
getrennt vom Privatleben des pädagogischen Personals.
Die „natürliche“ und die „pädagogische“ Familie, beide erweisen sich als Orte des
Schutzes und der Gefährdung. Der Ort der häufigsten Übergriffe und Missbrauchsfälle ist die
Familie. Sie ist im Normalfall für Kinder und Heranwachsende der sichere Hafen der Gefühle
und des Vertrauens, der Geborgenheit und der Zuflucht. Misstrauen gegen das, was Vater und
Mutter und andere Familienangehörige tun und unterlassen, wird hier nicht gelernt. Deshalb
sind die zunächst vertrauensseligen und dann missbrauchten Kinder und Heranwachsenden
ihrem Unheil und ihren Peinigern schutzlos ausgeliefert. Ausweich- oder Fluchtmöglichkeiten
gibt es praktisch nicht. Die Vergehen an den Kindern sind von einer Mauer des Wegsehens
und des schamvollen Verheimlichens umgeben: der „gute Ruf“ der Familie soll keinen
Schaden nehmen.
Die Familie ist eine Institution mit geringer Außenkontrolle, die Eingriffsmöglich-
keiten z. B. der Jugendämter sind sehr begrenzt. Und so geschehen Übergriffe und sexueller
Missbrauch auch in analogen Institutionen mit geringer Außenkontrolle: in Klöstern und Ge-
fängnissen, beim Militär und bei den Pfadfindern, in Landerziehungsheimen und Kloster-
9schulen und – ein besonders düsteres Kapitel, dass derzeit ein Runder Tisch aufarbeitet – in
den (kirchlichen) Waisenhäusern und Kinderheimen (besonders der Nachkriegszeit). –
Übrigens geschehen Übergriffe und Missbrauch auch in den Konstellationen Gleichaltriger
(besonders in Gefängnissen, in Heimen und beim Militär), so dass uns z.B. der Ausschluss der
Erwachsenen aus der Struktur und den Häusern der „Kameraden“-Familien im Landheim
keine Sicherheitsgewähr vor Übergriff und Missbrauch gibt.
Wenn wir verstehen und erklären wollen, was hier geschehen konnte, muss sich unser
Blick in mehreren Hinsichten auf die Institution richten; und vor allem: Was hier geschah
(und geschieht), wird von Menschen getan, und sie tun es individuell und unter bestimmten
ermöglichenden Bedingungen, es ist weder zufällig noch zwangsläufig. So auch in der
Institution Odenwaldschule und bei den in ihr möglichen und praktizierten Mikrostrukturen
von Abhängigkeiten, Übergriffen und Missbrauch. Noch einmal: Es ist abwegig, Kindesmiss-
brauch bzw. Pädophilie und Reformpädagogik in einen direkten Zusammenhang zu bringen,
wie uns jetzt beispielsweise der Zürcher Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers glauben
machen will.
Institutionen können interne „Kulturen“ ausbilden, die von außen kaum zu
kontrollieren oder zu korrigieren sind, weil diese „Kulturen“ – oder manchmal auch richtiger:
„Un-Kulturen“ – entweder schwer zu unterbinden sind oder weil sie Tabuisierung oder Ver-
schweigen unterliegen, um nicht gegen ein höherwertiges Gut zu verstoßen, in der Regel
gegen „den guten Ruf“. In der Soziologie heißen diese Institutionen auch „totale“. Die hier in
Abhängigkeit und meist ohne nennenswerte Außenkontakte lebenden Menschen – Kinder und
Schüler, Strafgefangene, Rekruten usw. – haben aus mehreren Gründen wenig Schutz vor
Übergriffen oder Missbrauch: es gibt, von Ausnahmen abgesehen, keine Möglichkeiten des
internen Ausweichens oder der Flucht nach außen. Durch internes Ausweichen, sofern über-
haupt möglich, droht die Gefahr des Außenseitertums, was verstärkte und vermehrte Ge-
fährdung bedeuten kann; die Flucht nach außen setzt eine Auffangstation voraus, die im
Zweifel nicht gegeben ist. – Nicht nur nebenbei: Wo waren eigentlich die Eltern der OSO-
Schüler, soweit sie ihre Kinder nicht einfach abgeschoben und abgestellt hatten? Und wer
kümmerte sich in dieser Hinsicht um die „Jugendamtskinder“? Wer ist dem nachgegangen,
wenn das Heimfahr-Wochende ein Verweil-Wochenende wurde? Wenn keine Post mehr
kam? Geheeb hat die Eltern ausdrücklich eingeladen, oft in die OSO zu kommen und mit den
dortigen Pädagogen Kontakt zu halten, hatten sie doch der OSO „ihr Liebstes, ihr Kind“ an-
vertraut. War das in Vergessenheit geraten?
10Zurück zur OSO und den fürchterlichen Missbrauchsfällen. Jemand konnte sich
vielleicht zur Wehr setzen und die „Familie“ wechseln, aber um welchen Preis? Woher hätten,
je nach biographischem Hintergrund, Mut und Stärke, aber auch ermutigende und be-
schützende Unterstützung kommen können? Hier müsste es übrigens heißen: herkommen
müssen! Und welche Chancen hatten jene, für die die OSO selber die letzte Auffangstation
war? Welcher Halbwüchsige kann sich mit seiner beschämenden Beschädigung welchem Er-
wachsenen anvertrauen? Zumal wenn er ja wohl weiß, dass er mit seinem Problem hinter
einer Mauer des Beschweigens und einer „Kultur“ – richtiger: einer Unkultur – des Weg-
sehens alleingelassen ist? Und dass er sich vielleicht auch dankbar, mindestens aber nach
außen loyal zu verhalten hat, um den „guten Ruf“ der OSO nicht zu schädigen?
Dies sind einige Komponenten der Prozesse in „totalen Institutionen“, die der Sozio-
loge Erving Goffman herausgearbeitet und begrifflich so gefasst hat: Anpassung,
Kolonisierung (Umprägung des Selbstbewusstseins), Loyalisierung. Dabei handelt es sich um
massive Zwänge, und das erhoffte und in vielen Fällen auch erzielte Ergebnis ist die „Be-
schränkung des Selbst“, oder sagen wir im Klartext: Beschädigung des Selbst. In der
Pädagogik ist dies der schlimmste Verstoß gegen den „Sokratischen Eid“, in dem kein anderer
als Hartmut von Hentig u.a. formulierte, dass ein Lehrer und Erzieher für die „körperliche und
seelische Unversehrtheit“ eines Kindes bzw. Schülers „einzustehen“ hat. Er muss heute seinen
totkranken Freund und Lebensgefährten Gerold Becker nicht im Stich lassen, aber zu er-
warten ist von ihm ein Wort dazu – zumal nach Beckers eigenem Eingeständnis des
sexuellem Missbrauchs von OSO-Kindern –, dass dieser Bruch des Sokratischen Eides unver-
zeihlich ist!
Und dann noch dies: Keiner sollte mit dem peinlichen Geschwafel vom
„pädagogischen Eros“ daherkommen, wenn er gegen das „pädagogische Ethos“ verstößt und
uns trotzdem glauben machen will, er könne eine „höhere“ Rechtfertigung für sein Handeln
ins Feld führen. Otto Friedrich Bollnow (dessen Wendung von der Physik zur Pädagogik und
Philosophie durch einen kurzen Aufenthalt im Winter 1925/26 in der OSO ausgelöst wurde)
hat bei seinen Überlegungen zur „pädagogischen Atmosphäre“ und zu den „Tugenden des
Erziehers“ schon vor einem Menschenalter Mitte der 1960er-Jahre darauf aufmerksam ge-
macht, dass es so etwas wie liebende Zuwendung zu den anvertrauten Kindern und Jugend-
lichen geben könne und dürfe (Pestalozzi), wenn sie sich ihrer Ziele und Grenzen bewusst ist;
denn dies kann eine hilfreiche pädagogische Grundeinstellung vor allem dann sein, wenn ein
vernachlässigtes, verwahrlostes Kind mit seinem verhärteten Gemüt wieder für Vertrauen zu
anderen erschlossen werden soll und der Weg dahin dem Erzieher zunächst mehr Ent-
11täuschungen als Belohnung bringt. Die Entscheidung für ein „dennoch“ kann hier eine Kraft-
quelle haben, in einer liebenden Zuwendung, die ja nichts für sich will. Mit „pädagogischem
Eros“ habe das, so Bollnow, ganz und gar nichts zu tun: die Vergötterung des Knaben sei ja
grade keine pädagogische Einstellung, sondern das Gegenteil: Ein Ideal erzieht man nicht!
Und anzufügen wäre vor allem: Die Berufung auf die antike Knabenliebe (Platons „Gast-
mahl“) ist hinter aller Verquastheit nichts anderes als der Versuch, Pädophilie als kriminelle
Handlung zu verschleiern. Schon in der Frühzeit der Landerziehungsheime wurde die
Öffentlichkeit aufmerksam auf eine Äußerung von Gustav Wyneken, mit dem zusammen Paul
Geheeb 1906 die Freie Schulgemeinde Wickersdorf gegründet hatte. Wyneken, der sich
übrigens dezidiert nicht als Reformpädagoge und die Freie Schulgemeinde nicht als Land-
erziehungsheim verstanden wissen wollte, hatte geschrieben: „Eine durch den platonischen
Eros mit ihrem Führer verbundene Knaben- und Jünglingsschar kann der innerste, lebendige
Kern des heiligen Ordens der Jugend werden, der die Freie Schulgemeinde sein will.“ Er
schwadronierte von einem „heiligen, schönen und begeisterten Liebesbund inmitten unserer
kalten und stumpfen Welt“ – was dazu führte, dass Wyneken wegen nach damaliger Auf-
fassung sexueller Belästigung (er, nackt, umarmte nackte Knaben nach der Gymnastik) seines
Postens in Wickersdorf enthoben wurde.
Das alles war Geheebs Sache nicht: Er trennte sich von Wyneken, wollte keine
„Ordensburg“, sondern vor allem eine gute Schule. Auch dort war der unbefangene Umgang –
gibt es das? – mit der „natürlichen“ Leiblichkeit eine Selbstverständlichkeit – als wenn es
„selbstverständlich“ wäre, was „natürlich“ ist! … Die Bauern des Hambachtales guckten
jedenfalls erstaunt bei der Morgengymnastik im „Lichtkleid“, wie berichtet wird. Hat eigent-
lich jemals jemand nachgefragt, was das denn für pubertierende Jungen und Mädchen eigent-
lich bedeutet hat? Wohl nicht, ganz im Zeitgeist von Befreiung von Konventionen.
Ich möchte deshalb hier noch einen „Zeitgeist“-Gedanken anschließen zu der Frage,
wie die OSO in den 1970er Jahren vermehrt ein Tatort von Übergriffen und Beschämung, von
Beschädigung durch sexuellen Missbrauch werden konnte. Junge Erwachsene, die in den
späten 1960er und frühen 1970er Jahren Lehrerinnen und Lehrer wurden, kamen in der Regel
aus konventionellen Kulturen mit rigiden Sexual- und Moralvorstellungen in eine Zeit des
Umbruchs, der Tabubrüche, des Experimentierens, der Entgrenzungen. Die „sexuelle
Revolution“ musste bei vielen von ihnen zu Orientierungs- und Identitätsproblemen führen:
sowohl zu einem persönlichen Kontrollverlust hinsichtlich des erlaubten bzw. unerlaubten
Verhaltens als auch zum Verschwinden von Unrechtsbewusstsein bei Grenzverletzungen und
Grenzüberschreitungen. „Alles Verstehen“ ist keineswegs „alles entschuldigen“ – hier sollte
12nur angeregt werden, besondere Umstände in der OSO damals in Betracht zu ziehen, nicht
nur den „Zeitgeist“ (auch wenn er nichts erklärt), sondern auch die Akteure in diesem
Kontext, der dadurch charakterisiert ist, dass erstens der Schulleiter der Hauptübeltäter war
und dass eben dieser die Schule zu einer Einrichtung der Jugendhilfe machte, so dass in der
OSO Kinder und Jugendliche ankamen, die auf jeden Fall keine Ausweich- oder Rückfall-
position hatten und in der Missbrauchs-Falle saßen. Diese Schicksale sind die bittere Hypo-
thek, die die OSO mit in ihr zweites Jahrhundert nimmt.
3.
Wie weiter?
Am Jahrestag einer Gründung wird üblicherweise abschließend nach der Zukunft gefragt.
Noch vor kurzem wäre jetzt die Rede gewesen von der Weiterentwicklung des
„pädagogischen Profils“ etc. Jetzt geht es um mehr und anderes, wenn nicht gar ums Über-
leben der OSO. Weniger „die Reformpädagogik“ steht auf dem Prüfstand, als vielmehr die
OSO als ganze, das Konzept des Landerziehungsheims bzw. der Internatsschule.
Ernest Jouhy, auch er einer der Remigranten wie Minna Specht und Kurt Zier, die die OSO
wieder aufgebaut haben, hat in einem auch heute lesenswerten Aufsatz (1968) geschrieben,
auf welche kulturellen, gesellschaftlichen und pädagogischen Fragen Landerziehungsheime
vor und nach dem Ersten Weltkrieg Bezug nahmen und auf welche veränderten nach dem
Zweiten Weltkrieg. Dabei stellte er nüchtern fest, dass die hochfliegenden Pläne von damals –
besondere Anforderungen in ethischer und ästhetischer Hinsicht sowie eine ungewöhnliche
geistige Intensität – der Lebenssituation und dem Lebensgefühl junger Menschen heute
(1960er Jahre) nicht mehr entsprächen, die Eltern aber mehr und mehr Erziehungsaufgaben an
Institutionen delegieren würden. Wir haben heute – vier Jahrzehnte später – die Aufgabe, auf
diese Fragen Antworten für heute und morgen zu finden und daraus herzuleiten, in welchen
Formen von Landheim und Tagheim für welche Schülergruppen die OSO künftig geeignet
sein kann.
Wir haben gesehen, dass das Familienprinzip eine Schutzfunktion und ein Gefährdungs-
potential enthält. Deshalb wird es eine der wichtigsten Aufgaben sein zu klären, in welchen
Lebens- und Wohnformen das Landheim künftig so organisiert sein muss, damit dort nach
menschlichem Ermessen künftig niemand mehr in eine Falle gerät. Dazu gehören dann auch
Vorkehrungen, an denen es früher (und heute?) offenbar gemangelt hat. Wo war/ist in der
OSO der Heimleiter? Wie kann es „Familien“ geben, deren „Oberhäupter“ gar keine „Eltern“
13sind? Wo waren/sind die Supervisions- und Balint-Gruppen für die kollegiums-internen Fort-
bildungen und Selbstkontrollen? Wo sind die externen Anlaufstellen für alle „Gerüchte“ und
deren Verfolgung bzw. Aufklärung? Gab/gibt es unschwer (erst einmal verdeckt) zugängliche
wirksame Frühwarnsysteme und sogleich effektive Sanktionen bei „begründetem Verdacht“?
Landrat Matthias Wilkes als für Jugendamtsfragen in seinem Amtsbereich Verantwortlicher
hat in seiner heutigen Ansprache zweimal mit großem Ernst darauf hingewiesen, dass die
OSO glaubhaft dartun muss, dass sie heute und künftig wieder nach menschlichem Ermessen
ein sicherer Ort ist, dem man aus Amtsverantwortung mit gutem Gewissen Kinder anver-
trauen kann.
Das Schlüsselproblem ist wie überall die Gewinnung und das dauerhafte Engagement
geeigneten Personals. Die OSO muss sich ehrlich machen: Was können wir als Erziehungs-,
Bildungs- und Ausbildungsstätte leisten und was nicht? Diese Handlungsperspektive muss
durch eine Entwicklungsperspektive ergänzt werden: Wo wollen wir in zehn Jahren sein? Wer
hilft uns dabei? Welche Ressourcen können wir erschließen? Wenn wir uns jetzt gründen
würden: Was wären die Merkmale einer Odenwaldschule, die auf sich aufmerksam macht?
Wie werden wir wieder ein zeitgemäßes, Maßstäbe setzendes „pädagogisches Laboratorium“?
Amelie Fried hat gestern auf dem Podium ganz richtig gesagt, dass die OSO eine Bringschuld
hat: darzulegen, wie sie künftig welche Aufgaben wahrnehmen will und kann.
Vermutlich, mit Sicherheit, würden Paul und Edith Geheeb den Kopf schütteln, wenn
sie uns jetzt zuhörten. „Glauben Sie doch ja nicht, das hätten wir im April 1910 gewusst, als
wir die Odenwaldschule eröffneten. Wir mussten uns auf den Weg machen, um herauszu-
finden, wohin die Reise gehen kann. Und erinnern Sie sich doch bitte daran, was bei der Er-
öffnungsrede am 14. April gesagt wurde: Die Hauptlast müssen die Schülerinnen und Schüler
tragen. Ohne ihr aktives Zutun kann nichts gelingen; wir Erwachsenen können einen Rahmen
schaffen, aber sie sind es, die ihn ausfüllen müssen. Aber wir haben auch gelernt, wann und
wie die Schülerinnen und Schüler diese Last zu tragen gewillt und imstande sind: Wenn sie in
die Pflicht genommen wurden und verstanden haben, dass jeder Einzelne seine Selbstver-
antwortung akzeptieren und in die Mitverantwortung für den Erfolg aller und der OSO im
ganzen eintreten muss.“
Bernhard Bueb hat einmal gesagt, dass wenn gegen die Zuschreibung „Eliteschule“
manche Internate und Landerziehungsheime sich nicht wehren könnten, dann sollten sie
diesem Ruf einfach dadurch gerecht zu werden versuchen, dass aus ihnen junge Erwachsene
hervorgehen, denen man mehr Verantwortung zumuten kann als anderen. Auch das ist ein
Erbe der Odenwaldschule. Deshalb sollte sie rechnen können auf die Unterstützung vieler
14Altschülerinnen und Altschüler, alter und neuer Förderer auf dem Weg in ihr zweites Jahr-
hundert rechnen können, damit die jetzigen und künftigen Schülerinnen und Schüler wie viele
vor ihnen auf „ihre OSO“ stolz sein können.
Autor
Prof. Dr. Ulrich Herrmann
Engelfriedshalde 101, 72076 Tübingen
Tel. 07071 / 61876
uherrmann-tuebingen@t-online.de
Nachweise zum Vortragstext in:
Paul Geheeb: Die Odenwaldschule 1909-1934. Texte von Paul Geheeb, Berichte und Dis-
kussionen von Mitarbeitern und Schülern. Hrsg. von Ulrich Herrmann. Jena: Verlag IKS
Garamond 2010.
15Sie können auch lesen