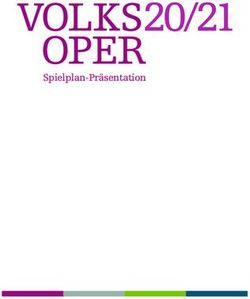Werner Egk: Eine Debatte zwischen Ästhetik und Politik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Münchner Theatergeschichte 3
Werner Egk: Eine Debatte zwischen Ästhetik und Politik
von
Jürgen Schläder
1. Auflage
Werner Egk: Eine Debatte zwischen Ästhetik und Politik – Schläder
schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Thematische Gliederung:
Einzelne Komponisten und Musiker
Utz, Herbert 2008
Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de
ISBN 978 3 8316 0269 8
Inhaltsverzeichnis: Werner Egk: Eine Debatte zwischen Ästhetik und Politik – Schläder40269_Schläder_Egk_TOC_001.fm Seite 1 Dienstag, 4. März 2008 3:07 15
Studien zur Münchner Theatergeschichte
Band 3
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de40269_Schläder_Egk_TOC_001.fm Seite 2 Dienstag, 4. März 2008 3:07 15
Studien zur Münchner Theatergeschichte
herausgegeben von
Hans-Michael Körner und Jürgen Schläder
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de40269_Schläder_Egk_TOC_001.fm Seite 3 Dienstag, 4. März 2008 3:07 15
Münchener Universitätsschriften
Philosophische Fakultät für Geschichts-
und Kunstwissenschaften
Werner Egk: Eine Debatte
zwischen Ästhetik und Politik
herausgegeben von Jürgen Schläder
Herbert Utz Verlag · München 2008
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de40269_Schläder_Egk_TOC_001.fm Seite 4 Dienstag, 4. März 2008 3:07 15
Gedruckt mit Unterstützung aus Mitteln der Münchener Universitätsschriften
ISBN 978-3-8316-0269-8
Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist
bei der Deutschen Nationalbibliothek erhältlich.
© Herbert Utz Verlag 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf
photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs-
anlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.
Herbert Utz Verlag GmbH
Tel. 089-277791-00 · Fax 089-277791-01
info@utz.de · www.utz.de
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de40269_Schläder_Egk_TOC_001.fm Seite 5 Dienstag, 4. März 2008 3:07 15
Inhalt
Vorwort 1
Albrecht Dümling
Von Weltoffenheit zur Idee der NS-Volksgemeinschaft.
Werner Egk, Carl Orff und das Festspiel Olympische Jugend 5
Robert Braunmüller
Aktiv im kulturellen Wiederaufbau.
Werner Egks verschwiegene Werke nach 1933 33
Boris von Haken
Werner Egk in Paris: Musiktheater im Kontext der Besatzungspolitik 70
Jan Thomas Schleusener
Entnazifizierung und Rehabilitierung. Vergangenheitsaufarbeitung
im Fall Egk 103
Monika Woitas
Abraxas und kein Ende. Kontext und Hintergründe eines Skandals 119
Ulrike Stoll
Freiheit der Kunst? Der Fall Abraxas 134
Jürgen Schläder
Quantität als Qualität. Werner Egks Opern und die gemäßigte
Moderne der fünfziger Jahre 147
Klaus Kanzog
„… und dazu ein nicht zu übersehendes, höchst aktuelles Element.“
Werner Egks Oper Die Verlobung in San Domingo zum Zeitpunkt
ihrer Uraufführung am 27. November 1963 162
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deVorwort 1
Vorwort
Werner Egk war ein Mann von ungewöhnlicher Reputation: Präsident des
Deutschen Komponistenverbandes, Präsident des Deutschen Musikrates
und Vorstandsvorsitzender der GEMA. Viel mehr konnte man als Komponist
nicht erreichen an einflußreichen Positionen in der jungen Bundesrepublik
Deutschland. Darüber hinaus avancierte Egk auch zum Präsidenten der
CISAC, der internationalen Dachorganisation für den Schutz der Urheber-
rechte – auch dies ein Ausweis des Ansehens und des Vertrauens, das er in
der Kulturpolitik genoß. Ein solcher Mann ist aller Achtung und war anläß-
lich seines 100. Geburtstags auch aller Würdigung im verehrenden Anden-
ken wert.
Speziell in München und Bayern läßt sich diese Verehrung an öffentli-
chen Ehrentiteln ablesen: Egk war ordentliches Mitglied der Bayerischen
Akademie der Schönen Künste, Ehrenbürger der Stadt München, Träger des
Kunstpreises der Stadt München 1949, Träger der Goldenen Ehrenmünze
der Stadt 1966 und Träger des Kulturellen Ehrenpreises der Stadt 1972.
Deutlicher kann man die Verdienste eines Kulturschaffenden um die Kultur
seiner Zeit kaum dokumentieren. In Bayern tut man sich leicht mit Werner
Egk und seiner Biographie, wohl weil die Münchner Karriere dieses Kompo-
nisten erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann, gleichsam in unverfängli-
cher historischer Situation. Daß diese Karriere auch noch mit einem Skandal
einsetzte, mit dem sogenannten Abraxas-Skandal, den man bundesweit zur
Kenntnis nahm und in dem Werner Egk vorderhand als Opfer staatlicher
Kulturpolitik erscheinen mußte, hat die Einstellung zu seiner Person und zu
seinem Werk in der breiten Öffentlichkeit ausschließlich positiv beeinflußt.
Freilich setzte die Münchner Karriere des Komponisten schon vor dem
Abraxas-Skandal ein, und dieser Beginn trug ebenfalls skandalöse Züge: das
Münchner Spruchkammerverfahren, das – etwas salopp und griffig formu-
lieren – das Berufsverbot für Werner Egk unmittelbar nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs aufheben sollte. Dieser eigentliche Karrierebeginn wird gern
übersehen und in seinen Konsequenzen vernachlässigt. Über die Art, wie
die politische Entlastung für Werner Egk zustande kam, ist lange kontrovers
diskutiert worden. Auch in diesem Band war das Thema unvermeidbar.
Aber auch die Folgen aus dem berühmten Abraxas-Skandal werden in
München und in Bayern gern in einer verkürzten Version dargestellt, weil
der offensichtliche Kuhhandel zwischen dem Komponisten-Opfer und der
Bayerischen Staatsoper, die auf Anweisung des zuständigen Ministeriums
handelte, nachgerade peinlich anmutet und deshalb tunlich übergangen
wird. Klaus Kanzog breitete schon in „Oper aktuell“, dem Jahrbuch der
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de2
Bayerischen Staatsoper für 2001/2002, einige Fakten zu diesem Thema aus.
Weiteres und Neues folgt von anderen Autoren in diesem Band.
Erwähnenswert ist diese fortgesetzte Beschäftigung mit nur scheinbar
bekannten und restlos ausgedeuteten Vorgängen, weil die Münchner
Rezeptionsgeschichte von Werner Egks Opern in unmittelbarem Zusam-
menhang mit diesen Ereignissen steht. Zwischen 1952 und 1986 wurden
allein an der Bayerischen Staatsoper Bühnenwerke von Werner Egk weit
mehr als 150mal gespielt. Der Zeitraum ist begrenzt durch die erste und
letzte Aufführung der Oper Peer Gynt an der Bayerischen Staatsoper. Hinzu
kommt eine ganze Reihe von Aufführungen auch im Gärtnerplatz-Theater.
Damit zählt Egk zu den in München meistgespielten zeitgenössischen Kom-
ponisten der 1950er bis 1980er Jahre – eine Folge des Karrierestarts und sei-
ner spezifischen Umstände in München.
Das Urteil über die Opern lag nämlich in der öffentlichen Münchner
Meinung von Anbeginn fest und hat sich bis heute nicht gewandelt: Werner
Egks Musik „öffnete die Ohren für die Moderne des 20. Jahrhunderts, die
während der NS-Zeit aus den Konzertsälen verbannt gewesen war.“ So der
vormalige Staatsminister für Kunst und Wissenschaft, Hans Zehetmair, in sei-
nem Grußwort für die Hochglanz-Broschüre, mit der der Freistaat die Egk-
Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 2001 ordnen und würdigen ließ. Der
Staatsminister irrte. Werner Egks Musik entspricht gerade nicht jenen Kom-
positionen und jener musikalischen Moderne, die in der NS-Zeit aus den
Konzertsälen verbannt war. Sie repräsentiert vielmehr mit geringen Modifi-
kationen gerade jenen Musikstil, den Egk auch in der Zeit des Nationalso-
zialismus vertrat. Der Komponist hat eine bemerkenswert schmale künstleri-
sche Entwicklung über 30 Jahre hinweg genommen. Und deshalb öffnete
seine Musik zu keiner Zeit nach 1945 die Ohren für die Moderne des
20. Jahrhunderts, auch nicht für bayerische Ohren. Die Tatsache, daß sol-
che Musik in den Rang von moderner Musik aufzusteigen vermochte, spie-
gelt das Spannungsverhältnis von ästhetischer Wertung und kulturpolitischer
Instrumentalisierung, die mit einem solchen Gesamtwerk bisweilen ver-
knüpft ist. Eine versehentlich verrutschte Formulierung in der schon ange-
sprochenen Hochglanz-Broschüre des Freistaats illustriert – auf unfreiwillige
Weise – den Sachverhalt. Dort heißt es im Zusammenhang mit Egks Münch-
ner Karriere: Sie „begann mit einem Paukenschlag: mit einem Skandal, der
die Schlagzeilen in der jungen Republik beherrschte. Doch aus dem Abra-
xas-Skandal entwickelte sich eine furchtbare Zusammenarbeit: Egks Werke
wurden an der Münchner Staatsoper zwei Jahrzehnte lang in mustergültigen
Inszenierungen gespielt … Damit bestimmte Egk entscheidend das Verhält-
nis der Musikliebhaber Münchens zu zeitgenössischer Musik: Egk verstand
als einer der ganz wenigen Komponisten, neue Musik für ein großes Publi-
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deVorwort 3
kum zu schreiben.“ Auch dieser Sachverhalt wird in den Beiträgen dieses
Bandes verhandelt.
Brisanter freilich ist die unvoreingenommene und vor allem redliche
Aufarbeitung der NS-Zeit. Vor der Spruchkammer hatte der öffentliche
Ankläger ein fünfjähriges Berufsverbot für Egk beantragt und die Konfiszie-
rung seines halben Vermögens, um auf diese Weise seine öffentliche Tätig-
keit in der NS-Zeit zu sühnen. Egk ging in die Offensive und beantragte eine
Erhöhung des Strafmaßes auf zehn Jahre und auf Einziehung seines gesam-
ten Vermögens, falls zwischen seiner beruflichen Tätigkeit und den KZ-Ver-
brechen ein ursächlicher Zusammenhang bestünde. Diese infame Wendung
führt mitten hinein in die Debatte zwischen Ästhetik und Politik.
Keine Frage, daß Musik komponieren in keiner Weise als schuldhafte
Tat vergleichbar ist mit der Anweisung oder gar der Durchführung von ver-
brecherischen Massenmorden. Mit Musik kann man nicht töten. Aber der
Historiker muß sich fragen, in welchem Maße man durch künstlerische Pro-
duktion zu Propagandazwecken ein Regime nach innen wie außen stützt,
das solche verbrecherischen Maßnahmen ergreift. Und in diesem Kontext
ist die Schuldfrage selbstverständlich zu stellen und zu beantworten. Der
gerade in Bayern oft benutzte Hinweis auf die grenzenlose Naivität des
Komponisten und Funktionärs Werner Egk in der NS-Zeit ist aus diesem
Blickwinkel wenig hilfreich. Vielmehr stellt sich die Aufgabe zu klären, wel-
che ästhetischen Phänomene sich in Egks Musik entdecken lassen, wie sich
diese Phänomene bewerten lassen und wie sie zu politischen Fakten und
Entscheidungen in Beziehung zu setzen sind. Auch wenn diese Aufgabe
schwierig ist – sie anzugehen ist lohnend.
Wohlverstanden: Das Symposium, auf dem 2001 die Vorträge gehalten
wurden, die den Beiträgen dieses Bandes zugrunde liegen, war alles andere
als eine Gegenveranstaltung zu den allenthalben in Bayern stattfindenden
Jubelfeiern für Werner Egk. Diese Haltung wäre zu billig gewesen und ent-
spräche auch nicht dem wissenschaftlichen Anspruch, den die Referentin-
nen und Referenten mit ihm verbanden. Das Forschungsprojekt zur Münch-
ner Theatergeschichte, in dessen Rahmen diese eineinhalb Tage stattfanden,
rückt gerade die offenen und verdeckten Beziehungen zwischen politischer
Geschichte und ästhetischen Phänomenen vor den Blick. Es war im besten
Sinne Kulturgeschichte zur Erhellung kultureller Entscheidungs- und Ent-
wicklungsprozesse. Dabei sollte der Blick über die engen Münchner oder
auch über die bayerischen Grenzen hinaus die Perspektive öffnen für den
größeren Zusammenhang. Fehleinschätzungen aus der rein lokalen
Betrachtungsweise sollten möglichst vermieden werden. Deshalb am ersten
Tag der Blick auf kulturpolitische Phänomene jenseits der engeren Münch-
ner Theatergeschichte. Deshalb am zweiten Tag die Weitung des Blickwin-
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de4
kels auf kulturpolitische Fragen, die nicht nur das Komponieren und Auffüh-
ren von Opern betreffen. Dies alles diente der Zeichnung eines Gesamtbil-
des von Werner Egks Bedeutung als Bühnenkomponist, dessen Details dann
schärfer und plastischer hervortreten, als dies bislang in der historiographi-
schen Würdigung dieses Komponisten der Fall ist.
Daß die Biographie der 1930er und 1940er Jahre dabei einen wesentli-
chen Stellenwert einnimmt, liegt auf der Hand. Die immer wieder erhobene
Forderung nach einer kritischen, aber eben auch differenzierten Reflexion
über Egks Wirken in der NS-Zeit konnte zumindest in einigen Detailfragen
eingelöst werden. Der Kontext der Tagespolitik 2001, immerhin geprägt von
der Zwangsarbeiterproblematik der NS-Zeit und Fragen der Verantwortlich-
keit von DDR-Funktionären, offenbart die Notwendigkeit, aber auch die
Schwierigkeit im wertenden Umgang mit Fakten und Interpretationen. So
manche Frage und so manches Argument mußte hin- und herwendet wer-
den, um der genuinen Aufgabe von Historikern gerecht zu werden: zu einer
redlichen Wahrheit und Einschätzung der Vergangenheit zu gelangen.
Die Vorträge mit anschließenden Diskussionen fanden 2001 in den Räumen
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften statt. Dem Haus der Bayeri-
schen Geschichte ist zu danken für die finanzielle Unterstützung der
Tagung, deren Ergebnisse in dieser Publikation präsentiert werden. Ein
besonderer Dank gilt den Referentinnen und Referenten, die sich z.T. sehr
kurzfristig in die entsprechenden Themen eingearbeitet haben und die mit
großer Geduld und Nachsicht auf die durch mancherlei Umstände unge-
bührlich verzögerte Drucklegung gewartet haben.
München, im Oktober 2007 Jürgen Schläder
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deVon Weltoffenheit zur Idee der NS-Volksgemeinschaft 5
Von Weltoffenheit zur Idee
der NS-Volksgemeinschaft.
Werner Egk, Carl Orff
und das Festspiel Olympische Jugend
Albrecht Dümling
Sport und Kult: Coubertins alter Traum
Als Carl Diem im Jahre 1912 zum Generalsekretär für die Berliner Olympiade
von 1916 ernannt wurde, erhielt er ein Glückwunschschreiben von Pierre de
Coubertin, dem Begründer der modernen olympischen Spiele. Darin schrieb
der Franzose, der dem Internationalen Olympischen Komitee (IOK) seit 1896
als Präsident vorstand, „daß er von den deutschen Spielen etwas besonderes
erwarte: die Verschmelzung des Olympismus mit Geist und Kunst, und er
hoffe von uns, daß wir seinen Lieblingsgedanken erfüllten: die Eröffnungsfeier
der Spiele mit den Klängen der IX. Symphonie von Beethoven zu krönen.“1
Für Coubertin waren es quasi sakrale Ereignisse, weshalb er die Olympiade
1908 in London mit einem christlichen Gottesdienst und die nachfolgende
1912 in Stockholm mit Psalmen und Gebeten eröffnen ließ. Die Aufführung
von Beethovens Neunter Symphonie sollte, einmündend in die Schillerworte
„Alle Menschen werden Brüder“, so erhoffte es sich der Sportpionier, der
symbolische Höhepunkt der Eröffnung sein.
Wegen des Ersten Weltkrieges konnte die Olympiade 1916 nicht durch-
geführt werden. Jedoch wurde ein neuer Antrag, den Staatssekretär Theo-
dor Lewald für Berlin gestellt hatte – er war seit 1919 Präsident des Deut-
schen Reichsausschusses für die Olympiade und seit 1927 Repräsentant
Deutschlands im IOK –, 1931 in Barcelona positiv entschieden.2 Der erneut
zum Generalsekretär ernannte Carl Diem durfte nun endlich darangehen,
den Coubertin-Vorschlag zu verwirklichen, zumal der Franzose ihn explizit
wiederholte. Zunächst aber schien die Berliner Olympiade daran zu schei-
1 Carl Diem, Ein Leben für den Sport. Erinnerungen aus dem Nachlaß, Ratingen o.J., S. 87;
vgl. auch Elizabeth Audrey Schlüssel, Zur Rolle der Festmusik bei den Olympischen Spie-
len unter besonderer Berücksichtigung der Vorstellungen Pierre de Coubertins, Diplom-
arbeit an der Deutschen Sporthochschule Köln 1995.
2 Mit 43 zu 16 Stimmen fiel die Entscheidung eindeutig aus. Vgl. Reinhard Rürup (Hg.),
1936. Die Olympischen Spiele und der Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Berlin
1996, S. 43.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de6 Albrecht Dümling
tern, daß die NSDAP dieses internationale und zudem von einem „Halb-
juden“3 initiierte Ereignis entschieden ablehnte.4 Nach dem Februar 1933
änderte Adolf Hitler seine Meinung.5 Die endgültige Bestätigung der Olym-
piade erhielt er aber erst, als die Reichsregierung dem belgischen Grafen
Baillet-Latour, dem damaligen Präsidenten des IOK, schriftlich den Verzicht
auf jegliche Rassendiskriminierung zugesagt hatte: alle Sportler würden
zugelassen und gleichberechtigt behandelt.
Auf Beschluß des IOK wurde das olympische Ritual 1936 in Berlin um
einen Stafettenlauf mit Feuer aus Olympia, um die Überbringung eines
Ölzweigs aus der griechischen Ursprungsstätte und den sogenannten
Olympischen Gruß ergänzt. Damit sollte in diesem Jahr, wie Diem in einer
durch Schallplatten verbreiteten Vorschau auf die Spiele hervorhob, in einer
„Hochzeit von Geist und Muskel“ (Coubertin)6 die Verbindung zu den anti-
ken Traditionen Griechenlands besonders verdeutlicht werden.7 Berlin
stellte damit in der Geschichte der modernen Olympiaden einen Höhe-
punkt der Ritualisierung, keineswegs aber einen Ausnahmefall dar. Obwohl
äußere Ähnlichkeiten mit NS-Ritualen bestanden – der Olympische Gruß,
mit ausgestrecktem Arm seitwärts entrichtet, ähnelte dem Hitler-Gruß –,
muß die gewachsene Eigenständigkeit des olympischen Zeremoniells betont
werden.8 Zwei entgegengesetzte Ideenwelten, die Internationalität der
olympischen Idee und die rassistische Eingrenzung des Nationalsozialismus,
traten mit symbolischen Formen auf, die zu Verwechslungen Anlaß geben
konnten. Die Verwechslungsgefahr ist bis heute geblieben.
3 Theodor Lewald war der Sohn eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter.
4 Vgl. Jörg Titel, Die Vorbereitung der Olympischen Spiele in Berlin 1936. Organisation der
Politik, in: Jürgen Wetzel (Hg.), Berlin in Geschichte und Gegenwart (Jahrbuch des Lan-
desarchivs Berlin 1993), Berlin 1993, S. 113–172.
5 In einem Brief vom 22. Juni 1958 an Leni Riefenstahl anläßlich der Wiederaufführung ih-
res Olympia-Films ging Diem auf die Wende ein, die Hitlers Entscheidung unter seinen
Anhängern auslöste. „Ich bin wirklich glücklich, daß Sie den Turnern den Film zeigen wol-
len und denke dabei mit einigem Vergnügen, daß sie die Veranstaltung der Spiele 1936
bis Februar 1933 wütend bekämpft haben, das sei ein rein westlerisches Fest, es sei ein in-
ternationalistisches Fest und was es alles für Charakterfehler gegeben hat; sobald aber Hit-
ler nach der anderen Richtung lenkte, verstummten sie.“ (Carl und Liselott Diem-Archiv
bei der Olympischen Forschungsstätte der Deutschen Sporthochschule Köln).
6 Vgl. Track 1 der CD-Dokumentation „XI. Olympische Sommerspiele 1.–16. August 1936
in Berlin“ (Reihe „Stimmen des 20. Jahrhunderts“), hg. vom Deutschen Historischen
Museum und dem Deutschen Rundfunkarchiv, Frankfurt am Main 1996.
7 Vgl. Hajo Bernett, Die Olympische Hymne von 1936. Ein Preisausschreiben und seine
Folgen, in: Gerhard Hecker/August Kirsch/Clemens Menze (Hg.), Der Mensch im Sport.
Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Liselott Diem, Schorndorf o.J., S. 46–61.
8 Vgl. Henning Eichberg u.a. (Hg.), Massenspiele. NS-Thingspiel, Arbeiterweihespiel und
olympisches Zeremoniell, Stuttgart 1977, S. 146–150.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deAktiv im kulturellen Wiederaufbau 33
Aktiv im kulturellen Wiederaufbau.
Werner Egks verschwiegene Werke nach 1933
Robert Braunmüller
„Der Künstlerhaus-Saal, dessen prunkvoller Rahmen zu diesem bolschewis-
tischen Kunsttreiben gar seltsam kontrastierte, war dicht gefüllt und das
Publikum nahm die Neuheit sehr freundlich auf. Das Werk wurde am glei-
chen Abend wiederholt. Ich hatte an dem einen Male vollauf genug.“1 Willy
Krienitz, Musikkritiker der Münchner Zeitung, floh am 29. November 1931
vor dem Rigorismus von Bertolt Brecht und Kurt Weill, in deren Schuloper
Der Jasager ein Knabe aufbricht, um Medizin für seine Mutter zu holen. Er
versagt an der schwierigsten Stelle eines Bergpfads und wird mit seinem Ein-
verständnis von den Mitreisenden in eine Schlucht geworfen.
Unmittelbare Gefahr eines Umsturzes ging von der geschlossenen Ver-
anstaltung im Künstlerhaus am Lenbachplatz kaum aus. Zugelassen waren
nur Mitglieder und geladene Gäste der Münchner „Vereinigung für zeitge-
nössische Musik“. Dennoch wurde die Aufführung in der Münchner Presse
ausführlich besprochen und auch von überregionalen Musikzeitungen
beachtet. Die Münchner Neuesten Nachrichten lobten die „Unmittelbarkeit
und kristalline Klarheit“ des Jasagers. Andere polemisierten: „Wenn noch
jemand Hoffnung hatte auf die Gesundung unseres Volks, mag er sie vor
diesem Stück begraben“, so die Bayerische Staatszeitung. „Daß dieses
Machwerk bisher schon 400mal von den Schülern aufgeführt worden ist,
spricht nicht für das Werk“, meinte Anton Würz in der Münchner Tele-
grammzeitung. „Daß Kinder gerne singen und spielen, glauben wir: denn
schließlich ist es auf alle Fälle lustiger, eine Oper einzustudieren, statt sich
mit der oratio obliqua oder mit Algebra-Gleichungen abzuplagen.“
Brecht und Weill hatten nach der Berliner Uraufführung ihrer Schuloper
im Sommer 1930 auch Beifall vom politischen Gegner erhalten. Die katholi-
sche Zeitschrift Hochland glaubte die „christlichen Grundwahrheiten“ seit
Jahrhunderten nicht mehr schlichter und unzweideutiger vernommen zu
haben als vom Jasager. Rechte Kreise begeisterte der Lobpreis des unbeding-
ten Gesetzes und des Opfers für die Gemeinschaft.2 In München demon-
strierte die Schuloper vor allem eine musikhistorische Konstante didakti-
1 Münchner Zeitung, Nr. 332. Dieses und die folgenden Zitate nach Zeitungsausschnitten
der Sammlung des Orff-Zentrums München. Die betreffende Mappe enthält auch den
maschinenschriftlichen Programmzettel.
2 Jürgen Schebera, Art. „Der Jasager“, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, hg. von
Carl Dahlhaus, München und Zürich 1997, Band 6, S. 704.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de34 Robert Braunmüller
schen Theaters: Sie korrespondierte mit dem eine knappe Woche vorher
aufgeführten Jephte von Giovanni Carissimi, bei dem ebenfalls die Opfer-
Thematik im Zentrum steht. „Durch die Gegenüberstellung eines sceni-
schen Oratoriums der Frühzeit und eines unserer Epoche soll das verwandte
wie das unterschiedliche der beiden Zeiten gezeigt werden“, hieß es in der
Einladung. Auch die Mitwirkenden waren eher für ihre unpolitische Haltung
bekannt: Carl Orff dirigierte, das Multitalent Werner Egk hatte die Projektio-
nen gemalt.
Dennoch entzog sich die Münchner Aufführung nicht der Auseinander-
setzung mit der politischen Botschaft: Ein auf dem Programmzettel und in
der Presse ungenannter Sprecher deutete die umstrittene Schuloper als
„politisches Schlüsselstück“: Die kranke Mutter, so seine etwas gezwungene
Deutung, stehe für den Staat, der Knabe sei der unmündige Bürger. Das
Versagen des Knaben interpretierte er als Individuations- und Selbst-
findungsprozeß, seinen Tod als Erreichung politischer Mündigkeit. Brechts
Szenenanweisung „sie warfen ihn hinab und warfen Erdklumpen und flache
Steine hinterher“ kommentierte er so: „Das Hindernde und Schädliche ver-
dient ein gründliches Begräbnis. Mit diesem Begräbnis der Unmündigkeit
schließt das Stück; der Weg zur Rettung der kranken Mutter ist frei – die
staats-politische Erziehung des Führers hat die Wandlung vom Knaben zum
Mann bewirkt.“
Wer diese Rede hielt und verfasst hatte, ist unbekannt. Vielleicht war es
Werner Egk, denn das Manuskript der vom Kritiker der Bayerischen Staats-
zeitung zutreffend zusammengefaßten Rede blieb in seinem Nachlaß erhal-
ten, allerdings nicht in seiner charakteristischen Handschrift.3 Die Mitwir-
kung an dieser Aufführung des Jasagers sagt dennoch einiges über den poli-
tischen Standort des „rätselhaften Opportunisten“4 aus, der sich in seiner
Autobiographie Die Zeit wartet nicht zum unpolitischen Flaneur stilisiert,
aber auch Abonnements der Zeitschrift Fanal des Anarchisten Erich Müh-
sam und der radikaldemokratischen Weltbühne sein eigen nannte.5
Wie fast alle jungen Komponisten seiner Generation sympathisierte Egk
vor 1933 mit der antiromantischen Gebrauchsmusik und den Spielarten des
epischen Theaters, ohne jedoch radikal linke Ansichten zu teilen, die Brecht
oder Piscator damit verbanden. Wie der sechs Jahre ältere Paul Dessau und
3 Bayerische Staatsbibliothek, Handschriftenabteilung, Ana 410. Der umfangreiche Bestand
an Briefen, Fotos und Zeitungsausschnitten ist bislang nur in provisorischen Bestandslisten
erfaßt. Der musikalische Nachlaß befindet sich davon getrennt in der Musiksammlung.
4 Michael Kater, Composers of the Nazi Era. Eight Portraits, New York und Oxford 2000,
S. 3, bzw. ders., Komponisten im Nationalsozialismus. Acht Porträts, Berlin 2003, S. 11
(mit gegenüber der englischen Fassung leicht erweitertem Egk-Kapitel).
5 Die Zeit wartet nicht, München 1981, S. 203 und 206. Fanal bestand bis 1931.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de70 Boris von Haken
Werner Egk in Paris: Musiktheater im
Kontext der Besatzungspolitik
Boris von Haken
Die Inszenierungen zweier Stücke Werner Egks 1942 und 1943 an der
Opéra de Paris sind kurze Episoden in der anhaltend erfolgreichen Karriere
des Komponisten. Doch es scheint bei den Aufführungen des Tanztheaters
Joan von Zarissa und der Oper Peer Gynt wenig sinnvoll, diese nur im
Zusammenhang mit der künstlerischen Biographie Werner Egks zu behan-
deln. Vielmehr ist es historiographisch ergiebiger, die Aufführungen in den
größeren Kontext der kulturellen Besatzungspolitik des Deutschen Reiches
in Europa einzuordnen. Die historische Relevanz dieser individuellen Ereig-
nisse zeigt sich erst aus dieser weiter gefaßten Perspektive.
Die beiden Inszenierungen an der Opéra wurden durch deutsche Agen-
turen in Frankreich veranlaßt; maßgeblich für die Aufführungen der Werke
Egks in Paris war die Propagandastaffel beim Militärbefehlshaber in Frank-
reich, formal eine Einrichtung der Reichswehr, tatsächlich jedoch eine
Abteilung des Berliner Propagandaministeriums. Die Situation in Paris ist
dabei als ein Sonderfall unter den zahllosen weiteren Sonderfällen zu
betrachten. So gab es in Paris kein deutsches Theater als eine ständige Ein-
richtung, sondern bekanntlich nur eine Fülle von Gastspielen und aufge-
drängten oder erzwungenen Aufführungen durch französische Ensembles.
Trotzdem gab es auch hier Überlegungen, ein eigenes Theater unter deut-
scher Leitung zu gründen, wie in anderen Teilen Europas, jedoch wurden
diese Pläne nicht realisiert.1
Die Zahl der deutschen Theater im besetzten Europa war sogar für die
zeitgenössischen Beobachter ein erstaunliches Phänomen. In der Saison
1942/43 unterhielt das deutsche Reich 47 staatliche Theater in den besetz-
ten Ländern.2 Im Reichsgau Sudetenland gab es 14, im Protektorat Böhmen
und Mähren zehn Bühnen, die an die kulturellen Traditionen der deutschen
1 Willi A. Boelcke (Hg.), Kriegspropaganda; 1939-1941. Geheime Ministerkonferenzen im
Reichspropagandaminsterium, Stuttgart 1966, S. 174; SD-Berichte zu Inlandsfragen vom
25. Oktober 1943 (Rote Serie): Widerstände gegen die Aufführung deutscher Werke auf
französischen Bühnen, in: Heinz Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich: 1938–
1945. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS, Herrsching 1984,
S. 5922–5925.
2 Die Theaterunternehmungen im Spieljahr 1942/43, in: Statistisches Reichsamt (Hg.),
Wirtschaft und Statistik, Jahrgang 1943, S. 246–248; vgl. Boguslaw Drewniak, Das Thea-
ter im NS-Staat. Szenarium deutscher Zeitgeschichte 1933–1945, Düsseldorf 1983,
S. 79–139.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deWerner Egk in Paris 71
Minderheit anschlossen. Rechtsträger dieser Häuser waren daher die Kom-
munen, finanziell großzügig unterstützt durch das Referat „Theater im Aus-
land“ im Propagandaministerium. Hier bestand eine Kontinuität mit der
Weimarer Republik. Im Reichsgau Wartheland, dem annektierten Teil
Polens, existierten sechs deutsche Theater, mit dem Reichsgautheater Posen
als wichtigster Institution. Im Generalgouvernement gab es fünf Theater; die
größten Häuser waren das Deutsche Theater in Warschau, mit Opern- und
Operetten-Ensemble, und, entsprechend den gewaltigen Ambitionen des
Generalgouverneurs Hans Frank, das Staatstheater des Generalgouverne-
ments in Krakau mit seiner angeschlossenen Staatsphilharmonie. Die eben-
falls in Krakau ansässige „Philharmonie des Generalgouvernements“ war
eine weitere Gründung, die den eigenwilligen Methoden Franks entsprach,
denn in diesem Orchester spielten unter der Leitung deutscher Dirigenten
und eines deutschen Konzertmeisters polnische Musiker aus den von der
Besatzungsmacht geschlossenen Institutionen, wie der Posener und War-
schauer Philharmonie, des Warschauer Opernhausorchesters, des Rund-
funks und der Musikhochschule.3 Es waren zum Teil prominente deutsche
Musiker, die mit diesem Orchester zusammenarbeiteten. So Hans Pfitzner
und Rudolf Hindemith, der ältere Bruder des Komponisten. Rudolf Hinde-
mith leitete als Chefdirigent von 1942 als Nachfolger des früh verstorbenen
Hanns Rohr bis 1944 das Orchester. Hindemith ist einer der wenigen Künst-
ler, der nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs in der Bundesrepu-
blik als sogenannter „Andersnamiger“ lebte und sogar beerdigt wurde.
Unter dem neuen Namen Hans Lofer wurde 1954 eine von Rudolf Hinde-
mith komponiert Oper in Mönchengladbach uraufgeführt. Letzter Dirigent
der Philharmonie des Generalgouvernements wurde 1944 noch für wenige
Monate Hans Swarowsky. Weitere Theater im besetzten Ost-Europa bestan-
den in Lettland und Estland. Ein deutsches Theater in der Nähe von Minsk
war in der Planung, ein regulärer Spielbetrieb wurde hier jedoch nicht mehr
aufgenommen.
Die größeren Einrichtungen in Westeuropa waren das Deutsche Opern-
haus in Den Haag und das Rheinische Landestheater in Arnheim, letzteres
jedoch ohne eigenes Ensemble. Rechtsträger beider Einrichtungen war der
Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete. Die deut-
schen Theater in Lille und das Opernhaus in Oslo wurden direkt durch das
Propagandaministerium verwaltet. Verantwortlich für das Theater der Stadt
Straßburg im verschleiert annektierten Elsaß war Robert Wagner, der Gaulei-
ter und Chef der Zivilverwaltung, während die Städtischen Bühnen in Mül-
3 Zur Lage im Generalgouvernement – Hier: Kulturelle Betätigung von Polen, in: Boberach
(Hg.), Meldungen (vgl. Anm. 1), S. 3268–3271.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deEntnazifizierung und Rehabilitierung 103
Entnazifizierung und Rehabilitierung.
Vergangenheitsaufarbeitung im Fall Egk
Jan Thomas Schleusener
Angesichts der beispiellosen Verwüstungen, die der Nationalsozialismus in
Europa und der Welt, aber auch im eigenen Land angerichtet hatte, war den
Siegermächten 1945 klar, daß im Fall des Deutschen Reiches der eherne
Grundsatz des Völkerrechts durchbrochen werden würde, daß der Kriegsgegner
mit inneren Maßnahmen des besiegten Staates nicht befaßt sei.1 Bereits auf der
Konferenz der „Großen Drei“ im Februar 1942 hatten Großbritannien, Amerika
und die Sowjetunion beschlossen, „alle nazistischen und militärischen Einflüsse
aus öffentlichen Einrichtungen, dem Kultur- und Wirtschaftsleben des deut-
schen Volkes“ zu entfernen.2 Das Problem, den Nationalsozialismus zu tilgen,
erwies sich als ebenso dringlich wie heikel. Zum einen mußte der Nazismus,
dessen Blutspur sich durch die halbe Welt zog, ausgerottet werden, zum
anderen konnte man nicht die gesamte NS-Volksgemeinschaft, die bis zum
Schluß weitgehend loyal hinter ihrem „Führer“ stand, in Haft nehmen für Ver-
heerungen, die der von Hitler entfesselte deutsche „Erlösungsantisemitismus“3
und blinde Eroberungswut bewirkt hatten.
Die Amerikaner, die von der öffentlichen Meinung im eigenen Land
unter Druck gesetzt wurden, mit den Deutschen nicht zu nachsichtig umzu-
gehen, gingen die Entnazifizierung, wie der amtliche Zeitjargon lautete, in
drei Schritten an.4 Die im Sommer 1945 erlassene US-Direktive JCS 1067
sah vor, die NSDAP und ihre Einrichtungen aufzulösen, die höheren NS-
Funktionäre zu verhaften sowie alle mehr als nominellen Parteimitglieder
aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen und das Erziehungswesen zu säu-
bern.5 200.000 als gefährlich geltende und mutmaßlich in die Verbrechen
1 Vgl. Walter Schwarz, Rückerstattung nach den Gesetzen der Alliierten Mächte, München
1974 (= Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepu-
blik Deutschland, Bd. 1, hg. vom Bundesminister der Finanzen in Zusammenarbeit mit
Walter Schwarz), S. 26.
2 Peter Reichel, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit
der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001, S. 30.
3 Saul Friedländer, Das Dritte Reich und die Juden. Band 1: Die Jahre der Verfolgung 1933–
1939, München 1998, S. 13.
4 Vgl. Reichel, Vergangenheitsbewältigung (vgl. Anm. 2), S. 31.
5 Vgl. ebda., S. 30. Vgl. auch Lutz Niethammer, Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung
am Beispiel Bayerns. Bonn 1982 (zuerst erschienen unter dem Titel Entnazifizierung in
Bayern. Säuberung und Rehabilitierung unter amerikanischer Besatzung, Frankfurt am
Main 1972), S. 150.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de104 Jan Thomas Schleusener
verstrickte NS-Aktivisten wurden aus dem gesellschaftlichen Leben entfernt,
unter „automatischen Arrest“ gestellt und in Internierungslager gebracht.6
Mit dem Ende September 1945 erlassenen Militärgesetz Nr. 8 griffen die
Amerikaner zusätzlich in die Wirtschaft ein.7 Mit Hilfe des berühmt-berüch-
tigten Fragebogens und dessen 131 Fragen sollten Personen, die Schlüssel-
positionen besetzten, vor ihrer Wiedereinstellung überprüft werden.8 Die
Überdehnung des Betroffenenkreises höhlte jedoch die Säuberungspolitik
innerlich aus, das Gesetz Nr. 8 bewährte sich in der Praxis nicht.9 Zudem
erwies sich, daß die Maßnahmen dem effektiven Wiederaufbau des öffentli-
chen Dienstes und der Wirtschaft zunehmend im Wege standen. Die Ame-
rikaner, die an der Schwächung der deutschen Wirtschaft kein Interesse hat-
ten, sahen keinen anderen Weg, als die Deutschen am Verfahren zu beteili-
gen, was bislang als problematisch gegolten hatte.10 Drei Vierteljahre nach
Beginn der Entnazifizierung führte schließlich das „Gesetz zur Befreiung von
Nationalsozialismus und Militarismus“ im März 1946 das sogenannte
Spruchkammerverfahren ein und verbesserte durch die Individualisierung
der Verfahren und die Einführung gerichtsähnlicher Schöffenkammern samt
Richter und Revisionsmöglichkeit die rechtsstaatliche Qualität der Entnazifi-
zierungsprozesse.
Im Mittelpunkt der Arbeit der Spruchkammern, deren Richter sich aus
den neu zugelassenen Parteien rekrutierten,11 stand nicht die Bestrafung der
Verbrecher. Sofern sich diese nicht zuvor selbst gerichtet hatten, saßen sie in
Nürnberg auf der Anklagebank. Den regionalen Entnazifizierungsinstanzen
war statt dessen die gerichtliche Aufarbeitung der politischen, moralischen
und metaphysischen Schuld aufgegeben.12 Das Befreiungsgesetz wollte viel
erreichen, bewirkte jedoch kurzfristig fast nichts.13 Zwar schuf die von den
Amerikanern beinahe missionarisch betriebene Entnazifizierung die Voraus-
6 Vgl. Klaus-Dietmar Henke, Die Trennung vom Nationalsozialismus. Selbstzerstörung, poli-
tische Säuberung, „Entnazifizierung“, Strafverfolgung, in: Klaus-Dietmar Henke/Hans
Woller (Hg.): Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kolla-
boration nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1991, S. 33.
7 Bei dem Gesetz Nr. 8 handelte es sich erstmals um ein deutsches Strafgesetz, was für den
Entnazifizierungsprozeß insofern ein Novum war, als alle bisherigen Regelungen Verwal-
tungsmaßnahmen der Sieger waren; vgl. Niethammer, Mitläuferfabrik (vgl. Anm. 5), S. 241.
8 Vgl. Reichel, Vergangenheitsbewältigung (vgl. Anm. 2), S. 31.
9 Vgl. Niethammer, Mitläuferfabrik (vgl. Anm. 5), S. 242 und 245.
10 Vgl. Reichel, Vergangenheitsbewältigung (vgl. Anm. 2), S. 32.
11 Vgl. ebda., S. 33.
12 Nach Ansicht des Philosophen Karl Jaspers, der die Schuldfrage 1946 in dieser Form kate-
gorisierte, mußte es bei der Aufarbeitung der jüngsten historischen Vergangenheit um eine
Befragung des Gewissens gehen. Als schuldhaft bezeichnete er es nicht bloß, Handlungen
vollzogen, sondern auch, sie nicht verhindert zu haben. Vgl. Karl Jaspers, Die Schuldfrage.
Zur politischen Haftung Deutschlands, München 1965, v.a. S. 17–55.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deAbraxas und kein Ende 119
Abraxas und kein Ende.
Kontext und Hintergründe eines Skandals
Monika Woitas
Es wurde bereits viel gesagt und einiges geschrieben über Abraxas, jenes
Teufelsballett von Werner Egk, das 1948 kurz nach seiner Uraufführung im
Prinzregententheater auf den Index gesetzt wurde und damit eine heftige
Zensurdebatte auslöste. So interessant diese Debatte um staatliche Einfluß-
nahme und künstlerische Autonomie auch sein mag, in der Retrospektive
kann man sich zuweilen des Eindrucks kaum erwehren, daß hier gezielte
Provokationen so lange geschürt wurden, bis aus dem Sturm im Wasserglas
ein Mythos geworden war: Werner Egk avancierte darin zum Märtyrer
moderner Musik und Abraxas zum Fanal für die Freiheit der Kunst.1 Der für
die Absetzung des Stückes verantwortliche Kultusminister Alois Hundham-
mer hingegen wurde zum Inbegriff des bornierten Moralisten und vom
Komponisten gar in einem Atemzug mit Joseph Goebbels genannt.2
Seitdem geistert Abraxas als epochales Ereignis deutscher Nachkriegs-
kultur, ja als von reaktionär-klerikalen Kreisen gewaltsam unterbundener
Beginn eines Nationalballetts deutscher Prägung durch die Literatur.3 Über
diese Verlagerung der Diskussion auf politische und moralische Aspekte
geriet das Stück selbst jedoch immer mehr aus dem Blickfeld. Die Spezifika
von Musik und Choreographie schienen von ebenso peripherem Interesse
wie deren ästhetische Prämissen oder die (möglichen) Intentionen der Auto-
ren – kurz: Die Frage nach dem tanz- und musikhistorischen Kontext wurde
auf Schlagworte reduziert und blieb damit letztlich unbeantwortet.
1 Ein kämpferischer Artikel Egks trägt genau diesen Titel: „Abraxas“ und die Freiheit der
Kunst, in: Werner Egk, Musik – Wort – Bild. Texte und Anmerkungen. Betrachtungen und
Gedanken, München 1960, S. 106–108.
2 Vgl. Werner Egk, Das Teufelsballett und der Gralsritter, ebda., S. 109.
3 Vgl. etwa Kurt Peters, Abraxas (Tanzarchiv-Reihe Band 2), Hamburg 1964; Horst Koegler,
Das Ballett in Deutschland. Eine vitale Vielseitigkeit, in: Tanz in Deutschland. Ballett seit
1945. Eine Situationsbeschreibung, hg. von Hartmut Regitz, Berlin 1984, S. 10; Auszüge
aus den Kritiken der Uraufführung in: Pia und Pino Mlakar, Unsterblicher Theatertanz.
300 Jahre Ballettgeschichte der Oper in München. Band 2: Von 1860 bis 1967, Wilhelms-
haven 1992, S. 169–171.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de120 Monika Woitas
Abraxas und die internationale Tanzszene
„Mit Abraxas wird Egk lange seinen Platz im Welt-Ballett behaupten”, lautet
das apodiktische Fazit des Egk-Biographen Ernst Krause4, der das so aufs
Podest gehobene Meisterwerk allerdings kaum einer genaueren Analyse
unterzieht oder nachprüfbare Belege für dessen Etablierung innerhalb des
internationalen Repertoires bieten kann. Abraxas wird zwar auch im Aus-
land aufgeführt; Helsinki, Brünn oder Belgrad sind allerdings kaum als Zen-
tren der internationalen Tanzszene zu bezeichnen. In Paris, London, New
York oder Moskau nimmt man von Egk und seinem Faust-Ballett keine
Notiz. Von einer Etablierung auf internationaler Ebene kann daher kaum die
Rede sein, eher schon, aus deutscher Sicht, von dem Versuch, an die Ent-
wicklungen der Moderne in Musik und Tanz Anschluß zu finden.
Die Anfänge dieser Moderne sind bei Diaghilews Ballets Russes anzusie-
deln, deren Produktionen das Ballett spätestens mit Parade von 1917 zu
einem Forum der Avantgarde gemacht hatten. Eine ganze Heerschar ehe-
maliger Ensemblemitglieder sorgte nach Diaghilews Tod 1929 dafür, daß die
ästhetischen Maximen des genialen Impresarios an die nachfolgende
Tänzergeneration weitergereicht wurden.5 Zu dieser Generation gehörte
auch der 1912 in Mühlhausen als Marcel Fenchel geborene Luipart, dessen
Lehrer Evgenia Eduardowa,6 Nikolai Legat7 und Victor Gsovsky8 allesamt der
St. Petersburger Schule entstammten und der deshalb schon durch seine
Ausbildung eine Sonderrolle innerhalb der deutschen Tanzszene einnahm,
4 Ernst Krause, Werner Egk. Oper und Ballett, Wilhelmshaven 1971, S. 168.
5 Vgl. meine Ausführungen in: MGG Prisma Tanz, hg. von Sibylle Dahms in Zusammenar-
beit mit Claudia Jeschke und Monika Woitas, Kassel 2001, S. 136–151.
6 Eduardowa (1882–1960) machte 1901 ihren Abschluß an der Kaiserlichen Ballettakade-
mie in St. Petersburg und avancierte zu einer der führenden Demi-caractère-Ballerinen
ihrer Generation. Nach Tourneen mit Anna Pawlowa ließ sie sich 1920 in Berlin nieder
und eröffnete dort eine Schule. Verheiratet mit Josef Lewitan, dem jüdischen Tanzkritiker
und Gründer der Fachzeitschrift Der Tanz, mußte sie zusammen mit ihrem Mann
Deutschland 1938 verlassen.
7 Legat (1869–1937) war Solotänzer und ab 1903 Choreograph am Marinski-Theater in
St. Petersburg, bevor er Nachfolger Cecchettis bei Diaghilews Ballets Russes wurde und
1926 eine Ballettschule in London eröffnete. Zu seinen Schülern zählten nahezu alle
bedeutenden Solisten der Ballets Russes, darunter Nijinsky, Fokine, Lopochowa, Dani-
lowa, Dolin, aber auch noch die Primaballerina des Londoner Royal Ballet, Margot Fon-
teyn.
8 Gsovsky (1902–1974) war einer der anerkanntesten Tanzpädagogen seiner Zeit und
stammte gleichfalls aus St. Petersburg. Gemeinsam mit seiner Frau Tatjana eröffnete er
1928 eine Schule in Berlin, wo er seit 1925 als Ballettmeister der Staatsoper Unter den
Linden im Engagement war und zwischen 1930 und 1933 auch für die UfA als Choreo-
graph arbeitete. Ab 1938 unterrichtete Gsovsky in Paris, wo er 1945 die Aufgabe des Bal-
lettmeisters der Pariser Opéra von Lifar übernahm. Von 1950 bis 1952 war er Nachfolger
seines Schülers Luipart in München.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de134 Ulrike Stoll
Freiheit der Kunst? Der Fall Abraxas
Ulrike Stoll
„Die Kunst kann nur leben, wenn sie frei ist“1, verkündete Dieter Sattler
1947 in seiner programmatischen Antrittsrede nach der Übernahme des
neugeschaffenen Amts eines Staatssekretärs für die Schönen Künste, einer
eigenen Stelle für Kunstangelegenheiten im bayerischen Kultusministerium.2
Nach den bitteren Erfahrungen mit der durch Bücherverbrennung, Berufs-
verboten, Spielplaneingriffen und Geschmacksvorschriften geprägten Kultur-
propaganda der nationalsozialistischen Diktatur war man nach dem Ende
des Dritten Reiches besonders sensibilisiert dafür, die Freiheit der Kunst zu
garantieren und maß der Kunst auch eine besondere Bedeutung dabei zu,
der Bevölkerung neue Orientierung zu bieten. Allerdings, so fügte Staatsse-
kretär Sattler in seiner Antrittsrede hinzu, könne der Staat dort nicht fördern,
wo es sich um einen direkten Angriff gegen die Grundlage der Gesellschaft,
nämlich die christliche und humanistische Wurzel der abendländischen Kul-
tur handle. Auch diese Besinnung auf die Werte des christlichen Abend-
lands waren charakteristisch für die unmittelbare Nachkriegszeit. Wenn
jedoch der Staat einen Angriff auf die christliche Kultur zu erkennen
glaubte, konnte dies in Widerspruch zum Postulat der Freiheit der Kunst
geraten – und dieser Widerspruch steht im Zentrum der Debatten um den
sogenannten „Fall Abraxas“, der sich 1948/49 in Bayern und darüber hinaus
zu einem der größten Theaterskandale der Nachkriegszeit entwickelte.3
Bei dem umstrittenen Ballett Abraxas von Werner Egk handelte es sich
um ein Werk, das am 6. Juni 1948 durch die Bayerische Staatsoper auf der
Bühne des Münchner Prinzregententheaters uraufgeführt wurde. Es lehnt
sich an Heinrich Heines Tanz-Poem Der Dr. Faustus von 1847 an und glie-
dert den Stoff der Faust-Sage in die fünf Bilder „Der Pakt“, „Die Verstrik-
kung“, „Pandämonium“, „Das Trugbild“ und „Die Begleichung“. Für den
„Skandal Abraxas“ war besonders das dritte Bild „Pandämonium“ von
1 Dieter Sattler, Die Aufgaben des Staatssekretärs für die Schönen Künste, in: Bayerischer
Staatsanzeiger, 22.2.1947.
2 Zu diesem Amt und der Amtstätigkeit Sattlers vgl. Ulrike Stoll, Kulturpolitik als Beruf. Die-
ter Sattler in München, Bonn und Rom (1906–1968), Diss. München 2002.
3 Die folgende Darstellung der Ereignisse kann sich zu großen Teilen auf die gründliche
Rekonstruktion der Vorgänge durch Klaus Kanzog stützen: Klaus Kanzog, Ballettzensur.
Der Skandal um Werner Egks Faustballett Abraxas, in: Oper aktuell. Die Bayerische Staats-
oper 2001/2002, S. 52–63. Ebenfalls hilfreich: Christiane Wilke, Das Theater der großen
Erwartungen. Wiederaufbau des Theaters 1945–1948 am Beispiel des Bayerischen Staats-
theaters (Europäische Hochschulschriften II/507), Frankfurt am Main 1992, S. 111–127.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deFreiheit der Kunst? Der Fall Abraxas 135
Bedeutung, das in einer Höllenszenerie eine satanische Zeremonie zeigt:
Im ursprünglichen Libretto war davon die Rede, daß der erhöht thronende
Satan mit seinen Geschöpfen „eine Art unbewegliches Sanktissimum oder
Hochaltar“ bildet und die „sakrilegische Zeremonie“, in der ihm die Erz-
buhlin Archisposa als Opfer dargebracht wird, den „Höhepunkt der
‚Schwarzen Messe‘“ bedeutet.4
Für die Uraufführung wurde eine hochrangige Besetzung gewonnen –
Solange Schwarz aus Paris tanzte Bellastriga, die Tschechin Irina Kladivova
die Archisposa und Marcel Luipart, der auch die Choreographie entwarf,
verkörperte den Faust. Der Komponist Egk dirigierte selbst. Trotz schwieriger
Probenbedingungen in dem kriegsgeschädigten, halbzerstörten München
kam es zu einer Uraufführung von beispiellosem Erfolg. Der Spiegel berich-
tete am 12. Juni 1948: „Nach dem 38. Vorhang war der bisherige Beifallsre-
kord der Münchner Staatsoper seit Jahrzehnten gebrochen. Die Bühnenar-
beiter tanzten vor Begeisterung. Erst nach dem 48. Vorhang konnten sich
Werner Egk, Komponist des uraufgeführten Balletts ‚Abraxas‘, und das Tanz-
Dreigestirn Marcel Luipart, Irina Kladivova und Solange Schwarz von der
entfesselt huldigenden Menge verabschieden. Am Bühnenausgang setzten
sich die lärmenden Ovationen mit Autogrammkämpfen fort.“5
Vor den Theaterferien 1948 erfuhr das Stück fünf en-suite-Vorstellun-
gen, die alle restlos ausverkauft waren. In der Gewißheit, daß Abraxas in der
nächsten Spielzeit seine Erfolgsserie fortsetzen würde, verließ Egk München
und fuhr in die Sommerpause.6 Das Ballett wurde jedoch nicht so sehr
durch seine Aufführungen als vielmehr durch seine Absetzung vom Spiel-
plan über den Kreis der Ballettliebhaber hinaus bekannt. Nach den Theater-
ferien kam das Stück nicht mehr zur Aufführung, obwohl dies zu den Bedin-
gungen des Komponisten und Dirigenten Egk gehört hatte, die zumindest
mündlich zwischen ihm und dem Intendanten Georg Hartmann vereinbart
worden waren.7 Egk selber wehrte sich mit allen rechtlichen Mitteln, die
ihm zur Verfügung standen, die Presse griff diese Neuigkeit sensationshung-
rig und mit neu erwachtem liberalen Geist auf. So begann eine engagierte
Diskussion um die Freiheit der Kunst und die Rechte des Kultusministers,
die die Presse, den Landtag, die Öffentlichkeit und auch das Gericht noch
länger beschäftigte und als „Abraxas-Skandal“ in die Geschichte einging.
4 Zitiert nach der Textrekonstruktion von Kanzog, Ballettzensur (vgl. Anm. 3), S. 54 f.
5 Faust flieht. Das gastliche München, in: Der Spiegel, 24, 12. Juni 1948.
6 Vgl. Werner Egk, Die Zeit wartet nicht, Percha 1973, S. 387.
7 Zeugenaussage Georg Hartmanns, Protokoll der öffentlichen Sitzung der 9. Zivilkammer
des Landgerichts München, 19. April 1951, S. 5, in: Bayerische Staatsbibliothek [BSB], NL
Egk, Mappe „Abraxas-Prozeß“; vgl. Kanzog, Ballettzensur (vgl. Anm. 3), S. 59, und dem
Beitrag von Jan Thomas Schleusener in diesem Band.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deQuantität als Qualität 147
Quantität als Qualität.
Werner Egks Opern und die gemäßigte
Moderne der fünfziger Jahre
Jürgen Schläder
Auf die Frage, ob die Oper Irische Legende Werner Egks Wendung zur
Zwölftonmusik bedeute, antwortete der Komponist, man möge darin seinen
Gruß in Richtung Dodekaphonie sehen, nicht aber einen Parteibeitritt.1 Egks
Äußerung traf ins Schwarze, aber sie war auch entlarvend. Zum einen brach
die Formulierung vom Gruß an die Dodekaphonie die ernsthafte Stellung-
nahme zur musikalischen Moderne der fünfziger Jahre, die man von einem
Komponisten seines Schlages hätte erwarten dürfen, herunter auf die blanke
Ironisierung der seinerzeit heftig geführten Stildebatte. Mit ihr unweigerlich
verknüpft war das Problembewußtsein für die ästhetische Autonomie
moderner Musik in den fünfziger Jahren und für die soziale und politische
Funktion dieser musikalischen Moderne. Dodekaphon zu komponieren,
bedeutete nicht nur die Adaptation von Regeln, mit denen man einen
handwerklich guten Tonsatz schreiben kann, sondern meinte, weit darüber
hinaus, eine künstlerische Haltung, nämlich die Vermeidung traditioneller
Klangidiome und das mit dieser Vermeidung verknüpfte ostentative
Bekenntnis zur Abkehr von der zu diesem Zeitpunkt allenthalben bereits
verkommenen Ausdrucksästhetik der Romantik.2 Egks Gruß an die Dodeka-
phonie verkleinerte die stilistische Signatur dieser Dekade zwischen 1948
und 1960 zu einem harmlosen Modernismus, an dem vorbei zu gehen und
ihn gönnerhaft eines kurzen Blicks zu würdigen er sich vermeintlich erlau-
ben durfte. Die kompositorische Faktur der Irischen Legende belegt freilich
schlagend, daß substantielle Zwölftonkomposition nicht Egks Sache war –
weder in der musikalischen Erfindung von Detailmomenten noch in der
strukturellen Organisation eines kompletten musikalischen Werks.
Zum andern akzentuierte Egks Hinweis auf den nicht vollzogenen Par-
teibeitritt eine von ihm gern stilisierte, beinahe mythisierte Einzelgänger-
Haltung, die ihm in der aufbrechenden pluralistischen Musikkultur der fünf-
1 Vgl. Werner Egk, Die Zeit wartet nicht. Künstlerisches, Zeitgeschichtliches, Privates aus
meinem Leben, München 1981, S. 477.
2 Vgl. R. Stephan, in: MGG. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hg. von Ludwig Finscher, Art.
Zwölftonmusik, Sachteil Band 9, Kassel u.a. 1998, Sp. 2516. Stephan charakterisiert die
Zwölftonmusik als eine Sammlung von Vorschriften, die dem Komponisten einen Rückfall
„ins traditionelle musikalische Idiom“ vermeiden hilft und „eine ganz bestimmte Art von
Traditionalismus: Banalität“ verhindert.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.de148 Jürgen Schläder
ziger Jahre3 eine Ausnahmestellung garantieren sollte. Egk hatte schon 1934
diese Solitär-Haltung beschworen, in einem kleinen „Selbstporträt“, wie er
es nannte.4 Dort skizzierte er seinen musikalischen Werdegang ohne
berühmte Lehrmeister und durchaus ohne musikalische Familie, d.h. ohne
Bindung an eine Gruppe oder stilistische Einflußnahme durch andere, so
daß er, wie er formulierte, „ganz und gar allein inmitten dieser bösen Welt“
stehe und es dennoch zu einigen Aufführungen gebracht, ja sogar einen
Verleger für seine Musik gefunden habe. Die „anrüchige Illegitimität“ seiner
ungeklärten musikalischen Herkunft kostete er in diesem Selbstporträt weid-
lich aus, indem er sich mit Shakespeare und der Rezeptionsgeschichte von
dessen dramatischem Werk aus der Perspektive des Originalgenies gleich-
setzte: Lobpreis des Genies oder Verdammnis des künstlerischen Bankerts
lägen stets dicht beieinander. Als Beweis zitierte Egk die einschlägigen For-
mulierungen höchst gegensätzlicher Einschätzungen seiner bis dahin
erschienenen Werke mit dem Ziel der unverhohlenen Selbstbeweihräuche-
rung. Von dieser Haltung, die durch eine scheinbare Selbstironie angenehm
wirken sollte, ist auch die Äußerung aus dem Jahre 1955 zur Irischen
Legende geprägt. Egk befand sich 1955 nicht anders als 1934 außerhalb des
kompositorischen Mainstreams, sofern man sich die Perspektive der avan-
cierten Musiksprache der Zeit zueigen macht. In beiden Dekaden, in den
dreißiger wie in den fünfziger Jahren, klafften kompositorisches Avancement
und Popularität der musikalischen Produktion weit auseinander. Bestimmt
man freilich den Mainstream nach den Gesetzen des Erfolgs und der Auf-
führungsfrequenz – wofür es auch in der historiographischen Sichtweise
gute Gründe gibt –, dann zählte Werner Egk vor wie nach dem Zweiten
Weltkrieg zu den ersten und erfolgreichsten Komponisten Deutschlands.
Dann machte die Stilisierung der Einzelgänger-Haltung Sinn.
Der Dissenz der Perspektiven auf Avancement oder Popularität spiegelt
das allgemeine Problem einer historiographischen Beschreibung und Wer-
tung: Hat Werner Egk, so wäre zu fragen, keinen Teil an der musikgeschicht-
lichen Entwicklung der dreißiger wie der fünfziger Jahre, weil seine Kompo-
sitionen der ästhetischen Stimmigkeit entbehren, oder ist er nicht gerade
deswegen ein exemplarischer Vertreter der deutschen Musikgeschichte zwi-
schen 1930 und 1960, weil seine Werke dem Verdikt der ästhetischen
Unstimmigkeit verfallen? Über die Kriterien der Werkästhetik in avancierter
Musik herrscht weitgehend Einigkeit und damit auch über die Frage nach
3 Der Begriff nach Hermann Danuser, Die Musik des 20. Jahrhunderts (= Neues Handbuch
der Musikwissenschaft, hg. von Carl Dahlhaus, Band 7, Laaber 1984, dort als Kapitel-
Überschrift („Die pluralistische Musikkultur: Tradition, Moderne, Avantgarde“), S. 285).
4 Musik – Wort – Bild, München 1960, S. 203 f.
© Herbert Utz Verlag 2008 · www.utzverlag.deSie können auch lesen