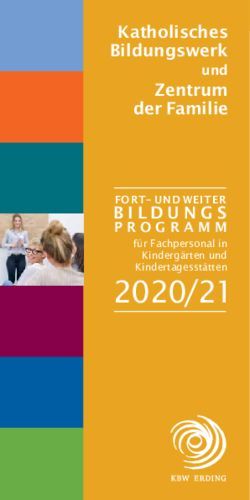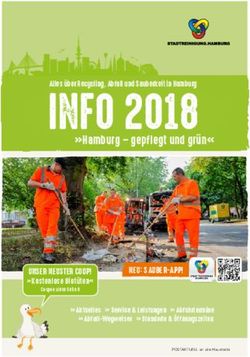The Royal Danish Orchestra - Per Nørgård Arnold Schönberg Carl Nielsen - September 2015
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
14. September 2015 The Royal Danish Orchestra Per Nørgård Arnold Schönberg Carl Nielsen Berliner Festspiele in Zusammenarbeit mit der Stiftung Berliner Philharmoniker
Bildnachweise
Titel: Ausschnitt aus dem Emblem des Royal Danish Orchestra. Kupferstich von 1583. Foto: Simon Lautrop
S. 9 Lampe in der Königlichen Oper, Kopenhagen, Entwurf: Olafur Eliasson.
Foto: Niels Elgaard Larsen / Wikimedia Commons
S. 16 Per Nørgård © Morten Ernst Lassen
S. 17 Arnold Schönberg 1911–1915. Foto: Nora Perscheid © Arnold Schönberg Center, Wien
S. 18 Carl Nielsen © Det Kongelige Bibliotek Kopenhagen
S. 19 Magdalena Anna Hofmann © Promo
S. 20 Michael Boder © Alexander Vasiljev
S. 21 The Royal Danish Orchestra © Natascha Thiara RydvaldMusikfest Berlin 2015
Montag, 14. September, 20 Uhr
5 Konzertprogramm
6 Essay
11 Erwartung – Libretto
16 Komponisten
19 Interpreten
33 Musikfest Berlin 2015 im Radio und Internet
34 Musikfest Berlin 2015 Programmübersicht
36 Impressum
Viele weitere Texte zum Musikfest Berlin lesen Sie im Blog der Berliner Festspiele:
blog.berlinerfestspiele.de4
Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor Beginn des Konzerts aus.
Bitte beachten Sie, dass Mitschnitte und Fotografieren
während des Konzerts nicht erlaubt sind.
Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur mitgeschnitten.
Sendung am 25. September 2015, 20:03 Uhr
Deutschlandradio Kultur ist in Berlin über UKW 89,6 MHz, Kabel 97,50 MHz,
digital und über Livestream auf www.dradio.de zu empfangen.Programm
Gastspiel: Kopenhagen
Unter der Schirmherrschaft
I.K.H. Prinzessin Benedikte zu Dänemark
Per Nørgård (* 1932)
Iris für Orchester (1966)
Arnold Schönberg (1874–1951)
Erwartung op.17 (1909)
Monodram in einem Akt
für Singstimme und großes Orchester
1. Szene: Am Rande des Waldes
2. Szene: Tiefstes Dunkel
3. Szene: Weg noch immer im Dunkel
4. Szene: Mondbeschienene breite Straße
Pause
Carl Nielsen (1865–1931)
5
Symphonie Nr. 5 op. 50 (1921/22)
1. Tempo giusto – Adagio
2. Allegro – Presto – Andante poco tranquillo –
Allegro (Tempo I)
Montag, 14. September Magdalena Anna Hofmann Mezzosopran
20:00 Uhr
Philharmonie The Royal Danish Orchestra
19:00 Uhr
Michael Boder Leitung
Einführung mit
Martin Wilkening
Eine Veranstaltung der Berliner Festspiele / Musikfest Berlin
in Zusammenarbeit mit der Königlichen Dänischen Botschaft Berlin
anlässlich des Carl Nielsen-Jahres 2015.
Mit Unterstützung von Augustinus Fonden, Beckett-Fonden und
Knud Højgaards FondEssay
Von der Wirkung der Klänge
Öffnung der Sinne
Viele Stücke des dänischen Komponisten Per Nørgård tragen sprechende Titel. Deren
Assoziationsräume sind manchmal mehr als nur ein Angebot für den Hörer. So ging der
Titel von Per Nørgårds „Iris“ – das griechische Wort für den Regenbogen – als eine Art
Werk-Phantasie der eigentlichen Komposition voraus. Das ist typisch für Nørgårds
Arbeiten der sechziger Jahre, zu deren gleichsam intuitivem Ursprung er sagte: „Diese
Titel haben schon eine Art Selbststeuerung in sich gehabt. ‚Iris‘, das Irisierende, war
Wirklichkeit für mich, lange bevor ich auch nur einen Ton geschrieben hatte, und nach
‚Iris‘ kam ‚Luna‘, als eine Art Gegenstück zu ‚Iris‘: das Lunare, Milchige im Gegensatz
zum Irisierenden, Glitzernden.“ Der 1934 geborene Nørgård ist in seiner Entwicklung
einen Weg von beeindruckender Eigenständigkeit gegangen. Er hatte schon früh be
gonnen, die zeitbestimmenden seriellen Techniken seinen eigenen Vorstellungen einer
durch beständige Metamorphosen sich organisch entwickelnden Musik anzuverwan-
deln, und er näherte sich in den sechziger Jahren vor allem den neuartigen Ideen der
Klangkomposition, für die weniger die Ausbildung abstrakter Strukturen als vielmehr
die Erforschung akustisch-musikalischer Wahrnehmung Bedeutung gewinnt. So spielt
6
für „Iris“ vor allem das Verhältnis zwischen Klang und Linie eine Rolle. Die optische Ana-
logie des Regenbogens liegt da nahe, nicht nur wegen dessen irisierender Farblichkeit,
sondern schon allein aufgrund der unstofflichen und vorübergehenden Existenz des
Regenbogens, dessen Gestalt nicht physisch für sich existiert, sondern nur in der Wahr-
nehmung.
Die klangliche Basis von „Iris“ sind die vielfach geteilten Streicher. Sie bilden ein dichtes
Netz ineinander verschlungener Klangfäden, aus deren Überschneidungen sich Frag-
mente melodischer Linien andeuten. Aus dieser Grundvorstellung entwickelt Nørgård
im Zusammenspiel mit den Bläsern eine überraschend eingängige Gesamtform. Den
Anfangsteil beherrscht eine Atmosphäre der Unbestimmtheit, bis mit einem luftigen
Glissando von zehn ersten Violinen ein Schleier aufreißt. Im Wechselgesang zwischen
unbegleiteter Klarinette und Orchester tritt nun eine Art Urmelodie deutlich hervor, in
einfachster Weise mit gleichmäßigen Vierteln rhythmisiert, pendelnd zwischen Terz-
und Sekundintervallen. In diesem Dialog schält sich immer stärker der Zentralton A
heraus. In der polyphonen Verdichtung der melodischen Elemente durch die Vielstim-
migkeit des Orchesters erreicht das Stück seinen Höhepunkt. Danach kehrt es zum
Anfang zurück, allerdings zunächst ohne Streicher, sondern nur mit den drei Flöten,
deren Klangband aus gegeneinander verschobenen Überblasklängen schon zu Beginn
den Streichersatz überlagerte. Eine kurze dramatische Steigerung der Hörner klingt wie
eine Erinnerung an typische sinfonische Coda-Augenblicke vor dem Ausklang, der in
eine breit wogende Klangfläche führt.
Nørgård sucht in seiner Klangkomposition nicht nach einer Gestaltung, die beabsichtigt,
die Wahrnehmung kunstvoll zu überlisten, sondern nach Möglichkeiten, mit der Musik
Erfahrungsräume zu schaffen, in denen der Hörer über die Sinne sich selbst neu zuEssay
entdecken vermag. In einem Interview aus dem Jahr 1996 sagte er: „Ich meine, dass die
Musik vor allen anderen Kunstarten an der Grenze zum unphysisch Existierenden liegt,
dass sie ein Ausdruck für Prozesse ist, welche konstant in unserem Nervensystem, im
Körper, in unserem sozialen Umfeld usw. stattfinden. Da ich zuallererst versuche, von
einer versteinerten Wirklichkeitsdeutung wegzukommen, meine ich, dass es noch ein
kolossal weiter Weg ist, bis wir von uns sagen können, wir hätten ein echtes offenes
Weltbild. Und ich glaube, dass der Weg hin zu dieser Öffnung in hohem Maße über die
Sinne verläuft, weil dort jenes Denkwürdige geschieht: dass wir unsere Umgebung in
uns selbst hinein vermitteln und uns selbst in sie zurück.“
Die Sinne als Gegenspieler
Arnold Schönberg schrieb die Musik zur „Erwartung“, seinem ersten Bühnenwerk, im
Oktober 1909. Nach dem 2. Streichquartett, den Liedern auf Gedichte von Stefan George,
den Klavierstücken op. 11 und den Orchesterstücken op. 16 bildet das Monodram den
vorläufigen Höhepunkt seines gut ein Jahr zuvor begonnenen Weges in eine von tonalen
Bindungen befreite Musik. Mit etwa einer halben Stunde Dauer stellt es sich in beson-
7
derem Maße der eigentlichen Herausforderung, die mit der Aufhebung der Tonalität
verbunden war: der Gestaltung größerer Formen, ohne die formbildende Kraft von tona-
len Spannungen und Kadenzierungen in Anspruch zu nehmen.
Für Schönberg war mit der „Erwartung“ auch ein vorläufiger Schlusspunkt erreicht. In
den folgenden zwei Jahren vollendete er lediglich die „Sechs kleinen Klavierstücke“
op. 19. Sein zweites Bühnenwerk, „Die glückliche Hand“, das er 1910 begann, brauchte
drei Jahre bis zur Fertigstellung. Dagegen muten die nur vierzehn Tage, die die Kompo-
sition der „Erwartung“ in Anspruch nahm, extrem kurz an, fast so, als ob es Schönberg
auch darum ging, sich der Dichte und Vielschichtigkeit des inneren Zeiterlebens, die
seine Partitur zeigt, auch im Schaffensprozess selbst anzunähern. Wie er schrieb, hatte
er in diesem Stück „ die Absicht, das, was sich in einer Sekunde seelischer höchster Erre-
gung abspielt, sozusagen mit der Zeitlupe, auf eine halbe Stunde ausgedehnt, darzu-
stellen“. Der Vergleich mit der Zeitlupe könnte irreführen, denn es geht hier keineswegs
um eine Verlangsamung der Zeitabläufe, sondern um die durch den sozusagen mikro-
skopischen Blick erschlossene Detailfülle, die den imaginären Raum des psychischen
Apparats bildet, aus dem heraus eine Sekunde zum gelebten Augenblick wird. Mit ersten
Kompositionsskizzen begann Schönberg anscheinend schon unmittelbar bei der Lektüre
des Textes, den ihm auf seine Anregung hin Marie Pappenheim geschrieben hatte, eine
literarisch ambitionierte Medizinstudentin aus dem Kreis um Karl Kraus. Am Rand des
Manuskripts notierte er einzelne Motive, Klänge und ungewöhnliche Vorstellungen zur
Instrumentation, etwa die einer präparierten „Harfe mit Papierstreifen“.
Die Sprache des Frauen-Monologs ist einerseits einfach und direkt, auch wenn die
Gedanken oftmals bruchstückhaft offen bleiben. Andererseits herrscht eine rätselhafte
Verunsicherung in der Wahrnehmung der Welt, durch die sich die Sprechende bewegt.Essay
Beides lässt deutlich den Einfluss Maurice Maeterlincks spüren, dessen Drama „Pelleas
und Melisande“ Schönberg einige Jahre zuvor als Vorlage für seine Symphonische
Dichtung benutzt hatte. Noch mehr als dort erscheint der Wald in der „Erwartung“
nicht nur als Schauplatz der Handlung oder eine Art Spiegel innerer Zustände, sondern
geradezu als Gegenspieler: Der Gang, der die Frau auf der Suche nach ihrem Geliebten
durch den nächtlichen Wald führt, ist wie ein Weg ins Unbewusste. Er trifft auf Wider-
stände, erzeugt Ängste und lässt alte Wunden aufreißen. Woher kommt das Blut an den
Händen der Frau? Hat ihr das Gestrüpp die Hände zerrissen, oder ist es das Blut vom
Kopf des Geliebten, den sie schließlich tot hinter einer Bank gefunden zu haben glaubt?
In Schönbergs zusätzlichen Bühnenanweisungen wird die Frage nach der Realität des
Leichnams noch stärker verunklart: Sie sprechen ausdrücklich immer nur von dem
„Gegenstand“, den die Frau berührt.
Schönbergs Musik verhält sich zum Text nie stimmungsmalend, benutzt auch keine Art
von Leitmotivik, sondern sie folgt konsequent, wie eine surrealistische écriture automa-
tique, dem inneren Echo der Worte. Adorno bestimmte als „das eigentlich umstürzende
Moment“ bei Schönberg in Werken wie der „Erwartung“ den „Funktionswechsel des
musikalischen Ausdrucks. Es sind nicht Leidenschaften mehr fingiert, sondern im
Medium der Musik unverstellt lebhafte Regungen des Unbewussten, Schocks, Traumata
registriert. Sie greifen die Tabus der Form an, weil diese solche Regungen ihrer Zensur
unterwerfen, sie rationalisieren und sie in Bilder transponieren.“ Am meisten gilt dies
vielleicht für die mehrmals merkwürdig starr aus dem Fluss der verwobenen Gesten
8
herausragenden Ostinato-Stellen, wo sich die Besetzung durch eine innere Erregung in
der Wiederholung festzuhaken scheint und plötzlich der Horror der real tickenden Zeit
dem erlebenden Ich gegenüber tritt. Nur an einer einzigen Stelle verlässt die Singstimme
den Sprechtonfall, im langsamen Tempo durchschreiten sechs Silben in großen Noten-
werten einen Tonraum von fast zwei Oktaven. Dies geschieht zu den Worten „für mich
ist kein Platz da“. Das ist der deutlichste Ausdruck der existentiellen Grundangst dieser
„Erwartung“, der Verlust eines sicheren Ortes – eine Angst, für deren Repräsentation die
angedeutete Geschichte selbst nur eine Einkleidung bedeutet.
Der Sinn des Symphonischen
Für die Zeit um 1920, als Carl Nielsen seine 5. Symphonie schrieb, war der Glaube an die
Idee des Symphonischen fremd geworden. Das humanistische Pathos, die künstlerische
Totalität eines Weltentwurfs und die Vorstellung einer Rede an die Menschheit, die von
Beethoven bis Mahler bei allen Unterschieden den inneren Sinn der Gattung Symphonie
bestimmt hatten, erschienen nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und den
gesellschaftlichen Veränderungen ausgehöhlt und fremd. Gefragt waren kürzere For-
men, kleinere Besetzungen und ein schärferer Ton. In dieser Hinsicht steht Nielsens
Symphonie quer zu ihrer Zeit. Und doch erzählt sie auch von ihr. Es ist europäische Musik,
die von der Peripherie her spricht, und zwar einer doppelten: Nielsen selbst hat Zeit sei-
nes Lebens eine Identität betont, die sich weniger auf Nationales als auf Regionales
bezieht, auf die ländliche Kultur der dänischen Insel Fünen, wo er aufgewachsen war.
Der Pastoralton seiner Musik, die Evokation von Landschaftlichem, wie sie den Anfang
der 5. Symphonie bestimmt, hat eine fast minimalistische Strenge. Die Farben diesesEssay
9Essay
Bildes erscheinen zunächst ungemischt: eine monotone Wellenbewegung zwischen klei-
ner Terz und Grundton in den Bratschen und ein einträchtiger Zwiegesang der Fagotte,
in einer anderen Tonart, aber auch in Terzen mit eingeschobenen Anklängen an soge-
nannte Hornquinten. Solchem aufs wesentliche reduzierten Impressionismus werden
im weiteren Verlauf nicht nur die zerstörerischen Energien gegenübergestellt, die Niel-
sen hier entfesselt wie in keiner anderen seiner Symphonien. Denn viel stärker als solche
Naturbilder prägt diese Musik insgesamt das Kunsthafte, das sich am deutlichsten in
den großen fugierten Abschnitten des 2. Satzes zeigt.
„Meine erste Sinfonie war namenlos. Aber dann kamen ‚Die vier Temperamente‘, ‚Espan-
siva‘ und ‚Das Unauslöschliche‘, eigentlich nur unterschiedliche Namen für dasselbe,
das einzige, was Musik ausdrücken kann, wenn alles gesagt und getan ist: die ruhenden
Kräfte im Gegensatz zu den tätigen. Müsste ich einen Namen für diese, meine neue,
fünfte Sinfonie finden, würde er etwas Ähnliches ausdrücken. Es ist mir nicht gelungen,
jenes eine Wort zu fassen, das gleichzeitig charakteristisch und nicht zu prätentiös ist –
also habe ich es gelassen.“ Nielsen konnte, wie hier in einem Zeitungsinterview kurz vor
der Kopenhagener Uraufführung im Januar 1922, sicher sein, dass die Botschaft seiner
neuen Symphonie, die er in zwei polar gegenüberstehende Sätze fasste, auch ohne Titel
verstanden werden würde. In jenen Jahren gab die Erinnerung des Ersten Weltkriegs ein
unmittelbar einleuchtendes Vorbild für die Sprengung des Zusammenhangs, die dem
ersten Satz widerfährt. Als Ausdruck einer Bedrohung lässt sich das musikalische
Geschehen jedoch in vielfältigen Kontexten verstehen.
10
Aus der umfangreichen Schlagzeuggruppe tritt in zunehmend negativer Semantik die
kleine Trommel hervor, fast wie eine handelnde Figur, wie die Verkörperung des Bösen.
Ihr Rhythmus nistet sich immer mehr in der Musik ein, bis er in offene Aggressivität
umschlägt: Nielsen lässt dieses Instrument in einem etwas schnelleren Tempo als das
Orchester spielen, so dass sich eine nicht synchronisierte Mehrschichtigkeit ergibt, die
momentweise an Charles Ives erinnert. Die Partituranweisung dazu lautet: „Der Tromm-
ler spielt in seinem eigenen Tempo, als ob er um jeden Preis die Musik behindern wollte.“
Und schließlich lässt Nielsen den Trommelpart gegen die notierten Orchesterstimmen
in eine völlig freie Kadenz auslaufen. Das ist allerdings weniger als avantgardistische
Geste zu verstehen, denn als eine Möglichkeit, den Exzess und das Verschwinden dieser
bösen Kraft gleichsam jenseits des Komponierten zu realisieren, als eine Handlung des
Interpreten, demgegenüber das Komponierte seine Integrität behauptet.
Auch den Gegenkräften, die im zweiten Satz dem symphonischen Topos des „Durch
Nacht zum Licht“ den Weg bahnen, haftet noch etwas Zwielichtiges an. So führt die
erste, halsbrecherisch losstürmende Fuge keineswegs zum Triumph, sondern sie zerfällt,
löscht sich wie von selber aus, bevor schließlich ein zweiter gesanglicher Fugenteil die
Musik zu einem glücklichen Ende führt. Diese Fugen erscheinen frei von aller demons-
trativen Handwerklichkeit, sie weisen auf einen echten Gehalt, die Beschwörung eines
Zusammenhangs, die sich nicht zuletzt als Gegenbild der chaotischen Polyphonie
bestimmt, in die der erste Satz gerät. Darauf deutete schon Max Brod hin, Freund Kaf-
kas und einer der ersten Nielsen-Verehrer außerhalb Dänemarks, als er, noch vor der
5. Symphonie, N ielsens „legitimen Kontrapunkt“ pries.
Martin WilkeningLibretto
Erwartung
1. Szene: Am Rande eines Waldes. Mondhelle Straßen und Felder; der Wald
hoch und dunkel. Nur die ersten Stämme und der Anfang des breiten
Weges noch hell. Eine Frau kommt; zart, weiß gekleidet. Teilweise entblät-
terte rote Rosen am Kleid. Schmuck.
(Zögernd): Hier hinein? ... Man sieht den Weg nicht ... Wie silbern die
Stämme schimmern ... wie Birken (vertieft zu Boden schauend) Oh! Unser
Garten ... Die Blumen für ihn sind sicher verwelkt ... Die Nacht ist so warm
... (In plötzlicher Angst): Ich fürchte mich ... (Horcht in den Wald, beklom-
men): Was für schwere Luft herausschlägt ... wie ein Sturm, der steht ...
(Ringt die Hände, sieht zurück): So grauenvoll ruhig und leer ... Aber hier
ist es wenigstens hell ... (Sieht hinauf): Der Mond war früher so hell ...
(Stille, kauert nieder, lauscht vor sich hin): Oh! Noch immer die Grille mit
ihrem Liebeslied ... Nicht sprechen ... es ist so süß bei dir ... Der Mond ist
in der Dämmerung ... (Auffahrend. Wendet sich gegen den Wald, zögert
wieder, dann heftig): Feig bist du ... willst ihn nicht suchen? So stirb doch
hier ... (Leise): Wie drohend die Stille ist ... (Sieht sich scheu um): Der Mond
11
ist voll Entsetzen ... Sieht der hinein? (Angstvoll): Ich allein ... in den dump-
fen Schatten ... (Geht rasch in den Wald hinein; Mut fassend): Ich will sin-
gen, dann hört er mich ...
2. Szene: Verwandlung. Tiefstes Dunkel, breiter Weg, hohe dichte Bäume.
Sie tastet vorwärts.
Ist das noch der Weg? (Bückt sich, greift mit den Händen): Hier ist es eben
... (aufschreiend): Was? ... Laß los! (Zitternd auf, versucht ihre Hand zu
betrachten): Eingeklemmt? ... Nein, es ist etwas gekrochen ... (Wild, greift
sich ins Gesicht): Und hier auch ... Wer rührt mich an? ... Fort ... (Schlägt
mit den Händen um sich): Fort, nur weiter ... um Gotteswillen ... (Geht
weiter, mit vorgestreckten Armen): So, der Weg ist breit ... (Ruhig, nach-
denklich): Es war so still hinter den Mauern des Gartens ... Keine Sensen
mehr ... kein Rufen und Gehn ... Und die Stadt in hellem Nebel ... so sehn-
süchtig schaute ich hinüber ... Und der Himmel so unermeßlich tief über
dem Weg, den du immer zu mir gehst ... noch durchsichtiger und ferner ...
die Abendfarben ... (Traurig): Aber du bist nicht gekommen. (Stehenblei-
bend): Wer weint da? ... Sss ... (Rufend, sehr leise, ängstlich): Ist hier
jemand? (Wartet. Lauter): Ist hier jemand? (Wieder lauschend): Nichts ...
aber das war doch ... (Horcht wieder): Jetzt rauscht es oben ... Es schlägt
von Ast zu Ast ... (Voll Entsetzen seitwärts flüchtend): Es kommt auf mich
zu ... (Schrei eines Nachtvogels.) (Tobend): Nicht her! Laß mich ...Libretto
Herrgott, hilf mir ... (Stille, Hastig): Es war nichts ... Nur schnell, nur schnell
... (Beginnt zu laufen, fällt nieder): Oh, oh ... was ist das? ... Ein Körper ...
(Greift): Nein, nur ein Stamm ...
3. Szene: Verwandlung. Weg noch immer im Dunkel; seitlich vom Wege ein
breiter, heller Streifen; das Mondlicht fällt auf eine Baumlichtung. Dort
hohe Gräser, Farne, große gelbe Pilze. Die Frau kommt aus dem Dunkel.
Da kommt ein Licht! ... (Atmet auf): Ach! nur der Mond ... Wie gut ... (Wie-
der halb ängstlich): Dort tanzt etwas Schwarzes ... hundert Hände ...
(Sofort beherrscht): Sei nicht dumm ... es ist der Schatten ... (Zärtlich
nachdenkend): Oh! wie dein Schatten auf die weißen Wände fällt ... Aber
so bald mußt du fort ... (Rauschen. Sie hält an, sieht um sich und lauscht
einen Augenblick): Rufst du? (Wieder träumend): Und bis zum Abend ist
es so lang ... (Leichter Windstoß. Sie sieht wieder hin): Aber der Schatten
kriecht doch! ... Gelbe, breite Augen (Laut des Schauderns) So vorquellend
... wie an Stielen ... Wie es glotzt ... (Knarren im Gras. Entsetzt): Kein Tier,
lieber Gott, kein Tier ... Ich habe solche Angst ... Liebster, mein Liebster, hilf
mir ... (sie läuft weiter).
12
4. Szene: Verwandlung. Mondbeschienene breite Straße, rechts aus dem
Wald kommend. Wiesen und Felder (gelbe und grüne Streifen abwech-
selnd). Etwas nach links verliert sich die Straße wieder im Dunkel hoher
Baumgruppen. Erst ganz links sieht man die Straße frei liegen. Dort mün-
det auch ein Weg, der von einem Haus herunterführt. In diesem alle Fens-
ter mit dunklen Läden geschlossen. Ein Balkon aus weißem Stein.
(Die Frau kommt langsam, erschöpft. Das Gewand ist zerrissen, die Haare
verwirrt. Blutige Risse an Gesicht und Händen. Umschauend): Er ist auch
nicht da ... Auf der ganzen langen Straße nichts Lebendiges ... kein Laut ...
(Schauer; lauschend): Die weiten blassen Felder sind ohne Atem, wie
erstorben ... kein Halm rührt sich ... (Sieht die Straße entlang): Noch
immer die Stadt ... Und dieser fahle Mond ... Keine Wolke, nicht der Flügel-
schatten eines Nachtvogels am Himmel ... diese grenzenlose Totenblässe
... (Sie bleibt schwankend stehen): Ich kann kaum weiter ... Und dort läßt
man mich nicht ein ... Die fremde Frau wird mich fortjagen ... Wenn er
krank ist ... (Sie hat sich in die Nähe der Baumgruppen geschleppt, unter
denen es vollständig dunkel ist): Eine Bank ... ich muß ausruhen ... (Müde,
unentschlossen, sehnsüchtig): Aber so lange habe ich ihn nicht gesehen ...
(Sie kommt unter die Bäume, stößt mit den Füßen an etwas): Nein. Das
ist nicht der Schatten der Bank (mit dem Fuß testend, erschrocken): Da
ist jemand ... (Beugt sich nieder, horcht): Er atmet nicht ... (Sie tastet hin-
unter): Feucht ... hier fließt etwas ... (Sie tritt aus dem Schatten insLibretto
Mondlicht): Es glänzt rot ... Ach, meine Hände sind wundgerissen ... Nein,
es ist noch naß, es ist von dort ... (Versucht mit entsetzlicher Anstrengung
den Gegenstand hervorzuzerren): Ich kann nicht ... (Bückt sich. Mit furcht-
barem Schrei): Das ist er ... (sie sinkt nieder.) (Nach einigen Augenblicken
erhebt sie sich halb, so daß ihr Gesicht den Bäumen zugewendet ist. Ver-
wirrt): Das Mondlicht ... nein, dort ... Da ist der schreckliche Kopf ... das
Gespenst ... (Sieht unverwandt hin): Wenn es nur endlich verschwände ...
wie das im Wald ... Ein Baumschatten, ein lächerlicher Zweig ... Der Mond
ist tückisch ... weil er blutlos ist, malt er rotes Blut ... (Mit ausgestreckten
Fingern hinweisend, flüsternd): Aber es wird gleich zerfließen ... Nicht hin-
sehen ... Nicht darauf achten ... Es zergeht sicher ... wie das im Wald ...
(Sie wendet sich mit gezwungener Ruhe ab, der Straße zu): Ich will fort ...
ich muß ihn finden ... Es muß schon spät sein ... (Schweigen. Unbeweg-
lichkeit. Sie wendet sich jäh um, aber nicht vollständig. Fast jauchzend):
Es ist nicht mehr da ... Ich wußte ... (Sie hat sich weiter gewendet, erblickt
plötzlich wieder den Gegenstand): Es ist noch da ... Herrgott im Himmel
... (Ihr Oberkörper fällt nach vorne, sie scheint zusammenzusinken. Aber
sie kriecht mit gesenktem Haupt hin): Es ist lebendig ... (tastet): Es hat
Haut ... Augen ... Haare ... (Sie beugt sich ganz zur Seite, als wollte sie ihm
ins Gesicht sehen): Seine Augen ... es hat seinen Mund ... Du ... du ... bist
du es ... Ich habe dich so lange gesucht ... Im Walde und ... (an ihm zer-
13
rend): Hörst du? Sprich doch ... Sieh mich an ... (Entsetzt, beugt sich ganz.
Atemlos): Herrgott, was ist ... (Schreiend, rennt ein Stück fort): Hilfe ...
(Von ferne zum Haus hinauf): Um Gottes willen ... rasch ... hört mich denn
niemand? ... er liegt da ... (schaut verzweifelt um sich.) (Eilig zurück unter
die Bäume): Wach auf ... Wach doch auf ... (flehend): Nicht tot sein, ...
mein Liebster ... Nur nicht tot sein ... ich liebe dich so. (Zärtlich, eindring-
lich): Unser Zimmer ist halbhell ... alles wartet ... die Blumen duften so
stark. (Die Hände faltend, verzweifelnd): Was soll ich tun ... was soll ich
nur tun, daß er aufwacht? ... (Sie greift ins Dunkel hinein, faßt seine
Hand): Deine liebe Hand ... (zusammenzuckend, fragend): So kalt? ... (Sie
zieht die Hand an sich, küßt sie. Schüchtern schmeichelnd): Wird sie nicht
warm an meiner Brust? (Sie öffnet das Gewand): Mein Herz ist so heiß vom
Warten ... (Flehend, leise): Die Nacht ist bald vorbei ... Du wolltest doch
bei mir sein heute nacht. (Ausbrechend): Oh! es ist heller Tag ... Bleibst du
am Tage bei mir? ... Die Sonne glüht auf uns ... deine Hände liegen auf mir
... deine Küsse ... mein bist du ... du ... Sieh mich doch an, Liebster, ich liege
neben dir ... So sieh mich doch an ... (Sie erhebt sich, sieht ihn an, erwa-
chend): Ah! wie starr ... Wie fürchterlich deine Augen sind ... (Laut auf-
weinend): Drei Tage warst du nicht bei mir ... Aber heute ... so sicher ... Der
Abend war so voll Frieden ... Ich schaute und wartete ... (ganz versunken):
über die Gartenmauer dir entgegen ... So niedrig ist sie ... Und dann winken
wir beide ... (Aufschreiend): Nein, nein ... es ist nicht wahr ... Wie kannst
du tot sein? ... Überall lebtest du ... Eben noch im Wald ... deine Stimme
so nahe an meinem Ohr ... Immer, immer warst du bei mir ... dein HauchLibretto
auf meiner Wange ... deine Hand auf meinem Haar ... (Angstvoll): Nicht
wahr ... es ist nicht wahr? Dein Mund bog sich doch eben unter meinen
Küssen ... (Wartend): Dein Blut tropft noch jetzt mit leisem Schlag ... Dein
Blut ist noch lebendig ... (Sie beugt sich tief über ihn): Oh! der breite rote
Streif ... Das Herz haben sie getroffen ... (Fast unhörbar): Ich will es küssen
... mit dem letzten Atem ... dich nie mehr loslassen (richtet sich halb auf):
In deine Augen sehn ... Alles Licht kam ja aus deinen Augen ... mir schwin-
delte, wenn ich dich ansah ... (In der Erinnerung lächelnd, geheimnisvoll,
zärtlich): Nun küß ich mich an dir zu Tode. (Tiefes Schweigen. Sie sieht ihn
unverwandt an. Nach einer Pause plötzlich): Aber so seltsam ist dein Auge
(verwundert): Wohin schaust du? (Heftiger): Was suchst du denn? (Sieht
sich um; nach dem Balkon): Steht dort jemand? (Wieder zurück, die Hand
an der Stirn): Wie war das nur ... das letzte Mal? ... (Immer vertiefter): War
das damals nicht auch in deinem Blick? (Angestrengt in der Erinnerung
suchend): Nein, nur so zerstreut ... oder ... und plötzlich bezwangst du dich
... (Immer klarer werdend): Und drei Tage warst du nicht bei mir ... keine
Zeit ... So oft hast du keine Zeit gehabt in diesen letzten Monaten ... (Jam-
mernd, wie abwehrend): Nein, das ist doch nicht möglich ... das ist doch
... (in blitzartiger Erinnerung): Ah, jetzt erinnere ich mich ... der Seufzer im
Halbschlaf ... wie ein Name ... du hast mir die Frage von den Lippen geküßt
... (Grübelnd): Aber warum versprach er mir, heute zu kommen? (In rasen-
14
der Angst): Ich will das nicht. Nein, ich will nicht ... (Aufspringend): Warum
hat man dich getötet? ... Hier vor dem Hause ... Hat dich jemand entdeckt?
(Aufschreiend, wie sich anklammernd): Nein, nein ... mein einzig Geliebter
... das nicht ... (Zitternd): Oh, der Mond schwankt ... ich kann nicht sehen
... Schau mich doch an ... (rast plötzlich): Du siehst wieder dort hin! ...
(Nach dem Balkon): Wo ist sie denn ... die Hexe, die Dirne ... die Frau mit
den weißen Armen ... (höhnisch): Oh, du liebst sie ja, die weißen Arme ...
wie du sie rot küßt ... (Mit geballten Fäusten): Oh, du ... du ... du Elender,
du Lügner ... du ... Wie deine Augen mir ausweichen! ... Krümmst du dich
vor Scham? ... (Stößt mit dem Fuß gegen ihn): Hast du sie umarmt? .. Ja?
... so zärtlich und gierig ... und ich wartete ... Wo ist sie hingelaufen, als du
im Blute lagst? ... Ich will sie an den weißen Armen herschleifen ... so
(Gebärde): so ... (schluchzt auf): Für mich ist kein Platz da ... Oh! nicht
einmal die Gnade, bei dir sterben zu dürfen ... (Sinkt nieder, weinend): Wie
lieb, wie lieb ich dich gehabt hab‘ ... Allen Dingen ferne lebte ich ... allem
fremd (in Träumerei versinkend): Ich wußte nichts als dich ... dieses ganze
Jahr ... seit du zum ersten Mal meine Hand nahmst ... oh, so warm ... nie
früher liebte ich jemanden so ... Dein Lächeln und deine Reden ... ich hatte
dich so lieb ... (Stille und Schluchzen. Dann leise sich aufrichtend): Mein
Lieber ... mein einziger Liebling ... hast du sie oft geküßt? ... während ich
vor Sehnsucht verging. (Flüsternd): Hast du sie sehr geliebt? (Flehend): Sag
nicht: ja ... Du lächelst schmerzlich ... Vielleicht hast du auch gelitten ...
vielleicht rief dein Herz nach ihr ... (Stiller, warm): Was kannst du dafür?
... Oh, ich fluchte dir ... aber dein Mitleid machte mich glücklich ... IchLibretto
glaubte ... war im Glück ... (Stille. Dämmerung links im Osten. Tief am
Himmel Wolken, von schwachem Schein durchleuchtet, gelblich schim-
mernd wie Kerzenlicht. Sie steht auf): Liebster, Liebster, der Morgen
kommt! ... Was soll ich allein hier tun? ... In diesem endlosen Leben ... in
diesem Traum ohne Grenzen und Farben ... denn meine Grenze war der Ort,
an dem du warst ... und alle Farben der Welt brachen aus deinen Augen ...
Das Licht wird für alle kommen ... aber ich allein in meiner Nacht? ... Der
Morgen trennt uns ... immer der Morgen ... So schwer küßt du zum Abschied
... wieder ein ewiger Tag des Wartens ... Oh, du erwachst ja nicht mehr ...
Tausend Menschen ziehn vorüber ... ich erkenne dich nicht ... Alle leben,
ihre Augen flammen ... Wo bist du? ... (Leiser): Es ist so dunkel ... dein Kuß
wie ein Flammenzeichen in meiner Nacht ... meine Lippen brennen und
leuchten ... dir entgegen ... (in Entzücken aufschreiend, irgend etwas ent-
gegen): Oh, du bist da ... ich suchte ...
15
Abdruck des Textes mit freundlicher Genehmigung der Universal-Edition.Biografien / Komponisten
Per Nørgård scher Prozesse erzeugt wird. Ähnlich gewichtige
Anregungen empfing Nørgård später in größe-
Per Nørgård, geboren 1932 in einem Vorort ren zeitlichen Abständen auf Reisen nach Indo-
Kopenhagens, ist ein Einzelgänger der neuen nesien und Südasien, von der Begegnung mit
Musik, der sich nicht auf eine bestimmte stilisti- den Arbeiten des schizophrenen Künstlers Adolf
sche Position festlegen lässt. Als sehr produk Wölfli und durch die Auseinandersetzung mit
tiver Komponist hat er in einem kaum überblick- den Schrecken des Ersten Weltkrieges. Daneben
baren Schaffen zahlreiche avantgardistische finden sich immer wieder Reflexe von Naturer-
und traditionelle Stilmittel erprobt. Dabei bilden lebnissen in seiner Musik. Als Professor für
allgemeine polare Vorstellungen wie die Dicho- Komposition hat Per Nørgård in einer über
tomie von Ordnung und Chaos oder Idyll und 30jährigen Lehrtätigkeit vor allem am Konser-
Katastrophe Konstanten seines musikalischen vatorium in Århus großen Einfluss auf die jün-
Denkens. geren Komponistengeneration genommen.
Per Nørgård studierte bei dem dänischen Sym-
phoniker Vagn Holmboe in Kopenhagen, bei
dem er mit 17 Jahren anfing, Privatunterricht
zu nehmen, und bei Nadia Boulanger in Paris. Arnold Schönberg
Nørgårds kompositorische Anfänge standen im
Zeichen nordischer Komponisten, vor allem von Zusammen mit Igor Strawinsky ist Arnold
Jean Sibelius und Carl Nielsen. Zu Beginn der Schönberg (1874–1951) der bedeutendste und
1960er Jahre kam Nørgård in engen Kontakt einflussreichste Komponist der ersten Hälfte
16
mit der europäischen Avantgarde, was sein des 20. Jahrhunderts. Zwei grundlegende Ent-
Schaffen grundlegend veränderte. Viele experi- wicklungen in der Musik sind untrennbar mit
mentelle Werke dieser Zeit basieren auf der so seinem Namen verbunden, die Aufgabe der
genannten Unendlichkeitsreihe, deren Töne Tonalität und der Gedanke einer der eigentli-
durch die Wiederholung einfacher mathemati- chen Komposition vorangehenden Vorordnung
des musikalischen Materials. Fast nebenbei war
Arnold Schönberg auch der wichtigste Komposi-
tionslehrer seiner Epoche. Zu seinen zahlreichen
Schülern zählen Alban Berg und Anton Webern,
die durch den Unterricht bei Schönberg selbst
zu großen Komponisten wurden.
Arnold Schönberg wurde am 13. September 1874
in Wien geboren. Er wuchs in bescheidenen
Verhältnissen auf und war im Wesentlichen
Autodidakt, der seine Kenntnisse aus Lexika,
von Klassenkameraden und aus dem Violinun-
terricht bezog. Erst 1895 lernte er mit Alexander
Zemlinsky einen professionellen Musiker und
Komponisten kennen, mit dem er sich rasch
anfreundete und der ihm Unterricht erteilte.
Zemlinsky prägte Schönberg vor allem auch
durch sein hohes Ethos von den Pflichten eines
Künstlers, das Schönberg selbst später an seine
Schüler weitergab. 1899 entstand mit demBiografien / Komponisten
1907 und 1909 in einem wahren Schaffens-
rausch komponierte, stieß er entscheidend in
die neue Musik vor. Kompositionen dieser Zeit
wie das Monodram „Erwartung“ und die „Fünf
Orchesterstücke“ wirken immer noch so frisch
und umstürzend neuartig, als seien sie gestern
entstanden.
Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete eine
Zäsur für Schönberg. Hochfliegende Komposi
tionspläne hatte er abbrechen müssen und er
empfand das Kriegsende als Zusammenbruch
der ihn tragenden Kultur. Einen künstlerischen
Neuanfang machte er im November 1918 mit
der Gründung des „Vereins für musikalische
Privataufführungen“, dem Urbild aller Avant-
garde-Ensembles unserer Zeit, der sich der
angemessenen Aufführung von Werken der
neuen Musik widmete. Zudem entdeckte
Schönberg zunehmend das Dirigieren für sich.
Auch wenn Aufführungen von Schönbergs
Musik im Konzertsaal in der Regel auf Ableh-
17
nung stießen und oft Skandale hervorriefen,
wuchs seine künstlerische Reputation doch
Streichsextett „Verklärte Nacht“ die erste Kom- ständig. 1925 wurde er schließlich als Professor
position, die Schönberg als vollwertig aner- für Komposition an die Preußische Akademie
kannte, und schon dieses Werk zeigt mit seiner der Künste nach Berlin berufen. Zu diesem Zeit-
unbedingten und bezwingenden Ausdrucks- punkt hatte er für sich bereits die Zwölfton
kraft, seinem melodischen Reichtum, seiner methode entwickelt, bei der eine bestimmte
Vorliebe für die Dissonanz als Ausdrucksträger Reihenfolge der benutzten Töne schon vor dem
und seiner formalen Meisterschaft wesentliche Komponieren selbst festgelegt wird, wodurch
Charakteristika von Schönbergs reifem Stil. ein gewisser innerer Zusammenhalt der Musik
Bis zum Ersten Weltkrieg führte Schönberg ein bei völliger Freiheit der Gestaltung garantiert
unruhiges Leben. Zwar erhielt er Anerkennung ist. Diese Methode blieb in verschiedenen Aus-
und Unterstützung von berühmten Kollegen wie formungen wesentliche Grundlage seines
Richard Strauss und Gustav Mahler, er war aber weiteren Schaffens.
gezwungen, von verschiedenen musikalischen Die Machtübernahme der Nationalsozialisten
Gelegenheitsarbeiten und kleineren Lehrauf trieb Schönberg, der bereits in den 1920er Jah-
trägen zu leben. Er zog deshalb häufig um und ren antisemitischen Anwürfen ausgesetzt war,
wohnte abwechselnd in Berlin und in Wien. im Mai 1933 in die Emigration. Nach einigen
Auch sein Privatleben verlief stürmisch. Unab- Umwegen ließ er sich 1934 in Los Angeles nieder.
hängig von diesen ungünstigen Bedingungen Die materiellen Bedingungen in Kalifornien
schuf Schönberg Werk um Werk und setzt dabei waren für Schönberg sehr schwierig, vor allem,
eine musikalische Revolution in Gang. Unter als er 1944 seine Professur für Komposition, die
seinem Ausdrucksbedürfnis zerriss ihm die er 1936 angetreten hatte, aus Altersgründen
Tonalität und in den Werken, die er zwischen abgeben musste. Trotz dieser bedrängten Situ-Biografien / Komponisten
ation schuf Schönberg noch hoch bedeutende aufgenommen. In dieser Zeit nahm er weiterhin
Werke wie das „Streichtrio“ und die Kantate Geigenstunden und begann auch zu kompo-
„A Survivor from Warsaw“, mit der er auf den nieren.
Holocaust reagierte. Schönberg starb am Ein Stipendium wohlhabender Bürger aus
13. Juli 1951 in Los Angeles. Odense ermöglichte Nielsen den Besuch des
Konservatoriums in Kopenhagen, wo er von
1884 bis 1886 Violine studierte und Theorie
unterricht bekam. Von 1889 an spielte Nielsen
Carl Nielsen als 2. Geiger in der Dänischen Hofkapelle, trat
aber nun auch als Komponist an die Öffentlich-
Carl Nielsen (1865–1931) ist ein ausgeprägt in- keit. Die Uraufführung seiner 1. Symphonie im
dividueller, unabhängiger Künstler, der sich in Jahr 1894 machte ihn in ganz Dänemark
großen Instrumentalwerken kühn und experi- bekannt. 1905 konnte der zunehmend erfolg
mentell zeigt, aber auch schlichte Lieder in reiche Komponist so schließlich seinen Posten
volkstümlichem Ton geschaffen hat. Nielsen in der Hofkapelle aufgeben. Ein wichtiges Ereig-
stammt aus beengten, ja armseligen Verhält- nis seiner künstlerischen Laufbahn war die
nissen. Er wuchs in der Nähe von Odense auf Premiere seiner zweiten Oper „Maskerade“ im
der dänischen Insel Fünen als eines von zwölf folgenden Jahr. Anfangs seines Librettos wegen
Kindern eines Malers auf, der sich als Tage nicht unumstritten, setzte sich das Werk bald
löhner verdingte, aber auch bei Festen und durch und wurde zur „Nationaloper“ Däne-
Tanzgelegenheiten musizierte. Als Kind erhielt marks. Von der Bürde des Orchesterdienstes
18
Carl Nielsen Violinunterricht und lernte Kornett befreit, konnte Nielsen sich nun freier dem
zu spielen, trat gemeinsam mit seinem Vater Komponieren widmen. Er fand aber bald auch
auf und wurde mit vierzehn Jahren als Blech- die Zeit, als Dirigent in Erscheinung zu treten.
bläser in das Regimentsmusikkorps in Odense Mit großen Symphonien und Instrumentalkon-
zerten rückte von den 1910er Jahren an die
Orchestermusik ins Zentrum seines Schaffens.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden seine Lieder,
von denen viele in Dänemark musikalisches All-
gemeingut geworden sind. Carl Nielsen starb
am 3. Oktober 1931 in Kopenhagen.Biografien / Interpreten
Magdalena Anna Hofmann Wien ab. Bereits vor ihrem Debüt als Sopranistin
trat sie an renommierten Opernhäusern wie
In jüngerer Zeit trat Magdalena Anna Hofmann dem Teatro alla Scala in Mailand und bei be-
u.a. in den Rollen der Senta in „Der Fliegende deutenden Festivals in Bregenz und Wien auf.
Holländer“ und der Carlotta in Schrekers „Die Im Jahr 2011 debütierte sie beim Klosterneuburg
Gezeichneten“ an der Opéra de Lyon auf sowie Festival als Sopranistin als Contessa Almaviva in
als „Frau“ in Arnold Schönbergs „Erwartung“ “Le nozze di Figaro”. Darauf folgte ihr Debüt als
an der Neuen Oper Wien und als Ausländische Kundry in einer Neuproduktion von Wagners
Prinzessin in „Rusalka“ am Aalto Theater Essen. „Parsifal“ an der Rahvusooper, Tallinn.
Zu den Höhepunkten der Spielzeit 2015/16 Seitdem begeisterte Magdalena Anna Hofmann
gehören die Rollen der Judith in von Rezniceks mit zahlreichen Aufführungen, zu denen u.a.
„Holofernes“ und der Senta in „Der Fliegende Schönbergs „Erwartung“ und Luigi Dallapicco-
Holländer“ am Theater Bonn, der Senta am las „Il prigioniero“ an der Opéra de Lyon, die
Aalto Theater Essen und der Elsa in einer kon- Portia in Tschaikowskys „The Merchant of
zertanten Fassung des „Lohengrin“ mit dem Venice“ sowie Konzerte in Osaka, Porto, Stutt-
Latvian National Symphony Orchestra. Außer- gart und im Rahmen des Bad Urach Festivals
dem wird sie in einem Konzert am Casa da gehörten.
Música in Porto Richard Wagners „Wesen- Magdalena Anna Hofmann arbeitete bereits
donck-Lieder“ und „Isoldes Liebestod“ singen. mit Dirigenten wie Daniel Harding, Kirill
Magdalena Anna Hofmann wurde in Warschau Petrenko, Daniele Gatti, Bertrand de Billy,
geboren und schloss ihre Gesangsausbildung in Michael Boder, Kazushi Ono, Hartmut Keil,
19
Lothar Königs, Riccardo Frizza, Gaetano
d’Espinosa, Bernhard Kontarsky, Patrick
Summers und Vladimir Vedosejev sowie Regis-
seuren wie Keith Warner, Àlex Olle (La Fura dels
Baus), Nicola Raab, Peter Stein, Frank Castorf,
Stéphane Braunschweig, Valentina Carrasco,
John Fulljames, William Friedkin, Gerd Heinz,
Daniel Slater und Walter Sutcliffe.
Michael Boder
Michael Boder ist seit 2012 Chefdirigent des
Royal Danish Orchestra und Künstlerischer
Berater des Royal Danish Theatre. Zu den aktu-
ellen Opernproduktionen unter Leitung von
Michael Boder zählen am Royal Danish Theatre
Richard Wagners „Der fliegende Holländer“,
„Porgy and Bess“ von George Gershwin, Alban
Bergs „Lulu“ sowie „Le Grand Macabre“ von
György Ligeti. An der Wiener Staatsoper hat
Michael Boder „Ariadne auf Naxos“ von Richard
Strauss und „Cardillac“ von Paul HindemithBiografien / Komponisten
dirigiert und am Theater an der Wien Igor Schloss“ von Aribert Reimann an der Deutschen
trawinskys „The Rake’s Progress“ sowie die
S Oper Berlin, „Ubu Rex“ von Krzysztof Penderecki
Oper „Lazarus“ von Franz Schubert und „Die und „Was Ihr wollt“ von Manfred Trojahn an der
Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss. Bayerischen Staatsoper, Luca Lombardis „Faust“
Der Dirigent leitete zudem Produktionen am am Theater Basel, „Der Riese vom Steinfeld“
Opernhaus Zürich, an der Opéra de Rouen von Friedrich Cerha an der Staatsoper Wien
Haute-Normande und an La Monnaie in Brüssel. sowie „Phaedra“ von Hans Werner Henze und
In der kommenden Saison wird Michael Boder „Faustus – the last night“ von Pascal Dusapin
„Die Frau ohne Schatten“ und „Salome“ von an der Staatsoper Berlin.
Richard Strauss am Royal Danish Theatre diri- Michael Boder ist darüber hinaus ein anerkann-
gieren, zudem Strauss’ „Daphne“ an der Ham- ter Dirigent von Orchestermusik und arbeitet
burgischen Staatsoper sowie die Uraufführung regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern
von Georg Friedrich Haas’ „Morgen und Abend“ zusammen, mit dem Gulbenkian Orchester in
am Royal Opera House Covent Garden in Lon- Lissabon, mit dem Ensemble Modern, dem RSO
don und die deutsche Erstaufführung dieses Wien, den Wiener Symphonikern, dem Saitoki-
Werks an der Deutschen Oper Berlin. nen Festival Orchestra, dem Tokyo Philharmonic
Neben den Werken der Zweiten Wiener Schule sowie mit dem Tokyo Symphony Orchestra.
und den Opern von Richard Strauss und Richard Nach dem Gastspiel beim Musikfest Berlin wer-
Wagner ist Michael Boder ein Spezialist für zeit- den Michael Boder und das Royal Danish Orche-
genössisches Musiktheater: Er hat eine Vielzahl stra die Werke ihres Berliner Konzerts auch in
von Uraufführungen geleitet, darunter „Das der Birmingham Symphony Hall vorstellen.
20
The Royal Danish Orchestra
Das Royal Danish Orchestra ist eines der ältes-
ten Orchester der Welt: Seit über 500 Jahren
prägt und repräsentiert es die Musiklandschaft
Dänemarks. Heutzutage ist der Klangkörper für
seinen einzigartigen Klang und seine besondere
Spielkultur bekannt. Sie wurden seit Generatio-
nen von Musikern entwickelt und weitergege-
ben. Das Royal Danish Orchestra hat mit vielen
bedeutenden Dirigenten und Komponisten
zusammengearbeitet, von Richard Strauss und
Igor Strawinsky bis zu Leonard Bernstein, Sergiu
Celibidache, Daniel Barenboim und in letzter
Zeit mit Michail Jurowski, Bertrand de Billy,
Hartmut Haenchen und Michael Schønwandt.
Seit 2012 spielt das Orchester unter der künstle-
rischen Leitung seines Chefdirigenten Michael
Boder.
Eine besondere Beziehung hat das Royal Danish
Orchestra zur Musik des dänischen Komponis-Biografien / Komponisten
21
ten Carl Nielsen, der viele Jahre lang Mitglied Danish Theatre eine DVD mit einer Neuproduk-
des Orchesters war und seine sechs Symphonien tion von Carl Nielsens Oper „Saul and David“
und zwei Opern speziell für das Royal Danish herausbringen, das Royal Danish Orchestra
Orchestra komponiert hat. In der heutigen spielt hier unter der Leitung von Michael
Zeit gibt das Orchester regelmäßig Symphonie Schønwandt.
konzerte und spielt bei Opern- und Ballettauf
führungen am Royal Danish Theatre in Kopen
hagen. Gastspiele führten das Orchester unter
anderem in den Wiener Musikverein und zum
Lincoln Center Festival in New York City. Einige
Tage nach seinem Auftritt beim Musikfest
Berlin wird das Royal Danish Orchestra in der
Birmingham Symphony Hall zu hören sein.
Das Orchester kann daneben auf eine ganze
Reihe von CD- und DVD-Veröffentlichungen
zurückblicken, darunter den international ge-
feierten Kopenhagener „Ring“ und Wagners
„Tannhäuser“. Anlässlich des 150. Geburtstages
von Carl Nielsen in diesem Jahr wird das RoyalBesetzungsliste
The Royal Danish Orchestra
Director General Morten Hesseldahl
Artistic Director Sven Müller
Principal Conductor Michael Boder
Administrative Director Restofte Magnus
22
Orchestra Manager Peter Andersen
Director of Touring Annette Berner
Orchestra Pit Managers Bente Errebo Nielsen, Jens Juul
Orchestra Pit Technicians Johanna Lundgren, Søren FiltenborgBesetzungsliste
Violine I ars Bjørnkjær Concertmaster, Tobias Durholm Concertmaster,
L
Mikkel Futtrup Concertmaster, Emma Ramsey Steele Concertmaster,
Anton Lasine, Anna Gwozdz, Tanja Savery, Tina Træholt,
Sara Wallevik, Michala Kisselhegn, Patrik Mårtensson, Charlotte Rafn,
Linda Aburto Hernandez, Signe Ane Andersen, Göran Rydström,
Alina Komisarova
Violine II Inkeri Vänskä, Therese Andersen, Anna Zelianodjevo, Bjarne Hansen,
Ane Marie Öberg, Kenneth McFarlan, Kristoffer Lund Madsen,
Grit Dirckinck-Holmfeld Westi, Vladimir Landa, Inge Husted Andersen,
Vanessa Blander Hedegaard, Helena Højgaard Nielsen,
Alexandra Schneider-Hansen, Ida Balslev
Viola ert-Inge Andersson, Iben Teilmann, Sune Ranmo, Tomas Kvæde,
G
Lotte Wallevik, Anne Lindeskov, Nanna Rasmussen, Hidekazu Uno,
Jens Balslev, Alexander Øllgaard, Ida Speyer Grøn, Anna Widlund
Violoncello J oel Laakso, Kim Bak Dinitzen, Ingemar Brantelid, Kristian Nørby,
Nina Reintoft, Emilie Eskær, Juliane Von Hahn, Therese Åstrand Radev,
Anna Dorthea Wolff, Tobias Lautrup
23
Kontrabass Mette Hanskov, Meherban Gillett, Nicholas Franco, Jonathan Colbert,
Yonas Ben-Hamadou, Jeppe M. Sørensen, Leif Jensen, Ramsey Harvard
Flöte Brit Halvorsen, Nikolaj Von Scholten, Marie Holzegel Otte, Ana Naranio
Oboe Juliana Koch, Pelle Gravers Nielsen, Rixon Thomas, Mette Termansen
Klarinette Lee Morgan, John Kruse, Tore O. Poulsen, Per Majland, Bertil Andersson
Fagott Jacob Dam Fredens, Jørgen B. Nielsen, Sabine Weinschnek, Klaus Frederiksen
Horn la Nilsson, Claudio Flückiger, Anna Lingdell,
O
Pall Sollstein, Johannes Undisz, Gustav Karlsson
Trompete ikolaj Viltoft, Jonas Wiik, Morten Hetland, Bjarne K. Nielsen,
N
Lars Husum, Victor Koch Jensen
Posaune Torbjörn Kroon, Kasper Thaarup, Jonas Karlsson, Lars Hastrup Hansen,
Tobias Biørs, Lars Haugaard
Tuba Lars Holmgaard
Pauke Henrik Thrane
Schlagzeug Per Jensen, Mads Drewsen, Marcus Wall, Matthias Friis-Hansen
Harfe Nina Schlemm
Klavier Leif Greibe128 DAS MAGAZIN DER
BERLINER PHILHARMONIKER
ABO BESTELLEN
SIE JETZ T!
✆ Te l e f o n: @ E - M a i l: O n l i n e:
040 / 468 605 117 128-abo@berliner-philharmoniker.de www.berliner-philharmoniker.de/128Foto: André Løyning
Café Restaurant
Ein Tag mit…
Karl Ove Knausgård
Eine Veranstaltung der Berliner Festspiele in
Kooperation mit der ZEIT-Stiftung Ebelin und HAT Gaststätten und Catering GmbH -
Gerd Bucerius
Café Restaurant Manzini
2. Oktober 2015, 19:30 Uhr
Haus der Berliner Festspiele Ludwigkirchstr. 11
www.berlinerfestspiele.de 10719 Berlin-Wilmersdorf
In Kooperation mit Die Berliner Festspiele werden
Fon 030 88 578 20
gefördert durch
mail@manzini.de, www.manzini.de
_MFB15_Knausgard_Anz_81x111_4c_pso_RZ.indd 1 10.08.15 11:14
Faust | Melnikov | Queyras
Robert Schumann Schumann | Brahms | Dietrich
Klavierkonzert & Klaviertrio Nr. 2
Alexander Melnikov, Klavier Neue Bahnen
Isabelle Faust, Violine Als „ein geheimes Bündnis verwandter Geister“
Jean-Guihen Queyras, Violoncello empfand Robert Schumann seine Freundschaft
Freiburger Barockorchester zu Johannes Brahms. Auf zwei neuen CDs
Pablo Heras-Casado haben Isabelle Faust, Alexander Melnikov und
HMC 902198 Jean-Guihen Queyras Kammermusik sowie das
berühmte Schumann’sche Klavierkonzert eingespielt.
Als geistesverwandte Musiker finden sie auf ihren
Originalinstrumenten einen ganz eigenen Ansatz, der
die ursprünglichen Feinheiten, die Transparenz und
Johannes Brahms
zugleich Leidenschaftlichkeit dieser Meisterwerke
Violinsonaten op. 100 & 108
wieder neu zum Leben erweckt.
Dietrich | Schumann | Brahms
FAE-Sonate
Isabelle Faust, Violine
Alexander Melnikov, Klavier
HMC 902219
harmoniamundi.com
Auch auf Ihrem Smart- und iPhoneSchütz • Bach •
Gestaltung: s-t-a-t-e.com
Schönberg
Rundfunkchor Berlin
Gijs Leenaars Dirigent Tickets unter
19. September 2015 Tel: 030 / 20 29 87 22
Sa 22 Uhr tickets@rundfunkchor-berlin.de
Passionskirche Berlin www.rundfunkchor-berlin.de
Di., 10.11.15 · 20 Uhr · Philharmonie* Fr., 29.1.16 · 20 Uhr · Kammermusiksaal Mo., 4.4.16 · 20 Uhr · Philharmonie*
Sol Gabetta Violoncello Quadro Nuevo Anne-Sophie Mutter Violine
Orchestre de Paris · Paavo Järvi, Leitung Neues Programm: „Tango!“ Mutter’s Virtuosi – Stipendiaten der
Saint-Saëns: Cellokonzert Nr. 1 a-moll „Anne-Sophie Mutter Stiftung e.V.“
Berlioz: Symphonie fantastique Mi., 17.2.16 · 20 Uhr · Philharmonie* Bach: Doppelkonzert d-moll BWV 1043
Lang Lang Klavier Previn: Nonett
Sol Gabetta Khatia Buniatishvili
Mo., 14.12.15 · 20 Uhr · Kammermusiksaal* Vivaldi: Die vier Jahreszeiten op. 8
National Symphony Orchestra Washington
Felix Klieser Horn Christoph Eschenbach, Leitung Di., 12.4.16 · 20 Uhr · Philharmonie*
Württembergisches Kammerorchester Grieg: Klavierkonzert a-moll
Haydn: Hornkonzert Nr. 1 D-Dur Brahms: Symphonie Nr. 1 c-moll Hélène Grimaud Klavier
Schumann: Adagio und Allegro Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Felix Klieser Enoch zu Guttenberg
sowie Werke von Purcell, Holst & Dvořák Mi., 24.2.16 · 20 Uhr · Philharmonie Santa Cecilia · Sir Antonio Pappano, Leitung
Fr., 18.12.15 · 20 Uhr · Kammermusiksaal Michael Bully Herbig Beethoven: Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur
Saint-Saëns: „Orgelsymphonie“
„Karneval der Tiere“ · Russische
Christmas meets Cuba Kammerphilharmonie St. Petersburg Do., 14.4.16 · 20 Uhr · Kammermusiksaal*
Klazz Brothers & Cuba Percussion
Do., 25.2.16 · 20 Uhr · Kammermusiksaal Sol Gabetta Violoncello
Khatia Buniatishvili Klavier
Klazz Brothers Anne-Sophie Mutter
Mo., 18.1.16 · 20 Uhr · Philharmonie* Il Giardino Armonico · Giovanni Antonini, Leitung
Rudolf Buchbinder Klavier Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung
J.S. Bach, W.F. Bach, C.Ph.E. Bach & Telemann
Sächsische Staatskapelle Dresden Strawinsky: Drei Sätze aus „Petruschka“ So., 22.5.16 · 20 Uhr · Philharmonie*
Weber: Konzertstück f-moll sowie Werke von Liszt
Mozart: Klavierkonzerte C-Dur & d-moll Daniil Trifonov Klavier
Di., 15.3.16 · 20 Uhr · Philharmonie The Philharmonics
Pittsburgh Symphony Orchestra
Kodo
Rudolf Buchbinder
Di., 19.1.16 · 20 Uhr · Philharmonie* Manfred Honeck, Leitung
Die Trommelsensation aus Japan
Gustavo Dudamel Leitung Neues Programm: „Mystery“
Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 2 c-moll
Tschaikowsky: Symphonie Nr. 6 „Pathétique“
Simón Bolívar Symphony Orchestra
of Venezuela Mi., 23.3.16 · 20 Uhr · Philharmonie Mo., 20.6.16 · 20 Uhr · Philharmonie
Strawinsky: Petruschka (1947)
Strawinsky: Le Sacre du Printemps Bach: Matthäus-Passion Bobby McFerrin
Gustavo Dudamel Chorgemeinschaft Neubeuern Hélène Grimaud
Von Samba bis Bossa Nova
Mo., 25.1.16 · 20 Uhr · Philharmonie Enoch zu Guttenberg, Leitung mit brasilianischen Sängern, Instrumenta-
Daniil Trifonov Klavier Di., 5.4.16 · 20 Uhr · Kammermusiksaal
listen und Tänzern
Bach/Brahms: Chaconne d-moll
Chopin: Zwölf Etüden op. 10 The Philharmonics
Rachmaninow: Sonate Nr. 1 d-moll „Das gewisse Quäntchen Schmäh“
Daniil Trifonov Sol Gabetta
* in Zusammenarbeit mit der Konzert-Direktion Adler
Tickets 0800-633 66 20 Anruf kostenfrei
www.firstclassics-berlin.de | Alle VorverkaufsstellenSie können auch lesen