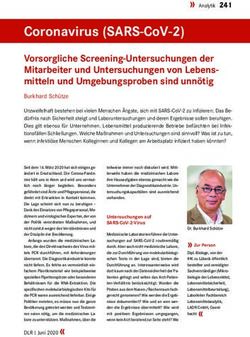Zur Schutzwirkung des Waldes gegen Hochwasser
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Forum für Wissen 2004: 15–20 15
Zur Schutzwirkung des Waldes gegen Hochwasser
Christoph Hegg, Alexandre Badoux, Peter Lüscher, Jonas Witzig
Eidg. Forschungsanstalt WSL, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf
christoph.hegg@wsl.ch, alexandre.badoux@wsl.ch, peter.luescher@wsl.ch, jonas.witzig@wsl.ch
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Schweiz von mehreren schweren Hochwas- lich nur halb so gross als der des
serereignissen heimgesucht. Sowohl die Fachwelt als auch die Öffentlichkeit sa- letztern…»
hen dabei einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem schlechten Zustand b) «…Bei Landregen ist das Retenti-
des Gebirgswaldes und dem Ausmass der Hochwasser. Diese Feststellung war ein onsvermögen des Waldes je nach
wichtiger Anstoss für das Forstgesetz von 1876. In seiner wegweisenden Publikati- der vorangegangenen Witterung,
on von 1919 belegte Engler diese Feststellung teilweise indem er aufzeigte, dass bezw. je nach dem Wassergehalt des
Wälder vor allem bei kurzen und intensiven Starkniederschlägen eine massgeben- Bodens und dem Verlauf des Re-
de Dämpfung einer Hochwasserwelle bewirken. Engler zeigte allerdings auch, gens, sehr verschieden. Ist der Was-
dass diese dämpfende Wirkung mit zunehmendem Niederschlagsvolumen mehr sergehalt des Bodens gross, so ist
und mehr abnimmt, weil dann der Bodenspeicher sowohl in Gebieten mit als auch der Wald wirkungslos, und es fliesst
ohne Wald gefüllt ist. In den letzten Jahren haben verschiedene Untersuchungen im Wald dieselbe Wassermenge ab
gezeigt, dass nicht jeder Wald in der Lage ist, Hochwasserspitzen massgeblich zu wie im Freien…»
dämpfen. Nachfolgend werden diese Ergebnisse kurz erläutert und auf ein mögli-
ches Vorgehen zur differenzierten Beurteilung der Schutzwirkung eines Waldes Seine Nachfolger (BURGER 1934, 1943,
gegen Hochwasser hingewiesen. 1954; CASPARIS 1959) vertieften diese
Untersuchungen und ergänzten sie ins-
besondere mit Untersuchungen zur
1 Die Anfänge Nach einigen vorbereitenden Arbei- Wasserbilanz der beiden Einzugsgebie-
ten begannen die eigentlichen forsthy- te. Während Engler für seine Arbeiten
Als die Schweiz im 19. Jahrhundert von drologischen Untersuchungen am 8. keine Wintermessungen zur Verfügung
einer Vielzahl von grossen Hochwas- April 1903, als gleichzeitig im Sperbel- standen und seine Analysen vorwie-
serereignissen (u. a. 1834 und 1868) und Rappengraben im Emmental die gend aus dem Vergleich von Einzel-
heimgesucht wurde, war sowohl für kontinuierliche Messung von Nieder- ereignissen bestand, werteten seine
grosse Teile der Fachwelt als auch für schlag und Abfluss aufgenommen wur- Nachfolger ganzjährige Messreihen
die Öffentlichkeit rasch klar, dass der de. Der Sperbelgraben ist praktisch aus. Sie zeigten damit, dass im Sperbel-
schlechte Zustand der Gebirgswälder vollständig bewaldet, der Rappengra- graben im Mittel 10 % weniger des in
ursächlich damit verbunden war ben dagegen war damals nur zu knapp einem Jahr gefallenen Niederschlages
(SCHMID 2001). Die Waldfläche in der einem Drittel mit Wald bedeckt und zum Abfluss kommen als im wenig be-
Schweiz hatte stark abgenommen, zu- wurde sonst landwirtschaftlich genutzt. waldeten Rappengraben, weil der
sätzlich waren viele Wälder übernutzt. ENGLER (1919) publizierte auf über Wald mehr Wasser verbraucht als eine
Allerdings fehlten trotz der verbreite- 600 Seiten die erste umfassende, auf Freilandvegetation.
ten Einigkeit die wissenschaftlichen Messungen beruhende wissenschaftli- Allerdings haben sowohl Burger wie
Grundlagen dieser These. Diese waren che Untersuchung zum Einfluss des auch Casparis die klare Unterschei-
aber nötig, um das einsetzende Sub- Waldes auf den Stand der Gewässer. dung zwischen kurzen und lang anhal-
ventionswesen auf eine fundierte In Bezug auf die Schutzwirkung des tenden Niederschlägen mehr und mehr
Grundlage zu stellen. Deshalb wurde Waldes gegen Hochwasser äussert sich zu Gunsten einer generellen Hochwas-
die 1885 gegründete damalige Central- ENGLER (1919, S. 614) dabei klar: serschutzwirkung des Waldes aufgege-
anstalt für das forstliche Versuchswe- a) «Bei allen intensiven Niederschlä- ben. Deshalb wird z. B. in der umfas-
sen, die heutige WSL, im Parlaments- gen von kürzerer Dauer (Gewitter- senden Geschichte der Forsthydrologie
beschluss zu ihrer Gründung unter an- regen, Wolkenbrüche) erweist sich von MCCULLOCH und ROBINSON
derem damit beauftragt, «… und zur das Retentionsvermögen des Wal- (1993) nicht darauf hingewiesen, dass
Lösung wichtiger forstlich-meteorolo- des als sehr gross. Die maximalen schon Engler Grenzen der Waldwir-
gischer Fragen beizutragen» (WULL- sekundlichen Abflussmengen des kung aufzeigte.
SCHLEGER 1985, S. 50). Unter forstlich- Sperbelgrabens betragen bei gleicher Generell war sich Engler der Gren-
meteorologischen Fragen wurde in der Intensität und Menge des Nieder- zen der möglichen Aussagen anhand
damaligen Zeit etwa das verstanden, schlages nur 1/3 bis 1/2 von denjenigen seiner Grundlagen sehr wohl bewusst.
was heute unter den Begriff Forsthy- des Rappengrabens und der Ge- So beschliesst er seine wissenschaftli-
drologie fällt. samtabfluss des erstern ist gewöhn- che Zusammenfassung mit dem drin-16 Forum für Wissen 2004
genden Wunsch, ähnliche Parallelver- Vogelbach, Lümpenenbach und Erlen-
10 A3
suche wie im Emmental auch in Regio- bach sind in Tabelle 1 angegeben. Ei-
A4
nen mit anderen geologischen und kli- nen vollständigen Überblick über die A10
matologischen Verhältnissen durchzu- Untersuchungsgebiete im Alptal ver-
q max (m3/s/km2)
führen. Dass es in der Schweiz beinahe mittelt BURCH (1994). 1
bis zum Ende des Jahrhunderts dauern An der Ausstattung der Stationen
würde, bis sein Wunsch in Erfüllung zeigt sich auch, dass sich die forsthydro-
ging, und dass bei diesen Untersuchun- logische Forschung längst nicht mehr
0.1
gen im Alptal seine Annahme wider- nur auf den Einfluss des Waldes auf
legt würde, Aufforstungen auf tonrei- den Abfluss konzentriert. Alle Statio-
chen und schlecht durchlässigen Böden nen erlauben Untersuchungen zur Was-
seien besonders wirksam, konnte er serqualität. Die drei Alptaler Gebiete 0.01
1 10 100
sich wahrscheinlich kaum vorstellen. sind deshalb seit kurzem Teil des NA- Niederschlagsintensität (mm/h)
DUF («Nationale Daueruntersuchung
der schweizerischen Fliessgewässer») Abb. 1. Abflussspitzen qmax in Abhängigkeit
2 Die Untersuchungen im Messnetzes, das von BUWAL, BWG, der Niederschlagsintensität über eine Dauer
EAWAG und WSL gemeinsam betrie- von 30 min in den drei Einzugsgebieten
Alptal
ben wird. Des Weiteren erlauben die Vogelbach (A3), Lümpenenbach (A4) und
Erlenbach (A10) im Alptal in den Jahren
Nach mehreren fehlgeschlagenen, Stationen Erlenbach und neuerdings
1987–1995 (BURCH et al. 1996: 166)
unvollständigen oder an den geologi- auch Vogelbach die zeitlich hoch auf-
schen Rahmenbedingungen geschei- gelöste Messung des Geschiebetrans-
terten Versuchen (z. B. in der Melera ports (HEGG und RICKENMANN 2002).
TI oder im Roten- und Schwändlibach Sie liefern damit die Grundlage für ein oder CALDER et al. 2004) der mittlere
FR), ein ähnliches Untersuchungsge- vertieftes Verständnis dieses Prozesses. Jahresabfluss aus einem mehrheitlich
biet unter anderen geologischen Be- Ebenfalls im Einzugsgebiet des Erlen- bewaldeten Einzugsgebiet kleiner als
dingungen zu installieren (KELLER bachs wurden an drei künstlich abge- aus einem wenig bewaldeten. Ein ähn-
1985), wendete sich die Forsthydrolo- grenzten Kleineinzugsgebieten von je licher Zusammenhang ist aber sowohl
gie dem Alptal zu. Hier wurden in ei- knapp 2 ha Fläche detaillierte Analysen bei lang anhaltenden als auch bei kur-
nem ersten Anlauf ab 1967 über zehn zu den Auswirkungen erhöhter Stick- zen intensiven Niederschlägen nicht
Einzugsgebiete mit einfachen Messsta- stoffeinträge durchgeführt (SCHLEPPI et gegeben (vgl. Abb. 1). Ihre Analyse der
tionen ausgerüstet, welche allerdings al. 2004). Diese drei Gebiete N1, N2 Messungen aus den je drei Einzugsge-
beim ersten grösseren Hochwasser zer- und N3 sind ebenfalls in Tabelle 1 be- bieten und Kleineinzugsgebieten zeigen
stört wurden. Aufgrund der vorliegen- schrieben. eindeutig, dass kein statistisch signifi-
den Messungen wurden drei besonders BURCH et al. (1996) stellten die Er- kanter Zusammenhang zwischen Be-
geeignete Einzugsgebiete ausgewählt gebnisse zur Frage der Waldwirkung waldungsgrad und Hochwasserabfluss-
und mit teilweise aufwendig konstru- auf den Abfluss unter den im Alptal spitzen besteht. Als Hauptgrund für
ierten Stationen ausgestattet, welche herrschenden Bedingungen dar. Auch diesen Unterschied zu den Beobach-
auch grosse Hochwasser schadlos und hier ist wie in den meisten Gebieten tungen von Engler vermuten BURCH et
zuverlässig erfassen können. Die wich- der Welt (vgl. z. B. BOSCH und HEWLETT al. (1996) die wenig speicherfähigen
tigsten Kennzahlen dieser drei Gebiete 1982; MCCULLOCH und ROBINSON 1993 Böden im Alptal.
Tab. 1. Kennwerte der hydrologischen Untersuchungsgebiete im Alptal, welche BURCH et al. (1996) für ihre Analysen verwendet haben.
Gebiets-Nummer A3 A4 A10 N1 N2 N3
Gebiets-Name Vogelbach Lümpenen- Erlenbach Nitrex-1 Nitrex-2 Nitrex-3
bach (Wald) (Wald) (Wiese)
Fläche ha 155 93 70 0,167 0,145 0,168
Exposition ESE ESE W W W W
Drainagedichte km/km2 ca. 8 15 27 26 28 28
Waldanteil % 63 19 39 100 100 0
Nassflächen % 25 24 61 100
Weideanteil % 12 57 0 0 0 0
Auswertung von 1.01.87 1.01.87 1.01.87 1.02.94 1.02.94 1.07.94
Auswertung bis 31.12.95 31.12.95 31.12.95 31.12.95 31.12.95 31.12.95
Messintervall min 10 10 10 10 10 10
Niederschlag/Jahr (1987–95) mm 2200 2340 2317 – – –
Abflusskoeffizient (1987–95) 0,73 0,87 0,79 – – –
Abflusskoeffizient (1994/95) 0,73 0,94 0,83 0,76 0,76 0,87Forum für Wissen 2004 17
3 Grundsätzliche Überlegun- derschlag zuerst der gesamte Nieder- weniger Niederschlag, damit eine all-
gen zum Einfluss des Waldes schlag gespeichert wird, dann aber ein fällige Waldwirkung nicht mehr fest-
auf die Abflussbildung immer grösserer Teil des gesamten Nie- stellbar ist, als wenn die Kapazität
derschlags zum Abfluss kommt. Darge- gross ist. So hat der Wald z. B. im Be-
Diese auf den ersten Blick wider- stellt ist der sogenannte Abflusskoeffi- reich von Buchstabe «A» im linken
sprüchlichen Ergebnisse aus dem Em- zient, welcher das Verhältnis zwischen Bild in Abbildung 2 eine beträchtliche
mental und dem Alptal sind die Folge gefallenem Niederschlag und dem Ab- Wirkung auf den Abfluss. In diesem
der Art und Weise, wie der Wald und fluss angibt. Für einen unbewaldeten Diagramm werden schematisch die
dabei vor allem der Waldboden die Ab- Standort folgt er unter den für diese Verhältnisse dargestellt, die in einem
flussbildung beeinflusst. Welcher Anteil Figur angenommenen Bedingungen mit Wald erwartet werden können, der auf
eines Niederschlags während einem zunehmendem Niederschlag der punk- einem Boden mit einem erheblichen
Hochwasser zum Abfluss kommt, tierten Linie. Für einen bewaldeten Speichervolumen stockt. Erst bei einer
hängt vor allem davon ab, wie viel Was- Standort, der im Vergleich zum unbe- Niederschlagsmenge im Bereich des
ser im Boden gespeichert werden kann. waldeten Standort aus den erwähnten Buchstabens «B» wird die Waldwir-
Grundsätzlich ähnlich, allerdings in viel Gründen über zusätzliche Speicher- kung tendenziell unbedeutend. Im Ge-
kleinerem Ausmass, wirkt die Interzep- kapazität verfügt, folgt der Abfluss- gensatz dazu ist bei einem Wald auf
tion. Waldböden weisen in der Regel koeffizient den ausgezogenen Kurven. Böden mit geringen Speicherkapazitä-
bei einem einsetzenden Niederschlag- Der Abflusskoeffizient des bewalde- ten (Abb. 2, rechts) schon im Bereich
sereignis eine grössere Wasseraufnah- ten Standorts liegt bei gleichem Nie- von Buchstabe «C» keine massgeben-
mekapazität auf als Freilandböden. derschlag stets unterhalb jenem des de Waldwirkung mehr vorhanden. Bei
Dies einerseits, weil sie in der Regel unbewaldeten Standorts. Allerdings gleichen Niederschlagsverhältnissen
eine grössere Speicherkapazität aufwei- nimmt die Differenz mit zunehmendem kann somit der Wald, je nach Bodenbe-
sen (generell besserer Bodenaufbau, Niederschlag immer mehr ab. Die ge- dingungen, eine Schutzwirkung haben
wenig Verdichtung aufgrund geringerer strichelten Linien zeigen, um welchen oder nicht.
Bewirtschaftungsintensität). Anderer- Faktor die angenommene zusätzliche Da der Wald auf den Hochwasserab-
seits auch, weil die Waldvegetation Speicherkapazität des Waldbodens den fluss je nach Ausgangsbedingungen
mehr Wasser verdunstet und damit Abfluss reduziert. Der Faktor nimmt sehr unterschiedlich wirkt, muss dies
dem Boden rascher und aufgrund der rasch ab und nähert sich asymptotisch differenziert und standortspezifisch be-
oft tiefreichenden Wurzeln bis in grös- dem Wert Null an. urteilt werden. Als Grundlage für diese
sere Tiefen Wasser entzieht. Wie gross der Abfluss bei einem ge- Betrachtung war es daher naheliegend,
Wie in BADOUX et al. (2004a) im De- gebenen Niederschlag ist, hängt von die Waldstandortskarten einzusetzen
tail erläutert, lässt sich die Wirkung des der generellen Speicherkapazität des (vgl. BURGER et al. 1996), wobei der
Waldes auf den Abfluss stark verein- Bodens inklusive einer allfälligen dort verwendete Schlüssel zur Anspra-
facht und schematisch anhand der Ab- Waldwirkung ab (zusätzliche Speicher- che der hydrologischen Eigenschaften
bildung 2 erläutern. Die punktierten Li- kapazität des Bodens und Interzepti- ursprünglich gutachterlich festgelegt
nien zeigen für einen unbewaldeten onsspeicher). Ist die Speicherkapazität und nicht mit Messungen im Feld über-
Standort, wie mit zunehmendem Nie- des Bodens klein, braucht es deutlich prüft wurde.
1,0 1,0
Abflusskoeffizient/Faktor
Abflusskoeffizient/Faktor
0,8 0,8
0,6 0,6
0,4 A B 0,4 C
0,2 0,2
Niederschlagsmenge Niederschlagsmenge
Abflusskoeffizient ohne zusätzliche Speicherkapazität durch Wald
Abflusskoeffizient mit zusätzlicher Speicherkapazität durch Wald
Faktor um den der Abflusskoeffizient durch die zusätzliche Speicherkapazität reduziert wird
Abb. 2. Schematische Darstellung der Waldwirkung auf den Abfluss. In beiden Grafiken wird angenommen, dass der Wald zu einer Verdop-
pelung der Speicherkapazität führe. Rechts ist die Speicherkapazität des Bodens (ohne Berücksichtigung des Waldeinflusses) fünf Mal
kleiner als links. Weitere Erläuterungen vgl. Text.18 Forum für Wissen 2004
4 Nach 100 Jahren wieder im Während im stark beschädigten Klein- als auch normal bis stark durchlässige
Sperbelgraben einzugsgebiet über 60 % der Bäume Braunerden vorkommen, konnte ein
geworfen oder gebrochen waren, wie- breites Spektrum an hydrologischen
Eine gute Gelegenheit, diese differen- sen im wenig beschädigten Gebiet nur Bodeneigenschaften untersucht werden
zierte Betrachtung im Feld zu überprü- etwa 20 % der Bäume entsprechende (vgl. Abb. 3).
fen, ergab sich nach dem Sturm «Lo- Schäden auf. Der Vergleich der un- Im Rahmen des Projektes «Lothar
thar» vom Dezember 1999. Der Sturm mittelbar benachbarten weitgehend und Wildbach» wurde deshalb der Sper-
hatte unter anderem im Sperbelgraben bewaldeten bzw. stark entwaldeten belgraben waldstandortlich im Mass-
seine Spuren hinterlassen und dabei Flächen versprach sowohl Informa- stab 1:5000 kartiert, die zwei erwähnten
neben den angerichteten Schäden auch tionen über die Auswirkungen der Kleineinzugsgebiete mit je einer Ab-
eine für die Forschung geeignete Aus- Sturmschäden als auch einen vertieften flussmessstation ausgestattet (vgl. Abb.
gangslage geschaffen. Zwei unmittel- Einblick in die generelle Wirkung des 4) sowie 19 sogenannte Oberflächenab-
bar benachbarte Kleineinzugsgebiete Waldes auf den Wasserkreislauf. Weil flussplots installiert. Diese Plots umfas-
von je etwa 2 ha Fläche wiesen nach gleichzeitig in beiden Kleineinzugsge- sen eine Fläche zwischen 50 und 110 m2
dem 26. Dezember 1999 einen sehr un- bieten sowohl stark vernässte gleyige und messen den Abfluss an der Ober-
terschiedlichen Schädigungsgrad auf. Böden mit gehemmter Durchlässigkeit fläche und in den obersten etwa 10 cm
18aF Typischer Tannen-Buchen-
wald, mit Wald-Schwingel
18d Tannen-Buchenwald mit
Etagenmoos
19 Tannen-Buchenwald mit
Hainsimse
20aP Farnreicher Tannen-Buchen-
wald, Ausbildung mit Pestwurz
20g Farnreicher Tannen-Buchen-
wald, Ausbildung mit Bärlauch
26ho Ahorn-Eschenwald mit Alpen-
dost
46a Typischer Heidelbeer-Fichten-
Tannenwald
49f Schachtelhalm-Tannenmisch-
wald, Ausbildung mit Esche
Abb. 3. Übersicht der beiden Kleineinzugsgebiete und deren Waldstandorttypen sowie der
Oberflächenabflussplot- und Niederschlagsmessstandorte.
Abb. 4. Abflussmessstation im beschädigten Kleineinzugsgebiet Abb. 5. Oberflächenabflussplot P9 im wenig beschädigten Kleinein-
KEG 1. zugsgebiet.Forum für Wissen 2004 19 des Profils (vgl. Abb. 5). Zudem wurden schaften aber unterschiedlichem Schä- zes Einzugsgebiet getan. Wie erwähnt, jeweils in unmittelbarer Nähe und re- digungsgrad nur teilweise und wenn kann nur ein Teil der Abflussreaktion präsentativ für die Plots total 18 Boden- dann nur schwach ausgeprägt festge- der Kleineinzugsgebiete durch die profile gegraben und angesprochen. stellt. Ein Grund dafür ist, dass der Abflussbildung auf den Plots erklärt Die hydrologischen Eigenschaften die- Sturm zwar oberflächlich grosse Schä- werden. Offensichtlich sind hier, wie ser Profile wurden mit Beregnungsver- den verursacht hat, der Boden selber BADOUX et al. (2004b) erläutern, noch suchen auf einer 1 m2 grossen Fläche aber nur punktuell betroffen wurde andere Faktoren von Bedeutung. Die unmittelbar oberhalb des Profils er- und sich deshalb seine Eigenschaften dabei entscheidende Frage, wie das fasst. Eine umfassende Beschreibung kurzfristig kaum änderten. Ausserdem Wasser vom Hang ins Gerinne gelangt, des Projektes «Lothar und Wildbach» kam sehr rasch eine Sekundärvegetati- ist erst ansatzweise verstanden. findet sich in HEGG et al. (2004). on auf, welche die weggefallene Inter- Zu beantworten sind dabei sicher Sowohl die Analysen der Bereg- zeption und Verdunstung der Bäume auch die Fragen wann und wie stark nungsversuche (WITZIG et al. 2004) als teilweise ersetzen konnte. sich die generell hohe Infiltration in auch die Messungen auf den Oberflä- bewaldeten Gebieten effektiv hoch- chenabflussplots (BADOUX et al. 2004b) wasserdämpfend auswirkt. Aus heuti- zeigten je zwei unterschiedliche Mu- 5 Der aktuelle Stand des ger Sicht ist einzig klar, dass dies vor ster der Abflussbildung. Diese waren Wissens und offene Fragen allem bei kurzen und intensiven Nie- auf beiden betrachteten Skalenniveaus derschlägen auf tiefgründig gut durch- jeweils ähnlich und liessen sich mit Hil- Die Untersuchungen im Sperbelgra- lässigen Böden von Bedeutung ist. Auf fe der Waldstandortskarte den verschie- ben haben die Notwendigkeit bestätigt grundnassen Böden ist die Infiltration denen Standorttypen klar zuordnen. und verstärkt, die Hochwasserschutz- durch die rasch erreichte Sättigung des Auf den gleyigen Böden des Ahorn- wirkung des Waldes differenziert zu Bodens und nicht durch dessen Infil- Eschenwaldes (26ho) und des Schach- betrachten. Gleichzeitig konnte gezeigt trationskapazität beschränkt, und bei telhalm-Tannenmischwaldes (49f) tritt werden, dass, zumindest unter den im lang anhaltenden Niederschlägen wird relativ rasch Sättigung ein, und ein Sperbelgraben angetroffenen Bedin- irgendwann auch der langsamere un- grosser Teil des Niederschlags bildet gungen, eine Beurteilung der mögli- terirdische Abfluss hochwasserwirk- Oberflächenabfluss. Die Verhältnisse chen Waldwirkung anhand einer sam. Einzig jenes Wasser, das im Bo- auf diesen Flächen sind grundsätzlich Standortskarte gemacht werden kann. den gespeichert wird und später wieder mit jenen im Alptal vergleichbar. Deshalb baut die Anleitung «NAIS» verdunstet, oder das in grosse Tiefen Auf den Braunerden der Tannen-Bu- (BUWAL 2005) auf diesem Konzept infiltriert und erst nach langen Zeiträu- chenwälder (Standorte 18af, 18d, 19) auf und macht Vorschläge, wie unter- men wieder an die Oberfläche gelangt, und des Heidelbeer-Fichten-Tannen- schiedliche Standorte in Bezug auf ihre trägt unter keinen Umständen zu waldes (46a) dagegen infiltriert der hydrologische Wirkung zu bewerten einem Hochwasser bei. grösste Teil des Wassers in den Boden. sind. Ein Grossteil dieser Vorschläge Zusammenfassend kann deshalb ge- Einzig zu Beginn eines Niederschlages basiert im Moment noch auf gutachter- sagt werden, dass heute die Schutz- wurde auf einigen Flächen teilweise lichen Einschätzungen. Ein Mehr an wirkung des Waldes vor Hochwasser Oberflächenabfluss festgestellt. Dieser Sicherheit in der Beurteilung lässt sich grundsätzlich differenziert angegangen wird durch die organische Auflage ver- hier nur mittels zusätzlicher Feldunter- werden muss. Insbesondere können je- ursacht, welche wasserabstossend wirkt, suchungen mit Plots und Profilen ana- ne Waldstandorte ausgeschieden wer- wenn sie trocken ist. Sobald sie ange- log den Untersuchungen im Sperbel- den, wo aufgrund der naturräumlichen feuchtet ist, wird sie durchlässig und graben erreichen. Für entsprechende Voraussetzungen grundsätzlich eine das Wasser kann in den Boden infiltrie- Arbeiten stehen Standorte im Vorder- Wirkung erwartet werden kann. Es ist ren. Im Boden wird ein Teil des Was- grund, welche einen Horizont mit allerdings noch nicht möglich, diese in sers gespeichert. Aufgrund der hohen deutlich reduzierter Durchlässigkeit in der Fläche eines Einzugsgebiets erziel- Durchlässigkeit des Untergrundes ver- einer Tiefe zwischen etwa 20 bis 60 cm te Wirkung genau zu quantifizieren sickert aber ein Grossteil des Wassers aufweisen. Erst aufgrund derartiger oder gar ihre Schutzwirkung für eine rasch in grössere Tiefen, in der Regel Untersuchungen wird es möglich sein, Siedlung, z. B. auf dem Schwemmkegel lange bevor Bodensättigung erreicht quantitativ zu beurteilen, wie gross die eines Wildbaches, zu bestimmen. ist. Hochwasserschutzwirkung ist, wenn Die Abflussreaktion auf der nächst- ein derartiger Standort, auf dem nach höheren Skalenebene, den Kleinein- heutigem Kenntnisstand am ehesten zugsgebieten, konnte mit den zwei eine Wirkung des Waldes zu erwarten erläuterten, im Hang festgestellten ist, aufgeforstet oder ein ungünstiger Mustern der Abflussbildung nur teil- Waldzustand mittels gezielter Pflege- weise erklärt werden (vgl. HEGG et al. massnahmen in einen besseren über- 2004). führt wird. Ein Einfluss der Sturmschäden auf Mit dieser Beurteilung der Waldwir- die Abflussbildung wurde in den Ver- kung im Hang ist allerdings erst ein gleichen von Oberflächenabflussplots Schritt in Richtung einer korrekten Be- mit gleichen bodenkundlichen Eigen- wertung der Waldwirkung für ein gan-
20 Forum für Wissen 2004
6 Literatur BURGER, H., 1954: Einfluss des Waldes auf HEGG, C.; THORMANN, J.-J.; BÖLL, A.; GER-
den Stand der Gewässer. Mitteilung 5: Der MANN, P.; KIENHOLZ, H.; LÜSCHER, P.;
BADOUX, A.; HEGG, C.: WITZIG, J.; LÜSCHER, Wasserhaushalt im Sperbel- und Rappen- WEINGARTNER, R. (Hrsg.) 2004: Lothar
P., 2004a: Studies on the runoff generation graben von 1942/43 bis 1951/52. Mitt. und Wildbäche. Schlussbericht eines Pro-
in two neighbouring sub-catchments with Schweiz. Anst. forstl. Vers.wes. 31, 1: 9–58. jektes im Rahmen des Programms «Lo-
and without storm damage. Hydrological BURGER, T.; DANNER, E.; KAUFMANN, P.; LÜ- thar Evaluations- und Grundlagenpro-
Processes. (Manuskript eingereicht) SCHER, P; STOCKER, R., 1996: Standort- jekte». Birmensdorf, Eidg. Forschungsan-
BADOUX, A.; JEISY, M.; WITZIG, J.; KIEN- kundlicher Kartierungsschlüssel für die stalt WSL. 79 S.
HOLZ, H.; LÜSCHER, P.; WEINGARTNER, R.; Wälder der Kantone Bern und Freiburg. KELLER, H.M., 1985: Die hydrologische
HEGG, C., 2004b: Impact of storm Lothar Kommentar und Anwenderschlüssel. So- Forschung an der EAFV seit 1889. Mitt.
damage on runoff – results from a com- lothurn, Lenzburg, Birmensdorf; ARGE Schweiz. Anst. forstl. Vers.wes. 61, 2: 886–
parative study in two small torrent catch- Kaufmann + Partner/Burger + Stocker 904.
ments. European Journal of Forestry Re- und Forstliche Bodenkunde WSL. MCCULLOCH, J.S.G.; ROBINSON, M., 1993:
search. (Manuskript in Vorbreitung) BUWAL, 2005: Nachhaltigkeit im Schutz- History of forest hydrology. J. Hydrol.
BOSCH, J.M.; HEWLETT, J.D., 1982: A review wald und Erfolgskontrolle. Wegleitung 150: 189–216.
of catchment experiments to determine für Pflegemassnahmen in Wäldern mit SCHLEPPI, P.; HAGEDORN, F.; PROVIDOLI, I.,
the effect of vegetation changes on water Schutzfunktion. Bern, Bundesamt für 2004: Nitrate leaching from a mountain
yield and evapotranspiration. J. Hydrol. Umwelt, Wald und Landschaft. (in Vor- forest ecosystem with gleysols subjected
55: 3–23. bereitung) to experimentally increased N depositi-
BURCH, H., 1994: Ein Rückblick auf die CALDER, I.; AMEZAGA, J.; AYLWARD, B.; on. Water Air Soil Pollut. Focus 4: 453–
hydrologische Forschung der WSL im BOSCH, J.; FULLER, L.; GALLOP, K.; GO- 467.
Alptal. Beitr. Hydrol. Schweiz 35: 18–33. SAIN, A.; HOPE, R.; JEWITT, G.; MIRANDA, SCHMID, F.S., 2001: Politische Konsequen-
BURCH, H.; FORSTER, F.; SCHLEPPI, P., 1996: M.; PORRASS, I.; WILSON, V., 2004: Forest zen aus dem Umwetterereignis von 1868
Zum Einfluss des Waldes auf die Hydrolo- and Water Policies. The need to reconcile – Anfänge des eidgenössischen Hochwas-
gie der Flysch-Einzugsgebiete des Alptals. public and science perceptions. Geologi- serschutzes. Schweiz. Z. Forstwes. 152, 12:
Schweiz. Z. Forstwes. 147, 12: 925–937. ca Acta 2, 2: 157–166. 521–526.
BURGER, H., 1934: Einfluss des Waldes auf CASPARIS, E., 1959: 30 Jahre Wassermesssta- WITZIG, J.; BADOUX, A.; HEGG, C.; LÜSCHER,
den Stand der Gewässer. Mitteilung 2: tionen im Emmental. Mitt. Schweiz. Anst. P., 2004: Waldwirkung und Hochwasser-
Der Wasserhaushalt im Sperbel- und forstl. Vers.wes. 35, 1: 179–224. schutz – eine standörtlich differenzierte
Rappengraben von 1915/16 bis 1926/27. ENGLER, A., 1919: Untersuchungen über Betrachtung. Forst und Holz. (Manu-
Mitt. Schweiz. Anst. forstl. Vers.wes. 18, 2: den Einfluss des Waldes auf den Stand skript eingereicht)
311–416. der Gewässer. Mitt. Schweiz. Anst. forstl. WULLSCHLEGER, E., 1985: 100 Jahre Eidge-
BURGER, H., 1943: Einfluss des Waldes auf Vers.wes. 12: 1–626. nössische Anstalt für das forstliche Ver-
den Stand der Gewässer. Mitteilung 3: HEGG, C.; RICKENMANN, D., 2002: Geschie- suchswesen 1885–1985. Teil 1: Die Ge-
Der Wasserhaushalt im Sperbel- und betransport in Wildbächen – Erfahrungen schichte der EAFV. Mitt. Schweiz. Anst.
Rappengraben von 1927/28 bis 1941/42. aus 15 Jahren zeitlich hochaufgelösten forstl. Vers.wes. 61, 1: 3–630.
Mitt. Schweiz. Anst. forstl. Vers.wes. 23, 1: Messungen. In: Proc. Internationales Sym-
167–222. posium 2002, Zürich. Moderne Methoden
und Konzepte im Wasserbau. 39–48.Sie können auch lesen