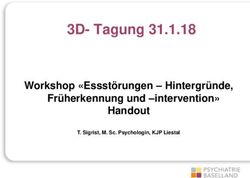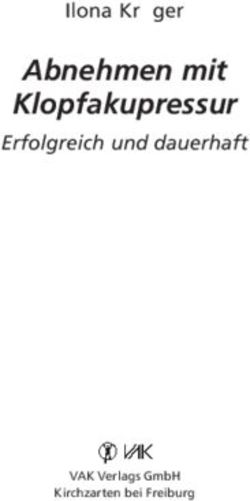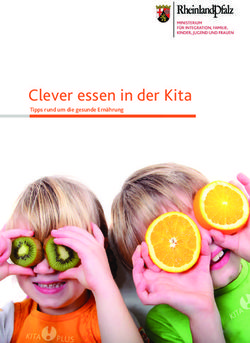Anorexia Nervosa und Bulimia Nervosa Symptomatik und Erklärungsmodelle
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Anorexia Nervosa und Bulimia Nervosa Symptomatik und Erklärungsmodelle
Anorexia Nervosa - Diagnose nach DSM IV • Weigerung, das Körpergewicht über einem Alter und Größe entsprechenden minimalen Normalgewicht zu halten; Gewicht mindestes 15% unter dem zu erwartenden Gewicht • Gewicht und Figur werden verzerrt wahrgenommen, unangemessener Einfluss des Gewichts oder der Figur auf die Selbstbewertung oder Verleugnung der Ernsthaftigkeit des aktuell niedrigen Körpergewichts • Intensive Angst, zuzunehmen oder dick zu werden, obwohl untergewichtig • Ausbleiben von mindestens 3 aufeinanderfolgenden Menstruationszyklen
Bulimia Nervosa - Diagnose nach DSM IV • Wiederkehrende Heißhungeranfälle: - Essen einer Nahrungsmenge, die größer ist als sie die meisten Menschen in ähnlicher Zeit und unter ähnlichen Umständen verzehren würde - Gefühl des Kontrollverlustes beim Essen • Wiederkehrend ungeeignet kompensatorisches Verhalten, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden, wie selbst induziertes Erbrechen, Missbrauch von Laxantien, Appetitzüglern, Diuretika oder anderen Medikamenten, Fasten oder exzessive körperliche Betätigung.
Bulimia Nervosa - Diagnose nach DSM IV • Heißhungeranfälle und Maßnahmen zur Gewichtsregulierung treten im Durchschnitt über 3 Monate mindestens zweimal wöchentlich auf • Die Selbstbewertung hängt phasenweise stark vom Gewicht und von der Figur ab • Die Störung tritt nicht ausschließlich während Episoden von Anorexie auf
Anorexia und Bulimia Nervosa –
differenzierende Merkmale
Anorexie Bulimie
„Anorexie“ Hyperoxie
Hypophagie Zwang zum Essen
Nicht aufhören können, nicht zu Nicht aufhören können zu essen
essen
Keine Klagen über mangelnde Klage über viel essen müssen (oft
Nahrungsaufnahme (kein Krankheitsgefühl)
Krankheitsgefühl)
Körpergewicht im Normbereich oder
Untergewicht (BDI < 17,5) (leicht) überhöht
Dünnsein müssen, krankhafte (Reales) Dicksein wird abgelehnt
Furcht vor (virtuellem) „Dicksein“ und vermiedenAnorexia und Bulimia Nervosa –
differenzierende Merkmale
Anorexie Bulimie
Verleugnen von Magerkeit Kein Verleugnen von evt. Dicksein
Bemühung um Änderung
Keine Anstrengung, den Zustand
(Appetitzügler, Diät,
zu verändern
Selbsthilfegruppen)
Konsekutive Scham, Schuld,
Trotziger Triumph
Selbstverurteilung
Zwang zur Kontrolle Kontrollverlust
„Verwahrlosung“, aktiveres
Askese Sexualverhalten
Mortalität (ca. 6%) -Epidemiologie und Verlauf Anorexie • Prävalenz bei Frauen bis 30 Jahre: 0,3% • Erkrankungsbeginn Frauen: 16 Jahre • Erkrankungsbeginn Männer: 11 Jahre • Mortalität: 6% Bulimie • Prävalenz bei Frauen zwischen 18 und 35 Jahren: 1-3% • Erkrankungsbeginn: Adoleszenz, frühes Erwachsenenalter • Mortalität: 0,3% Geschlechterverhältnis • Anorexie und Bulimie sind bei jungen Frauen weit mehr verbreitet als bei jungen Männern • Max. 5-15% der Erkrankten sind Jungen
Psychobiologische Interaktionen bei
Störungen des Essverhaltens
Biologische Vulnerabilität Soziokulturelle Faktoren
Individuelle psychologische
Bedingungen
Veränderung des
Essverhaltens
-Fasten
-Erbrechen
-Essanfälle
Psychologische und
Biologische Veränderungen
psychosoziale VeränderungenPsychobiologische Interaktionen bei
Störungen des Essverhaltens
Veränderung des
Essverhaltens
-Fasten
-Erbrechen
-Essanfälle
Biologische Veränderungen Psychologische und
-metabolische und endokrine psychosoziale Veränderungen
Anpassung an Mangel- -affektive Labilität
ernährung -kognitive Störungen (z.B.
-Neurotransmitterstörungen Konzentrationsstörungen)
-Beeintächtigung -Beeinträchtigte Wahrnehmung
gastrointestinaler Funktionen für Hunger und Sättigung
-Pseudotrophie des Gehirns -Soziale IsolationPhysiologische und
psychologische Deprivation
Neuroendokrine Störungen, Kognitive Beeinträchtigung,
Veränderung des affektive Labilität, mangelnde
Energiestoffwechsels Befriedigung hedonistischer
Bedürfnisse
Ignorieren viszeraler Reize,
Dekonditionierungsprozesse
Disinhibitorische
Bedingungen Störung der Regulation von
z.B. Stressoren, Hunger und Sättigung
Alkohol, Angst
EssanfallGezügeltes Essverhalten
kognitiven Kontrolle
Verschärfung der
Essanfall
Antizipierte
Gewichtszunahme
Erbrechen,
Laxantienabusus,
exzessive Bewegung
Erreichen, bzw. Beibehalten
eines erwünschten GewichtsDie Bedeutung kognitiver Kontrolle für die
Entstehung von Essanfällen
Vulnerabilitätscharakteristika, Umweltbedingungen,
z.B. niedriger Energiebedarf z.B. Schlankheitsideal
Gezügeltes Essverhalten
z.B. wiederholtes Diätieren,
Verzehr kleiner Portionen, kein
Erreichen eines befriedigenden
Sättigungsgrades
Physiologische und
psychologische Deprivation
Kognitive Beeinträchtigung,
Neuroendokrine Störungen,
affektive Labilität, mangelnde
Veränderung des
Befriedigung hedonistischer
Energiestoffwechsels
BedürfnisseEmpirische Befunde zur Bedeutung
gezügelten Essverhaltens als Risikofaktor
für das Auftreten von Essanfällen
• Nach längeren Diätperioden treten Essanfälle häufiger auf
(belegt für anorektische Patienten mit bulimischer Symptomatik
und für Normalgewichtige mit Bulimia Nervosa).
• Fasten führte bei Teilnehmern eines Fastenexperiments
sowohl während als auch nach der Fastenperiode zu
Essanfällen, die keine der Personen zuvor erlebt hatten.
• Erzwungener Verzicht auf eine Mahlzeit wird durch erhöhte
Nahrungsaufnahme bei der nächstmöglichen Gelegenheit
ausgeglichen.
• Unter Deprivationsbedingungen steigt die pro Mahlzeit
aufgenommene Nahrungsmenge mit der Länge der
Deprivationszeit an (im Tierversuch gezeigt).Fragebogen zum Essverhalten -
(Pudel & Westenhöfer, 1998)
Skala „Kognitive Kontrolle des Essverhaltens“ - Beispielitems
• Ich esse absichtlich kleine Portionen, um nicht zuzunehmen.
• Bei den üblichen Nahrungsmitteln kenne ich ungefähr den
Kaloriengehalt.
• Häufig höre ich auf zu essen, obwohl ich noch gar nicht satt bin.
• Bestimmte Nahrungsmittel meide ich, weil sie dick machen.
• Ich zähle Kalorien, um mein Gewicht unter Kontrolle zu halten.
• Wenn ich während einer Diät „sündige“, dann halte ich mich
anschließend beim Essen zurück, um es wieder auszugleichen.Der „dishibition effect“ bei gezügeltem Essverhalten
nach Herman & Mack (1975)
• Personen, die anhand eines Fragebogens in gezügelte und
ungezügelte Esser eingeteilt werden, unterscheiden sich auch
im Labor in ihrem Essverhalten:
• Bei einem angeblichen „Geschmackstest“ essen gezügelte
Esser weniger als ungezügelte Esser.
• Herman et al. untersuchten die Effekte einer erzwungenen
Vormahlzeit.Der „dishibition effect“ bei gezügeltem Essverhalten
Menge verzehrter Eiscreme unter verschiedenen Preload-
Bedingungen bei gezügelten und nicht gezügelten Essern
(nach Herman & Mack, 1975)
250
200
wenig gezügelte
150 Esser
100 stark gezügelte
Esser
50
0
2M
ke
1M
in
ilc
ilc
M
hs
hs
ilc
ha
ha
hs
ke
ke
ha
s
keDie Rolle psychischer Belastungen
Tuschen, B., Vögele, C., Kuhnhardt, K. & Cleve-Prinz, W. (1995).
Steigern psychische Belastungen das Essbedürfnis?
6
5
Essbedürfnis
4
Bulimiegruppe
3
Kontrollgruppe
2
1 LS= Leistungs-
0 stressor
Baseline
während LS
nach LS
Pause
während IS
nach IS
Follow-Up
IS=Interperso-
neller StressorSie können auch lesen