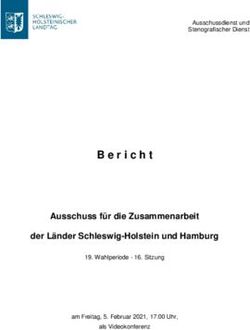Bericht - Hamburgische Bürgerschaft
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 22/6120
22. Wahlperiode 21.10.21
Bericht
des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie
über die Drucksache
22/4007: Bürgerschaftliches Ersuchen vom 28. Oktober 2020: „Hochwasser-
schutz für Hamburg“ – Drs. 22/1515
(Unterrichtung durch die Präsidentin)
Vorsitz: Stephan Gamm Schriftführung: Andrea Nunne
I. Vorbemerkung
Die Drs. 22/4007 wurde am 5. Mai 2021 auf Antrag der SPD und GRÜNEN durch
Beschluss der Bürgerschaft dem Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie überwie-
sen.
Dieser befasste sich in seiner Sitzung am 2. September 2021 abschließend mit der
vorgenannten Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Einleitend berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Bürgerschaft
in ihrer Sitzung vom 28. Oktober 2020 mit Annahme der Drs. 22/1515 das bürger-
schaftliche Ersuchen „Hochwasserschutz für Hamburg“ beschlossen hatte. Mit dem
Ersuchen sei der Senat aufgefordert worden, der Bürgerschaft die vorhandenen
Untersuchungen, mögliche Hochwasserszenarien und neue Konzepte zum Hochwas-
serschutz für den Bereich der ersten, der Hauptdeichlinie, und der sogenannten zwei-
ten Deichlinie darzulegen. Ferner sollte er über die aktuellen wissenschaftlichen Stu-
dien und die für die Behörde relevanten Erkenntnisse zum Meeresspiegelanstieg und
zu Extremwetterereignissen mit dem Schwerpunkt auf die prognostizierten Folgen für
Hamburg sowie über den Stand der Umsetzung des Bauprogramms Hochwasser-
schutz informieren. In diesem Zusammenhang sollten die konzeptionellen Überlegun-
gen der zuständigen Behörde zum künftigen Umgang mit der zweiten Deichlinie vor-
gelegt werden und dabei die Konzepte der zweiten Deichlinie der benachbarten Bun-
desländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen vergleichend herangezogen wer-
den. Des Weiteren sei der Senat ersucht worden, auf bisherige und geplante Beteili-
gungsformate und Kommunikationsformen zur Einbeziehung und Information der
Bevölkerung einzugehen. Über die vorgenannten Punkte sollte er der Bürgerschaft im
1. Quartal 2021 berichten. Mit Schreiben vom 30. März 2021 sei die Behörde für
Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) als zuständige Behörde für den
Hochwasserschutz ihrer Berichtspflicht gegenüber dem Senat und der Bürgerschaft
nachgekommen, und habe mit der Beantwortung des Ersuchens grundlegende Über-
legungen im Sinne der Fragestellung des Ersuchens skizziert und einen weiteren,
umfassenderen Bericht zum Jahresende 2021 angekündigt.Drucksache 22/6120 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Der Küstenhochwasserschutz, erklärten sie, sei für Hamburg seit jeher eine überle- benswichtige Aufgabe gewesen. Aus diesem Grund habe die Sicherheit der Deiche für den Senat und somit auch für die fachlich zuständige BUKEA die höchste Priorität. Jedoch, und das betonten sie, sei deutlich spürbar, stelle sie der Klimawandel vor neue Herausforderungen, weil sich die Rahmenbedingungen zum Teil dramatisch geändert hätten. Im September 2019, das heiße, ein Jahr, bevor die Bürgerschaft das Ersuchen an den Senat gestellt hatte, habe der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – auch als Weltklimarat bezeichnet – seinen „Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima“ vorgelegt, der eine aktualisierte Grundlage für die in der Entwicklung befindlichen Pläne und Konzepte zum Hochwasserschutz in Hamburg biete. Das sei, erklärten sie, auch einer der Gründe, warum sie bis März 2021 keinen umfassenden Bericht hätten vorlegen kön- nen, weil der IPCC schon zu diesem Zeitpunkt eine neue Einschätzung abgegeben hatte. Mit dieser Situation seien sie nun abermals konfrontiert, weil Anfang August 2021 der erste Teil des 6. Sachstandsberichts des IPCC erschienen sei, der ebenso neue wissenschaftliche Erkenntnisse über den Klimawandel und die Klimakrise ent- halte wie über den damit einhergehenden Anstieg des Meeresspiegels. Diese neuen Erkenntnisse müsse Hamburg in die Planungen zum Hochwasserschutz einbeziehen, auch in dem angekündigten weiteren Bericht. Durch die Berücksichtigung dieser neu- en Informationen, räumten sie ein, könne sich eine Verzögerung des angekündigten, weiteren Berichts ergeben. In Anbetracht dessen, dass die aktuellen Prognosen des IPCC zum Anstieg des Meeresspiegels bis 2050 nicht nennenswert von den bisheri- gen Prognosen abweichen würden, sei Hamburg mit dem gegenwärtigen Bemes- sungswasserstand bis 2050, auch nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, weiterhin gut aufgestellt. Eine grundlegende Veränderung der Strategie zum Schutz Hamburgs vor Küstenhochwasser sei daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die Hamburger Deicherhö- hungsstrategie auf Jahrzehnte ausgelegt sei. Dementsprechend sei der letzte Bauab- schnitt des bisherigen zugleich der Beginn des neuen Deicherhöhungsprogramms. Ein besonderes Augenmerk sei dabei gleich in der Anfangsphase des Bauprogramms zur Deicherhöhung auf die besonders zu schützenden Insellagen in Wilhelmsburg und Veddel gelegt worden. Insgesamt, resümierten sie, könne Hamburg derzeit eine sehr hohe Deichsicherheit und einen dementsprechend guten Schutz vor Hochwasser zusichern. Dennoch, und diese Erkenntnis sei neu, räumten sie ein, werde für die Zeit nach 2050 mit einem deutlich schnelleren Meeresspiegelanstieg gerechnet als bisher, sodass sich Hamburg angesichts der Langfristigkeit der Deicherhöhungsprogramme bereits jetzt darauf einstellen und überlegen müsse, wie ein adäquates Hochwasser- schutzniveau erreicht werden könne. Das sei, betonten sie, sowohl finanziell eine umfangreiche Aufgabe, aber auch deshalb, weil sie die dafür Zuständigen in einer Millionenmetropole wie Hamburg vor vielfältige Herausforderungen, nicht nur bezogen auf Flächenkonkurrenzen, stelle. Da Hamburg diesen Anforderungen nicht im Allein- gang gerecht werden könne, sei eine Abstimmung mit den Nachbarbundesländern erforderlich. Im Rahmen der „Kleingruppe Küste“ des ständigen Ausschusses „Hoch- wasserschutz und Hydrologie“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA- AH) hätten sich der Bund und die Küstenländer darauf verständigt, ungeachtet der laufenden Anstrengungen für einen verbesserten Klimaschutz, für vorsorgliche Pla- nungen von dem RCP8.5-Klimaszenario, das die höchsten Anpassungserfordernisse mit sich bringe, auszugehen. Vor dem Hintergrund, dass Deichbau Flächenvorsorge erfordere, weil nach heutigem Stand der Dinge mit Deicherhöhungen auch Deichver- breiterungen einhergingen, seien neue Strategien und Instrumente des Grunderwerbs entwickelt worden, um die erforderliche Flächenverfügbarkeit künftig besser sicher- stellen zu können. Für den Ankauf der zukünftig für den Hochwasserschutz benötigten Flächen berücksichtige Hamburg vorsorglich bereits heute schon das zwischen dem Bund und den Küstenländern vereinbarte Vorsorgemaß. Dadurch, erklärten sie, könn- ten bereits heute schon Flächen angekauft werden, die für ein weiteres, noch zu beschließendes Bauprogramm für den Hochwasserschutz in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts benötigt würden. Hinzu komme, dass sie sich nunmehr auch der zweiten Deichlinie widmen würden, der in den letzten Jahrzehnten weder das behördliche, noch das öffentliche Interesse zugekommen sei. Geleitet würden sie dabei nicht von der Sorge, die Sperrwerke könnten versagen; vielmehr gehe es darum, den neuesten Erkenntnissen des IPCC bezogen auf die Veränderung der hydrologischen Situation 2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/6120
Rechnung zu tragen, die zu dem Schluss geführt hätten, dass die zweite Deichlinie
insbesondere notwendig sei, um vor anwachsenden Gefahren durch Binnenhochwäs-
ser zu schützen, die nicht durch den ansteigenden Meeresspiegel, sondern durch
zunehmende Starkregenereignisse ausgelöst würden. Der steigende Meeresspiegel
hingegen entfalte seine Wirkung dann, wenn durch schneller, stärker und höher auf-
laufende klimabedingte Hochwasser immer häufiger Situationen entstünden, in denen
aus den Hochwasserschutzanlagen in tidefreien Gewässern oder hinter Sperrwerken,
vereinfacht gesagt aus der sogenannten zweiten Deichlinie nicht mehr in die Elbe
entwässert werden könne, wenn sogenannte Sperrtiden auftreten würden. Daher,
hoben sie hervor, sei es notwendig, nunmehr auch die zweite Deichlinie in einen
guten Zustand zu versetzen, wohl wissend, dass damit starke Interessenskonflikte
verbunden seien, weil vielen Anwohnerinnen und Anwohnern die Gesetzeslage nicht
bekannt gewesen sei und diese in den letzten Jahren auch nicht konsequent umge-
setzt worden sei. Dennoch sei es das Ziel, eine angemessene, einvernehmliche und
tragfähige Lösung zu finden, die nur dann zu einer breiten Akzeptanz führen könne,
wenn die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bereits zu einem Zeitpunkt beteiligt würden,
bevor die Planungen abgeschlossen seien, vor allem, weil vielen vermutlich gar nicht
bewusst sei, dass es insbesondere seitens der Stadt Handlungsbedarf gebe. Ein
Gleichklang von Senat und Bürgerschaft, auch hinsichtlich der Beteiligung der Anwoh-
nenden, habe beispielsweise bezogen auf die zweite Deichlinie an der Dove Elbe
erreicht werden können. Wohl wissend, dass es Sinn macht, auch wenn es mit einem
zusätzlichen zeitlichen Aufwand verbunden und nicht absehbar sei, welche Anregun-
gen und Einwendungen geäußert würden, hielten sie es für richtig, die Fragen, mit
denen sie sich in der Konzeptentwicklung für die Ertüchtigung der zweiten Deichlinie
beschäftigen würden, vor Ort mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zu diskutieren.
Jedoch, räumten sie ein, könne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auch
dazu führen, da im Vorwege nicht abschätzbar sei, wie sie verlaufen werde, dass der
für das Jahresende 2021 in Aussicht gestellte ausführlichere Bericht möglicherweise
erst im 1. Quartal 2022 vorliegen werde.
Die Thematik des steigenden Meeresspiegels sowie die Frage, welche Folgen daraus
erwachsen würden, fügten sie ergänzend hinzu, könne Hamburg nur in Zusammenar-
beit mit seinen Nachbarbundesländern sinnvoll bearbeiten und man habe daher auf
Basis des IPCC-Sonderberichts aus dem Jahr 2019 mit den Nachbarbundesländern
Kontakt aufgenommen und entsprechende Gespräche geführt. Im Ergebnis habe sich
Hamburg mit den anderen Küstenbundesländern darauf geeinigt, zukünftig ein auf
den Klimawandel bezogenes Vorsorgemaß von 1,0 Meter, basierend auf dem Mee-
resspiegel vor Cuxhaven, zu verwenden. Das bedeute jedoch nicht, dass alle Deiche
einfach um 1,0 Meter erhöht werden müssten; vielmehr diene dieses Vorsorgemaß als
Grundlage für die Berechnung von Szenarien, die anhand von Modellen und Risiko-
abwägungen ermittelt würden, aus denen der Bemessungswasserstand für die
Zukunft weiterentwickelt werde. Aktuell stünde hierzu noch die fachliche Abstimmung
mit dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer an. Darüber hinaus seien sie
aber auch damit befasst, mit den Nachbarbundesländern und der Bundesanstalt für
Wasserbau zu ermitteln, was dieser 1 Meter für Hamburg bedeute, da dieser schließ-
lich einmal für den Verlauf der Tideelbe hochgerechnet werden müsse. In dem IPCC-
Sonderbericht aus dem Jahr 2019 seien verschiedene Szenarien betrachtet worden,
auch bezogen auf den CO2-Ausstoß. Hamburg habe sich diesbezüglich für ein hoch-
wassertechnisch konservatives Herangehen und somit für das RCP8.5-Klimaszenario
entschieden. Nicht, betonten sie, weil sie dieses anstreben oder gar begrüßen wür-
den, sondern um ein erfolgreiches Vorankommen beim Klimaschutz zu gewährleisten.
Der IPCC-Sonderbericht aus dem Jahr 2019 habe im Median für das Jahr 2100 einen
Anstieg des Meeresspiegels von 84 Zentimetern ergeben; die Bandbreite habe auf-
grund unterschiedlicher Modellberechnungen zwischen 61 Zentimetern und 1,10 Me-
tern gelegen. Damit hätten sie mit dem vereinbarten Vorsorgemaß von 1,0 Meter
oberhalb des Medianwerts gelegen. In 2021 sei dann der erste Teil des Sechsten
IPCC-Sachstandsberichts veröffentlicht worden, in dem das Thema „Meeresspiegel-
anstieg“ erneut betrachtet worden sei. Die bereits im IPCC-Sonderbericht aufgezeigte
Bandbreite der prognostizierten Meeresspiegelerhöhung habe sich im Sechsten
IPCC-Sachstandsbericht verringert und zwischen 63 Zentimetern und 1,02 Metern
gelegen, der Median bei 77 Zentimetern. Das bedeute, dass sich die Tendenz gegen-
3Drucksache 22/6120 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode über älteren IPCC-Berichten bezogen auf den Meeresspiegelanstieg nicht noch ein- mal verschärft habe, sondern der Sechste Sachstandsbericht eine Bestätigung und weitere Eingrenzung dessen sei, was der IPCC-Sonderbericht 2019 bereits prognosti- ziert hatte. Somit hätten auch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse die Einigung mit den Nachbarbundesländern auf das Vorsorgemaß von 1,0 Meter bestätigt. Bei der sogenannten zweiten Deichlinie, berichteten sie, stehe der Klimawandel weniger im Fokus als bei der ersten Deichlinie, weil es bei der zweiten Deichlinie darum gehe, die Erfordernisse des Hochwasserschutzes einerseits und die gewachsenen Nutzungen, die es dort gebe, die Kulturlandschaften, die sich dort entwickelt hätten, in einen ver- nünftigen Einklang zu bringen. Das, erklärten sie, könne einerseits im Einzelfall durch- aus auch mal zu Härten bei den Anwohnerinnen und Anwohnern führen, andererseits lohne es sich, genauer hinzuschauen, weil einige dieser Deiche ursprünglich größer bemessen worden waren, als sie noch zur Hauptdeichlinie gehört hätten, sodass es an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Reserven gebe. Somit würde die Verordnung über öffentliche Hochwasserschutzanlagen, die Deichordnung, nicht zwangsläufig an jeder Stelle eins zu eins umgesetzt, zumindest nicht ohne nochmali- ge inhaltliche Prüfung, was wirklich für den Deich erforderlich sei, um daraufhin nach Lösungen zu suchen, die für die Anwohnerinnen und Anwohner minimal belastend seien, gleichzeitig aber perspektivisch und langfristig den Erfordernissen des Hoch- wasserschutzes Genüge tun würden. Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass es gut gewesen sei, dass sie ihren Antrag bereits im Oktober 2020 auf den Weg gebracht hätten, weil nunmehr, insbesondere nach diesem Sommer, bundesweit die Diskussion zu diesem Thema in Gang gekom- men sei. Zu der Aussage auf Seite 3 der Bezugsdrucksache, dass für erneute Erhö- hungen der Hochwasserschutzanlagen zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden müssten, und, um die erforderliche Flächenverfügbarkeit besser sicherzustel- len, derzeit neue Strategien und Instrumente des Grunderwerbs entwickelt würden und für den Ankauf der zukünftig für den Hochwasserschutz benötigten Flächen Ham- burg vorsorglich bereits heute das zwischen dem Bund und den Küstenländern ver- einbarte Vorsorgemaß berücksichtige, wodurch bereits heute Flächen angekauft wer- den könnten, die für ein weiteres noch zu beschließendes Bauprogramm für den Hochwasserschutz in der sogenannten zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts benötigt würden, fragten sie, wie die Prognose für Hamburg als Stadtstaat mit überschaubar verfügbaren Flächen aussehe. Zwar würden die Baumaßnahmen auf den Elbinseln gut laufen, jedoch sei deren Größe auch überschaubar. Vor dem Hintergrund, dass dort, wo die benötigten Flächen zur Deichertüchtigung oder Deicherhöhung nicht ver- fügbar seien, sie den Eigentümerinnen und Eigentümern abgekauft werden müssten, interessierte sie, ob es eine Prognose zum eigentlichen Flächenbedarf bei der ersten Deichlinie gebe und ob die Planungen gut laufen würden oder ob sich in dem einen oder anderen Stadtteil bereits herausfordernde Situationen erahnen ließen. Konkret erkundigten sie sich insofern nach der Prognose des eigentlichen Flächenbedarfs für die Deichbaumaßnahmen an der Hauptdeichlinie. Darüber hinaus sei ebenfalls über die zweite Deichlinie gesprochen worden, auch darüber, was in diesem Zusammen- hang auf die zum Teil beunruhigten Bürgerinnen und Bürger zukommen werde. Die SPD-Abgeordneten begrüßten daher sehr, dass die BUKEA proaktiv eine Beteiligung der von den Deichbaumaßnahmen Betroffenen vorgesehen habe. Sie äußerten, dass Deichbaumaßnahmen in der Regel einen jahrelangen Planungsvorlauf hätten. Auf- grund von Verzögerungen durch die Corona-Pandemie und zwischenzeitliche Roh- stoffengpässe sowie wegen der verzögerten Fertigstellung der Restarbeiten des ver- gangenen Bauprogramms laufe die bauliche Umsetzungsphase des aktuellen Deich- erhöhungsprogramms mit einer zeitlichen Verzögerung an, sodass von der 103,1 Kilo- meter langen Hauptdeichlinie bisher nur 2,5 Kilometer auf den aktuellen Bemessungs- wasserstand angepasst worden seien. Auch, wenn sie in den Gesamtplänen gut dastünden, interessierte die SPD-Abgeordneten, wie die Prognose für den weiteren Baufortschritt sei, und sie wollten wissen, ob sie sich inzwischen wieder im Zeitrah- men befänden. Ferner fragten sie nach, ob es gelungen sei, die bisherigen Probleme zu lösen, und erkundigten sich, ob neue Schwierigkeiten aufgetaucht seien. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Herausforderungen des Grunderwerbs zu den zentralen Fragen und Problemen im Rahmen von Deichbau- maßnahmen gehören würden. Das liege daran, dass, wenn ein Erddeich um 1 Meter 4
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/6120
erhöht werden solle, er in beide Richtungen um je etwa 3 Meter breiter werde. Für
diese Verbreiterung würden besagte zusätzliche Flächen benötigt. Das, bekräftigten
sie, sei in einem Stadtstaat noch einmal eine andere Herausforderung als in einem
Flächenland. Es gebe zwar die Möglichkeit, Deiche auch durch technische Bauwerke
zu ersetzen, das sei jedoch wesentlich teurer und zudem hochwasserschutztechnisch
schlechter sowie weniger flexibel für einen weiteren Ausbau im Zuge künftiger Erhö-
hungen. Die Flächenbedarfe, führten sie aus, hätten bei bisherigen Deicherhöhungs-
maßnahmen immer wieder zu Verzögerungen geführt. Schließlich sei das Thema
„Enteignung“ auch keines, das leichtfertig angegangen werde, da zunächst alle ande-
ren Optionen geprüft würden. Daher, und das hätten sie auch in der Beantwortung
des Ersuchens ausgeführt, würden sie künftig versuchen wollen, von der anlassbezo-
genen Ausübung des Vorkaufsrechts und dem projektbezogenen freien Ankauf von
Grundstücken abzurücken und sich stärker dem freien vorsorglichen Ankauf von
Grundstücken zu widmen. Folglich könnte die Stadt künftig proaktiv Grundstücke
ankaufen, wenn diese perspektivisch für den Hochwasserschutz benötigt würden,
auch wenn damit bislang noch kein konkretes Projekt verbunden sei. Das hätte den
Vorteil, dass sich das Zeitfenster für den Ankauf vergrößere, weil bereits viele Jahre
oder auch Jahrzehnte bevor ein Grundstück für Deichbaumaßnahmen benötigt werde,
möglicherweise Verkaufsbereitschaft bestehe und genutzt werden könnte, weil
lebenssituativ eine Eigentümerin oder ein Eigentümer umziehe oder der Erbfall einge-
treten sei. Dadurch werde der Druck hinsichtlich notwendiger Grundstücksankäufe
bereits im Vorwege verringert.
Vorbereitend auf die nächste Deicherhöhungsrunde sei zunächst ein nicht unerhebli-
cher Planungsvorlauf mit vielen parallel verlaufenden Planungen, der sich nicht inner-
halb weniger Monate abarbeiten lasse, erforderlich. Infolgedessen halte sich die Bau-
tätigkeit derzeit noch in einem überschaubaren Rahmen. Der Umstand, dass zunächst
von dem neuen Deicherhöhungsprogramm aufgrund nur weniger Stellen, an denen
gebaut werde, nicht viel sichtbar sei, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
gebe jedoch keinen Anlass zur Sorge, sondern sei ein normaler Prozess im Zuge
dessen das Deicherhöhungsprogramm dennoch zügig voranschreite. Das letzte
Deichbauprogramm sei im Wesentlichen mit der Erhöhung der Hochwasserschutz-
anlage an den Landungsbrücken, am Niederhafen, beendet worden. Die in diesem
Zusammenhang erstellte Promenade sei der Übergang vom bisherigen zum jetzigen
Deicherhöhungsprogramm. Derzeit, informierten sie, werde am Haulander Hauptdeich
und am Klütjenfelder Hauptdeich gearbeitet, um primär die Insellagen zu schützen.
Zudem würden sich weitere neun Deichprojekte für eine Erhöhung in Planung befin-
den, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Die nächsten ein bis zwei
Jahre würden voraussichtlich noch für die Planungen benötigt, dann würden die ver-
schiedenen Projekte vermehrt in den Bau gehen, sodass das neue Deicherhöhungs-
programm mehr und mehr sichtbar werde. Derzeit gebe es Planungsarbeiten für den
Harburger Hauptdeich, den Cranzer Hauptdeich, den Neuenfelder Hauptdeich, den
Aue-Hauptdeich ebenso wie für den Buschwerder Hauptdeich und den Pollhorner
Hauptdeich, den Reiherstieg-Hauptdeich und den Kreetsander Hauptdeich sowie den
Obergeorgswerder Hauptdeich.
Die SPD-Abgeordneten zeigten sich erfreut, dass sich neun größere Projekte in der
Planung befänden, und fragten, wie viel Kilometer Hauptdeichlinie diese neun Projek-
te, die aktuell zur Anpassung in Planung seien, ausmachen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die gewünschten Angaben zu
Protokoll nachzuliefern, und erklärten mit Schreiben vom 9. September 2021
nachträglich:
Die Gesamtlänge der aktuell in Planung befindlichen Deicherhöhungsmaßnah-
men beträgt 12,245 Km.
Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
Bezeichnung Deich-km In Planung
[von bis] in [m]
Klütjenfelder HD BA 3 1,960 bis 2,250 290
Obergeorgswerder HD 5,09 bis 5,518 428
5Drucksache 22/6120 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode
Bezeichnung Deich-km In Planung
[von bis] in [m]
Kreetsander HD 6,300 bis 8,400 2.100
DRV Ellerholz 8,400 bis 9,500 1.100
Buschwerder HD 17,200 bis 17,500 300
Pollhorner HD Süd 18,400 bis 18,700 300
Reiherstieg 4. BA 21,475 bis 22,000 525
Reiherstieg 3. BA 22,000 bis 22,500 500
Reiherstieg 2. BA 22,500 bis 22,900 400
Reiherstieg 1. BA 22,900 bis 23,700 800
Harburger HD Ost 4,600 bis 4,900 300
Harburger HD West 4,900 bis 5,300 400
Aue HD 18,100 bis 19,600 1.500
Neuenfelder HD 30,400 bis 32,100 1.700
Cranzer HD 32,100 bis 33,700 1.600
Summe 12.245
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten weiter, dass die Längenangabe auch
davon abhänge, welche Bauabschnitte im Einzelnen betrachtet würden. Bei dem sehr
langen Reiherstieg-Hauptdeich werde beispielsweise nicht über die gesamten 6 Kilo-
meter gebaut, sondern es finde eine Einteilung in einzelne Bauabschnitte statt.
Die GRÜNEN-Abgeordneten begrüßten die Ausführungen der Senatsvertreterinnen
und -vertreter, und hießen gut, dass auch auf den aktuellen, den Sechsten Sach-
standsbericht des IPCC eingegangen worden sei. Wohl wissend, dass möglicherweise
die Beantwortung ihrer Fragen erst im Zuge des nächsten, ausführlicheren Berichts
möglich sein werde, erkundigten sie sich, ob sie es richtig verstanden hätten, dass,
verglichen zum letzten Sachstandsbericht, nicht von einer weiteren Erhöhung des
Meeresspiegels bis 2050 ausgegangen werde. Zur zweiten Deichlinie interessierten
sie vor allem auch die Deichdurchfahrten, weil diese zum Teil offen stünden und
zudem unklar sei, wer diese im Bedarfsfall schließe. Darüber hinaus wollten sie vor
dem Hintergrund, dass es vermehrt zu Binnenhochwässern komme, wissen, ob, und
falls ja, welche Pläne es für Sturmflutschöpfwerke gebe.
Der IPCC-Sonderbericht aus 2019, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
sei nicht einer der aufeinanderfolgenden regulären Sachstandsberichte gewesen, son-
dern ein „Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre in einem sich wandeln-
den Klima“. Dieser habe die Prognose einer beschleunigten Erhöhung des Meeres-
spiegels gestellt, die von dem regulären, dem ersten, Teil des Sechsten Sachstands-
berichts des IPCC, durch Eingrenzung auf einem ähnlichen Niveau präzisiert worden
sei. Jedoch weise der Sechste Sachstandsbericht des IPCC verglichen mit dem Fünf-
ten Sachstandsbericht eine deutliche Beschleunigung des Meeresspielelanstiegs aus.
Es sei zwar richtig, dass bereits zum Jahr 2050 ein Meeresspiegelanstieg prognosti-
ziert werde; dieser, betonten sie, sei jedoch im Rahmen des aktuellen Deicherhö-
hungsprogramms abgesichert. Dadurch, betonten sie, würden sie sich in ihren bishe-
rigen Planungen bestätigt sehen. Für den Zeitraum nach 2050 hingegen würde
anhand der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse Vorsorge getroffen werden müs-
sen.
Bei sogenannten Sperrtiden, bei hohen Elbaußenwasserständen, erklärten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei es tiefliegenden Gebieten nicht mehr möglich,
im freien Gefälle zu entwässern. Angesichts dieser sich verschärfenden Situation wer-
de im Bereich der Dove Elbe ein leistungsfähiges Schöpfwerk geplant. Für die Reali-
sierung, auch um den Fließweg zum Schöpfwerk gestalten zu können und dann das
Gebiet als Entwässerungsunterstützung nach Osten herstellen zu können, würden
noch einige weitere Grundstücke benötigt; die entsprechenden Verhandlungen wür-
den derzeit geführt. Um eine bessere Entwässerung in Richtung Westen erreichen zu
können, bedürfe es einer verbesserten Steuerung, die wiederum durch eine optimierte
6Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/6120
Deichsielentwässerung und durch Schöpfwerk-Bauwerke erreicht werden könne.
Damit, betonten sie, würden sie sich auf wiederkehrende, verschärfende Situationen
einstellen. Schöpfwerke, erklärten sie weiter, seien Bauwerke, die in der Regel in der
Hauptdeichlinie eingebaut seien und insbesondere im Hinblick auf zunehmende Stark-
regenereignisse eine beschleunigte Entwässerung der Binnenbereiche zum Ziel hät-
ten. Das zum Beispiel in den Einzugsgebieten der Dove Elbe anfallende Wasser wer-
de über Pumpen in Richtung Elbe entwässert. Durch derlei Maßnahmen, erklärten sie,
könne einer Vergrößerung der ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete entgegen-
gewirkt werden. Das, schlossen sie ihre Ausführungen, sei das Konzept für die Vier-
und Marschlande.
Auf die Nachfrage der GRÜNEN-Abgeordneten, ob es derartige Pläne im Hinblick auf
Schöpfwerke auch für das Alte Land, insbesondere für den Bereich der Este, gebe,
erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es hierfür derzeit keine ent-
sprechenden Planungen gebe, räumten aber ein, dass es Überlegungen gebe, ob die-
se in Zukunft notwendig werden könnten. Die Priorität liege derzeit im Bezirk Berge-
dorf, in den Vier-und Marschlanden, die hochwassertechnisch gefährdeter seien als
das Alte Land. Die Este, erklärten sie, sei anders ausgelegt, habe ein anderes Ein-
zugsgebiet und darüber hinaus auch andere Fließwege als die Dove Elbe. Ein Ver-
gleich sei daher nicht möglich. Zudem sei das Este-Sperrwerk als Hauptentlastungs-
sperrwerk sehr leistungsfähig.
Die GRÜNEN-Abgeordneten stellten fest, dass bereits zwei Schwerpunkte, die Vier-
und Marschlande und der Bereich zwischen Finkenwerder und Cranz, das Alte Land,
angesprochen worden seien. Nicht zuletzt, damit das Verständnis der Bevölkerung für
derlei Maßnahmen mit der Zeit weiter zunehme, seien entsprechende Beteiligungsver-
fahren wichtig und würden daher ausdrücklich begrüßt. Häufig, stellten sie fest, seien
Maßnahmen, die den Deichbau oder die zweite Deichlinie betreffen, bei denen Häuser
gefährdet seien oder nicht mehr wie bisher bewohnt werden könnten, nicht populär.
Der Drs. 20/5561 Hochwasserschutz für Hamburg (Senatsmitteilung) könne entnom-
men werden, dass aus Modellrechnungen der Bundesanstalt für Wasserbau für Alten-
gamme von einem Bemessungswasserstand (inklusive Klima- und Metropolzuschlag)
von NN + 8,60 Meter ausgegangen werde. Hinzu käme, dass der bisherige Klimazu-
schlag von 0,5 Meter auf 1 Meter angehoben worden sei. Dies vorausgeschickt inte-
ressierte sie, ob das bedeute, dass in Altengamme künftig von einem Bemessungs-
wasserstand von NN + 9,60 Meter ausgegangen werden müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sich durch die Hochrechnung
des 1 Meters Deicherhöhung eine leichte Verschiebung bei der Tideelbe ergeben kön-
ne, sodass möglicherweise der 1 Meter nicht überall zum Tragen kommen werde.
Letztlich, stellten sie fest, gehe es um die Frage, ob der Klimazuschlag noch dazuge-
rechnet werden müsse oder in der alten Erhöhung bereits enthalten sei, und darum,
wie hoch die Deiche in Zukunft werden müssten. Hamburg, führten sie aus, gehe nach
dem Konzept vor, sich alle zehn Jahre anhand der Auswertung der neuesten und
geltenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und Meeresspiegelan-
stieg für weitere, erforderliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu entscheiden.
Bis 2050, wiederholten sie, gebe es keine neuen Erkenntnisse, die von den bisherigen
Auswertungen abweichen würden. Darüber hinaus sei mit Blick in die Zukunft ein Vor-
sorgemaß von 1 Meter verabredet worden, das auch für 2021 gelte. Dennoch, räum-
ten sie ein, sei ihnen nicht bekannt, was der IPCC in zehn Jahren berichten werde,
oder im Jahr 2030 oder 2040 an neuen Erkenntnissen vorweisen könne, sodass die
tatsächliche Entscheidung über die künftige Deichhöhe erst dann getroffen werde,
wenn belastbare Erkenntnisse vorliegen würden. Bis dahin würden sie mit dem Vor-
sorgemaß, das mit den anderen Nachbarbundesländern abgestimmt sei und dem
entspreche, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen vorliege, arbeiten, um weitere
Deicherhöhungen vorzubereiten. Sie betonten, dass die bauliche Umsetzung dieses
neuen Maßes derzeit zwar noch nicht erfolge, wiesen aber darauf hin, dass eine lang-
fristige Festlegung auf dieses Maß erfolgen werde, wenn keine neuen Erkenntnisse
gewonnen würden. Dann würde ein entsprechender Klimazuschlag festgelegt, der auf
Basis der dann vorliegenden Erkenntnisse, des Wellenaufkommens und der Strö-
mungsverhältnisse ermittelt werde, sodass zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau gesagt
werden könne, wie hoch die Deiche künftig sein würden.
7Drucksache 22/6120 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Die GRÜNEN-Abgeordneten stellten klar, dass es ihnen gar nicht in erster Linie um die Deichhöhe, sondern um den Bemessungswasserstand gegangen sei, und fragten erneut, ob der Pegel in Altengamme bei NN + 9,60 Meter liegen werde, wenn man den 1 Meter Klimazuschlag hinzurechnen würde. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass sie zwar den Bemessungs- wasserstand für Altengamme nicht vorliegen hätten, erklärten jedoch, dass der Bemessungswasserstand sich aus verschiedenen Anteilen zusammensetzt. Der Kli- mazuschlag beispielsweise solle die Problematik des sich weiter erhöhenden Meeres- spiegels, wodurch auch der Wasserstand in Hamburg steigen werde, erfassen. Für den Zeitraum von 2000 bis 2100 sei laut neuesten Erkenntnissen des IPCC ein Anstieg von rund 1 Meter zu erwarten, worauf sich auch Bund und Länder geeinigt hätten, diese Angabe zunächst als Grundlage für ihre bevorstehenden Hochwasser- schutzmaßnahmen anzunehmen. Das, erklärten sie, bedeute aber auch, dass der Klimaanteil im Bemessungswasserstand steigen werde, wenn auch nicht um 1 Meter. Bezogen auf Altengamme werde der Bemessungswasserstand um ein Maß steigen, das bisher noch nicht berücksichtigt worden sei. Sie betonten, dass Hamburg sich bereits im Jahr 2012 im Gegensatz zu den Nachbarbundesländern entschieden habe, den Bemessungswasserstand nicht bereits bis zum Jahr 2100 festzulegen, weil sei- nerzeit die Wissenschaftler und Prognosen in den verschiedenen betrachteten Szena- rien bis 2050 relativ einheitliche Ergebnisse erzielt hätten, ab 2050 jedoch deutliche Schwankungen zwischen den Ergebnissen bestanden hätten, sodass Hamburg den Bemessungswasserstand zunächst nur bis 2050 festgelegt habe. In dem Bemes- sungswasserstand sei neben einem Klimazuschlag von 20 Zentimetern auch ein Metropolzuschlag von 30 Zentimetern, also insgesamt 50 Zentimeter, enthalten. In den Nachbarbundesländern stelle sich die Situation anders dar, weil sie im Vergleich zu Hamburg eine sehr viel längere Küste hätten und somit eine längere Deichlinie. Folglich könnten sie sich nicht den Luxus leisten, so, wie Hamburg, „relativ schnell“ die Deichlinie komplett zu erhöhen, sondern bräuchten lange Zeiträume, einmal alle Deiche anzupassen, weswegen sie sich auf den Bemessungszeitraum bis 2100 fest- gelegt hätten. Das heiße, wenn der 1 Meter, das Vorsorgemaß bis 2100, betrachtet werde, müsse geguckt werden, welche Komponenten bereits im Bemessungswasser- stand berücksichtigt seien und welche in dem Zeitraum zwischen 2050 bis 2100 noch hinzukommen würden. Insgesamt werde das voraussichtlich kein ganzer Meter, son- dern weniger sein, antworteten sie. Auf die Nachfrage der GRÜNEN-Abgeordneten, ob die 50 Zentimeter somit das gesuchte Maß seien, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass 80 Zentimeter das richtige Maß seien, weil der Klimazuschlag bisher 20 Zentimeter betragen habe. Das sei jedoch erst einmal nur ein grober Wert, weil die Details noch abgewartet werden müssten, was sie für Hamburg bedeuten würden. Da Cuxhaven als Referenzort angesehen werde, müsse ermittelt werden, was bei den Modellbe- rechnungen, die erst im Laufe der sogenannten zweiten Jahreshälfte vorliegen wer- den, herauskomme, wenn die Werte die Elbe hochgerechnet worden seien, ob es dann um 1 Meter oder mehr oder weniger gehe. Insofern handele es sich nur um einen groben Wert, über den gesprochen werde. Die AfD-Abgeordneten begrüßten das Bauprogramm zur Deicherhöhung und lobten die Fortschritte, die dem Schutz der Bevölkerung dienen würden, ausdrücklich. Vor dem Hintergrund, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereits eingeräumt hätten, dass die konkrete zeitliche Vorhersage für die Realisierung der verschiedenen Deicherhöhungsprojekte mitunter schwierig sei, erkundigten sie sich nach deren Kos- ten. Überdies interessierte sie die Zusammensetzung der auf Seite 2 der Bezugs- drucksache genannten Kleingruppe Küste, insbesondere dahin gehend, ob auch Ver- treterinnen und Vertreter der Hafenwirtschaft, der Unternehmen und örtlicher Deich- verbände oder andere Expertinnen und Experten darin mitarbeiten würden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter baten um Verständnis, dass ein Baupro- gramm, das bis 2050 sukzessive umgesetzt werden solle, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eurogenau beziffert werden könne, insbesondere auch vor dem Hinter- grund nicht, dass die Baukosten in den letzten Jahren immens gestiegen seien. In den letzten Jahren hätten sie durchschnittlich 30 Millionen Euro pro Jahr für Deichbau- maßnahmen ausgegeben. Da sie sich derzeit in einer Phase befänden, in der viel 8
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/6120
geplant, aber weniger realisiert werde, seien in den nächsten Jahren erst einmal
etwas weniger Kosten zu erwarten; an diese Phase anschließend aber aufwachsend
wesentlich mehr als die 30 Millionen Euro pro Jahr. Um die Belastung für den Ham-
burger Haushalt zu begrenzen, würden sie sich, berichteten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, wie bisher um die Bundesförderung über die Gemeinschaftsaufgabe
Küstenschutz bemühen. Darüber hinaus würden sie versuchen, über ELER-Mittel
(Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) auch
europäische Fördermittel für Hamburg zu akquirieren. Eine Kosteneinschätzung für
das gesamte Bauprogramm abzugeben wäre hingegen unseriös. Fest stehe aber,
dass die steigenden Herausforderungen durch den Klimawandel zu einem verstärkten
Flächenbedarf aufgrund des Erfordernisses höherer Deiche und Hochwasserschutz-
anlagen und somit in der Tendenz zu steigenden Kosten führen würden. Die Klein-
gruppe Küste sei eine verwaltungsinterne Gruppe der Küstenländer Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zusätzlich sei
auch der Bund in dieser Gruppe, die sich in regelmäßigen Abständen treffe und in der
Zwischenzeit in den unterschiedlichen Ressorts weiterarbeite, vertreten.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass viele konkrete Ergebnisse erst für den noch
folgenden, abschließenden Bericht angekündigt seien. Dies vorausgeschickt nahmen
sie Bezug auf die Ergebnisse der Bundesanstalt für Wasserbau zur Ermittlung der
maßgeblichen Scheitelwerte. Hierzu sei in Aussicht gestellt worden, dass diese im
nächsten Halbjahr erwartet würden, und baten um terminliche Konkretisierung. Über-
dies interessierten sie die Schritte, die diesen Ergebnissen folgen würden. Sie fragten,
wann das Konzept zur Ertüchtigung der sogenannten zweiten Deichlinie vorliegen
werde, und wollten wissen, wann beabsichtigt sei, die Anwohnerinnen und Anwohner
zu beteiligen. Des Weiteren erkundigten sie sich, ob es eine Liste der Flächen gebe,
die für die anstehenden Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz benötigt würden.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats äußerten in Bezug auf die sogenannte
zweite Deichlinie, dass noch in diesem Jahr der Beteiligungsprozess zu den geplanten
Deichbaumaßnahmen an der Dove Elbe vor Ort durchgeführt werden solle, sodass
dort auftauchende Fragen und Anregungen im Rahmen des ausführlicheren Berichts
bereits beantwortet oder kommentiert einfließen könnten. Das bedeute jedoch auch,
dass der Zeitplan davon abhängig sei, was sie im Rahmen der Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger an Rückmeldungen bekämen. Wenn es dabei um ganz andere
Themen, als die, mit denen sie sich bisher befasst hätten, gehe, sei nicht auszu-
schließen, dass der angekündigte Bericht möglicherweise nur knapp zum, oder erst
nach dem Jahresende 2021 fertig werde. Das sei der Preis dafür, dass die Bevölke-
rung nicht mit einem fertigen Konzept behelligt, sondern auf die vielen Sorgen sowie
Gesprächs- und Beteiligungswünsche eingegangen werde. Wenn man diese ernst
nehme, müssten sie auch abgearbeitet werden. Daher sei es auch nicht möglich, ein
definitives Datum anzugeben, bis wann das Konzept zur sogenannten zweiten Deich-
linie fertiggestellt sein werde. Die Bundesanstalt für Wasserbau sei aufgrund ihrer
Expertise von den Tideanrainerländern beauftragt worden, die Modellberechnungen
zum Hochwasserschutz vorzunehmen. Erste vorläufige Ergebnisse lägen bereits vor,
der Abschlussbericht sei von der Bundesanstalt für Wasserbau für Ende September/
Anfang Oktober 2021 in Aussicht gestellt worden. Dieser sei zeitlich davon abhängig,
welche Anmerkungen und Fragestellungen noch bearbeitet werden müssten, weil ver-
einbart worden war, dass die Anrainerstaaten nach den ersten Zwischenergebnissen
noch Rückfragen stellen könnten, um einen möglichst breiten Konsens erreichen zu
können. Im Übrigen sei es ihre Absicht gewesen, mit der Beantwortung des Ersu-
chens ein derartiges Konzept wenigstens angelegt zu haben, ohne davon auszuge-
hen, dass darin für jeden Deich bereits eine fertige Lösung präsentiert werde; vielmehr
gehe es ihnen darum, Eckpunkte und Leitgedanken, die gegebenenfalls rechtliche
Anpassungen der Deichordnung mit sich bringen könnten, in einem Fahrplan für den
weiteren Prozess vorzuhalten. Das, unterstrichen sie, sei kein Masterplan, der Stück
für Stück abgearbeitet werde, sondern entspreche einer konzeptionellen Vorlage. Die
Flächen, die für die Deicherhöhungen benötigt würden, stünden noch nicht im Detail
fest, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, seien aber auch davon
abhängig, welche Erhöhung der Deiche letztlich erforderlich sein werde. Gehe man
von einem knappen Meter aus, könne anhand der Deichgeometrie, die sowohl was-
serseitig als auch landseitig eine Eins-zu-drei-Böschung aufweise, ausgerechnet wer-
9Drucksache 22/6120 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode den, um wie viel weiter nach hinten ein zukünftiger Deich, wenn man ihn landseitig verbreitern würde, reichen werde, und könne daraus grob die benötigte Fläche errech- nen, der es für die entsprechenden Deichbaumaßnahmen bedürfte. Es sei jedoch nicht so, gaben sie zu bedenken, dass schon heute für jeden Deichkilometer eine Planung vorliege, wie weit nach außen und wie weit nach innen Deiche verbreitert würden. Die CDU-Abgeordneten gaben an, dass, wohl wissend, dass Beteiligung ihre Zeit brauche, trotzdem ein Zeitziel vorgegeben sein müsste, bis wann die Ergebnisse vor- zuliegen hätten und das Konzept fertig sein sollte. So, wie ausgeführt, sei die Termin- lage ihres Erachtens noch viel zu ungenau. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dass sie in dem Schreiben an die Präsidentin in Aussicht gestellt hätten, bis Jahresende einen umfassenderen Bericht vorzulegen, der voraussichtlich eher zum Ende des letzten Quartals vorliegen werde. Das Ziel, dem nachzukommen, bestehe weiterhin. Dennoch hätten sie es für sinnvoll erachtet, darauf hinzuweisen, dass es, je nachdem, wie sich der Beteiligungs- prozess gestalte, zu Verzögerungen kommen könne. Bezug nehmend auf die Aussage auf Seite 5 der Bezugsdrucksache, wonach das Konzept es ermöglichen solle, die Schutzfunktion in einem Prozess zu sichern, des- sen Dauer an städtebauliche Entwicklungszeiträume angelehnt sei, fragten die Abge- ordneten der Fraktion DIE LINKE, was konkret für wie viele Jahrzehnte damit festge- legt würde. Darüber hinaus baten sie den ebenfalls auf der gleichen Seite befindlichen Satz, dass, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Deiche für die Region zu schärfen und die Akzeptanz der Entwicklung der Deiche zu schaffen, geplant sei, die betroffenen Anwohner und Stakeholder vor der Finalisierung der Konzeption umfas- send zu informieren, sobald die Eckpunkte des Konzepts ausgearbeitet seien, zu erläutern, und fragten, wie verfahren werde, wenn sich ein Haus auf einer Fläche befinde, auf der Deichbaumaßnahmen vorgesehen seien. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen abermals darauf hin, dass es keine fertigen Masterpläne gebe, anhand derer für jedes Gebäude abgeleitet werden könne, oder für jeden Deichabschnitt, was genau geplant sei. In einem Konzept werde ledig- lich definiert, nach welchen Grundsätzen Zielkonflikte bearbeitet werden sollen. Für die Sicherheit von Deichen, führten sie aus, gebe es an bestimmten Stellen wenige bis keine Spielräume, an anderen Stellen hingegen schon. Diese Spielräume, und wie damit umgegangen werden solle, müssten erst festgelegt werden. Nach der geltenden Deichordnung sei es beispielsweise verboten, auf dem Deich Bäume zu pflanzen beziehungsweise sie dort wachsen zu lassen. Dennoch gebe es zum Beispiel in Wil- helmsburg Abschnitte auf der sogenannten zweiten Deichlinie, die einer Allee mit 40 bis 50 Jahre alten, aber auch mit jungen Bäumen gleichen würden. Da Bäume nach jetziger Rechtslage weder auf der ersten, noch auf der sogenannten zweiten Deichli- nie zulässig seien, müssten sie eigentlich umgehend beseitigt werden. Ob das jedoch das beste Vorgehen sei, darüber würden sie derzeit noch nachdenken. Auf die Frage der LINKEN-Abgeordneten, was mit einem Haus passiere, dessen Grundstück für den Deichbau benötigt werde, müsse zwischen erster und zweiter Deichlinie unterschie- den werden. Rechtlich gesehen gelte die Deichordnung mit minimalen Abstufungen sowohl für die Hauptdeichlinie als auch für die sogenannte zweite Deichlinie. Auf der ersten Deichlinie, informierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, gebe es defini- tiv weder Häuser noch Bäume, und falls dort doch mal ein Baum wachsen sollte, wür- de dieser umgehend entfernt. Dieses konsequente Vorgehen in der ersten Deichlinie sei nicht zuletzt auch den Erfahrungen aus der großen Sturmflut von 1962 geschuldet. Bezogen auf die sogenannte zweite Deichlinie, die rechtlich gesehen der ersten Deichlinie gleichgestellt sei, spiegele die Realität ein völlig anderes Bild wider. Neben den bereits erwähnten alleeartigen Streckenabschnitten und erheblichem sonstigen Bewuchs gebe es auch sehr erhaltenswerte, charmante, die Landschaft und Kultur prägende Bauten, die mehr oder weniger auf der sogenannten zweiten Deichlinie stünden. Das, räumten sie ein, sei jahrelang toleriert worden, ohne dass es einen konsequenten Vollzug gegeben hätte. Jedoch sei die sogenannte zweite Deichlinie aus fachlicher Sicht nicht der ersten Deichlinie gleichzusetzen. Zum einen befinde sich vor der sogenannten zweiten Deichlinie entweder ein Sperrwerk oder eine andere Deichlinie. Darüber hinaus diene die zweite Deichlinie dem Schutz vor Binnenhoch- 10
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/6120
wasser und nicht dem Schutz vor Küstenhochwasser, das noch einmal eine ganz
andere Wucht innehabe. Daher würden sie, und das sei fachlich auch vertretbar, zwar
entschlossen, aber vorsichtig an das Thema der sogenannten zweiten Deichlinie
herangehen und den dort Wohnenden nicht einfach heute mitteilen, dass sie morgen
ausziehen müssten, damit ihr Haus abgerissen und ein ordentlicher Deich auf dem
Grundstück errichtet werden könne. Inwieweit Konsequenz erforderlich und Abstriche
vertretbar seien, müsse anhand der Vorschriften in der Deichordnung geprüft werden.
Die Methodik der Herangehensweise gelte es mit den Anwohnerinnen und Anwohnern
zu besprechen. Die Ausführungen in der Bezugsdrucksache bezogen auf die städte-
baulichen Zeiträume, erklärten sie, würden sich darauf beziehen, dass die doch sehr
verbreitete Nutzung der Binnendeiche zwar nicht in ein, zwei oder drei Jahren, auch
nicht binnen einer Legislaturperiode beendet werden könne, sondern nur über einen
langen Prozess, um auch der Kulturlandschaft, zu der auch die Deiche zählen wür-
den, eine Chance zu geben, sich mit dem Klimawandel mitzuentwickeln und langfristig
dafür zu sorgen, dass auf der sogenannten zweiten Deichlinie ein besseres Schutzni-
veau als heute vorgehalten werden könne. Das entsprechende Konzept solle relativ
schnell erstellt und dann auch umgesetzt werden. Hierfür bedürfe es voraussichtlich
einer Anpassung der Deichordnung. Bis jedoch das letzte Haus, das die neu definier-
ten Anforderungen nicht erfülle, entfernt sei, werde es noch lange dauern, stellten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter fest. Im Rahmen der Beteiligung würden sie weder
in der Lage sein, den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern mitzuteilen, welcher Baum
gefällt, noch welches Haus abgerissen werden müsse. Wenn diese Aussagen zu die-
sem Zeitpunkt schon möglich wären, wäre das Konzept bereits fertig. Aber genau das,
betonten sie, sei nicht gewollt; vielmehr solle vor Konzeptfertigstellung mit den Betrof-
fenen gesprochen werden. Vom Ablauf her würden sie zunächst ein Zielbild definie-
ren, um Zustände in der Deichlinie, die aus Hochwasserschutzsicht nicht mehr tole-
rierbar seien, zu benennen, um daraufhin festzulegen, welche Maßnahmen geeignet
seien, um Abhilfe zu schaffen. Entlang der sogenannten zweiten Deichlinie, stellten
sie klar, werde grundsätzlich nicht enteignet; zudem sei dort ein proaktives Vorgehen
nicht vorgesehen. Die Stadt habe ein öffentlich-rechtliches Vorkaufsrecht und agiere
nur in den Fällen, in denen Betroffene ihr Haus oder Grundstück in der sogenannten
zweiten Deichlinie verkaufen wollen würden, beziehungsweise dann, wenn der Erbfall
eintrete. Jedoch, betonten sie, müsse sich niemand, der in einem Haus im Bereich der
zweiten Deichlinie wohne, sorgen, dass die Behörde das Haus enteigne. Sollten die
dortigen Bewohnerinnen und Bewohner die nächsten Jahre dort wohnen bleiben wol-
len, würde die Behörde nicht tätig werden. Erst wenn sich die Möglichkeit biete, das
Vorkaufsrecht auszuüben, würde sie aktiv, um in der Folge geeignete Maßnahmen zu
treffen, den Deich in einen besseren Zustand zu versetzen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE verwiesen zum Stichwort Vorkaufsrecht auf
den Fall „Fährstraße 115“ in Wilhelmsburg. Dort habe die Stadt von ihrem öffentlich-
rechtlichen Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Jedoch hätten die dort Wohnenden von
diesem Vorkaufsrecht keine Kenntnis gehabt und sich darauf, auch durch die Siche-
rung von Krediten, vorbereitet, das Haus für sich selber zu kaufen. Schließlich seien
die Bewohnerinnen und Bewohner der Fährstraße 115 von dem Ankaufsverfahren
ausgeschlossen worden und auf den Kosten sitzengeblieben, die unter anderem mit
der Kreditsicherung einhergegangen waren. Dass diese Betroffenen natürlich ganz
anders auf das Vorhaben der Behörde gucken würden, auch wenn noch nicht haus-
genau feststehe, was passiere, sei verständlich. Vor dem Hintergrund, dass einige
öffentlich-rechtliche Vorkaufsrechte der Stadt erst kürzlich beschlossen worden seien,
interessierte sie, was passiere, wenn Verträge über den Kauf/Verkauf bereits ausge-
handelt worden seien, bevor das Vorkaufsrecht beschlossen worden sei, und wollten
wissen, ob die Betroffenen in diesen Fällen entschädigt würden oder selber klären
müssten, wie sie aus eventuell bereits geschlossenen Vorverträgen wieder heraus-
kämen.
Der Fall „Fährstraße 115“ stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter klar, sei
deshalb anders gelagert, weil es sich um die erste Deichlinie handele, in der sie sehr
konsequent vorgehen würden und die Stadt nicht, wie in der zweiten Deichlinie,
abwarte, bis sich eine Gelegenheit zum Kauf biete. Vielmehr werde eine Vereinbarung
mit den Betroffenen geschlossen, die aus ihrer Sicht das Schutzniveau sicherstelle,
das es in der ersten Deichlinie brauche. In der Regel sehe das öffentlich-rechtliche
11Drucksache 22/6120 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode
Vorkaufsrecht vor, dass die Stadt in den Vertrag eintrete, sodass auch nicht nachvoll-
ziehbar sei, warum hierfür eine Entschädigung gezahlt werden sollte.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hakten nach, dass, wenn jemand in einen
Vertrag eintrete, kurz bevor dieser Unterschriftsreife habe, die Finanzierung bereits
geklärt sein müsse. Daher fragten sie sich, ob die Schuld, wie es in der Fährstraße
115 gelaufen sei, bei dem Verkäufer zu suchen sei, der die dort wohnenden Kaufinte-
ressierten offenbar nicht darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass es ein öffentlich-
rechtliches Vorkaufsrecht gebe.
Wie ausgeführt, wiederholten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden beim
Hochwasserschutz in der ersten Deichlinie grundsätzlich keine Abstriche gemacht.
Folglich würden sie dort, wo sie die Möglichkeit hätten, von ihrem Vorkaufsrecht
Gebrauch machen. Nach dem Kauf würden die auf dem Deichgrund oder Schutzstrei-
fen befindlichen Häuser, die dort gemäß Deichordnung nicht stehen dürften, abgeris-
sen. Trotz konsequentem Vorgehen in der ersten Deichlinie, würden sie dennoch prü-
fen, ob es Möglichkeiten gebe, die Härte für die Betroffenen abzumildern. Wenn bei-
spielsweise der Deich an einer Stelle ohnehin angefasst werden müsse und in diesem
Kontext fachlich vertretbare Alternativen bestünden, die sich auch finanziell im Rah-
men bewegen würden, könnten diese in Betracht gezogen werden. Grundsätzlich
gebe es zum Beispiel auch die Möglichkeit, ein technisches Bauwerk zum Hochwas-
serschutz statt eines Deiches zu errichten. Allerdings seien die Kosten dafür doppelt
so hoch wie die für die Errichtung eines Erddeichs. Überdies könnten technische
Bauwerke auch nicht so leicht in der Höhe angepasst werden wie ein Deich, sodass
dies in der Regel kein infrage kommender Kompromiss sei. Wenn es hingegen die
Möglichkeit gebe, die Trasse des Deiches sinnvoll umzulegen, sei dies, abhängig vom
Einzelfall, durchaus als Kompromiss denkbar. Härten, wie im Fall „Fährstraße 115“
beschrieben, sollten hingegen tunlichst vermieden werden. Daher seien sie bestrebt,
möglichst frühzeitig an die Informationen über derartige Vorkaufsmöglichkeiten heran-
zukommen, um das öffentlich-rechtliche Vorkaufsrecht frühzeitig ausüben zu können,
sodass es nicht zu derlei Situationen wie in der Fährstraße komme. Zwar, räumten sie
ein sei der Fall „Fährstraße 115“ suboptimal gelaufen, dennoch habe das Vorkaufs-
recht seine gesetzliche Ausgestaltung, an die sie sich halten würden. Billigkeitsent-
schädigungen für gefühlte Härtefälle hingegen würden nicht bewilligt. Entschädigun-
gen kämen nur dann zum Tragen, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben seien.
III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie empfiehlt der Bürgerschaft, von
der Drs. 22/4007 Kenntnis zu nehmen.
Andrea Nunn e , Berichterstattung
12Sie können auch lesen