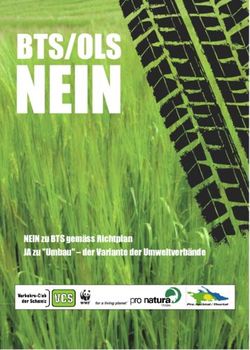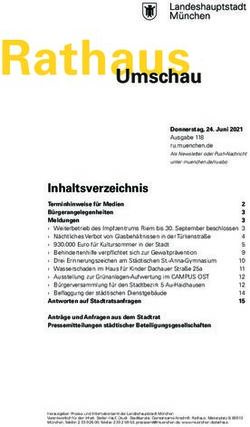Neubau Berufsfachschule Winterthur Projektwettbewerb Wettbewerbsprogramm - Kanton Zürich Baudirektion Hochbauamt 29. März 2019 - Kanton Zürich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kanton Zürich Baudirektion Hochbauamt Neubau Berufsfachschule Winterthur Projektwettbewerb Wettbewerbsprogramm 29. März 2019
2019 Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt Rhea Lesniak, Projektleiterin Fachstelle Planerwahl/Wettbewerb Anja Green, Projektleiterin Baubereich C Projektnummer Hochbauamt 12725 Berufsfachschule Winterthur, Neubau Tösstalstrasse 29/31, 8400 Winterthur, Projektwettbewerb 29. März 2019 Version 1.0
Hochbauamt
3/33
Neubau
Berufsfachschule Winterthur
Tösstalstrasse 29/31, 8400 Winterthur
Einstufiger Projektwettbewerb im offenen Verfahren
für Generalplanerleistungen
Wettbewerbsprogramm
Unterlage B1Hochbauamt
5/33
Inhalt
1. Einleitung 7
2. Verfahren 8
Allgemeine Bestimmungen 8
Preisgericht 8
Vorprüfung, Preissumme und Auftragserteilung 9
Publikation und Urheberrechte 10
Anforderungen 12
Beurteilungskriterien 16
3. Genehmigung 17
4. Wettbewerbsaufgabe und Zielsetzung 18
Ausgangslage 18
Städtebau 18
Denkmalpflege 19
Vorstudie Bauvorhaben 20
Zielsetzung 20
Projektperimeter 22
Raumprogramm 23
Betriebliche Anforderungen 24
Anforderungen an den Freiraum 24
Bauliche und gebäudetechnische Anforderungen 25
Energie und Ökologie 26
Wirtschaftliche Anforderungen 27
5. Rahmenbedingungen 28
Baurecht 28
Kantonaler Gestaltungsplan 28
Grundbuch 28
Verkehr 29
Parkierung 30
Geologie 30
Hochwasserschutz 31
Gesetze, Normen und Grundlagen 32Hochbauamt
7/33
1. Einleitung
Gegenstand des Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt (HBA), veranstaltet im
Projektwettbewerbs Auftrag des Immobilienamts (IMA) des Kantons einen einstufigen Projektwettbewerb im
offenen Verfahren für die Vergabe der Generalplanerleistungen für den Neubau Berufs-
fachschule Winterthur an der Tösstalstrasse 29/31 in Winterthur.
Mit dem Neubau soll das Raumangebot der Berufsfachschule betrieblich optimiert werden
und den stark anwachsenden Schülerzahlen entsprechen. Das Raumprogramm umfasst
im Wesentlichen die Unterrichtszimmer, eine Dreifachturnhalle und Räume für den Schü-
leraufenthalt und die Verwaltung. Die voraussichtlichen Kosten für das Bauvorhaben wer-
den auf Fr. 62 Mio geschätzt (BKP 1-9; ± 25 %, inkl. MWST).
Projektwettbewerb Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens ist ein Vorschlag für die Umsetzung der in den
Unterlagen detailliert umschriebenen Bauaufgabe zu erarbeiten. Neben der städtebauli-
chen, architektonischen und freiraumplanerischen Qualität des Entwurfes liegt das Au-
genmerk der Beurteilung auf den Aspekten der Funktionalität, der Wirtschaftlichkeit (Er-
stellung und Betrieb) sowie der Nachhaltigkeit.
Abb. 1: Luftbild Perimeter und Umgebung, Quartier Altstadt und Mattenbach, Winterthur
Quelle: GIS-Server2. Verfahren
Allgemeine Bestimmungen
Wettbewerbsverfahren Das Wettbewerbsverfahren untersteht dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Es wird als Planungswettbewerb im of-
fenen Verfahren gemäss Art. 12 Abs. 3 der interkantonalen Vereinbarung über das öffent-
liche Beschaffungswesen (IVöB) durchgeführt. Subsidiär gilt die SIA-Ordnung 142 für Ar-
chitektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009.
Das Verfahren ist anonym und wird in deutscher Sprache geführt. Die Ermittlung der Na-
men der Verfasserinnen und Verfasser, die Veröffentlichung des Berichts sowie die Aus-
stellung sämtlicher Wettbewerbsarbeiten erfolgen nach der Beurteilung durch das Preisge-
richt. Eine anonyme, separat entschädigte Bereinigung mehrerer Projekte in Konkurrenz
im Anschluss an das Wettbewerbsverfahren gemäss SIA 142, Art. 5.4, bleibt vorbehalten.
Teilnahmeberechtigung Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Generalplanerteams (Gesamtleitung Architek-
tur) mit Planerleistungen aus den Bereichen Baumanagement, Bauingenieurwesen, Land-
schaftsarchitektur und Gebäudetechnik (HLKKSE). Voraussetzung für alle Teams ist ein
Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des WTO-
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegen-
recht gewährt.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Preisge-
richts, einem Experten oder einem bei der Vorprüfung Mitwirkenden in einem beruflichen
Abhängigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit einem solchen na-
he verwandt sind. Nicht teilnahmeberechtigt sind die Verfassenden der Volumenstudie
Oester Pfenninger Architekten Zürich mit Rotzler Krebs Partner, Winterthur sowie das Ate-
lier WW, Zürich, welches für die erste Studie zuständig war. Ebenfalls dürfen aufgrund um-
fassenden Vorabklärungen das Büro SIMA I BREER Landschaftsarchitektur Winterthur
und das Büro SNZ Ingenieure und Planer Zürich nicht teilnehmen. Planer aus den Berei-
chen Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur und Gebäutetechnik, sowie Bauma-
nagement, sofern sie nicht Teil einer ARGE bilden, können an mehreren Wettbewerbsein-
gaben mitarbeiten, sofern alle beteiligten Generalplaner damit einvestanden sind.
Preisgericht
Fachpreisrichterinnen / Patrick Wetter, Abteilungsleiter, Hochbauamt, Baudirektion, Vorsitz
Fachpreisrichter Prof. Luca Selva, Architekt ETH SIA BSA
Corinna Menn, Architektin ETH SIA
Oliver Strässle, Leiter Beratung, Amt für Städtebau Winterthur
Sandro Balliana, Landschaftsarchitekt BSLA
Ersatzfachpreisrichter Daniel Penzis, Architekt SIA
Sachpreisrichterinnen / Sandra Mischke, Sektorleiterin Bauten, Generalsekretariat Bildungsdirektion
Sachpreisrichter Peter Störchli, Leiter Bauten, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Bildungsdirektion
Eva Debatin, Portfoliomanagerin, Immoblienamt, Baudirektion
Andreas Vonrufs, Abteilungsleiter FM, Immobilienamt, Baudirektion
Ersatzsachpreisrichter Paul Müller, Rektor Berufsfachschule WinterthurHochbauamt
9/33
Expertinnen / Myriam Bernauer, Projektleiterin Bauten, Mittelschul- und Berufsbildungsamt,
Experten Bildungsdirektion
Hans Seelhofer, Dr. Lüchinger+Meyer (Tragwerk)
Johannes Mörsch, Leiter Feuerpolizei, Stadt Winterthur (Brandschutz)
Herbert Elsener, Leiter Verkehrsplanung, Stadt Winterthur (Verkehr)
Daniela Nussle, Geschäftsbereichsleiterin Wasserbau, Holinger AG (Hochwasser)
Reto Wild, Suter von Känel Wild AG (Gestaltungsplan)
Katrin Pfäffli, Architektin ETH SIA, Architekturbüro K. Pfäffli (Nachhaltigkeit)
Peter Frischknecht PBK AG (Bauökonomie)
Roland Eichenberger, Ressortleiter, Hochbauamt, Baudirektion
Anja Green, Projektleiterin, Hochbauamt, Baudirektion
Rhea Lesniak, Projektleiterin Planerwahl/Wettbewerb, Hochbauamt, Baudirektion
Bei Bedarf können weitere Expertinnen/Experten zur Beurteilung zugezogen werden.
Vorprüfung, Preissumme und
Auftragserteilung
Vorprüfung Die Vorprüfung der Wettbewerbsprojekte erfolgt unter der Leitung des Hochbauamtes
durch das Büro Suter von Känel Wild AG, Zürich. Bei den Projekten der engeren Wahl er-
folgt eine Baukostenermittlung und eine Berechnung der Lebenszykluskosten durch die
PBK AG, Zürich, sowie eine Nachhaltigkeitsprüfung durch das Architekturbüro K. Pfäffli,
Zürich. Bei Bedarf werden weitere Experten für die Vorprüfung beigezogen.
Preise, Ankäufe und Ei- Zur Prämierung von mindestens fünf Entwürfen (Preise und Ankäufe) stehen dem Preisge-
gentumsregelungen richt insgesamt Fr. 260’000 (exkl. MWST) zur Verfügung. Die eingereichten Unterlagen der
prämierten und angekauften Wettbewerbsarbeiten gehen ins Eigentum der Auftraggeberin
über.
Weiterbearbeitung Die Veranstaltenden beabsichtigen, die mit dem Bauvorhaben verbundenen General-
planerleistungen den Verfassenden der erstrangierten Eingabe (1. Preis oder 1. Ankauf)
zu übertragen. Die Vergabestelle kann mögliche Folgeaufträge, welche sich direkt auf den
Grundauftrag beziehen, unter Anwendung §10 Abs. 1 lit. g der Submissionsverordnung
freihändig an die Wettbewerbsgewinner vergeben. Es besteht jedoch kein Anspruch auf
allfällige Folgeaufträge.
Das Hochbauamt behält sich vor, bei einer erneuten Beauftragung die Honorarparameter
neu zu verhandeln.
Auftragserteilung und Die Auftraggeberin beabsichtigt, das Verfasserteam als Generalplaner zu beauftragen. Mit
Planervertrag den beauftragten Planern wird ein Generalplanervertrag auf der Basis der «Vertragsur-
kunde für Generalplanerleistungen» des Hochbauamtes (Vgl. Unterlage E3) abgeschlos-
sen. Die in dieser Urkunde nicht veränderbaren Vertragsbestimmungen sind verbindlich.
Vom Hochbauamt vorgegeben werden die folgenden Honorarparameter
− Z-Werte:
Architekt: Z1 = 0.062 Z2 = 10.58
Bauingenieur: Z1 = 0.075 Z2 = 7.23
Landschaftsarchitekt: Z1 = 0.062 Z2 = 10.58
Gebäudetechnikplaner: Z1 = 0.066 Z2 = 11.28− Baukategorie: gemäss LHO 102 bis 108
LHO 102 Architektur: Baukategorie V (Schwierigkeitsgrad Berufsschulen) n = 1.1
LHO 103 Bauingenieurwesen n = 0.9
LHO 105 Landschaftsarchitektur Freiraumkategorie IV n = 1.0
LHO 108 Elektro-/Sanitäringenieur n= 0.9
LHO 108 HLKK- /Gebäudeautomationsingenieur n= 0.8
LHO 108 Fachkoordination n= 0.8
− Anpassungsfaktor: r = 1.0
− Stundenansatz h: der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Ansatz des
Hochbauamtes für Planeraufträge (z. Zt. Fr. 130.00 exkl. MWST)
− Stundenansatz für Arbeiten nach effektivem Zeitaufwand:
z. Zt. Fr. 145.00 exkl. MWST als Verhandlungsbasis
− Generalplanerzuschlag max. 5 % (Faktor s)
Die Faktoren i und s sind team- bzw. projektspezifisch und werden im Rahmen der Ausar-
beitung des Generalplanervertrages festgelegt.
Die Honorierung der Grundleistungen erfolgt nach den aufwandbestimmenden Baukosten
für das Gesamtprojekt; die Planungsphasen werden einzeln freigegeben. Die Grundleis-
tungen definieren sich nach der Ordnung SIA 102/2014, 103/2014, 105/2014, 108/2014
und den «Präzisierungen zu den Grundleistungen» (gemäss Vertragsurkunde). Von der
Bauherrschaft bewilligte Zusatzleistungen werden nach dem effektiven Zeitaufwand vergü-
tet. Das Honorar kann gegebenenfalls nach Genehmigung des Objektkredites pauschali-
siert werden.
Beauftragung Beabsichtigter Leistungsanteil: 100 % (gemäss SIA LHO 102). Der Auftraggeber behält
sich vor, das Bauvorhaben mit Einzelleistungsträgern oder in Zusammenarbeit mit einem
Generalunternehmer auszuführen; entsprechend würde sich der Leistungsanteil reduzie-
ren (minimaler Leistungsanteil 58.5 % gemäss SIA LHO 102). Der Generalplaner bleibt
aber direkter Vertragspartner des Hochbauamtes.
Teambildung Der Generalplaner (Architektur/Bamanagement) ergänzt sein Planungsteam mit den not-
wendigen Fachplanern als Subplaner (Wettbewerbsunterlage D1). Als Fachplaner zu be-
nennen sind: Bauingenieur, Landschaftsarchitekt, HLKK-Ingenieur, Sanitäringenieur,
Elektroingenieur sowie bei Bedarf Brandschutzplaner, Fachkoordination, MSRL (GA), und
Bauphysiker. Weitere Fachplaner können team- und/oder projektspezifisch beigezogen
werden. Wird das Baumanagement durch ein beigezogenes Büro geleistet, so ist dieses
ebenfalls zu benennen. Die Zusammensetzung des Teams sowie der Zeitpunkt des Bei-
zugs von Fachplanern liegen in der Verantwortung des Generalplaners. Das Hochbauamt
behält sich jedoch vor, Auftragnehmenden ohne genügende Erfahrung auf deren Kosten in
den von ihnen zu erbringenden Teilleistungen versierte Fachleute beizustellen.
Unterbrüche Aus finanziellen, technischen, rechtlichen oder politischen Gründen können nach jeder
Projektphase Unterbrüche oder Verzögerungen auftreten. Dies berechtigt die Anbietenden
nicht zu finanziellen Nachforderungen.
Publikation und Urheberrechte
Publikation und Die Publikation des Wettbewerbsergebnisses erfolgt nach Abschluss der Jurierung auf
Ausstellung www.simap.ch. Über das Wettbewerbsverfahren wird ein Bericht erstellt, der allen Teil-
nehmenden zugestellt und zudem den einschlägigen Fachzeitschriften zur Publikation zurHochbauamt
11/33
Verfügung gestellt wird. Die Wettbewerbsentwürfe werden nach dem Entscheid des Preis-
gerichtes unter Namensnennung der Verfassenden während mindestens zehn Tagen öf-
fentlich ausgestellt.
Rechtsschutz und Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 15 IVöB sowie § 2 des
Urheberrecht Beitrittsgesetzes zur IVöB. Das Urheberrecht an den Wettbewerbsarbeiten verbleibt bei
den Verfassenden. Nach Abschluss des Planervertrags mit dem Wettbewerbsgewinner
kommt die dort vorgesehene Urheberrechtsregelung zum Tragen. (Unterlage E3).
Termine Wettbewerb 26. April 2019 Ausschreibung
24. Mai 2019 Ablauf Anmeldefrist
13. Juni 2019, Geführte Begehung des Wettbewerbareals, Treffpunkt
10.30 -11.30 Uhr Platz vor Schulhaus Blumental Tösstalstrasse 20,
8400 Winterthur
13. Juni 2019 Bezug der Modelle beim Modellbauer
08.00 - 17.00 Uhr Abholadresse:
Keller Modellbau, Schützenstrasse 17, 8400 Winterthur
Modellausgabe nur gegen Modellgutschein (Wettbewerbs-
unterlage F)
bis 18. Juni 2019 Schriftliche Fragenstellung
ab 8. Juli 2019 Verfügbarkeit der Fragenbeantwortung:
https://hochbauamt.zh.ch/
Ausschreibungen Planungsaufträge – aktuelle Ausschrei-
bungen
11. September 2019, Eingabe der Wettbewerbsarbeiten (Pläne)
16.00 Uhr
25. September 2019 Ort und genauer Zeitpunkt der Modellabgabe wird mit der
Fragenbeantwortung bekanntgegeben
Oktober/November 2019 Beurteilung der Projekte durch das Preisgericht
Dezember 2019 Veröffentlichung des Berichts und Ausstellung der Wettbe-
werbsarbeitenTermine Projektierung Gemäss heutigem Kenntnisstand ist die Umsetzung in den Jahren 2022 bis 2024 geplant.
2019 2020 2021 2022 2023 2024
l ll lll lV l ll lll lV l ll lll lV l ll lll lV l ll lll lV l ll lll lV
Projektw ettbew erb
Projektierungskredit
Vorprojekt KS
Bauprojekt KV
Baubew illigung
Objektkredit
Ausschreibungsplanung
Realisierung
Inbetriebnahme
Anforderungen
Anmeldung, Bezug der Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt mit dem Anmeldeformular (Wettbewerbsunterlage A)
Wettbewerbsunterlagen per Email an Frau Selcan Kalender (Selcan.Kalender@bd.zh.ch). Aus administrativen
Gründen müssen die Anmeldungen bis am Freitag, 24. Mai 2019 im Hochbauamt ein-
treffen. Dem Anmeldeformular ist ein Nachweis (Kopie Bank- oder Postbeleg) der Einzah-
lung eines Depots von Fr. 300.- an die Baudirektion Kanton Zürich beizulegen. Bankver-
bindung und Postcheckkonto sind auf dem Anmeldeformular ersichtlich. Eine Rückzahlung
des Depots erfolgt bei fristgerechter Abgabe eines vollständigen, zur Beurteilung zugelas-
senen Projektes und kann erst nach Abschluss des Verfahrens erfolgen. Ab dem Datum
der Ausschreibung sind, mit Ausnahme des Gutscheins für die Modellgrundlage, sämtliche
untenstehend aufgeführten Unterlagen auf der Website des Hochbauamtes
(http://www.hochbauamt.zh.ch, Ausschreibungen & Planungsaufträge) verfügbar. Der Ver-
sand des Gutscheins für die Modellunterlage (Wettbewerbsunterlage F) erfolgt nach dem
Eingang der vollständigen Anmeldung mit Zahlungsnachweis. Das Modell kann gegen
Vorweisen des Modellgutscheins am Donnerstag 13. Juni 2019 abgeholt wer-
den. Ein Versand der Modelle findet nicht statt.
Wettbewerbsunterlagen A Anmeldeformular zur Teilnahme am Wettbewerb PDF
B Programm, Projektierungsunterlagen
B1 Wettbewerbsprogramm PDF
B2 Raumprogramm PDF
B3 Betriebskonzept PDF
C Planunterlagen
C1 Situationsplan DWG/PDF
C2 Katasterplan Areal, Perimeterplan DWG/PDF
C3 Werkleitungskataster DWG/PDF
C4 Orthofoto PDF
C5 Kantonaler Gestaltungsplan BFSW Situationsplan M 1:500 PDF
D Formulare
D1 Angaben zum Unternehmen DOCX
D2 Mengentabelle XLSX
(= zwei Unterlagen in einem Excel)Hochbauamt
13/33
D3 Tabelle Raumprogramm XLSX
E Weitere Dokumente zur Information
E1 Geologisch – geotechnischer Bericht PDF
E2 Kantonaler Gestaltungsplan BFSW, Bestimmungen PDF
E3 Vertragsurkunde für Planerleistungen (HBA) PDF
E4 Auszug Betriebs- und Gestaltungskonzept Tösstalstrasse PDF
E5 Leitfaden Gebäudeschutz Hochwasser (AWEL; 2017) PDF
E6 Leitbild Promenadenring PDF
E7 Alleenkonzept Stadt Winterthur PDF
E8 Betrachtungsperimeter: Umliegende Schulbauten EG und Fassaden PDF
F Gutschein für den Bezug der Modellunterlage
Begehung Für die Teilnehmenden findet am Donnerstag, 13. Juni 2019 um 10.30 Uhr eine ge-
führte Begehung des Areals statt (Treffpunkt: Platz vor Schulhaus Blumental Tösstalstras-
se 20, 8004 Winterthur). Es werden keine Einladungen versandt. Ausserhalb dieses Ter-
mins ist das Areal frei zugänglich. Die bestehenden Bauten des Areals sind ausserhalb
dieses Termins nicht zugänglich.
Fragenstellung Fragen zum Wettbewerbsverfahren können schriftlich und anonym bis spätestens Diens-
tag, 18. Juni 2019 um 12.00 Uhr an die Kanzlei des Hochbauamtes geschickt wer-
den. Die Wettbewerbsteilnehmenden müssen um die Wahrung der Anonymität besorgt
sein. Willentliche Verstösse gegen das Anonymitätsgebot können zum Ausschluss führen.
Die mit dem Vermerk «Projektwettbewerb Neubau Berufsfachschule Winterthur» versehe-
nen neutralen Couverts müssen bis zu diesem Datum beim Hochbauamt Kanton Zürich
(Postadresse: Hochbauamt Kanton Zürich, Projektdienste, Stampfenbachstrasse 110,
Postfach, 8090 Zürich) eintreffen. Die Fragen sind mit Kapitel und Seitennummer, auf wel-
che sich die Frage bezieht, zu kennzeichnen.
Fragenbeantwortung Die auslobende Stelle beantwortet die Fragen und stellt diese allen Teilnehmenden zur
Verfügung. Die Fragenbeantwortung ist ab 8. Juli 2019 auf der Homepage des Kanto-
nalen Hochbauamts (www.hochbauamt.zh.ch) als Download verfügbar.
Wettbewerbseingabe Die Wettbewerbseingaben (ohne Modell) sind ohne Namensnennung in geeigne-
ter Verpackung und mit dem Vermerk «Projektwettbewerb Neubau Berufsfachschule Win-
terthur» bis Mittwoch, 11. September 2019, 16.00 Uhr, in der Kanzlei des Hoch-
bauamtes Kanton Zürich, Stampfenbachstrasse 110, Zürich (Schalter Erdgeschoss) abzu-
geben (Abgabezeiten: 07.30 – 12.00 h und 13.30 – 16.00 h). Per Post versandte Unterla-
gen (Postadresse: Hochbauamt Kanton Zürich, Projektdienste, Stampfenbachstrasse 110,
Postfach, 8090 Zürich) müssen bis zu diesem Datum an der Eingabeadresse eintreffen,
das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Sämtliche Bestandteile der Wettbe-
werbseingabe sind mit einem Kennwort zu versehen. Die Eingabe von mehreren Lö-
sungsmöglichkeiten ist nicht zulässig. Das Modell ist bis Mittwoch, 25. September
2019, mit dem Vermerk «Projektwettbewerb Neubau Berufsfachschule Winterthur» einzu-
reichen; Ort und der genaue Zeitpunkt der Modellabgabe werden mit der Fragenbeantwor-
tung bekanntgegeben.
Einzureichende Die vollständige Eingabe hat folgende Unterlagen zu umfassen und ist gemäss untenste-
Unterlagen henden Angaben zu gestalten:Pläne Auf maximal 4 Blättern im Format A0 quer (84 x 120 cm) sind folgende Angaben zum Pro-
jekt darzustellen:
− Situationsplan mit Dachaufsicht inklusive Dachaufbauten des Projekts (genordet)
M 1:500 mit sämtlichen Bauten auf dem Wettbewerbsareal und der umliegenden
Bauten. Darzustellen sind auch die Freiräume sowie die Erschliessung (Zufahrten,
Parkierungsflächen, Gebäudezugänge). Die zur Beurteilung nötigen Höhenkoten
sind einzutragen.
− Erdgeschossplan M 1:200 mit Angaben zur Freiraumgestaltung (Beläge, Pflanzun-
gen, Ausstattung, Buswartehaus, Funktion der Aufenthaltsorte, Wege, Plätze etc.).
− Sämtliche weitere Grundrisse und Fassaden sowie die für das Verständnis des Pro-
jekts notwendigen Schnitte im M 1:200. In den Grundrissen sind die wichtigsten
Höhenkoten einzutragen. Alle Räume sind in gut lesbarer Schriftgrösse mit den im
Raumprogramm angegebenen Raumnummern, Raumbezeichnungen und den ef-
fektiven Raumflächen zu beschriften. Legenden sind nicht zulässig. In den Schnit-
ten und Ansichten sind das gewachsene sowie das neu gestaltete Terrain in m. ü.
M. einzutragen.
− Konstruktiver Schnitt mit Teilansicht im M 1:50 durch die Gebäudehülle. Die Schnitt-
linie sollte so verlaufen, dass die grösste Aussagekraft über die Detaillösung mög-
lich ist. Der Schnitt ist vom Fundament bis und mit Dachkonstruktion, die Teilansicht
vom Terrain bis zum Dachrand darzustellen. Im Schnitt anzugeben sind ein Kon-
struktionsbeschrieb mit Angaben zu Materialien, Schichtstärken und Wärmeschutz.
− Erläuterungen mit den aus Sicht der Projektverfassenden zum Verständnis der Ein-
gabe erforderlichen Angaben. Nebst Aussagen zum städtebaulichen und architek-
tonischen Konzept sowie zu Tragsystem, Schachtkonzept, Konstruktion, Materiali-
sierung und Fundation werden Angaben zu betrieblichen Aspekten, insbesondere
zu der Erschliessung erwartet. Das Freiraumkonzept mit der Einbindung in die be-
stehende Umgebung soll präzise veranschaulicht werden. Die Erläuterungen sind in
der Plandarstellung zu integrieren.
− Schematische Darstellungen der Erschliessung (Fussverkehr, Veloverkehr, sowie
ÖV) und Eingliederung in das bestehende Wegnetz sowie der Raumbeziehung des
Neubaus und seiner Aussenräume zu der Umgebung.
− Konzeptionelle Darstellungen (Skizzen) zu Kraftfluss, Lastabtragung.
− Die horizontalen und vertikalen Haupterschliessungszonen Haustechnik, auch Lüf-
tungen, sind in den Abgabeplänen nachzuweisen.
− Sämtliche Dachaufbauten sind in den Dachaufsichten, Fassaden und Schnitten so-
wie im Modell darzustellen.
− Für Photovoltaikanlagen geeignete, zusammenhängende und gut besonnte Flä-
chen sind in den Plänen zu kennzeichnen und mit Flächenangaben zu versehen.Hochbauamt
15/33
Formulare D2 und D3 Flächen und Volumen nach SIA 416 (Mengentabelle, Formular D2)
Mit Angaben der Flächen und Volumen des Wettbewerbprojekts nach SIA 416 inklusive
nachvollziehbaren Schemaplänen zu den Berechnungen.
Kennzahlen Nachhaltigkeit (Mengentabelle, Formular D2)
Mit Angaben der erforderlichen Kennzahlen inklusive nachvollziehbaren Schemaplänen zu
den Berechnungen.
Tabelle Raumprogramm (Formular D3)
Mit Angabe der effektiven Flächen der Räume des Wettbewerbprojekts.
Art der Darstellung Für die Abgabe des Projektwettbewerbs ist das Format A0 verbindlich. Pro Eingabe ste-
hen jeweils zwei Stellwände von 120 cm Breite und 180 cm Höhe zur Verfügung. Die Plä-
ne dürfen nicht auf Platten aufgezogen werden. Die Pläne sind mit einem Kennwort zu
versehen. Die Teilnehmenden sind gebeten, eine gut lesbare, möglichst platzsparende
Darstellung zu wählen. Die Grundrisse sind nach dem Situationsplan zu orientieren und zu
beschriften (Norden oben). Der Massstab ist mittels Massstabsleiste auf den Plänen anzu-
geben. Die Pläne sind wie folgt einzureichen:
− ein Plansatz für die Beurteilung durch das Preisgericht, ungefaltet, auf weissem
Papier von mindestens 120 g/m².
− zwei Plansätze für die Vorprüfung, gefaltet, auf Normalpapier (80 g/m²).
− der komplette Plansatz als PDF-Datei auf einem anonymisierten digitalen Datenträ-
ger (USB Stick) für den Schlussbericht. Abgegebene Pläne als PDF in Original-
grösse A0 und verkleinert A3 (gut reproduzierbar).
Die Eingabe der Formulare D2 und D3 (= zwei Arbeitsblätter in einem Excel):
− auf demselben anonymisierten Datenträger als PDF- Datei und als Excel zur Ver-
wendung für die rechnerische Kontrolle bei der Vorprüfung.
− auf Papier, einseitig bedruckt (dreifach).
Der Datenträger ist in einem separaten, neutralen und verschlossenen Briefumschlag mit
Kennwortbezeichnung abzugeben.
Modell Modell im Massstab 1:500 auf der abgegebenen Modellunterlage. Das Modell ist kubisch
und in weiss zu halten. Der Modelleinsatz ist zu fixieren.
Verfassercouvert mit Das Formular D1 «Angaben zum Unternehmen» ist in einem verschlossenen, neutralen
Formular D1 Couvert, versehen mit dem Kennwort und der Bezeichnung «Angaben zum Unterneh-
men», abzugeben. Das Formular ist rechtsgültig zu unterzeichnen. Ein Einzahlungsschein
(Teilnehmende aus den Ausland: Angabe der Bankverbindung) für die Rückerstattung des
Depots und die Überweisung eines allfälligen Preisgeldes ist beizulegen.Beurteilungskriterien
Beurteilung der Eingabe Das Preisgericht beurteilt die eingegangenen Lösungsvorschläge nach den nachfolgend
aufgeführten Kriterien.
− Städtebau, Architektur
Städtebauliche Setzung / räumliches Zusammenspiel mit der Umgebung / Adress-
bildung / Architektonisches Konzept / Fassadengestaltung und Materialisierung /
Tragwerkskonzept / Aussenraumgestaltung im Kontext des Umfelds / Einpassung
der Erschliessung in die Umgebungsflächen
− Funktionalität
Optimaler Schul- und Sportbetrieb / optimale betriebliche Abläufe und Bewirtschaf-
tung / Nutzungsanordnung / Erschliessung / Betriebliche Flexibilität und Nutzungs-
flexibilität / Funktionale Nutzbarkeit der Innen- und Aussenräume / Qualität des ge-
bäudetechnischen Konzepts
− Wirtschaftlichkeit
Investitionskosten / geringe Betriebs-, Unterhalts- und Instandsetzungskosten /
ökonomischer Umgang mit Ressourcen
− Energie, Ökologie
Graue Energie / Betriebsenergie / Nachhaltigkeit der Konstruktion und Materialien
in Erstellung und Betrieb
Die Reihenfolge entspricht keiner strikten Gewichtung. Das Preisgericht nimmt aufgrund
der aufgeführten Beurteilungskriterien eine Gesamtwertung vor.Hochbauamt
17/33
3. Genehmigung
Mit der Teilnahme am Wettbewerb anerkennen die Projektverfassenden die in diesem
Programm festgehaltenen Wettbewerbsbedingungen, die Fragenbeantwortung und die
Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen.
Das vorliegende Wettbewerbsprogramm wurde von der Baudirektion Kanton Zürich als
Veranstalterin, vertreten durch das Hochbauamt, in Rücksprache mit allen Mitgliedern des
Preisgerichtes genehmigt.
Fachpreisrichter
Patrick Wetter Luca Selva Corinna Menn
Oliver Strässle Sandro Balliana Daniel Penzis (Ersatz)
Sachpreisrichter
Peter Störchli Sandra Mischke Eva Debatin
Andreas Vonrufs Paul Müller (Ersatz)
Zürich, den 29. März 20194. Wettbewerbsaufgabe und Zielsetzung
Ausgangslage
Schulprofil Die Berufsfachschule Winterthur ist eine kantonale Berufsfachschule für die Fachrichtun-
gen Detailhandel, Dentalassistenz und ein Kompetenzzentrum für Soziale Berufe (Fach-
richtung Betagtenbetreuung, Behindertenbetreuung und Kinderbetreuung). Menschen mit
unterschiedlichsten Voraussetzungen treffen an dieser Schule zu zielgerichtetem Lehren
und Lernen zusammen.
Regionalstrategie Seit 2005 musste der Schulraum der BFS Winterthur laufend erweitert werden, was auf-
Winterthur und grund der zeitlichen Dringlichkeit stets mittels Mietgeschäften sichergestellt werden muss-
Umgebung te. Mittlerweile ist der Schulraum auf diverse Standorte in der Stadt Winterthur verteilt.
Durch die dabei entstandene räumliche Distanz zwischen den verschiedenen Schulräu-
men ist die Möglichkeit, die entsprechenden Flächen gemeinschaftlich zu nutzen, nicht
bzw. nur eingeschränkt vorhanden. Der sich daraus ergebende betriebliche, organisatori-
sche und finanzielle Aufwand ist hoch. Zudem fehlt es an Turnhallen, um das Obligatorium
für den regelmässigen Sportunterricht an Berufsfachschulen gemäss dem Sportförde-
rungsgesetz und der Sportförderungsverordnung des Bundes zu erfüllen. Hinzu kommt,
dass die Bevölkerungs- und Schülerzahlen im Kanton Zürich in den kommenden Jahr-
zehnten weiterhin stark wachsen werden.
Mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 1098/2017 werden der Schulraumbedarf und die
entsprechende Umsetzung im Rahmen der Regionalstrategie «Winterthur und Umge-
bung» festgelegt. Ein Neubau an der Tösstalstrasse 27/29/31, gegenüber den bestehen-
den Bauten der BFSW (Mühletal, Wiesental) und angrenzend an die Wirtschaftsschule
Kaufmännischer Verband Winterthur (WSKVW), mit rund 40 Unterrichtszimmern, einem
ergänzende Gastronomieangebot, einer Dreifachturnhalle sowie Räumen für den Schüler-
aufenthalt und die Verwaltung, soll die Abdeckung des prognostizierten Schulraumbedarfs,
eine Konzentration auf den Perimeter im Bereich des Stammschulhauses Mühletal und die
Aufhebung von dezentralen Mietflächen ermöglichen. Die Mensa, wie auch die Räumlich-
keiten der Schulleitung, mit Ausnahme einer Abteilung, verbleiben in den bestehenden
Gebäuden. Das Konzept der Verteilung der allgemeinen Räume auf das Stammschulhaus
Mühletal und den Neubau soll im Aussenraum durch eine Stärkung der Bezüge zwischen
den Gebäuden und dem entsprechenden Freiraumkonzept erkennbar sein.
Entwicklungsstrategie Die Entwicklungsstrategie wurde durch den Regierungsrat mit dem Kauf der dazu benötig-
ten Landflächen gemäss RRB Nr. 936/2011 und Nr.173/2016 bereits eingeleitet und der
kantonale Gestaltungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Um-
setzung des Neubaus an der Tösstalstrasse.
Städtebau
Das Gebiet südöstlich des Altstadtkerns von Winterthur zeigt ein Aufeinandertreffen ver-
schiedener Stadtstrukturen. Neben dem gartenstädtisch geprägten Parkquartier nördlich
der St. Gallerstrasse, dem «Promenadenring» (Unterlage E6) mit angelagerten Parkanla-
gen (Grüngürtel um Altstadt), dem Adlergarten-Park und der Gartensequenz mit der Villa
Flora entlang dem Stadtfallenweg und der Mühlestrasse sind Einschlüsse dichter Stadt-
schollen mit gewerblichen Betrieben sowie eine Vielzahl öffentlicher Bauten prägend. Die
verschiedenen Teilidentitäten werden durch die Kontinuität des grosskronigen Baumbe-
standes verbunden. Die Tösstalstrasse ist eine historische Hauptverkehrsachse und soll
gemäss dem städtischen Gesamtverkehrskonzept 2011 und dem Alleenkonzept entwickelt
werden. Die bestehenden Schulbauten der Sekundarstufe II bilden derzeit den strassen-Hochbauamt
19/33
übergreifenden Campus mit funktionalen und räumlichen Bezügen. Die städtebauliche
Ambivalenz ist bei der Neubebauung der Parzelle des neuen Schulhauses angemessen
zu berücksichtigen.
Im Süden der Tösstalstrasse steht das Gewerbeschulhaus der Architekten Kellermüller
und Hofmann von 1949. Das Gebäude, im Eigentum des Kantons, ist ein kommunales
Schutzobjekt und im Rahmen der Eigenbindung des Kantons langfristig zu erhalten. Die
nördliche Grenze bildet der historisch bedeutende «Äussere Rettenbachweg» als baum-
bestandener Wegkorridor zwischen dem Promenadenring und dem Adlergarten-Park. Die-
ser ist durch örtliche Aufweitungen des begleitenden Grünraums in der Tiefe und durch
Bepflanzung zu stärken. Unterirdische Bauten sind zu Gunsten von Baumpflanzungen zu
minimieren.
Abb. 2: Übersichtskarte Winterthur, Quartiere Altstadt und Mattenbach, ohne Massstab, genordet
Quelle: GIS-Server
Denkmalpflege
Im Baubewilligungsverfahren ist gemäss § 127 Abs. 1 PBG auf Schutzobjekte Rücksicht
zu nehmen. Der Perimeter des kantonalen Gestaltungsplans Berufsfachschule Winterthur
wurde hinsichtlich seiner möglichen Auswirkungen auf Schutzobjekte der Archäologie und
der Denkmalpflege geprüft.
Dabei wurde festgestellt, dass der Gestaltungsplanperimeter ausserhalb der archäologi-
schen Zonen liegt. Trotzdem ist mit dem heute noch bestehenden Sodbrunnen, der 2015
seitens Kantonsarchäologie dokumentiert wurde, eine FundsteIle vorhanden (Gärt-
nerstrasse 21). Der Sodbrunnen kann jedoch beim Neubau abgebrochen werden. Die
Kantonsarchäologie wird den Abbruch bzw. den Aushub begleiten. Die notwendigen Hin-
weise und Auflagen werden stufengerecht im weiteren Verfahren erfolgen.Im Weiteren wurde festgestellt, dass sich im Nahbereich, insbesondere entlang der
Tösstalstrasse, diverse überkommunale Schutzobjekte befinden. Auf diese ist gebührend
Rücksicht zu nehmen.
Das Gebäude Tösstalstrasse 24 (Baujahr 1948, Architekt Kellermüller&Hofmann) ist ein
kommunales Inventarobjekt.
Das Areal ist im ISOS lediglich als Umgebungsschutzzone bezeichnet. Im Rahmen der
städtebaulichen Studie wurde nachgewiesen, dass mit dem geplanten Neubau der Schutz
der Altstadt und des Promenadenringes nicht beeinträchtigt wird. Das Erhaltungsziel B
(ISOS) wird mit der angemessenen Überbauung erfüllt.
Alle Bauten innerhalb des Wettbewerbsperimeters werden abgerissen, keines der Gebäu-
de steht unter Schutz oder ist inventarisiert.
Vorstudie Bauvorhaben
Machbarkeitsstudie In den Jahren 2016/2017 prüfte das Büro Oester Pfenninger Architekten, Zürich, gemein-
sam mit Matthias Krebs, Rotzler Krebs Partner, Winterthur, in einer Machbarkeitsstudie
das konkrete Potential zur Umsetzung der Nutzerwünsche unter spezieller Berücksichti-
gung des Städtebaus, des Verkehrs, des Freiraums und der baurechtlichen Situation. Da-
vor wurde bereits das Atelier WW zu ersten Vorstudien zu Raumprogramm und Volumen
beauftragt.
Der Kanton Zürich gab nach Abschluss der Studien einen kantonalen Gestaltungsplan für
den Neubauperimeter in Auftrag. Mit diesem werden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Umsetzung des Neubaus an der Tösstalstrasse geschaffen. Der Kantonale
Gestaltungsplan wurde unter Mitwirkung des Büros Suter von Känel Wild AG erstellt.
Die für die Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe relevanten Angaben und Erkenntnisse
aus diesen Studien sind in die Formulierung des vorliegenden Wettbewerbsprogramms
(Wettbewerbsunterlage B1) und des Raumprogramms (Wettbewerbsunterlage B2) einge-
flossen. Auf eine Abgabe der Machbarkeitsstudien an die Teilnehmenden wird bewusst
verzichtet.
Zielsetzung
Städtebau und Gesucht wird ein gesellschaftlich vorbildliches Projekt, das eine hohe architektonische
Architektur Qualität mit sorgfältig gewählter Materialisierung aufweist und angemessen auf die umlie-
gende Stadt- und Quartierstruktur reagiert.
Aussenräume Wichtig ist die Schaffung von hochwertigen Aussenraumflächen für den Aufenthalt vor,
während und nach dem Schulunterricht innerhalb des Bebauungsperimeters, damit die
umliegenden öffentlichen Freiflächen entlastet werden. Die Bedürfnisse der jungen Ler-
nenden (Ort für Begegnung sowie Rückzug, etc.) soll berücksichtigt werden.
Erdgeschoss Durch eine hohe Transparenz der Erdgeschossbereiche soll der Bezug vom Gebäudein-
neren zum Aussenraum hergestellt und das Schulleben von innen nach aussen sichtbar
werden. Bevorzugte Erdgeschossnutzungen sind Räume mit öffentlichem Charakter (z.B.
Verpflegungszone, Aufenthaltszonen für Lernende etc.). Die Lage der Eingangszonen ist
so zu wählen, dass sie günstig zu den Strömen der Lernenden angeordnet sind und die
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel (Busstationen Tösstalstrasse und St. Gal-Hochbauamt
21/33
lerstrasse) gewährleisten. Der Hauptzugang zum Schulhaus sollte an der Tösstalstrasse
liegen, ein weiterer Eingang an der nordwestlichen Ecke.
Begegnungs- und Die Erschliessungszone ist ein wichtiger Begegnungsraum und soll nach Möglichkeit na-
Lernzonen türlich belichtet werden, damit sie von Lernenden, unter entsprechender Berücksichtigung
der feuerpolizeilichen Auflagen, nach Möglichkeit auch als Arbeits- und Aufenthaltsraum
genutzt werden können.
Schulraum Der Schulraum soll flexibel auf Veränderungen im Betrieb reagieren können und spätere
Anpassungen an veränderte Organisationsstrukturen und Raumnutzungen zulassen. Aus
diesem Grund sind eine möglichst hohe Anzahl gleichartiger Zimmer (typähnliche Grös-
sen, Rasterstruktur) zu konzipieren, welche verschiedenartig genutzt werden können. Die
detaillierten Anforderungen sind im Raumprogramm und im Betriebskonzept abgebildet.
Betrieb Der Neubau der Berufsfachschule soll in allen Teilen die funktionalen Anforderungen eines
zeitgemässen Schulbetriebs erfüllen. Schulbauten dienen in erster Linie dem schulischen
Auftrag; die Sportflächen können in zweiter Linie der weiteren Öffentlichkeit (z.B. Sport-
vereinen) zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend ist die Gebäudekonzeption (Sport-
bereich) hinsichtlich Erschliessung und Schliesskonzept auf einen unabhängigen Betrieb
auszurichten.
Allgemein Zusätzlich zu diesen spezifischen Vorgaben sind die folgenden, allgemeinen Planungs-
grundsätze zu berücksichtigen:
− Ein besonderes Augenmerk gilt der Raumorganisation, einer zeitgemässen, hohen
architektonischen Qualität, Funktionalität und Nutzungsflexibilität.
− Auf die Bedürfnisse der Berufsfachschule ausgerichtete Lehr- und Lernumgebung.
− Gute natürliche Belichtung und Raumakustik.
− Ökologische Nachhaltigkeit sowie sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsbe-
dingungen.
− Barrierefreiheit im ganzen Gebäude und in den umgebenden Aussenräumen
− Die Steigzonenkonzeption soll eine einfache Erschliessung der Geschosse ermög-
lichen und eine gute Zugänglichkeit für Wartung und Erneuerungen zulassen.
− Zielgrösse Gesamtvolumen Gebäude 32’000 m3 (max. 35'000 m3).
− Auf die Wirtschaftlichkeit der Projekte, im Sinne niedriger Erstellungskosten sowie
eines kostengünstigen Betriebs und Unterhalts ist zu achten. Der Kostenrahmen für
den Neubau der Berufsschule liegt bei 62 Mio. Franken (BKP 1-9; ± 25 %, inkl.
MWST). Die durchschnittliche Zielgrösse für die Erstellungskosten der Fassade
wird mit 950 Fr./m2 definiert.
− Niedrige Betriebs- Unterhalts- und Instandsetzungskosten/ökonomischer Umgang
mit Ressourcen.Projektperimeter
Neubau
Wiesental KV
Winterthur
WSKVW
Mühletal
Abb. 3 Projektperimeter ohne Massstab, genordet
Perimeter Neubau BFSW – rote Markierungslinie
Perimeter Bestand BFSW – blaue Markierungslinie
Betrachtungsperimeter Wettbewerb – grün schraffierte Fläche
Für den im Rahmen des Projektwettbewerbs zu planenden Bau steht der auf dem Katas-
terplan (Unterlage C2) eingetragene Perimeter zur Verfügung.
Projektperimeter Der Projektperimeter für den geplanten Neubau an der Tösstalstrasse 27/29/31, Gärt-
nerstrasse 19/20 umfasst die Parzellen Kat. Nr. ST101, ST102, ST1794 und ST9330 mit
einer Fläche von rund 3180 m2. Sämtliche Bauten innerhalb des Perimeters werden abge-
rissen. Der Neubau soll das bestehende Raumprogramm mit rund 40 Unterrichtszimmern,
einer Dreifachturnhalle sowie Räume für den Lernenden-Aufenthalt und die Verwaltung
erweitern.
Betrachtungsperimeter Auf den Grundstücken gegenüber befindet sich das Stammareal der BFS mit ihren Berufs-
fachschulgebäuden Wiesental und Mühletal, welche nicht Bestandteil dieses Wettbe-
werbsverfahrens sind. Zukünftig aber bilden sie zusammen mit dem Neubau und dem Ge-
bäude der WSKVW ein strassenübergreifendes Ensemble und sind Teil der Gesamtanlage
Schule BFS Winterthur.Hochbauamt
23/33
Das Bestandsgebäude Wiesental von den Architekten Kellermüller und Hofmann von 1949
ist ein kommunales Inventarobjekt. In den bestehenden Gebäuden befinden sich heute 54
Unterrichtszimmer, eine Mediothek, zwei Turnhallen, eine Mensa und Räume für die Ver-
waltung, die so erhalten bleiben sollen.
Raumprogramm
Das detaillierte Raumprogramm befindet sich in den Wettbewerbsunterlagen (Vgl. Kap.
2.5., Absatz Wettbewerbsunterlagen B2). Zusammenfassend sind in nachfolgender Tabel-
le die geforderten Nutzflächen und Funktionsflächen (NF und FF nach SIA 416) abgebil-
det. Die zu realisierenden Nutz- und Funktionsflächen betragen rund 8’500 m².
Nr. Bereich Fläche in m²
1 Unterrichtsräume 3‘528 m²
2 Vorbereitung 516 m²
3 Allgemeine Räume 636 m²
4 Schulleitung / Verwaltung / Lehrper- 312 m²
sonenaufenthalt
5 Hausdienst 813 m²
6 IT 198 m²
7 Sport 2058 m²
8 Haustechnik 400 m²
Total Nutz- und Funktionsflächen 8461 m²
Flexibilität / Die neuen Räumlichkeiten sollen möglichst nutzungsflexibel konzipiert werden. Damit soll
Grundrissgestaltung ein grösstmöglicher Spielraum für künftige organisatorische Anpassungen und Nutzungs-
änderungen ermöglicht werden. Aus diesen Gründen sind grössere Nutzflächen möglichst
auf das Schulzimmerraster abzustimmen bzw. nach Möglichkeiten auf mehrere Räume zu
verteilen, welche auch als Schulzimmer (um-)genutzt werden könnten.
Raumgrössen im
Klassenzimmerraster
1 = KlassenzimmerUnterrichtskonzept Die Lernenden wechseln die Unterrichtsräume je nach Fach. Für Gruppen- und selbstän-
diges Arbeiten stehen freie Unterrichtsräume, Gruppenräume, Arbeitsplätze in den Er-
schliessungs- (Lerninseln) oder Verpflegungszonen zur Verfügung. Diese können auch in
Zwischenstunden genutzt werden.
Gastronomiekonzept Der bisherige Standort für die Verpflegung wird im Bereich der heutigen Mensa im Schul-
haus Mühletal beibehalten. Das Gastronomiekonzept im Neubau, welches sich von der
Hauptmensa im Schulhaus Mühletal abhebt, ergänzt das bestehende Verpflegungsange-
bot. Die im Raumprogramm definierten Flächen lassen keine eigene Produktionsküche zu.
Deshalb sollen im Gastrobereich des Neubaus hauptsächlich ein Zusatzangebot zum
klassischen Menuplan der Hauptmensa bereitgestellt werden. Der Essbereich ist so zu
konzipieren, dass er bei Bedarf durch die Fläche des Mehrzweck- und Plenarsaales erwei-
tert werden kann und einen direkten Bezug zum Aussenraum aufweist.
Zusätzlich dazu soll eine Verpflegungszone mit Teeküche und Möglichkeiten für das Auf-
wärmen von Speisen sowie Getränke- und Snackautomaten eingerichtet werden, da zahl-
reiche Lernende und Lehrkräfte die Verpflegung von zu Hause mitnehmen.
Sportkonzept Im Neubau sollen eine Dreifachturnhalle (nicht für Wettkampfbetrieb), ein Gymnastikraum
und ein Raum für Krafttraining realisiert werden. Für eine optimale Organisation des
Sportunterrichts ist die betriebliche Trennung zwischen Sport- und Schulinfrastruktur vor-
zusehen. Die Belegung wird so optimiert, dass ein möglichst grosser Teil des obligatori-
schen Sportunterrichts in Sporthallen stattfindet. Ergänzend kann der Sportunterricht im
Gymnastik- und Kraftraum oder im Freien durchgeführt werden. In Randzeiten und an Wo-
chenenden können die Sportinfrastrukturen für ausserschulischen Sport (bspw. Vereine,
etc.) genutzt werden. Die Empfehlungen gemäss Normen des Bundesamtes für Sport
BASPO, sind zwingend einzuhalten.
Betriebliche Anforderungen
Das detaillierte Betriebskonzept befindet sich in den Wettbewerbsunterlagen (Vgl. Kap.
2.5., Absatz Wettbewerbsunterlagen B3).
Belegungsprognose An der BFSW werden aktuell (Schuljahr 2018/2019) 3919 Lernende von 186 Lehrperso-
nen unterrichtet. Das Verhältnis von weiblichen und männlichen Lernenden beträgt 90 zu
10. Bei den Lehrpersonen beträgt das Verhältnis 80 zu 20.
Künftig ist wochentags in den Schulbauten der BFSW von einem täglichen Aufkommen
von etwa 100 Lehrpersonen, 33 weiteren Mitarbeitenden und 1100 Lernenden verteilt auf
57 Klassen auszugehen (40 % im Neubau). Der Unterricht findet Montag bis Freitag von
8.00 bis 17.00 Uhr statt. Die Dreifachturnhalle im Neubau soll durch private Vereine von
18.00 bis 22.30 Uhr genutzt werden können; das gleiche gilt für weitere Räumlichkeiten
des Neubaus jeweils abends und samstags von 18.00 bis 21.30 Uhr.
Langfristig wird sich die Zahl der Lernenden auf etwa 4000 Lernende einpendeln, ergänzt
von 200 Lehrpersonen und 40 weiteren Mitarbeitenden.
Anforderungen an den Freiraum
Qualität und Grösse der Aussenanlagen sind für das Schulklima von grosser Wichtigkeit.
Die Pausenflächen werden hauptsächlich vormittags, über Mittag und nachmittags be-
nutzt. Die Aussenanlagen sind so zu gestalten, dass diese für temporäre gestalterische
Projektarbeiten im Rahmen des Unterrichts im Aussenraum, aber auch ausserhalb der Un-
terrichtszeiten für die Öffentlichkeit zugänglich und benutzbar sind. Nach Möglichkeit istHochbauamt
25/33
eine schattenspendende Bepflanzung in Form vom grosskronigen Bäumen vorzusehen.
Versteckte Nischen und dunkle, nicht einsehbare Ecken sind zu vermeiden. Eine Aussen-
beleuchtung erleichtert in den Wintermonaten die Orientierung. Der Problematik von Über-
nutzung und Vandalismus durch schulfremde Personen muss situativ Rechnung getragen
werden. Hauptzugänge und Parkplätze sind zu beleuchten.
Der Freiraum, bestehend aus den Teilbereichen des Strassenraums gegen die
Tösstalstrasse bzw. Gärtnerstrasse und dem Korridor «Äusserer Rettenbachweg», ist mit
Rücksicht auf die jeweilige Situation so zu gestalten, dass eine besonders gute Aufent-
halts- und Ankommensqualität erreicht wird.
Der Vorplatz zum Neubau ist als Strassenraum zur Tösstalstrasse als Teil des geplanten
ÖV-Hochleistungskorridors und des Alleenkonzepts zu gestalten. Die geplante Bushalte-
stelle ist in die Gestaltung des Vorplatzbereiches miteinzubeziehen.
Der Äusserer Rettenbachweg weist grosses Potenzial auf als Verbindungsweg für den
Langsamverkehr zwischen der Altstadt und dem neuen Schulhaus. Durch die Anbindung
des Weges an die angrenzenden Aussenräume entsteht eine wichtige Achse im Frei-
raumnetz. Diese gilt es durch entsprechende Freiraum-Konzepte zu stärken.
Veloabstellplätze Sämtliche Veloabstellplätze sollen gut auffindbar und leicht zugänglich platziert werden.
Zweckmässige Sicherungsmöglichkeit gegen Diebstahl sind einzuplanen.
Rollstuhlgängigkeit Schulbauten sind als öffentliche Bauten behindertengerecht zu gestalten (Norm SIA 500).
Dies gilt auch für die Hauptzugänge im Aussenbereich. Die Rollstuhlgängigkeit der Anlage
erleichtert zudem die Anlieferung von Material sowie die Pflege der Anlage mittels Maschi-
nen (Schneepflug, Rasenmäher usw.). Ein oberirdischer rollstuhlgerechter Parkplatz ist
gemäss den Bestimmungen des kantonalen Gestaltungsplanes auf der Parzelle anzuord-
nen.
Raucher- und Das Gebäude ist grundsätzlich rauchfrei zur halten. Raucherzonen sind im Aussenbereich
Nichtraucherzone witterungsgeschützt so anzuordnen, dass die Raucher/innen nicht vor den Eingängen und
Fluchtwegen und möglichst nicht entlang von Fassaden stehen.
Bauliche und gebäudetechnische Anforde-
rungen
Statik Die Dachflächen sind für eine Belastung durch Photovoltaikanlagen für die Warmwasser-
aufbereitung zu dimensionieren. Technisch bedingte Aufbauten sind auf ein Minimum zu
beschränken. Sie sind als visuelle Einheit zu gestalten.
Erdbebensicherheit Für die erdbebengerechte Projektierung gemäss SIA-Norm 261 (Einwirkungen auf Trag-
werke) gelten folgende Präzisierungen:
− Untergrund Baugrundklasse C
− Bauwerkklasse BWK II
− Erdbebenzone Z1
Holzbau Bezugnehmend auf die Artikel 34a und 34b zur Holzbauförderung im Bundesgesetz über
den Wald (Waldgesetz, WaG) sind ausdrücklich auch Holzbauten möglich.
Lichte Höhe Angaben zu den lichten Raumhöhen, wie im Raumprogramm vermerkt, müssen zwingend
eingehalten werden.Gebäudetechnik Die Grundlage für die gebäudetechnische Infrastruktur bildet der «Standard Nachhaltigkeit
Grundlagen Hochbau», die technischen Richtlinien zu Gebäudetechnik und die gültigen Gesetze, Nor-
men und Richtlinien.Technische Richtlinien zur Gebäudetechnik sind dieser Grundlage zu
entnehmen:
http://www.hochbauamt.zh.ch/internet/baudirektion/hba/de/projektplanung/gebaeudetechni
k/techn_richtlinien.html .
Raumbedarf und Die technischen Räume sind so zu dimensionieren und anzuordnen, dass die Anlagen und
Erschliessung Systeme für den Einbau, die Wartung und den Ersatz gut positioniert sind. Die benötigten
Funktionsflächen sind im Raumprogramm ausgewiesen und projektspezifisch einzuplanen.
Ein Schachtkonzept, welches horizontale und vertikale Verteilung der Gebäudetechnik-
medien und insbesondere der Lüftung aufzeigt, ist zu erstellen.
Schallschutz / Gem. Art. 3 Abs. 1 BZO gilt unabhängig von der Zonenzuweisung für Schulareale die ES
Lärmschutz II. Die Grundstücke sind überbaut und erschlossen und es gelten die Immissionsgrenzwer-
te (IGW). Der Projektperimeter befindet sich im Einflussbereich Tösstalstrasse, St. Gal-
lerstrasse, Technikumstrasse und der General-Guisan-Strasse. Gemäss Grobbeurteilung
durch das Ingenieurbüro Andreas Suter beträgt der massgebende IGW 60 dB(A). Dieser
wird an der direkt zur Tösstalstrasse zugewandten Fassade und teilweise auch an den
Seitenfassaden überschritten. Für jedes Fenster in diesem Bereich ist eine Ausnahmebe-
willigung erforderlich. Da eine kontrollierte Lüftung als Massnahme zur Einhaltung der
Grenzwerte zulässig ist, können Schulzimmer aber grundsätzlich an allen Fassaden ohne
Einschränkungen angeordnet werden.
Energie und Ökologie
Nachhaltigkeit Es gilt der «Standard Nachhaltigkeit im Hochbau»:
im Hochbau https://bd.zh.ch/internet/baudirektion/hba/de/ueber_uns/nachhaltigkeit_im_hochbau.html
Ressourcen- und Die Neubauten sollen ressourcen- und klimaschonend erstellt und betrieben werden. Zent-
Klimaschonung ral dafür sind flächeneffiziente Konzeptionen, kompakte Gebäudevolumen mit einer tiefen
Gebäudehüllzahl, ein angemessener Fensteranteil an den Fassaden und ein hoher
Dämmstandard. Bei der Materialisierung ist auf die Verwendung beständiger, funktions-
tüchtiger und dabei möglichst ressourcenschonender Konstruktionen zu achten. Wert ge-
legt wird auf eine Systemtrennung, welche die unterschiedlichen Lebensdauern von Bau-
teilen beachtet. Vorgeprüft wird sowohl die Graue Energie für die Erstellung der Bauten
(Primärenergie und Treibhausgasemissionen) als auch die Betriebsenergie (Wärme und
Kälte).
Folgende Punkte sind zu beachten:
- effizientes Verhältnis zwischen Hauptnutzflächen und Geschossflächen
- tiefe Kompaktheitszahl und tiefe Gebäudehüllzahl
- ressourcenschonende Materialisierung
- tiefer Heizwärmebedarf dank gut gedämmter Gebäudehülle (Standard Minergie-P)
- bauliche Konzeption für einen tiefen Kühlbedarf
- angemessener Fensteranteil/gute Tageslichtnutzung
- funktionstüchtiger sommerlicher Wärmeschutz
- Systemtrennung (Primär-, Sekundär- und Tertiärkonstruktion)
- zugängliche Medienführung/Schachtkonzept
- hoher Anteil erneuerbarer Energie/EigenproduktionHochbauamt
27/33
Die Verwendung schadstoffarmer Baustoffe für ein gesundes Innenraumklima wird in der
weiteren Bearbeitung phasengerecht eingefordert (siehe http://www.eco-bau.ch).
Dämmstandard Neubauten müssen gemäss Standart Minergie-P-eco, als Voraussetzung für die erforderli-
che Zertifizierung, projektiert werden.
Wärmeversorgung Als Quelle für die thermische Energie sind nicht fossile Brennstoffe vorgesehen. Aktuell
sind die Liegenschaften Blumental, Wiesental, Mühletal ans Winterthurer Fernwärme-Netz
angeschlossen. Der Neubau soll die Fernwärme ebenfalls als Energieträger für die Wär-
meenergie und für allfällig notwendige Kälteenergie (Ab- oder Adsorbtions-Systeme) ein-
gesetzt werden.
Photovoltaik In der Projektierung ist Photovoltaik als Energieträger zu prüfen. Entsprechend sind für
Photovoltaikanlagen geeignete, gut besonnenen Flächen projektspezifisch in den Plänen
zu kennzeichnen und mit Flächenangaben zu versehen.
Dachbegrünung Die Flachdächer sind extensiv mit einheimischem, regionaltypischem Saatgut zu begrü-
nen, soweit sie nicht als begehbare Terrasse oder für den Bau von Anlagen zur Nutzung
der Sonnenenergie genutzt werden.
Sommerlicher Der sommerliche Wärmeschutz soll prioritär durch die Gebäudestruktur und Gebäudekon-
Wärmeschutz zeption gewährleistet werden. Die Gebäudetechnik hilft mit, den sommerlichen Wärme-
schutz zu gewährleisten.
Wirtschaftliche Anforderungen
Der Wirtschaftlichkeit der Bauten in Erstellung und Betrieb ist zentrale Bedeutung beizu-
messen. Die erwähnten Kostenvorgaben (Vgl. Kap. 4.5) sind einzuhalten und die Zielvor-
gaben anzustreben. Optimierte Lebenszykluskosten sind wesentlich. Im Rahmen der ver-
tieften Vorprüfung und der Jurierung werden die Projekte von einem unabhängigen Kos-
tenplaner auf ihre Wirtschaftlichkeit, andererseits auf Betriebs- und Unterhaltskosten über-
prüft.
Positiv auf die Wirtschaftlichkeit wirken sich einfache und kompakte Volumen mit einem
hohen Anteil an Nutzfläche zur Geschossfläche sowie optimierten Verhältnis von Gebäu-
devolumen zu Geschossfläche aus. Ein sinnvolles statisches Konzept sowie gebündelte
und durchgehende Haustechnikerschliessungen sind zu bevorzugen. Einfache erprobte
Materialisierungen und Detaillösungen minimieren die Kostenrisiken.5. Rahmenbedingungen
Baurecht
Die Vorgaben für die baurechtlichen Rahmenbedingungen gelten für den Neubau gemäss
den Bestimmungen im Kantonalen Gestaltungsplan. Soweit im Gestaltungsplan nichts An-
deres festgelegt ist, gilt das übergeordnete kantonale und eidgenössische Recht. Es
kommt das Planungs- und Baugesetzes in der Fassung bis zum 28. Februar 2017 zur An-
wendung.
Kantonaler Gestaltungsplan
Der kantonale Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:500 (Unterlage C5) und
den Bestimmungen (Unterlage E2). Alle Bestimmungen daraus sind verbindlich.
Bau- und Nutzungsvor- - Die bestehenden Gebäude dürfen abgebrochen werden.
schriften (Auszug KGP) - Sämtliche Gebäude müssen unter Einhaltung der Verkehrsbaulinie innerhalb des
im Plan bezeichneten Baubereichs erstellt werden.
- Die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 25 m und die Geschosszahl ist frei.
- Die Gebäude können ohne Rücksicht auf baurechtliche Abstands-, Höhen- und
Längenbestimmungen angeordnet werden. Vorbehalten bleiben feuerpolizeiliche
Vorschriften sowie wohn- und arbeitshygienisch einwandfreie Verhältnisse.
- Abgrabungen dürfen nicht mehr als 1.5 m betragen. Ausgenommen sind Gebäu-
dezugänge/- zufahrten oder solche, die die Nutzbarkeit der Gebäude und des Frei-
raums erhöhen. Weitergehende Abweichungen, gestützt auf das Ergebnis des
Konkurrenzverfahrens, sind zulässig. Es ist ein harmonischer Terrainverlauf zu
gewährleisten.
- Die maximal zulässige Baumasse beträgt 35’000 m3.
- Technische Aufbauten auf dem Dach wie Kamine, Abluftrohre, Oblichter, Liftauf-
bauten, Lüftungsaufbauten und weitere technisch bedingte Aufbauten sind auf ein
Minimum zu beschränken. Sie sind als visuelle Einheit zu gestalten. Anlagen zur
Gewinnung von erneuerbaren Energien haben dem kantonalen Standard zu ent-
sprechen.
- Besondere Gebäude gemäss § 273 PBG sind nur innerhalb des Baubereichs zu-
lässig.
- Infrastrukturbauten wie Lüftungsbauwerke, Energie- und Versorgungskanäle, Ent-
fluchtungsausgänge, Tiefgarageneinfahrten, Einbringschächte, Pausenunterstand,
Containerabstellung, Zweiradparkierungsanlagen etc. sind punktuell zulässig, so-
fern sie gestalterisch sorgfältig in den Freiraum eingebunden werden.
- Unterirdische Bauten sind ausserhalb des Baubereichs zulässig. Sie sind auf die
Freiraumgestaltung abzustimmen. Innerhalb der Strassenbaulinie sind unterirdi-
sche Bauten nicht zulässig.
- Als gewachsener Boden gilt die Höhenkote 444.75 m. ü. M.
Grundbuch
Der geplante Neubau an der Tösstalstrasse 27/29/31 und Gärtnerstrasse 19/21 umfasst
die Parzellen Kat.-Nrn. ST101, ST102, ST1794 und ST9330 mit einer Fläche von insge-
samt rund 3’180 m2.
Wegrecht Die Gärtnerstrasse ist eine Privatstrasse (Fusswegrecht zu Gunsten der Stadt Winterthur)
und ist im Miteigentum aller Anstösser, wobei die Miteigentumsanteile ausgeschieden
sind. Der Äussere Rettenbachweg ist im Eigentum der Stadt Winterthur.Sie können auch lesen