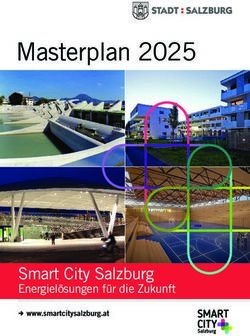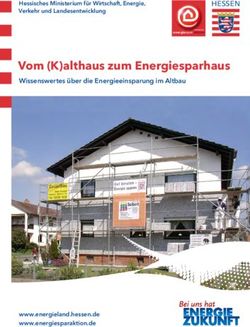DAUER-HAFTIGKEIT KIRCHLICHER BAUTEN - ee concept
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
IMPRESSUM HERAUSGEBER: Kirchbauförderverein der Propstei Leipzig in Zusammenarbeit mit der katholischen Propsteipfarrei St. Trinitatis Nonnenmühlgasse 2, 04107 Leipzig KONZEPT UND REDAKTION: Thomas Gohr, Christian Wischalla (Schulz und Schulz) Martin Zeumer (ee concept) REDAKTIONELLE MITARBEIT: Gregor Giele, Michael Sagurna GESTALTUNG & GRAFIKEN: ee concept GmbH Spreestraße 3, 64295 Darmstadt DRUCK: dieUmweltDruckerei GmbH Hans-Böckler-Straße 52, 30851 Langenhagen FOTOS: F. Eveleens, Rotterdam Michael Moser, Leipzig Stefan Müller, Berlin (inkl. Umschlagsfoto) Peter Andres Lichtplanung, Hamburg Schulz und Schulz, Leipzig twenty4pictures, Leipzig André Wirsig, Dresden Martin Zeumer, Darmstadt 1/2016 ISBN: 978-3-00-052390-8 Gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
INHALT
KIRCHLICHE BAUPROJEKTE 4
Dauerhaftigkeit und Alterungsfähigkeit 5
Aktuelle Entwicklungen 7
DAS BEISPIEL PROPSTEIKIRCHE ST. TRINITATIS IN LEIPZIG 9
STRATEGIEN FÜR DIE BEARBEITUNG DAUERHAFTER PROJEKTE 13
Baukörper vor Technik 14
Beispiel Kirchenraum 15
Handlungsspielräume für zukünftige Entwicklung schaffen 17
Beispiel Gemeindezentrum 18
Strategie der Vermeidung und Beständigkeit 19
Beispiel Fassade mit Porphyrverkleidung 21
Beispiel Erdwärmenutzung 23
Alterung, Wartung und Instandhaltung vordenken 24
Offene Schnittstellen in der Technik 26
ARBEITSPAKETE FÜR EINE DAUERHAFTE, NACHHALTIGE
UMSETZUNG 27
Projektvorbereitung 27
Vorentwurf 27
Entwurf 28
Werkplanung 29
Ausschreibung & Realisierung 31
Nutzung 32
ANHANG & GLOSSAR 33
Quellenverzeichnis 33
Glossar 34
3KIRCHLICHE BAUPROJEKTE
Kirchenbauten stehen in einer Jahrhunderte alten Bautradition, die Mit dem sehr langen Lebenszyklus verlieren die Kosten für die
als geweihter Ort auf die Versammlung der Glaubensgemeinschaft, Erstinvestition gegenüber den Unterhaltskosten an Gewicht. Die
der gemeinsamen Andacht und der Spendung und dem Empfang Lebenszyklusorientierung verschiebt dabei schon in der Planung
von Sakramenten ausgerichtet ist. Diese übergeordnete gesell- bei der Grundlagenermittlung, der Gebäudenutzung und dem Ent-
schaftliche Nutzung spiegelt sich an herausgestellten städtebauli- wurf den Fokus. Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung oder gar
chen Positionen von Kirchen die noch heute ganze Stadtansichten Umnutzung mit einzelnen Gebäudeteilen und/oder Anlagen ge-
prägen und in symbolträchtigen architektonischen Räumen. Die winnen an Bedeutung, denn hier entstehen über die gesamte Le-
Zeichenhaftigkeit und der spirituelle Rahmen des Glaubens steht bensdauer die größten Aufwendungen und die größten Ausgaben.
dabei im Vordergrund. Neben der Licht und Raumstimmung, der Für kirchliche Bauten entscheidet sich dabei zwischen den beiden
Raumgröße und -konstruktion, der Materialität und der künst- Polen der dauerhaften Nutzbarkeit und der Alterung ihre Zukunfts-
lerischen Ausgestaltung ist es auch die Dauerhaftigkeit, denen fähigkeit, damit in Zukunft keine Sanierungsfälle entstehen.
Kirchenbauten eine besondere gesellschaftliche Position verdanken
- Kirchen sind zugleich erlebbare Orte der Geschichte. Wie ein Fels Zugleich steigt aktuell die Komplexität der Bauaufgabe Kirche. Wie
scheinen Sie die Zeit zu überdauern. Aus der Bautradition resultiert in allen Bereichen des Bauens haben sich auch die Komfortan-
damit auch eine langfristig Wirkung auf das städtische, räumliche forderungen an den sakralen Raum deutlich erhöht. Exemplarisch
und kulturelle Umfeld. Auch bei Kirchenneubauten sind die Grund- seinen Heizung und Lüftung benannt, bei denen Ansprüche und
lagen für einen solchen übergeordneten Wirkhorizont selbstgenüg- Herausforderungen unter dem gebotenen Ziel eines schonenden
same, gestalterische und konstruktive Qualitäten, die die Bauten Umgangs mit der Schöpfung mittlerweile stärker als früher thema-
aus der breiten Maße des Baugeschehens herausheben. tisiert wird. Sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz gewinnen
an Bedeutung und der Spagat zwischen langfristiger Unterhalts-
Anders als bei öffentlichen oder gewerblichen Bauherrn ist mit und Versorgungssicherheit, effizienter Technik, ökologischer Unbe-
dem Bau einer Kirche kein gewinnorientierter Nutzungszweck denklichkeit, Zukunftsfähigkeit und Spiritualität beginnt.
verbunden, den es innerhalb eines vorab definierten Zeithorizonts
einzulösen gilt. Die Gewinnmaximierung eines Kirchenraums liegt Die modellhaften Erfahrungen aus dem von der Deutschen Bun-
damit nicht auf einer möglichst hohen Rendite in kürzester Zeit desstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt für den Neubau der
sondern vielmehr auf einer möglichst unbegrenzten Nutzungs- Katholischen Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig sind in dieser
dauer des Gebäudes für die Gemeinde bei gleichzeitig geringen Broschüre gesammelt. Sie sind zu Themengruppen gebündelt, um
Wartungs- und Unterhaltskosten für das Objekt [Propstei 14]. Diese Strategien für nachfolgende Projekte abzuleiten. Sicher stellt die
Vorstellung ist per se eng mit der Vorstellung von nachhaltigem Sammlung der Aspekte kein abschließendes Ergebnis dar. Sie kann
Bauen verbunden. aber für andere Projekte als Handreichung dienen.
Der Neubau der katholischen Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig, Quelle: © Stefan Müller
4Material
- Ökobilanzierung
- Nachhaltige
Ressourcenverwendung
Energie Wasser
- Minimierung des Energiebedarfs - Minimierung der
- Nutzung erneuerbarer Energien Trinkwasserbedarfs und
- Monitoring Wasseraufkommens
Leitgedanke =
Langlebigkeit
des Gebäudes
Komfort + Gesundheit Versorgungssicherheit
- Schadstoffreduktion - Funktionalität im Krisenfall
- Universal Design
Instandhaltungsfähigkeit
- Dauerhaftigkeit
- Austauschbarkeit
- Anpassungsfähigkeit
Darstellung der Themenschwerpunkte am der Propsteikirche St. Trinitatis mit den jeweiligen Zielstellungen,
Quelle: [Propstei 14]
Dauerhaftigkeit und Alterungsfähigkeit
Wir verstehen Gebäude in der Regel grundsätzlich als dauerhaft heute teilweise schon nach 10 bis 20 Jahren. Basis der Anlagestra-
– es bestehen aber auch zwischen einzelnen Gebäuden deutliche tegie sind niedrige Investitionskosten für einfache Standards, die
Unterschiede, die jedoch erst über die Zeit schrittweise offen- langfristige Wertschöpfung zumindest in Frage stellen.
sichtlich werden. Denn der Lebenszyklus eines Gebäudes wird
bestimmt durch die Dauerhaftigkeit und Alterungsfähigkeit der Grundfesten für langlebiges Bauen werden durch stadträumliche,
Baustoffe und der eingesetzten Systeme in Bezug auf die jeweilige architektonische, materielle und bautechnische Qualitäten definiert,
Nutzung. Ergänzend tragen Wartung und Instandhaltung zum Wer- die im Dienst gesellschaftlicher und räumlicher Wertschöpfung
terhalt bei und dienen der Verlängerung des Lebenszyklus. Um ein stehen. Die Produktion von Dauerhaftigkeit beginnt also bereits
möglichst störungsfreies Zusammenwirken von Nutzung, Konstruk- bei der Grundlagenermittlung. Sie entscheidet bereits über die
tion und Material zu erreichen, sollten negative Wechselwirkungen nachfolgenden Standards für Raum, Materialität und Erweiterungs-
(z.B. Verschleiß, konstruktive Spannungen, Setzungen) hinreichend fähigkeit, die wiederum emotionalen Wert, Nutzungsflexibilität und
untersucht und schädliche äußere Einflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Instandhaltungsfähigkeit hervorbringen können.
Frost, UV-Strahlung, Tausalz, Luftverschmutzung) konstruktiv
vermieden werden. Die höheren Investitionskosten für zusätzli- Ein weiteres wichtiges Indiz für die Dauerhaftigkeit eines Gebäu-
che Maßnahmen (u.a. Materialwechsel, größere Materialstärken, des ist die bauliche Gestaltung. Der Wettbewerb der Ideen und
konstruktive Erweiterungen) sind in der Betrachtung der gesamten die Bewertung durch eine fachkundige Jury sind seit Jahrzehnten
Lebenszykluskosten den Folgekosten für intensivere Wartungs- und in Deutschland ein probates Mittel, um für die bevorstehende
Instandhaltungsmaßnahmen gegenüberzustellen. Bauaufgabe eine „dauerhaft schöne“ Lösung zu erhalten. Mit Blick
auf Langlebigkeit und Wertstabilität sind „klassische“ Lösungen im
Beständigkeit und Haltbarkeit sind Grundeigenschaften des Bauens, Dienst der europäischen Stadt gegenüber kurzlebigen Trends (z.B.
da ein Haus – jedenfalls in Mitteleuropa – historisch immer der Blob-Architektur) die bessere Wahl und erzielen langfristige Ak-
langfristigen Daseinsvorsorge diente. Erst das neuzeitliche durch zeptanz. Eine breite Zustimmung wird zudem durch die Beteiligung
Rendite und Spekulation getriebene Baugeschehen wird durch der Öffentlichkeit erreicht. Wird diese frühzeitig und detailliert, wie
deutlich kürzere Zeitspannen geprägt. Neubauten amortisieren sich beim Neubau der Propsteikirche, über das Vorhaben informiert,
5Bauteilwert [%]
Wertgewinn durch Instandsetzung
100
Bewohnbarkeitsschwelle inkl.
Steigerung der Komfortansprüche
Bewohnbarkeitsschwelle
50
Alterung ohne Alterung mit Alterung mit
Instandhaltung Instandhaltung Instandsetzung
statische Sicherheit
0
Zeit [t]
Reduktion der Verlängerung der
Lebensdauer Lebensdauer
Lebensdauer des Bauteils
Darstellung der Themenschwerpunkte am Projekt St. Trinitatis mit den grundlegenden Zielstellungen, Quelle: [Bahr, Lennerts 10]
lassen sich mögliche Vorbehalte ausräumen. In der intensiven Aus- punktthemen aufzuteilen. Idealer Weise werden die resultieren-
einandersetzung findet auch die wichtige Aneignung des Projekts den Themen dann in der interdisziplinären Zusammenarbeit aller
statt. Beim Neubau von St. Trinitatis wurde in ersten Schritten die Beteiligen bearbeitet. Wichtig dabei ist, dass die Schwerpunkte
Gemeinde und darüber hinaus auch die breite Öffentlichkeit konti- eine gewisse Bedeutung innerhalb des Projekts behalten (z.B.
nuierlich über den aktuellen Stand des Projekts informiert (Dialog Dauerhaftigkeit der Fassadenkonstruktion) und in der planerischen
mit der Verwaltung und den Ratsfraktionen, Auswahl des Bau- Ausarbeitung vielfältige Lösungen in Abhängigkeit zu weiteren
grundstücks, Aufstellung des Raumprogramms). Dabei wurde von Aspekten (z.B. Beschriftung des Bauwerks) zulassen. Zugleich wird
Anfang an regelmäßig und viel kommuniziert (Pressekonferenz, damit auch die Chance erhöht, besondere Qualitäten des Bauwerks
Baustellen-Webcam, VIP-Besuche, Pressemitteilungen, Ausstellung herauszuarbeiten, die auf Basis eines gemeinschaftlich abgestimm-
zum Wettbewerb, Baustellenführungen, öffentliche Beteiligung an ten Grundgerüstes entstehen und die divergierenden fachlichen,
allen Teilschritten des Baus etc.). monetären und terminlichen Ziele aller Beteiligten berücksichtigen.
Bereits in der Planung kann die Alterungsfähigkeit von Gebäuden Der kontinuierlichen Beteiligung des Bauherrn kommt dabei eine
gedanklich vorweggenommen und damit vorausgeplant werden. zentrale Rolle zu. Er sollte als Geldgeber und späterer Nutzer ein
Da sie auf eine Verlängerung des Lebenszyklus zielt, ist sie zent- grundlegendes eigenes Verständnis für die relevanten Frage-
raler Bestandteil einer umfassenden Auseinandersetzung. Wichtig stellungen und mögliche Lösungen entwickeln und diese dann
ist die integrale Betrachtung der Alterungsfähigkeit, denn allein ein über den Planungsprozess hinaus in der Bau- und Nutzungsphase
schöner Raum von hohem emotionalem Wert sichert noch nicht mittragen. Das ist von grundlegender Bedeutung, um über die
dessen Beständigkeit. Erst wenn auch seine Konstruktion, Funk- theoretischen Annahmen hinaus eine reale Verlängerung der
tionalität, Materialität und technische Ausstattung eine Alterung, Nutzungs- und Lebensdauer eines Gebäudes zu erreichen. Spiegeln
Instandhaltung und Erweiterung erlauben, kann das Bauwerk einer die Planungen also nicht die Gewohnheiten bzw. Ansprüche des
dauerhaften Nutzung zugeführt werden. Denn anders als z.B. bei Nutzers, dann verhindern beispielsweise fehlende Wertschätzung,
einem guten Schuh, für dessen langfristigen Erhalt allgemein an- unsachgemäße Umnutzung oder mangelnde Instandhaltung die
erkannt regelmäßige Pflege und kleinere Reparaturen notwendig gewünschte dauerhafte Beständigkeit.
sind, sehen die Nutzer von Gebäuden in der Regel die Dauerhaf-
tigkeit als konstitutiv an. Ausgehend von der christlichen Verantwortung für die Bewahrung
der Schöpfung wurden beim Neubau der Katholischen Propsteikir-
Zur Steigerung der Dauerhaftigkeit ist es hilfreich, die Komplexität che St. Trinitatis unter dem Leitgedanken der Langlebigkeit insge-
von Gebäuden für Planung und Benutzung in einzelne Schwer- samt sechs Schwerpunkte gebildet, an denen sich eine nachhaltige
6Rochlitzer Porphyr - Ein Stein „zuhause“ in der Stadt Leipzig, Quelle: © Schulz und Schulz
Kirchengestaltung abzeichnet. Dabei wirken besonders die Themen qualität besonders schwierig messen. Und aufgrund der angestreb-
Material und Instandhaltungsfähigkeit auf die Dauerhaftigkeit und ten, besonders langen Nutzungszeit der Bauteile sind frühzeitige
damit auf die Langlebigkeit des Gebäudes und seiner Technik ein. Ausfälle von Produkten in der Regel besonders ärgerlich. Gerade
Aber auch die Themen Energie und Nutzerkomfort verdienen in aus diesem Grund sind Planer häufig gegenüber Neuerungen eher
diesem Zusammenhang besondere Betrachtung. konservativ eingestellt. Das Thema der Materialqualität kann daher
als ein Grund unter vielen für diese Entwicklung gesehen werden.
Wegen der vielfältigen bekannten Optionen ist dies jedoch keines-
Aktuelle Entwicklungen wegs alternativlos. Planer können durch Materialauswahl bewusst
auf diese Aspekte einwirken. So können die Baustoffe mit Blick
Schon seit Jahren entwickelt sich die Dauerhaftigkeit von Bauteilen auf intensive Nutzung und aggressive Umwelteinflüsse ausge-
in Gebäuden eher rückwärts als vorwärts. In einer langjährigen wählt werden [IPBau94]. Auf der anderen Seite wirken einfache
Vergleichsstudie des IPBAU (Impulsprogramm BAU des Bundesam- Materialien, geringe Materialqualität und Mängel in der Ausführung
tes für Konjunkturfragen der Schweiz) anhand von 200 Gebäuden verkürzend auf die Lebensdauer [Bahr, Lennerts 10].
unterschiedlichen Alters wurde der Ersatzzeitpunkt von Bauteilen
ermittelt. Auffällig ist dabei der sich stetig verkürzende Ersatz- Funktionale Qualität
rhythmus. Bei Bauteilen, die zum Jahr 1933 erstellt wurden, lag Mit den zunehmenden Anforderungen an Bauteile steigt auch
die mittlere Verweildauer im Gebäude im Schnitt bei 52 Jahren. Bis der konstruktive Aufwand. Bestand eine Außenwand z.B. lange
zum Jahr 1983 wurde etwa die Hälfte aller Bauteile ausgetauscht. nur aus Putz und Mauerwerk, so finden sich heute oft zusätzlich
Bauteile aus dem Jahr 1963 haben jedoch nur eine mittlere Ver- Dämmschichten, Armierungen, zusätzliche Tragkonstruktionen
weildauer im Gebäude im Schnitt von 30 Jahren. Die Gründe für der Vorsatzschale oder Ebenen der Leitungsführung. Mit der
diese Entwicklung finden sich auf verschiedenen Ebenen: Zunahme von Schichten im Bauteil steigen auch die Komplexität
der Abhängigkeiten und damit auch das Fehlerpotenzial. Hier
Materialqualität bedarf es einer sicheren Dimensionierung und der Nutzung nicht
Einige Studien sehen die geringer werdende Lebensdauer von reparaturanfälliger Konstruktionen. Bauweisen in nicht ausreichend
Materialien [IPBau 94] als einen Grund für diese Entwicklung. bewährten Konstruktionssystemen sollten vermieden werden.
In den letzten 20 Jahren wurden jedoch vermutlich mehr neue Gerade bei komplexen Bauteilen sollte besonders die vertiefte
Produkte entwickelt, als in der gesamten Geschichte der Mate- Ausführungsplanung gemäß den anerkannten Regeln der Technik
rialkunde zuvor [El khouli, John, Zeumer 14]. Und gerade in der beachtet werden, die sich aus zahlreichen Normen, Richtlinien,
Werkstoffentwicklung lässt sich die Dauerhaftigkeit als Material- Bestimmungen und Fachregeln zusammensetzen. Im Idealfall
7100% Gesellschaftliche Entwicklung
Häufig unterschätzt in ihrer Wirkung werden immaterielle Fakto-
52 Jahre
1933 50% ren. Sie spielen in der Regel zusammen mit sich verändernden
Anforderungen und Erwartungen an das Bauen. Zunächst sind
0% dabei Anpassungen von Normen, Verordnungen oder Richtlinien
100% zu nennen. Die Funktionstauglichkeit im eigentlichen Sinne ist
dann noch gegeben, die Umsetzung aber nicht mehr zeitgemäß.
50 Jahre Beispiele hierfür sind Anforderungen von Wärme-, Schall- Brand-
1943 50%
oder Gesundheitsschutz. Aber auch die sich erneuernden Lern- und
0%
Arbeitswelten, der demographische Wandel oder die angemessene
Beachtung von Behindertengerechtigkeit und Inklusion können
100%
baulichen Wandel bedingen.
36 Jahre
1953 50%
Ein typischer Auslöser sind Nutzungsänderungen, die auch bei der
Propsteikirche St. Trinitatis – besonders für den Gemeinde- und
0%
Wohnbereich – nicht auszuschließen sind. Aber auch einzelne
100%
Bauteile können vor dem Ende ihrer technischen Lebensdauer
30 Jahre ausgetauscht werden, wenn sich z.B. die Anforderungen an die
1963 50% Funktionalität eines Gebäudes ändern. Dabei kann es auch um die
Gestaltungsqualität und die Umsetzung von modischen bzw. for-
Baujahr-Dekade des Bauteils (Zeitspanne je +/- 5 Jahre)
0% malen Ansprüchen gehen. Man kann hier auch von visueller Abnut-
100% zung sprechen. Die Ansprüche richten sich gerade an Innenbauteile
und ihre Farbigkeit, Muster, Oberflächen oder ihre Machart, aber
1973 50% auch an alle beweglichen Teile der technischen Anlagen, etwa
Bedienelemente. Dabei kann indirekt die Art der Nutzung eines
0% Gebäudes Aufschluss über das Potenzial zu modischen Änderungen
100% einer Immobilie geben. Denn die gestalterischen Anforderungen
spielen insbesondere bei Immobilien mit Repräsentationszweck
1983 50%
eine wichtige Rolle.
0%
Die Abnutzung von Bauteilen hängt auch vom Verhalten der
Nutzer ab. Ausschlaggebend ist hierbei vor allem der Grad der
Identifikation eines Nutzers mit dem Gebäude [Kalusche 04]. Kann
1933
1943
1953
1963
1973
1983
1993
Architektur dazu beitragen, Identität zu stiften und persönliches
Anteil an Originalbauteilen am Bestand Verantwortungsbewusstsein zu fördern, so wird damit in der Regel
Darstellung der Themenschwerpunkte am Projekt St. Trinitatis mit den auch die Langlebigkeit positiv beeinflusst. Unter der Maßgabe ei-
grundlegenden Zielstellungen, Quelle: [Bahr, Lennerts 10] nes möglichst dauerhaften Bauwerks wie einer Kirche, ergibt sich
die Frage, welche Aspekte sich dauerhaft positiv auf die Nutzung
auswirken. Eine „modische“ Umsetzung kann zwar kurzfristig die
werden dazu bereits in der Planungsphase Instandhaltungsaspekte Identitätsbildung fördern, sich aber langfristig eher negativ auswir-
berücksichtigt. Instandhaltungsarme oder -freundliche Bauteile ken, da der Nutzungshorizont idealerweise mehrere Generationen
verbessern z.B. die Inspektionsmöglichkeiten und erleichtern die überdauert. Ergänzend sind kontinuierliche Nutzerbeteiligung,
späteren Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen [Bahr, Nutzereinweisung und ein zentrales Nutzerhandbuch hilfreich,
Lennerts 10]. Dabei ist eine vertiefte Betrachtung von Details um über den gesamten Nutzerquerschnitt hinweg eine breite
sinnvoll, insbesondere mit Prüfung der physikalischen Vorgänge in Identifikation und eine große Achtsamkeit zu erzeugen. Letztlich
den Bauteilen. Denn im Schadensfall können Probleme häufig auf muss gerade bei kirchlichen Projekten das Ziel bestehen, mit der
wenige konstruktive Aspekte reduziert werden. Ebenso notwen- Architektur eine qualitätvolle, in sich eigenständige Gestaltung zu
dig ist die fachgerechte Ausführung, unterstützt durch bewährte finden. Bei kirchlichen Neubauten bedarf es gleichzeitig einer zeit-
Arbeitstechniken, die Qualifikation und Erfahrung des eingesetzten genössischen wie weitgehend zeitlosen Ästhetik, um ihren Wert
Personals sowie geeignete Werkzeuge, Geräte und Maschinen. im Sinne der Langlebigkeit auch umfassend nutzen zu können.
8DAS BEISPIEL PROPSTEIKIRCHE ST. TRINITATIS
Stadträumliches Konzept städtebauliche Torsituation, die den Auftakt für die Entwicklung
Die neue Leipziger Propsteikirche ist aus dem Organismus der des angrenzenden Stadtraums mit der S-Bahn-Station Wilhelm-Leu-
umgebenden Stadt heraus entwickelt und definiert in prominenter schner-Platz und dem Areal Nonnenmühlgasse markiert. Der
Lage, zwischen der Höhendominante Neues Rathaus und dem Kirchenneubau ist wichtiges Initial für eine hochwertige, nachhaltig
Wilhelm-Leuschner-Platz, einen Ort, der sich respektvoll einfügt stadtbildprägende Entwicklung des gesamten kriegsbedingt zer-
und entlang des städtischen Platzes sowie des Innenstadtrings störten Quartiers. Die öffentliche Durchwegbarkeit des Gebäudes
eine deutlich wahrnehmbare Kante ausbildet. Mit dem „Ausgie- verankert den Neubau im Netz der umgebenden Stadt und führt
ßen“ des dreieckigen Grundstücks und der Betonung der gegen- die angrenzenden Stadtbausteine von Neuem Rathaus, Stadtbib-
überliegenden Pole von Kirchenraum und Kirchturm spannt sich liothek, Universität und Bundesverwaltungsgericht ganz selbstver-
der Baukörper auf. Zwischen den beiden Hochpunkten ist der ständlich zusammen.
Pfarrhof eingeschnitten, als ein neuer zentraler Aufenthaltsort für
die Begegnung. Die Silhouetten von Kirche und Rathaus definieren Die kommunikative Mitte von Kirche und Gemeindezentrum ist der
entlang der ansteigenden Topografie des Martin-Luther-Rings eine für jedermann offene Pfarrhof, der in zentraler Lage zur Innenstadt
Die gegenüberliegenden Pole von Kirchenraum und Kirchturm spannen den Baukörper der neuen Propsteikirche auf, Quelle: © Stefan Müller
9Städtebauliche Torsituation mit Neuem Rathaus und neuer Trinitatiskirche (oben) und passagenartige Durchwegung des Pfarrhofs, Quelle: © Stefan Müller
einen neuen öffentlichen Freiraum von besonderer Qualität schafft. inszeniert. Dem Fenster im Inneren gegenüberliegend befindet
In der Tradition der Leipziger Innenstadtpassagen ermöglicht der sich die Werktagskapelle. Die Orgel als dritter „Verkündigungsort“
Hof die zwanglose Annäherung und bietet Raum für Begegnung. ist links von Altar und Ambo auf der Galerie deutlich sichtbar. Über
Prägende Elemente des Hofs sind die überdecken Bereiche der den Luftraum erweitert sich der Kirchenraum im Obergeschoss
nördlichen und südlichen Brückenbauwerke, der Brunnen mit dem auf die Empore und bietet hier Platz für die Aufstellung des Chors
auch akustisch wirksamen Wasservorhang und der zentrale Baum. sowie weiterer Kirchenbänke. Der Kirchenraum ist in Querrichtung,
Die erdgeschossig großzügig verglasten Fassaden verknüpfen den über die kürzere Raumseite, orientiert und schafft ausreichenden
Innen- mit Außenraum, stellen wechselseitige Bezüge her und Platz für die Anordnung der Gemeinde in einem offenen Circum-
leiten in den Kirchenraum sowie das Gemeindezentrum über. Mit stantes, dessen optische und szenografische Mitte der Altarraum
seiner Hülle aus gemauertem Rochlitzer Porphyr bekennt sich der ist. Auf Abtrennungen gegenüber der Gemeinde wurde verzichtet,
Bau zu Region und Tradition. was den Altarraum zusätzlich als mehrdimensional bespielbare
Fläche für unterschiedliche liturgische Handlungsformen öffnet.
Architektur Lediglich ein leichtes Gefälle (vom Eingang zum Altar) umschließt
Die neue Trinitatiskirche wird von den Elementen Kirchenraum, den Altarraum und folgt dabei der Anordnung der Kirchenbänke.
Pfarrhof, Gemeindezentrum und Kirchturm bestimmt, die im
Wesentlichen durch Licht, Raum und Material geprägt sind. Mit Der Altarraum ist über fünf Wege mit dem Portal und dem
seiner lichten Höhe von 14,50 Metern ermöglicht der Kirchenraum Taufstein, dem Aufstellort der Madonna, dem Kirchenfenster
eine transzendente Raumerfahrung, die durch das große Oberlicht (zur Stadt), dem Tabernakel und der Kapelle verbunden. Diese
in 22 Metern Höhe noch intensiviert wird. Von hier fällt Tageslicht Wege unterteilen die Bankreihen des offenen Circumstantes in
unterschiedlicher Intensität entlang der Altarrückwand in den Kir- sechs Segmente. Der Einzug in den Kirchenraum erfolgt über das
chenraum und bestimmt die Atmosphäre des Raums. Ein weiteres Hauptportal der Kirche, in dessen Nähe der Taufstein aufgestellt
wichtiges Raumelement ist das große ebenerdige Kirchenfenster ist, um schon beim Eintritt in den Kirchenraum an das Sakrament
(Künstler: Falk Haberkorn), das die Kommunikation zwischen der Taufe zu erinnern. Der Taufstein dient der Gemeinde zugleich
Gemeinde und Stadt wie über ein interaktives „Schaufenster“ als zentrales Weihwasserbecken. Gegenüber dem großen Kreuz
10an der Altarrückwand (Künstler: Jorge Pardo) ist ein zweites Kreuz Konstruktion
als dessen negativer Abdruck in die große Wandfläche über der Der Neubau ist ein homogener Baukörper mit auskragenden und
Empore eingeschnitten und öffnet den Kirchenraum zum Licht der weitgespannten Bauteilen. Basis bilden die beiden Gebäudetei-
tiefstehenden Westsonne. le von Kirche (Kirchenraum, Sakramentskapelle, Beichträume,
Sakristei, Einrichtungen der Kirchenmusik) und Gemeindezent-
Besonderes Element des Kirchenraums ist das große Kirchenfens- rum (Gemeindesaal, Büros, Priesterwohnungen, Technikräumen,
ter, das dem missionarischen Gedanken der Gemeinde entspre- Kirchturm, Tiefgarage), die über zwei brückenartige Bauteile
chend Neugierde weckt und individuelle Annäherungen erlaubt. miteinander verbunden sind. Die Konstruktion besteht aus einer
Es öffnet und begrenzt den Kirchenraum zugleich, und es dient als fugenlosen Stahlbetonkonstruktion, deren Eigenlasten weitgehend
gezielt gesetzte Öffnung, als Schnittstelle zwischen profaner und minimiert sind. Hierfür sind die Geschossdecken in Unterzugs-
sakraler Welt. Die damit einhergehende hermetische Offenheit des decken aufgelöst, das Dach über dem Kirchenraum wird durch
Kirchenraums generiert die von der Gemeinde gewünschte Öff- einen Fachwerkträger getragen. Die brückenartigen Bauteile über
nung und garantiert ein Mindestmaß notwendiger Geschlossenheit, den passagenartigen Zugängen zum Pfarrhof sind als wandartige
um die wichtige Einkehr, Ruhe und Konzentration zu ermöglichen. Träger ausgebildet, deren Lasten gezielt aufgenommen und durch
Konzeption und Ausformung des Fensters wurden im Rahmen wenige lastabtragende Bauteile im Erdgeschoss in den Baugrund
eines internationalen Kunstwettbewerbs ausgearbeitet. abgeleitet werden. Die Gründung erfolgt mittels Pfählen, um die
1 Kirchenraum
2 Empore
3 Werktagskapelle
4 Sakristei
5 Pfarrhof
6 Gemeindesaal
7 Gemeindebüros
8 Grauwasserzisterne
6
1
7
5
3
4
8
2
6 5 1
Erdgeschoss und Längsschnitt des Kirchenneubaus, M 1:750
11Das wechselseitig ergänzende Tages- und Kunstlichtkonzept prägt die Atmosphäre des sakralen Raums, Quelle: © Stefan Müller
Lasten in den tragfähigen Baugrund in circa 4 Metern Tiefe unter technologisch begrenzten Horizont aufweist und auch zukünftigen
Geländeoberkante zu übertragen. Anforderungen gerecht werden kann.
Material Universal Design
Gewohnte Standards der Langlebigkeit sowie des Komforts Ein weiterer Gradmesser für die Dauerhaftigkeit eines Gebäudes
wurden während der Planungsphase hinterfragt und in Bezug auf ist dessen Akzeptanz, die im Wesentlichen aus der kontextuellen,
die jeweilige Notwendigkeit neu bewertet. Im Fokus steht eine räumlichen, funktionalen und sozialen Disposition entsteht. Aus
Bewertung von der Produktion über den Lebenszyklus bis hin der besonderen Vernetzung, Offenheit, Qualität und Angebotsviel-
zu Revisionierbarkeit und Entsorgung. Die Betrachtungen führen falt des Neubaus resultiert eine große Selbstverständlichkeit, die
über den üblichen Zeitraum von 50 Jahren (nach DGNB) hinaus den Neubau in das gesellschaftlich-kulturelle Leben der Leipziger
und zielen auf eine nahezu unbegrenzte Nutzungsdauer. Entspre- Innenstadt einbindet. Zentraler Anker ist der offene, hochwertige
chend wurden sehr langlebige Baustoffe auf mineralischer oder Pfarrhof, der mit Wasserbecken, Wasservorhang (Verdunstungsküh-
nachwachsender Rohstoffbasis bevorzugt. Im Ergebnis liegt der le), Bepflanzung, Lesecafé und wechselseitigen Blickbeziehungen
Referenzwert der Ökobilanz des Kirchenneubaus 45 Prozent unter begehrter, gemeinschaftlich genutzter Ort ist. Kirchenraum und
dem Referenzwert nach DGNB. Gemeindezentrum sind dabei mehrdimensional nutzbare Räume
(Gebet, Andacht, Gottesdienst, Kontemplation, Lesungen, Konzer-
Regionale, nachwachsende oder mineralische sowie schadstofffreie te, Gemeindeleben, Bildung, Feierlichkeiten). Basis für die breite
Materialien (Porphyr aus Rochlitz, Travertin aus Weimar, Granit und anhaltende Akzeptanz ist die kontinuierliche Beteiligung der
aus Beucha bei Leipzig, Eichenholz aus Hessen) wurden bevorzugt Öffentlichkeit am Planungs- und Realisierungsprozess durch konti-
eingesetzt. Die Aktivierung von Wertstoffkreisläufen (Altglas als nuierliche Kommunikation (z.B. Pressemitteilungen, Ausstellungen,
Grundlage für die Schaumglasdämmung) und eine handwerkliche, Kommissionsbildung, Veranstaltungen, Publikationen, Besucherfüh-
materialgerechte Fügung (freie Steinlängen im Wilden Verband rungen). Auch die strikte Ausrichtung von Kirche und Pfarrzentrum
der gemauerten Porphyrfassade) verbessern die Ökobilanz und auf die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen erzeugt weitere
die Dauerhaftigkeit weiter. Hinzu kommen der weitgehende Akzeptanz. Neben der baulichen Barrierefreiheit sind es vor allem
Verzicht auf Verbundwerkstoffe und die Planung anpassungsfähi- die ganzjährig blendfreie Nutzung des Tageslichts, reservierte Roll-
ger Anlagen und Systeme, durch deren Austausch, Wartung und stuhlplätze, induktive Höranlagen sowie die akustische Übertragun-
Erweiterung das Gebäude per se keinen absehbaren zeitlichen und gen von Gottesdiensten in Mutter-Kind-Räume.
12STRATEGIEN FÜR DIE BEARBEITUNG DAUERHAFTER PROJEKTE
Es gibt tragfähige Strategien, mit denen man Projekte entwickeln wendigen Instandhaltung. Und der Effekt wird durch die aktuellen
kann, deren Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsaufwand auf Tendenzen zur Effizienzsteigerung von Gebäuden weiter verstärkt.
ein Mindestmaß reduziert werden soll. Allerdings lassen sich nicht Ab 2021 wird für Neubauten in Europa der Niedrigstenergiestan-
alle dieser Strategien pauschalisieren und damit allgemeingültig dard verpflichtend. Spätestens dann werden z.B. bei neu errichte-
einfach umsetzen. Sie stellen jeweils unterschiedliche Ansätze dar, ten Wohngebäuden etwa 50 % der im Lebenszyklus aufgewende-
die projektspezifisch gewichtet und ausgewählt werden sollten. ten Energie in die Bauteilherstellung und -instandhaltung fließen.
Die Gewichtung sollte dabei anhand der Nutzung erfolgen. Aus ihr
lässt sich die Dauerhaftigkeit der Nutzung ableiten. Zugleich lassen Besonders wirksam ist eine Optimierung des Materialeinsatzes,
sich Ziele für einen ungefähren Betriebsenergiebedarf abschätzen. die die Umweltwirkungen der Bauteile und ihre Dauerhaftigkeit
Mit dem Betriebsenergiebedarf und der angedachten Gebäude- gleichermaßen berücksichtigt. Dabei sind dauerhafte Baustoffe
nutzungsdauer ergibt sich auch ein Verhältnis von Betriebsenergie in der Regel ökologisch positiver zu bewerten als solche mit
zu Material- und Instandhaltungsaufwand. Erst so lässt sich der für einem geringen Energiebedarf in der Herstellung, die jedoch eines
das Gebäude angemessene Materialaufwand erkennen. häufigeren Austauschs bedürfen. Die passende Strategie dazu wird
in der Folge unter „Baukörper vor Technik“ beschrieben. Aller-
Je höher der Energieaufwand für den Gebäudebetrieb ist und je dings lassen sich gerade bei besonders langlebigen Gebäuden die
mehr energetische Dienstleistungen die Nutzung erfordert, desto Bauteile nur selten so gestalten, dass sie möglichst synchronisiert
stärker sollte die Gebäudekonstruktion auch zu einer Senkung der das Ende ihres Nutzungszyklus erreichen. Erforderlich ist dann die
Betriebsenergie beitragen. Dabei kann der Betriebsenergiebedarf Aufteilung der Instandhaltung in Maßnahmenpakete. Die Gebäude
direkt gesenkt werden (z. B. durch Dämmung), Energiequellen erhalten dadurch langfristig ihren Wert, können jedoch schlechter
für das Gebäude erschlossen werden (z. B. mittels mikroklimati- umgenutzt werden. Daher werden strategische Ansätze zu einer
scher Hüllen, Luftkollektoren oder die technische Unterstützung hohen Nutzungsflexibiliät, wie sie z.B. bei Gemeindezentren
von Gebäudetechnik durch Prozesswärme) oder der Energiefluss sinnvoll erscheint, unter dem Aspekt „Handlungsspielräume für
annähernd bedarfsgerecht gestaltet werden (z. B. über selektive zukünftige Entwicklung schaffen“ zusammengefasst.
Reflexion oder Speichermassen). Der dazu notwendige technische
Aufwand lohnt sich jedoch nur dann, wenn tatsächlich ein hoher Allgemeingültig lassen sich für die Instandhaltungsfähigkeit eines
Energiebedarf vorliegt. Ansonsten wird durch die hohe Investition Gebäudes alle baulichen Maßnahmen, die zur dauerhaften Nutz-
in technische Mittel gleichzeitig ein erhöhtes Ausfallrisiko von barkeit des Gebäudes beitragen, heranziehen. Dabei spielt bei der
aufwändigen Bauteilen erzeugt, das seine Vorteile im Lebenszyklus besonders langen Nutzungsphase einer Kirche insbesondere die
durch ebenso erhöhten Wartungs- und Instandhaltungsaufwand Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Bauteilen und Materialschichten
wieder verliert. eine wichtige Rolle. Dazu gehören auch eine lange Lebensdauer
sowie ein geringer Wartungsbedarf von Konstruktion und TGA, die
Bei Gebäuden mit geringem Energiebedarf und dauerhafter leichte Zugänglichkeit von wartungs- und austauschrelevanten
Nutzung, zu denen auch Kirchen und Pfarrheime zählen, steigt die Komponenten sowie die Entwicklung von Sanierungskonzepten für
Bedeutung der im Bauteil gebundenen Energie und der dazu not- unzugängliche Komponenten der TGA [Propstei 14].
Nutzungsflexibilität hoher betriebsoptimierte flexible
Betriebs- Gestaltung Umsetzung
temporäre Bauten
schneller Nutzungswechsel, z.B. Shops energiebedarf
eit
rh ste
Ge amt
(G
igk
g
ue as
bä ) S
es
lin
aft
Da gep
ud ys
yc
trendgerechte Gestaltung
e tem
ec
an
als
ffr
angepasste Dauerhaftigkeit
to
hs
große Maßnahmenpakete
Ro
Gemeinde- Konstruktionseffizienz
dauerhafte Nutzung
zentren Konstruktionsvariabilität
z.B. hochwertige
eit
Wohn- und Büroflächen
ilre ftigk
ng
a
cli
Ba uerh
Mo
cy
zeitlose Gestaltung Pfarrhaus Gemeinde-
du
Da
Kirchen
lar
ute
hohe Dauerhaftigkeit zentren
he
itä
geringer
ho
t
kleine Maßnahmenpakete
Kirchen Betriebs- Langlebigkeit Pfarrhaus Rückbaubarkeit
Werthaltigkeit energiebedarf
niedriger Nutzungswechsel hoher Nutzungswechsel
Abhängigkeit von Nutzungsflexibilität und Werthaltigkeit sowie von Nutzungswechsel und Energiebedarf, Quelle: erweitert nach [El khouli, John, Zeumer 14]
13Baukörper vor Technik
Heute werden im Gegensatz zum früheren Bauen viele Probleme Instandhaltungsaufwand beitragen. Das methodische Vorgehen
durch technische Elemente gelöst. Wir wissen jedoch aus Studien, dazu beginnt in der Projektvorbereitung. Will ein Bauherr eine
dass die verstärkte Heranziehung technischer Lösungen zumindest möglichst geringe Technisierung und eine hohe Dauerhaftigkeit
ökonomisch im Lebenszyklus durchaus negativ wirken kann. Denn der Bauteile erreichen, darf er daher im Anforderungsprofil nicht
typischerweise wird bei der Umsetzung ein neues Bauteil mit einer besonders hohe Behaglichkeitsanforderungen an die Umsetzung
eher geringen Dauerhaftigkeit zur Problemlösung eingesetzt. Dabei stellen. Ebenso hilfreich ist die bewusste Ausrichtung des Pla-
geht in der Regel eine höhere Technisierung mit einer Qualitäts- nungsteams auf die Fragestellung, z.B. durch die Auswahl von
steigerung im Sinne der Behaglichkeit einher. Es ist durchaus zu Planern mit einer erhöhten Erfahrung bei der baulichen Umsetzung
hinterfragen, ob diese Qualitätssteigerung im Lebenszyklus immer passiver energetischer Strategien.
notwendig und tatsächlich auch durch den Bauherrn gewünscht ist.
Die weiter steigende Anzahl der im Bauwesen relevanten Normen Nach der Konkretisierung des Baukörpers sollten die Energiedienst-
macht es Planern dabei zunehmend einfach, diese Qualitätssteige- leistungen Wärme, Kälte, Licht und Luft übergeordnet auf mögliche
rung als „Stand der Technik“ zu definieren, ohne dass im Rahmen systemische und bauteilbezogene Lösungen im Detail überprüft
von Projekten über die Sinnhaftigkeit der Vorgaben diskutiert werden. Häufig bieten die Themen Vermeidung sommerlicher
wird. Ein sinnvoller Lösungsansatz muss daher schon im Rahmen Überhitzung und Lüftung Ansatzpunkte für die planerische Ausein-
der Projektvorbereitung und des Vorentwurfs mitgedacht werden, andersetzung. Um die eher geringen Kräfte in der Luftführung zum
da hier über die Definition von Behaglichkeitsanforderungen und Gebäudebetrieb nutzen zu können, bedarf es in der Regel einer
Baukosten der Rahmen für eine mögliche Umsetzung (zusätzlicher hohen thermischen Qualität des Baukörpers. Fast alle passiven
Bruttorauminhalt, individuelle handwerkliche Ausführung in Abwei- Strategien basieren in der Regel auf einer gewissen thermischen
chung von industriellen „Stand der Technik“ etc.) festgelegt wird. Trägheit des Baukörpers. Sie eignen sich besonders für einen
gleichmäßigen Betrieb des Gebäudes. Da sie gerade bei schnell
Die zentrale Rolle spielt dabei die Zeitlichkeit technischer Lösun- wechselnden, wenig planbaren Nutzungen schwierig umzusetzen
gen im Vergleich zu baulichen Lösungen. Vergleicht man z.B. die sind, sollte die Strategie nur bei Gebäuden angewendet werden,
von Le Corbusier entwickelte „Brise Soleil“ (Sonnenbrecher) als in denen die Nutzung konstant, sicher und dauerhaft umgesetzt
Verschattungstechnik mit den heute baulich üblichen außenliegen- werden kann. Um die einfach wirkenden Lösungen tatsächlich um-
den Verschattungstechnologien, so hält die bauliche Lösung im zusetzen, müssen jedoch teilweise über übliche Planungsprozesse
Vergleich zu einem textilen Sonnenschutz 10 mal so lange. Ent- hinausgehende Bearbeitungen in der Planung erfolgen. Beispiels-
sprechend hoch kann dann der bauliche Aufwand sein. Und selbst weise lässt sich die sommerliche Überhitzung nach DIN 4108-2
im Vergleich zu einem bewitterten, feststehenden Sonnenschutz nicht nur statisch, sondern auch über eine dynamische Simulation
aus Metall liegt die Dauerhaftigkeit noch 2,5 mal höher [GföB 06]. nachweisen. Die entstehenden Ergebnisse bedürfen darüber eines
Die dabei eingesetzten technologische Lösung (z.B. die Eigenver- hohen bauphysikalischen Verständnisses der Planer und sollten
schattung) hat natürlich nicht die technische Leistungsfähigkeit, in der Planungsphase nach Erstellung auf die Veränderung von
kann aber im Lebenszyklus zu einem sehr geringen Wartungs- und Eingangsgrößen abgeprüft werden.
Tragwerk
Verschiebung von
Dachbelag Funktionen in
dauerhaftere
Bauteile
Fenster
/ Türen
Installationen
Bodenbeläge
Wandbeläge
20 40 60 80 Jahre
Fassade der Unité d’Habitation in Marseille mit horizontalem „Brise Soleil“, Dauerhaftigkeit von unterschiedlichen Bauteilen und methodischer Ansatz
Quelle: Martin Zeumer zur Optimierung, Quelle: FG ee, TU Darmstadt / ee concept
14Beispiel Kirchenraum Die Erwartungen an das Raumklima in Kirchenneubauten haben
sich den allgemein gestiegenen Komfortstandards unserer Lebens-
Das prominent gelegene Baufeld zwischen Neuem Rathaus und welten angepasst. Kirchen sind heute also keine unbeheizten Räu-
Wilhelm-Leuschner-Platz bindet den Neubau in das öffentliche me mehr, müssen aber auch nicht Standards wie etwa aus dem
Leben und die Infrastruktur von Stadt und Region ein. Dem Bürobau erreichen. Hier gilt es, einen Projektstandard zu definie-
hochfrequentierten Standort steht ein Angebot von Einkehr, Ruhe ren, der weitreichende Parameter einbezieht und eine zukunfts-
und Kontemplation gegenüber. Dieser Widerspruch wird durch fähige, ökologische und ökonomische Lösung erst ermöglicht. Für
die Konfiguration und die Geometrie des Baukörpers aufgehoben. den Neubau der Propsteikirche hat die Gemeinde für die Tempe-
Eingänge und Kirchenportal sind auf den „beruhigten“ Pfarrhof rierung einen Rahmen von mindestens 8/15 Grad (ungenutzt/
ausgerichtet, der durch Kirche, Gemeindezentrum, Brückenbau- genutzt) definiert, um ein Mindestmaß an Komfort zu sichern. Im
werk und Wasservorhang räumlich abgetrennt ist. Der großzügige Zusammenspiel von Raumvolumen, Nutzungszeiten, Speicherfä-
Vorraum übernimmt zusätzliche akustische und klimatische Puffer- higkeit der Bauteile und Art der Wärmeerzeugung und -verteilung
funktionen. Hinzu kommt die weitgehend massive Raumhülle der ergaben die Simulationen während der Planungsphase, dass durch
Kirche, die mit wenigen, gezielt gesetzten Öffnungen Interaktionen die Trägheit der Flächenheizsysteme (Industrieflächenheizung im
mit dem Stadtraum fördert und zugleich Einkehr und Ruhe sichert. Bereich von Fußböden und Wänden), die Wärmeerzeugung mittels
Erdwärmesonden und das große Raumvolumen von etwa 10.000
Das Tageslicht fällt über ein großes Oberlicht in 22 Metern Höhe Kubikmetern die kurzfristige, nutzungsspezifische Beheizung der
entlang der Altarrückwand in die Kirche und prägt die Atmosphäre Kirche problematischer und damit langfristig unwirtschaftlicher ist
des sakralen Raums. Die Art der Tageslichtversorgung bestimmt als eine gleichmäßig träge und speichermassennutzende Tempe-
Wahrnehmung, Wohlbefinden, Nutzungsszenarien sowie den rierung von 12 bis 15 Grad. Zumal auch die hohe Dämmwirkung
Bedarf an zusätzlichem künstlichem Licht. Im Zusammenspiel mit von Wand-, Decken- und Bodenflächen für eine gleichmäßige
der hohen Nutzungsintensität der Kirche (Planungsgrundlage: ganz- Temperierung des Raums sprechen. Diese Überlegungen beziehen
jährig von 8 bis 21 Uhr an sieben Tagen in der Woche) wirkt die auch die sommerliche Kühle (einen mit Kirchen fest verbundenen
Tageslichtversorgung wesentlich auf Energiekosten und Lebens- Komfortfaktor) mit ein, der nicht nur über die geschlossenen
zyklen der künstlichen Lichtquellen. Schon in der Planung wurden Wandflächen sondern auch über die kühlende Aktivierung der Flä-
dazu die Wechselwirkungen von Lichtschacht- und Raumgeometrie, chenheizsysteme gesichert wird. Hinzu kommt der aufgrund hoher
Oberflächenstruktur und -farbigkeit, Oberlichtverglasung sowie der Nutzerzahlen erforderliche hohe Luftwechsel, der den Wirkungs-
Kunstlichteinsatz simuliert und bewertet. Neben der computerge- grad einer reinen Warmluftheizung mindert.
stützten Simulation im „Raytracing-Verfahren“ wurde ergänzend
eine Echtzeit-Simulation am Innenraummodell (M 1:25) mittels ei- Eine dauerhafte, hochfrequente Nutzung der Kirche wird auch in
nes künstlichen Himmels überprüft. Im Ergebnis wird die Kirche in der Materialwahl abgebildet. Hier sind es z.B. der Steinboden aus
38 Prozent der Gesamtbetriebszeit (1820 h/a) mit mindestens 300 Travertin, das Laiengestühl aus Eichenholz, die mineralisch geputz-
Lux Tageslicht ausgeleuchtet. Hinzu kommt die sehr gleichmäßige ten Wandoberflächen und die zukunftsweisende leistungsfähige
Beleuchtung durch das Oberlicht, für das auch im dichten inner- LED-Beleuchtung, die durch ihre Robustheit und Alterungsfähigkeit
städtischen Bereich langfristig keine Verschattung zu erwarten ist. niedrigen Wartungseinsatz und lange Lebenszyklen ermöglichen.
Intensive Tageslichtplanung und -simulation am Modell, Quelle: © Schulz und Schulz, Andres Lichtplanung
15Die Intensität des Tageslichts bestimmt die Atmosphäre im Kirchenraum, Quelle: © Stefan Müller 16
Handlungsspielräume für zukünftige Entwicklung schaffen
Gebaute Fläche ist kostbar - entsprechend versuchen Planer in der sollten auch die Lage und die Anzahl der vertikalen Erschließungen
Regel die Flächeneffizienz von Gebäuden soweit wie möglich zu betrachtet werden. Eher kleine angediente Flächen pro Erschlie-
steigern. Die effiziente Grundrissgestaltung und die Minimierung ßungskern lassen später auch einen kleinteiligeren Nutzungswech-
von Verkehrs-und Nebenflächen bieten dabei einen signifikanten sel zu. Ebenso können frühzeitig Traglasten zur statischen Dimen-
ökonomischen Vorteil. Er kann sich aber ins Negative verkehren, sionierung vorgegeben werden, die unterschiedliche Nutzungen
wenn die Struktur des Gebäudes - z.B. bei veränderten Nutzeran- ermöglichen. Unterstützend wirkt die Umsetzung des Innenausbaus
forderungen oder einem Nutzungswandel - nicht die Ausschöpfung mittels leichter Konstruktionen, die wesentliche Änderungen inner-
der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ermöglicht. Das Objekt kann halb der Raumaufteilung ohne Eingriff ins Tragsystem ermöglichen.
dann nicht die anvisierte Wertstabilität erzielen. Handelt es sich dabei um modulare Systeme, können sie leicht
ergänzend eingesetzt oder zerstörungsfrei zurückgebaut werden.
Gerade bei Nutzungen, die einem langfristigen Wandel unterlie-
gen können (bei der Propsteikirche z.B. die Wohn- und Gemein- Neben dem baulichen Potenzial bedarf es auch eines technischen
debereiche) sollte die Planung daher Handlungsspielräume für Potenzials. Die horizontal und vertikal geführten Lüftungs- und
zukünftige Entwicklungen offen lassen. Man kann dazu zwischen Sanitärinstallationen sollten über alle Geschosse einfach zugänglich
Nutzungsneutralität, Nutzungsflexibilität und Umnutzungsfähigkeit sowie reparierbar, demontierbar, erneuerbar und erweiterbar sein
unterscheiden. [MINERGIE 12]. Entsprechend bedarf es dazu einer Planung von Re-
visionsöffnungen oder der Einplanung von Leerrohren für eventuel-
Nutzungsneutralität le spätere Elektroinstallationen. Räumliche Reserven in Schächten
Je detaillierter ein Gebäude oder ein Raum an seine Nutzung an- (z.B. eine nur 80%ige Ausnutzung des Schachtvolumens) tragen
gepasst wird, umso geringer ist die Möglichkeit einer alternativen dazu bei, dass eventuelles Nachrüsten von technischen Elementen
Nutzung. Es sollte daher in der Planung zunächst darauf geachtet möglich bleibt [BNB 15 2.2.2].
werden, dass sich Räume aufgrund ihrer Raumgröße nicht nur für
einen einzigen Zweck eignen. Gerade hier liegt z.B. der Vorteil der Planerisches Vorgehen
bei Bewohnern sehr beliebten Gründerzeitbauten. Die typischen Gerade eine erhöhte Nutzungsflexibilität oder technische Reser-
Raumgrößen zwischen 15 und 25 m2 lassen dort eine alternative ven sind jedoch mit zum Teil erheblich höheren Investitionskos-
Wohn-Nutzung in der Regel ohne Einschränkungen zu. Unterstüt- ten verbunden. Hier gilt es, in einer Art Balanceakt das richtige
zend wirkt eine hochwertige Gestaltung aller Räume mit natürli- Gleichgewicht zwischen den Mehrkosten und einem ggf. auf lange
cher Belichtung und einer angemessenen technischen Ausstattung. Sicht wirksam werdenden Nutzungsvorteil zu finden [Mergl 07].
In einzelnen Fällen steht auch die fehlende Verfügbarkeit von Die entscheidende Weichenstellung dazu erfolgt in Projekten schon
Neben- und Technikräume einer Änderung der Nutzungsrahmenbe- sehr früh - in der Regel innerhalb der Projektentwicklung, spätes-
dingungen entgegen. tens aber im Vorentwurf. Darüber hinaus sind die entsprechenden
Leistungen zumeist nicht anhand von harten Faktoren festschreib-
Nutzungsflexibilität und Umnutzungsfähigkeit bar. Es bedarf als Grundlage der Erarbeitung einer kurz-, mittel-und
Eine beim Bau anvisierte Nutzung wird sich im Laufe der Zeit langfristigen Nutzungsstrategie durch den Bauherrn als Grundlage
immer wandeln. Bei einer Lebensdauer von über 100 Jahren ist für die weitere Bearbeitung. Für Diskussionen in der Planung
es weder für Bauherren noch für Planer umfassend möglich, alle hat es sich dabei bewährt, die Aspekte in Form von erzielbaren
Eventualitäten vorzudenken. Als hilfreich ist es, wenn sich das Mehrwerten darzustellen und Wechselwirkungen zwischen den
Gebäude im Lebenszyklus an unterschiedliche Nutzungen anpassen Zielen, Bedürfnissen und Anforderungen klar zu benennen. Daraus
lässt oder auch einer ganz anderen Nutzung zugeführt werden lässt sich, z. B. mithilfe der Minergie-ECO-Checkliste [MINERGIE 12
kann. Kriterien GN01 bis 06 sowie GN16] oder des BNB-Steckbriefs 2.2.2
[BNB 15], ein Umnutzungskonzept erarbeiten. Für die Bewertung
Auf das Grundstück bezogen ist dabei zunächst die Vorhaltung von der Maßnahmen und die Einschätzung ihrer Wirksamkeit kann
Flächen für bauliche Erweiterungen bzw. die Ausbildung von Aus- die Erstellung von Sensitivitätsanalysen hilfreich sein. Leichter
baureserven (z.B. über eine mögliche Dachaufstockung) sinnvoll verständlich und einfacher in eine Zielstellung umsetzbar sind
[MINERGIE 12]. Neben einer weiterbaubaren Tragstruktur ist dazu hingegen selbst entwickelte Best-Case/Worst-Case-Szenarien.
auch eine durchgehende vertikale Lastabtragung anzustreben.
Strukturell sind für die Gebäude z.B. Rastermaße und Spannweiten Wichtig ist bei sehr dauerhaften Bauten auch das eigene Selbstver-
der Tragkonstruktion, die unterschiedliche Grundrissgestaltungen ständnis von Bauherr und Planer. Der Bau sollte nie als abge-
zulassen, zu prüfen. Gerade zu hohe Gebäudetiefen können hier schlossenes Werk verstanden werden, sondern immer Platz lassen
nur schwer nutzbare Flächen im Gebäudeinneren schaffen. Dabei für die zukünftige Arbeit anderer.
17Beispiel Gemeindezentrum die vorausschauende Planung und Zuführung von Medien, die den
Betrieb eines zentralen Tresens ermöglichen. Dabei steigt auch die
Gegenüber der Kirche sind die Räume für das Gemeindeleben Effizienz eines sonst nur temporär genutzten Erschließungsraums.
angeordnet. Die Nutzung ist hier nicht so stark festgelegt wie im
Bereich der Kirche und kann Anforderungsänderungen unterliegen. Kurzfristige Änderungen können also leicht durch Neutralität und
Mögliche Veränderungen könnten aus Nutzungszuschreibung, Flä- Flexibilität der räumlichen Strukturen aufgefangen werden. Für die
chenanforderungen und technischen Ausstattungsmerkmalen (Vor- Umsetzung bis dato noch nicht geplante Nutzungsszenarien (z.B.
trags-, Präsentationstechnik etc.) entstehen und verlangen nach weitere Wohnungen, Kindertagespflege, Museumsshop, Einzelhan-
einer vorschauenden Planung, die sowohl kurzfristige (veränderte delsbereiche, Restaurant) bedarf es darüber hinaus einer gewissen
Raumkonfigurationen im laufenden Betrieb) als auch mittel- und Umnutzungsfähigkeit des Gebäudes, die mit reduzierten baulichen
langfristige (leichte Umbauten) Handlungsspielräume ermöglicht. Eingriffen eine neue Grundrisskonfiguration ermöglicht. Vorausset-
zung dafür ist eine strukturelle Flexibilität, die durch das konstruk-
Die Flexibilität in der täglichen Nutzung des Gemeindebereichs tive System des Tragwerks entsteht. Trotz monolithischer Stahl-
resultiert aus der Möglichkeit variabler Raumzuordnungen inner- betonbauweise von Kirche und Pfarrzentrum lassen Anordnung
halb des bestehenden Grundrisses. Die Variabilität entsteht aus der und Minimierung lastabtragender Wände und große Spannweiten
multifunktional nutzbaren Raumgröße, der Tageslichtversorgung, der Decken unterschiedliche raumbildende Ausbauten zu. Die
der wiederkehrenden Materialität (keine Abstufungen innerhalb dienende Raumspange für die Gemeindearbeit im Erdgeschoss und
flexibel nutzbarer Raumstrukturen) und gleicher haustechnischer die Bereiche für die Schulungsräume und Priesterwohnungen im
Ausstattung. So erlauben im administrativen Bereich der Gemeinde Obergeschoss sind als leichter Ausbau (Trockenbau) ausgeführt und
z.B. „nutzungsneutrale“ Raumgrößen von 10 bis 30 Quadratme- können mit geringem Aufwand um- oder zurückgebaut werden.
tern funktionale Überlagerung und Mehrfachnutzung. Die als Büros
genutzten Räume könnten bei entsprechender Möblierung auch für Die baulich-räumliche Flexibilität wird durch regelmäßig wie-
Besprechungen, Kinderbetreuung oder als Lager fungieren. derkehrende Wandanschlusspunkte, zusätzliche Öffnungsflügel
sowie die Aufteilung des Sonnenschutzes im Bereich der Fassade
Die Gestaltung des Gemeindesaals folgt dem Ziel großer Fle- gestärkt. Hinzu kommt die haustechnische Ausstattung der Räume.
xibilität. Der nahezu quadratische Grundriss ermöglicht eine So ermöglichen beispielsweise der Einbau von Flächenheizsyste-
Vielzahl gleichberechtigter Nutzungen. So sind neben kleineren men und umfänglicher medialer Ausstattung eine deutlich flexib-
Lesungen, Konzerten und Theateraufführungen auf Gemeindefes- lere Nutzung bei nur leicht erhöhten Investitionskosten. Neben der
ten, Chorproben und Empfänge durchführbar. Befördert wird die konstruktiven Flexibilität spielt die Anordnung und Ausrichtung der
Nutzungsflexibilität durch eine mobilen Trennwand zwischen Foyer Räume eine wesentliche Rolle für die Art der Nutzung. Innenlie-
und Gemeindesaal, die die Zuschaltung des Foyers zur Saalfläche gende Dunkelbereiche oder nach Norden ausgerichtete Räume
ermöglicht und eine direkte räumliche Verbindung zwischen Saal weisen z.B. eine deutlich reduzierte Nutzungsvariabilität auf. Die
und Pfarrhof zulässt. Raumzuschnitt, -größe, -ausrichtung und weitgehend entlang der nach Süden ausgerichteten Fensterfassade
-ausstattung lassen auch im Bereich Foyer und Gemeindesaal angeordneten Raumspangen der neuen Propsteikirche St. Trinitatis
flexibel überlagerte, mehrfache Nutzungsszenarien zu. So wird der verfügen über einen besonders großen Handlungsspielraum hin-
Foyerbereich im Alltag als Lesescafé bespielt. Grundlage bietet sichtlich Nutzungsflexibilität und Umnutzung.
Flexibilität durch neutrale Raumgröße und -standards, © Stefan Müller Neutrale Raumgeometrie des Gemeindesaals, Quelle: © Stefan Müller
18Sie können auch lesen