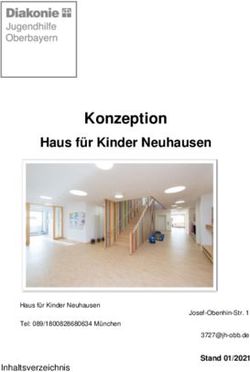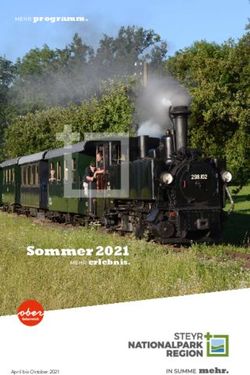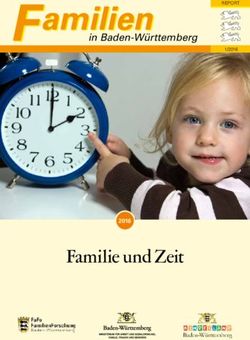Debatte um das Betreuungsgeld: Falsche Anreize für eine moderne Familienpolitik?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Debatte um das Betreuungsgeld: Falsche Anreize für eine
moderne Familienpolitik?
Zur Diskussion gestellt 7
Das 2013 eingeführte Betreuungsgeld wurde im April 2015 vom Bundesverfassungsgericht auf
seine Rechtmäßigkeit überprüft. Ein Urteil wird im Sommer 2015 erwartet. Für die Kritiker wider-
spricht die Regelung einer modernen Familienpolitik, und sie halten sie unvereinbar mit der Gleich-
stellung der Geschlechter. Die Befürworter dagegen sehen im Betreuungsgeld eine Anerkennung
und Unterstützung der Erziehungsleistung der Eltern. Setzt das Betreuungsgeld falsche Anreize
für die Familienpolitik?
Das Betreuungsgeld – rung und mussten ihr Leistungsspektrum
ein Rückfall in veraltete spürbar einschränken. In ganz Deutsch-
land, so kann man vereinfachend sagen,
Traditionen der
gilt seitdem der Vorrang der Wohlfahrts-
Familienpolitik politik – der 1945 eingeleiteten Tradition
folgend – eindeutig der Familie, während
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die den öffentlichen Bildungs- und Sozialein-
Bundesrepublik Deutschland die Tradition richtungen eine eher ergänzende und
der Wohlfahrts- und damit der Familien- ausgleichende Rolle zugesprochen wird.
politik der Weimarer Republik und des
Kaiserreiches wieder auf und orientierte Das Ergebnis: Kinder sind im wahrsten
sich am Vorrang der Familienförderung als Sinn des Wortes »auf Gedeih und Ver-
Kernelement der sozialen Absicherung derb« auf ihre Eltern angewiesen. Machen
der Bevölkerung. Zugrunde lag das Sub- Klaus Hurrelmann*
die Eltern ihre Sache gut, sind sie in der
sidiaritätsprinzip, wonach es die Familie Lage, die ihnen »obliegende Pflicht der
als »soziale Keimzelle« der Gesellschaft Erziehung und Pflege« zu erfüllen, dann
am besten versteht, alle ihre Mitglieder – profitieren ihre Kinder davon, können eine
darunter natürlich auch die Kinder – zu starke Persönlichkeit entwickeln und ihre
versorgen und zu fördern. Unter dem Ein- Leistungsfähigkeit entfalten. Machen die
druck des totalitären Regimes der Natio- Eltern ihre Sache schlecht, dann hat ihr
nalsozialisten, das dem Staat weitgehen- Kind einen schweren Start ins Leben.
de Interventionen in das Familienleben Deshalb ist es auch nicht verwunderlich,
erlaubte, waren die Verfassungsgeber ge- dass in Deutschland die schulischen Leis-
genüber Eingriffen in das Familienleben tungen und die Bildungsabschlüsse so
äußerst skeptisch geworden und veran- stark von der sozialen Herkunft abhängen
kerten im Grundgesetz der Bundesrepu- wie in kaum einem anderen hochentwi-
blik Deutschland ein monopolartiges Er- ckelten Land der Welt.
ziehungsrecht der Eltern. In Artikel 6 steht
der bemerkenswerte Satz: »Erziehung
und Pflege der Kinder sind das natürliche Drei Traditionen der
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen Wohlfahrtspolitik
obliegende Pflicht«. Eine solche Festle-
gung dürfte es wohl kaum noch einmal in Viele andere europäische Länder schrei-
der Welt in einer Verfassung geben. Der ben dem Staat mit seinen Erziehungs-
Staatseinfluss wurde auf ein Wächteramt und Bildungseinrichtungen eine verant-
reduziert. wortliche Rolle für jeden Bürger und jede
Bürgerin zu, auch schon für die ganz jun-
Nach der Vereinigung der beiden deut- gen. Sie relativieren damit absichtlich den
schen Staaten gilt diese Vorgabe auch für Einfluss der Eltern. Großbritannien, die
die frühere DDR, die bis dahin auf eine Niederlande und die skandinavischen
ganz andere Tradition der Familienpolitik Länder, um nur einige Beispiele zu nen-
gesetzt hatte und die Elternhäuser durch nen, investieren anteilsmäßig mehr in die
ein flächendeckend ausgebautes System vorschulische Erziehung und Bildung als
von Erziehungs- und Betreuungseinrich-
tungen entlastete. Diese Einrichtungen
* Prof. Dr. Klaus Hurrelmann lehrt in den Bereichen
erlebten seitdem einen empfindlichen Gesundheits- und Bildungspolitik an der Hertie
Rückgang in ihrer finanziellen Absiche- School of Governance, Berlin.
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 20158 Zur Diskussion gestellt
in die Unterstützung von Familien. Sie sehen die öffentliche berale Modell der angelsächsischen Länder legt den wohl-
Erziehungs- und Bildungspolitik als einen integralen Be- fahrtspolitischen Akzent auf eine Starthilfe für jeden Bürger
standteil der Wohlfahrtspolitik an und geben ihr ein entspre- und jede Bürgerin. Beide Modelle folgen der Philosophie,
chend hohes Gewicht. Dem liegt eine andere politische Tra- der Staat habe gute Startbedingungen für die Entfaltung der
dition zugrunde als in Deutschland. Kinder herzustellen, maßgeblich durch eine gute, von der
Herkunftsfamilie unabhängige Erziehung und Bildung. Das
In Europa lassen sich grob vereinfacht drei Traditionen der deutsche Modell weicht in seiner Tradition hiervon ab und
Wohlfahrtspolitik unterscheiden, die sich in den letzten richtet die Aufmerksamkeit des Staates überwiegend darauf,
30 Jahren zwar deutlich angeglichen haben, aber immer die Familien zu stärken.
noch die »Pfadabhängigkeit« von politischen Entscheidun-
gen bestimmen:
Studien zur den Effekten der Familienpolitik
1. Die skandinavische Tradition ist darauf ausgerichtet,
gleich stark in die individuelle Bildung der Gesellschafts- Wie erst vor einem Jahr eine systematische Evaluation der
mitglieder als auch in deren Absicherung gegen Risiken Familienpolitik, offiziell vom Familienministerium noch in Zei-
im Lebensverlauf zu investieren. Diese Tradition will je- ten von Ministerin von der Leyen in Auftrag gegeben, bestä-
dem Bürger und jeder Bürgerin ein Potenzial für die Ent- tigt hat, geben wir im internationalen Vergleich sehr viel Geld
faltung eigener Möglichkeiten, für den »Statuserwerb«- für die Familienpolitik aus, nach Schätzung der Evaluatoren
gewissermaßen, mit auf den Weg geben und gleichzeitig fast 180 Mrd. Euro im Jahr. Das Kindergeld bildet einen der
ein hohes Niveau garantierter Lebensqualität, also eine größten Einzelposten, es wird flankiert von den alternativ
»Statussicherung«, für alle die gewähren, die bereits ei- wählbaren Kinderfreibeträgen, vom Kinderzuschlag, vom
nen Status, vor allem einen beruflichen, haben. Die Fa- Elterngeld, von Steuererleichterungen bei überdurchschnitt-
milie soll diese Aufgabe nicht allein und auch nicht vor- lich hohen Kosten der Kinderbetreuung, Kinderzuschlägen
rangig erfüllen, weil sie hierdurch überfordert würde. bei der Riester-Rente, Ausbildungsfreibeträgen, von der Mit-
2. Die marktorientierte angelsächsische Tradition verfolgt versicherung der Kinder in der Krankenversicherung, Bei-
einen stimulierenden Förderansatz und ist von ihrer tragsreduktionen für Eltern bei der Pflegeversicherung und
Grundphilosophie her geneigt, intensiv in die Bildung des vielen anderen Programmen mehr. Sie haben alle das gleiche
individuellen Gesellschaftsmitglieds zu investieren, damit Strickmuster: Familien mit Kindern sollen finanzielle Unter-
es sich dadurch eine starke Position am Arbeitsmarkt stützung erfahren, um den im Grundgesetzt festgelegten
aufbauen kann. Der Statuserwerb wird also stark unter- Auftrag erfüllen zu können.
stützt, und zwar von der Idee her absichtlich unabhängig
von der Herkunftsfamilie. Im weiteren Lebenslauf werden Die Ergebnisse der Evaluation sind ernüchternd. Es gelingt
den Bürgern hingegen zur Statussicherung nur wenige kaum, mit den riesigen Transfersummen die erwünschten
soziale Transferleistungen zugestanden. Der Staat si- Effekte zu erzielen, die letztlich den Kindern direkt zugute-
chert ihnen eine gute Ausgangsposition zu, aber den kommen: ihre materielle Lage zu sichern, ihre körperliche
weiteren Lebensweg sollen sie im Wettbewerb mit an- und psychische Wohlfahrt zu stärken und ihre Bildung zu
deren am Markt selbst gestalten. fördern. Die Evaluation bestätigt damit, was die internatio-
3. Das zentraleuropäische, insbesondere das deutsche nale Bildungsforschung schon lange zeigt, dass nämlich das
Modell der Wohlfahrtspolitik spricht der sozialen Siche- deutsche Modell der Familienpolitik keine wirksame und
rung die eindeutig größte Bedeutung zu. Diese Sicherung nachhaltige »Erziehung und Pflege« der Kinder sichert. Trotz
wird überwiegend über die Familie vorgenommen, indem der gewaltigen Familiensubventionen haben wir in Deutsch-
der »Broterwerber«, meist der berufstätige Vater, der land eine erschreckend hohe Zahl von Familien mit Kindern,
Empfänger von Versorgungsleistungen für alle Familien- die in relativer Armut leben, also nicht das materielle Lebens-
mitglieder ist und die Mutter für Haushalt und Kinderer- niveau erreichen, das bei uns durchschnittlicher Standard
ziehung frei gestellt wird. Der öffentlichen Erziehungs- ist. Die jüngste Studie von UNICEF spricht hier eine erschre-
und Bildungspolitik kommt in dieser Tradition ckend klare Sprache. Durch die Fixierung auf die Förderung
grundsätzlich eine geringe Rolle zu. Diese subsidiäre von Familien als Haushalten kann nicht im Geringsten ga-
Wohlfahrtstradition setzt darauf, dass sich die Familien rantiert werden, dass die Geldsummen tatsächlich bei den
selbst am besten versorgen können und auch in erster Kindern selbst ankommen oder ihnen indirekt zugutekom-
Linie für die Erziehung und Bildung der Kinder zuständig men. Das »Kindergeld« zum Beispiel heißt zwar so, aber es
und verantwortlich sind. ist eigentlich ein Familiengeld, das den Eltern und nicht den
Kindern zur Verfügung steht.
Das skandinavische Modell geht davon aus, der Staat sei
für die Wohlfahrt jedes einzelnen Bürgers und jeder einzel- Nun ist es nicht so, dass die Politik in Deutschland auf die-
nen Bürgerin direkt verantwortlich. Das marktorientierte li- se ernüchternde Bilanz der bisherigen Tradition der Wohl-
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 2015Zur Diskussion gestellt 9
fahrts- und Familienpolitik nicht reagiert hätte. Die Regierung den Erziehungs- und Bildungsimpulse der Elternhäuser aus-
Schröder, die in ihrer ersten Legislaturperiode noch das Kin- zugleichen.
dergeld kräftig erhöht hatte, korrigierte später diesen Kurs
und nahm in ihrer Schlussphase entscheidende Weichen- Die Phase der Erziehung und Bildung der Kinder in den ers-
stellungen vor. Steuervergünstigungen etwa beim Eigen- ten, besonders formativen Lebensjahren ist durch eine un-
heimbau wurden zurückgenommen, und bis auf den Kin- angenehme Spannung und eine teilweise verkrampfte Ab-
derzuschlag für Eltern mit niedrigem Einkommen und die grenzung zwischen Familien und Erziehungs- und Bildungs-
Vorbereitung des Elterngeldes wurden demonstrativ keine einrichtungen gekennzeichnet. Das ist für die Erziehung und
Geldsummen mehr in die Familienförderung traditionellen Bildung der Kinder kontraproduktiv. Hilfreich wäre eine enge
Zuschnitts gelenkt. Stattdessen leitete die Regierung erheb- Kooperation und Partnerschaft. International vergleichende
liche Investitionen in den Ausbau von Kindertagesstätten Bildungsstudien haben drei strukturelle Merkmale heraus-
und Ganztagsschulen. Das war ein klarer Kurswechsel von gearbeitet, die den verhängnisvollen Effekt der sozialen Her-
der isolierten Familienpolitik zu einer Kombination von Fa- kunft auf die Leistungsbilanz der Kinder abschwächen kön-
milien- und Bildungspolitik. nen: 1. ein möglichst hoher Anteil von Kindern in den vor-
schulischen Bildungseinrichtungen. 2. ein möglichst langer
Aufenthalt der Kinder in diesen Einrichtungen bei intensiver
Rückfall in veraltete Muster Abstimmung der Erziehungsimpulse zwischen Elternhaus
und Einrichtung. 3. eine möglichst spät in der Bildungslauf-
Auch die Regierungen unter Angela Merkel haben dieses bahn einsetzende Aufteilung der Kinder in unterschiedliche
Umsteuern zuerst mitgetragen. In der ersten großen Koali- Schultypen nach ihrem bis dahin erreichten Leistungsstand.
Jedes dieser Merkmale erhöht das Potenzial des Bildungs-
tion wurde der Ausbau der Vorschulerziehung ebenso un-
systems, die schulischen Leistungen bei allen Kindern un-
terstützt wie der von Ganztagsschulen, beim »Teilhabe- und
abhängig von den Vorgaben des Elternhauses, aber immer
Bildungspaket“« wurden interessante neue Ansätze einer
in enge Abstimmung mit dem Elternhaus, zu erhöhen und
gezielten Anreizpolitik zur Förderung der Bildung von Kin-
auf diesem Wege auch die Persönlichkeit- und Leistungs-
dern sichtbar. Aber schon während der zweiten Regierung
entwicklung der Kinder aus den unteren sozialen Herkunfts-
Merkel, in der Koalition ausgerechnet mit der liberalen FDP,
schichten anzuheben.
wurde dieser Kurs aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf-
gegeben. Aus rein machtpolitischen Gründen wurde auf
Alle drei Aspekte waren im Visier der zweiten Regierung
Drängen des zweiten Koalitionspartners CSU, ohne jeden
Schröder und der ersten Regierung Merkel. Das Umsteuern
erkennbaren Widerstand der Bundeskanzlerin, das Betreu-
hat aber nur wenige Jahre angehalten. Mit dem Betreuungs-
ungsgeld eingeführt. Damit war es mit dem Umsteuern in
geld werden wieder die alten Politikmuster bedient, obwohl
der Familien- und Bildungspolitik vorbei. Die deutsche Wohl-
wir doch wissen, dass sie Kindern nicht zugutekommen.
fahrtspolitik war in ihre alte Pfadabhängigkeit zurückgefallen
Nicht obwohl, sondern weil wir so viel Geld in die direkte
und leitete fortan wieder mehr Geld in die Familie als in die
und indirekte Familienförderung hineinstecken, ist bei uns
Erziehung- und Bildungsinstitutionen. die Bildungsungleichheit so groß. Durch Kindergeld, Eltern-
geld, durch die Steuerpolitik mit dem sogenannten »Ehe-
Die Auswirkungen werden bald zu spüren sein. Die Einfüh- gattensplitting« als wichtigster struktureller Komponente
rung des Betreuungsgeldes ist ein Symptom für eine unent- setzen wir Anreize, mit der wir die Familie von der sozialen
schiedene, ja widersprüchliche und die Eltern verunsichern- Umwelt abschotten, statt sie mit ihr zu verzahnen.
de staatliche Familien- und Bildungspolitik. Weil die Politik
sich nicht entscheiden kann, ob sie die Kinder über eine
Förderung der Eltern oder eine Förderung der Bildungsins- Gefragt ist eine kombinierte Familien- und
titutionen unterstützen möchte, schafft sie ambivalente An- Bildungspolitik
reize sowohl für die Eltern als auch für Bildungsinstitutionen.
Viele Frauen und Männer fallen, sobald sie Mütter und Väter
geworden sind, in die traditionellen Geschlechtsrollen des Ziel der Wohlfahrts- und Familienpolitik sollte es sein, pro-
konservativen Wohlfahrtsstaatsmodells zurück: Die Frau ist grammatische und finanzielle Schritte einzuleiten, die unmit-
die Haushälterin und Kindererzieherin, der Mann der Broter- telbar den Kindern als jungen Staatsbürgern und als Per-
werber der Familie. Viele Kindergärten und Grundschulen sönlichkeiten mit besonderem Bedarf zugutekommen. Eine
halten sich mit Erziehungs- und Bildungsimpulsen zurück, solche Politik ist nicht gegen Eltern und nicht gegen Fami-
weil sie nicht sicher sein können, ob das politisch erwünscht lien gerichtet. Sie stellt die Rolle von Eltern als Dreh- und
ist. Die Folge: Es gelingt dem deutschen Schulsystem, wie Angelpunkt für die Entwicklung des Nachwuchses nicht in
der internationale Vergleich zeigt, viel weniger als den meis- Frage. Aber sie trägt der Tatsache Rechnung, dass Eltern
ten vergleichbaren Ländern, die immer ungleicher werden- Laienerzieher sind und ihre natürlichen Grenzen haben,
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 201510 Zur Diskussion gestellt
wenn es um die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder geht die 150 Euro pro Monat, die zur Diskussion stehen, viel Geld,
– weil sie berufstätig sein wollen oder müssen, ihre Bezie- und sie werden alles tun, um an dieses Geld zu gelangen.
hung in die Brüche geht, sie eigene Ansprüche an ein erfüll- Was sie tun sollen ist, ihr Kind nicht in eine öffentliche Bil-
tes Leben stellen und in vielen Belangen nicht kompetent dungseinrichtung zu geben.
bei der schwierig gewordenen Erziehung sind.
Das ist eine Verkehrung der Grundidee von Förderanreizen.
Hier setzt moderne Kinderpolitik an. Sie ist gezielte Förder- Mit der Einführung des Betreuungsgeldes fällt Deutschland
politik für Kinder und eben nicht nur Finanzausgleich für den in das alte, überwunden geglaubte Muster der Familienpo-
Elternhaushalt mit Kindern. Kinder- und Familienpolitik ge- litik zurück. Es folgt der Logik, die Familienfixiertheit der Er-
hören auf das Engste zusammen, ebenso wie Bildungs- und ziehung und Bildung zu bestärken, wo wir es doch so drin-
Familienpolitik. Wir brauchen die materielle Basisabsiche- gend nötig haben, sie zu lockern. Das Betreuungsgeld ist
rung des Elternhaushaltes und zugleich die vorschulische insofern ein schwerer Rückschritt auf dem Wege, Familien-
Betreuung und Erziehung in Kinderkrippen und Kinderta- politik und Kinderpolitik auf die heutigen veränderten Le-
gesstätten und die Angebote von Kindergärten und Grund- bensbedingungen zuzuschneiden. Das Betreuungsgeld
schulen auch am Nachmittag, weil sie die Förderimpulse der passt in die traditionellen Muster des konservativen Wohl-
Eltern ergänzen. Je besser die öffentliche mit der privaten fahrtsstaates, die in Deutschland ganz offensichtlich immer
Erziehung abgestimmt ist, desto mehr profitieren die Kinder. noch sehr stark sind. Die vielen Millionen Euro, die Jahr für
Und es gibt nun einmal auch Kinder, die in ihren Familien Jahr für das Betreuungsgeld ausgegeben werden sollen,
nicht die Anregungen und Unterstützungen bekommen, die wären dringend nötig, um die öffentlichen Bildungs- und
sie für ihre körperliche, psychische, sprachliche, emotiona- Betreuungsinstitutionen um die Familie herum endlich auf
le und intellektuelle Entwicklung unbedingt benötigen. Für ein Niveau zu bringen, wie es im internationalen Maßstab
üblich ist.
sie sind die öffentlichen Einrichtungen überlebenswichtig.
Ohne sie fallen sie zurück und sind nicht in der Lage, den
Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens gerecht zu
werden.
Gegen mehr Geld für Familien ist nichts zu sagen, aber es
muss klug eingesetzt werden. International werden sehr gu-
te Erfahrungen mit dem Modell des Conditional Cash Trans-
fer gemacht, bei dem finanzielle Zuwendungen an bestimm-
te Bedingungen geknüpft sind, die auf ein klar definiertes
Ziel ausgerichtet sind. Beim »Teilhabe- und Bildungspaket«
sind wir dicht an dieses Prinzip herangegangen. Zunächst
wurde klar der Adressatenkreis definiert, der von diesen fi-
nanziellen Transfermitteln profitieren soll: Eltern, die bereits
Unterstützung nach dem Hartz-IV-Gesetz bekommen. Dann
wurden die Bedingungen festgelegt: Eltern bekommen dann
Geld, wenn sie für ihre Kinder zum Beispiel Nachhilfe oder
die Mitgliedschaft in einem Sportverein organisieren oder es
zum Schulmittagessen anmelden. Das sind begrüßenswer-
te Schritte in Richtung eines an Bedingungen geknüpften
finanziellen Zuwendungssystems.
Die Zahlung von Mitteln an Eltern unter der Bedingung, dass
sie ihre Kinder nicht in eine öffentliche Bildungseinrichtung
geben, sondern zu Hause betreuen, führt diesen Ansatz in
die Irre. Damit wird die Idee, finanzielle Anreize für bestimm-
te Betreuungshandlungen zu gewähren, die einem Kind zu-
gutekommen, auf den Kopf gestellt. Das in Aussicht gestell-
te Betreuungsgeld soll das Kind an die Eltern binden und
von den Impulsen der Erziehungs- und Bildungseinrichtun-
gen abhalten. Damit schafft es Fehlanreize: Ohne dass das
Betreuungsgeld an den Adressatenkreis der wirtschaftlich
benachteiligten Eltern gebunden wäre, ist es doch genau
für diese Eltern von unmittelbarem Interesse. Für sie sind
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 2015Zur Diskussion gestellt 11
ments, während die »offizielle« Diskussion hängengeblie-
ben ist in einer unterkomplexen Gegenüberstellung der
»Hausfrauenehe« versus dem Modell, bei dem beide
gleichberechtigt einer (vollzeitigen) Erwerbsarbeit nachge-
hen. Dass die klassische »Hausfrauenehe« ein Auslaufmo-
dell geworden ist, wird sicher keinen überraschen und er-
klärt zugleich, warum die Bedarfe nach teilzeitiger Kinder-
betreuung außerhalb der Familie ansteigen. Man sollte sich
aber davor hüten zu glauben, dass das spiegelbildlich be-
deutet, dass das gleichberechtigte, egalitär ausgerichtete
Partnerschaftsmodell an Bedeutung gewonnen hat. Das
wird erkennbar, wenn man – wie das Heike Wirth und An-
Stefan Sell* gelika Tölke getan haben – die Entwicklung der Erwerbs-
konstellationen von Eltern über einen längeren Zeitraum
Das Betreuungsgeld als Instrument untersucht (vgl. Wirth und Tölke 2013). Und das dann auch
noch im west- und ostdeutschen Vergleich, was besonders
einer mehrfach fragwürdigen
interessant ist vor dem Hintergrund der erheblich differie-
»Kompensationsökonomie«
renden Familienmodelle zum Zeitpunkt der Wiedervereini-
gung. Ein Befund aus der Studie von Wirth und Tölke sei
Was war das im Jahr 2013 für eine erregte Debatte. Wieder
hier besonders herausgestellt: Nicht nur für Ostdeutsch-
einmal ging es um ganz grundsätzliche Fragen des Seins
land, sondern auch für Westdeutschland – von einem be-
und wie es sein sollte bzw. nicht sein darf. Und das dann
reits niedrigen Niveau Anfang der 1990er Jahre ausgehend
auch noch bezogen auf »die« Familie, ein gerade in
Deutschland normativ und emotional hochgradig aufgela- – zeigen die Daten neben dem erwartbaren Rückgang des
denes Terrain mit vielen Fettnäpfchen, von denen man traditionellen Erwerbsarrangements aber auch einen Rück-
kaum alle umgehen kann. Entweder so oder anders. »Zu gang des egalitären Erwerbsarrangements in den Familien.
Hause« oder »Fremdbetreuung« (eine Wortschöpfung, die Für Westdeutschland: Hatten 1991 noch 16% der Paare
genau so antiquiert daherkommt und ist wie das wenig mit einem Kind im Vorschulalter ein egalitäres Erwerbsmus-
einladende »Fremdenzimmer« im ländlichen Übernach- ter, waren es 2009 nur noch 10%; bei Paaren mit Kindern
tungswesen). Die damals anstehende Scharfstellung des im Schulalter geht der Anteil von 22% (1991) auf 15%
Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem (2009) zurück. Noch drastischer sind die Rückgänge in
vollendeten ersten Lebensjahr zum 1. August 2013 und Ostdeutschland: Von 61% auf 37% bei Familien mit Kin-
die aufgeregte Diskussion über ein drohendes »Kita-Cha- dern im Vorschulalter. Um es auf den Punkt zu bringen:
os« im Sinne einer nicht erreichbaren »Bedarfsdeckung« Der Anteil der egalitären Erwerbsarrangements von Eltern
war schon spannungsgeladen genug und wurde dann in Ost-, aber auch in Westdeutschland ist in heute geringer
auch noch angereichert durch das ebenfalls vor der Ein- als vor 25 Jahren.
führung stehende »Betreuungsgeld«, dem jüngsten
Sprössling in der langen Geschwisterreihe »familienpoliti- Was folgt daraus? In der Lebenswirklichkeit der meisten
scher« Leistungen. Familien geht es um Kombinationen aus familialer und au-
ßerfamilialer Betreuung der Kinder in durchaus unter-
In einem engeren Sinne wurden (und werden) sowohl hin- schiedlichen Mischungsverhältnissen. Bekanntlich hat der
sichtlich des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungs- (und Tag 24 Stunden, und auch wenn man eine Kindertages-
man müsste man korrekterweise anfügen Bildungs- und einrichtung oder die Kindertagespflege in Anspruch nimmt,
Erziehungs-)Platz in einer Kindertageseinrichtung oder der verbleiben zahlreiche Stunden, in denen man sich selbst-
Kindertagespflege wie auch beim Streit über das »Betreu- verständlich um die Kinder kümmern muss. Vor diesem
ungsgeld« typische »Stellvertreterkriege« ausgefochten, bei Hintergrund hat es ja auch Sinn, dass man die Kitas aus-
denen es letztendlich um bestimmte Familienmodelle geht. baut als eine familienergänzende Infrastruktur, die aber
Aber dieses »Entweder-Oder« hat sich in der Realität der niemals eine familienersetzende Funktionalität haben wird,
Familien längst überholt und ist bei genauerem Hinschau- wie manche ideologisch motivierte Debattenbeiträge be-
en einem »Sowohl-als-auch« gewichen. Anders ausge- haupten.
drückt: In der Lebenswirklichkeit der meisten Familien do-
miniert heute eine »Mosaikstrategie« der Kombination un- Aber der Ausbau der Kinderbetreuungsinfratstruktur ist auf
terschiedlicher Erwerbsarbeits- und Betreuungsarrange-
der einen Seite mit erheblichen Kosten verbunden – die
* Prof. Dr. Stefan Sell lehrt Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozial-
dann auch die öffentliche Debatte dominieren, weil die Ki-
wissenschaften an der Hochschule Koblenz, Campus Remagen. ta-Plätze als eine aus Steuermitteln hoch subventionierte
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 201512 Zur Diskussion gestellt
Angelegenheit daherzukommen scheinen.1 Nun muss man Zweite Ebene: Die Kompensationsfunktion für die
an dieser Stelle anmerken, dass die konkrete Finanzierung Nicht-Inanspruchnahme einer öffentlich
der Kindertagesbetreuung keinem einheitlichen System finanzierten Leistung?
folgt, sondern wir haben 16 unterschiedliche Finanzie-
rungssysteme in durchaus heterogener Ausformung. Was Hier sind wir konfrontiert mit einem ordnungspolitischen (und
man aber grob sagen kann: 60 und mehr Prozent der lau- logischen) Bermuda-Dreieck. Es handelt sich um eine Leis-
fenden Kosten – die vor allem Personalausgaben sind – tung, die dadurch charakterisiert ist, dass sie nur dann in
fallen auf der Ebene der Kommunen an, gefolgt von den Anspruch genommen werden kann, wenn eine andere öf-
Bundesländern. Der Bund war lange Zeit gar nicht beteiligt, fentliche Leistung nicht in Anspruch genommen wird, denn
seit einigen Jahren ist er über eine anteilige Finanzierung das Betreuungsgeld bekommen ja nur die Eltern, die ihr Kind
vor allem der Ausbaukosten im Bereich der Plätze für unter nicht in eine Kita oder in die öffentlich finanzierte Tagespfle-
dreijährige Kinder eingebunden. Das ist für die folgenden ge schicken. Das ist schon aus einer grundsätzlichen Per-
Ausführungen zu den »kompensationsökonomischen« As- spektive mehr als fragwürdig. Denkt man diesen Ansatz
pekten des Betreuungsgeldes hoch relevant, wie wir gleich konsequent zu Ende, dann könnte man durchaus argumen-
sehen werden. Wichtig ist die Hervorhebung des Tatbe- tieren, dass das auch in anderen Bereichen Anwendung
standes, dass wir es hinsichtlich der öffentlich geförderten finden müsste – und da würde sich ein ganzes Universum
Kindertagesbetreuung mit einer extrem verzerrten Kos- an möglichen Fallkonstellationen auftun. Wie wäre es mit
ten-Nutzen-Verteilung zu tun haben, denn die monetär be- den erheblichen staatlichen Subventionen, die in den Be-
stimmbaren Nutzeneffekte fallen vor allem auf der Ebene reich der Opern fließen? Nun gibt es viele Menschen, die
des Bundes und der Sozialversicherungen an, die aber nur aus welchen Gründen auch immer niemals in ihrem Leben
unzureichend bzw. gar nicht an der Regelfinanzierung der einen Fuß in eine derart hoch subventionierte Oper setzen
Angebote beteiligt sind.2
werden. Insofern könnte man nun über die Kompensation
derjenigen nachdenken, die die Dienstleistung Oper nicht in
Anspruch nehmen wollen und werden. Wo soll das enden?
Erste Ebene: Die (partei)politische
Kompensationsfunktion des Betreuungsgeldes?
Wenn man allerdings etwas genauer nachdenkt und die Fi-
nanzierungsgegebenheiten berücksichtigt, dann wird durch-
Das Betreuungsgeld kann und muss verstanden werden
aus eine gewisse Kompensationslogik erkennbar – vor allem
als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses in der politi-
für die Ebene der Bundesländer und auch der Kommunen.
schen Arena. Es handelt sich um ein Tauschgeschäft: Auf
Denn das Betreuungsgeld beschränkt ja die ansonsten hö-
der einen Seite der Ausbau der Betreuungsplätze für un-
here Inanspruchnahme der öffentlich geförderten Kinderta-
ter Dreijährige inklusive Rechtsanspruch auf einen sol-
gesbetreuung, die mit erheblichen Aufwendungen verbun-
chen Platz. Auf der anderen Seite reklamierte vor allem
den ist, ganz überwiegend für die kommunale und die Lan-
die CSU einen »Ausgleich« für diejenigen, die aus welchen
desebene. Zugleich handelt es sich um eine Leistung, die
Gründen auch immer die Betreuungsplätze in der Alters-
aus Bundesmitteln finanziert wird. Daraus folgt, dass im Er-
spanne unter drei Jahren nicht in Anspruch nehmen wol-
len. Offensichtlich vermutet man hier ein signifikantes gebnis ein erst einmal »teurer« Kita-Platz substituiert werden
Wählerklientel, und im Sinne der politischen Psychologie kann über die Ausreichung einer deutlich niedrigeren Geld-
sollte diese Gruppe »honoriert« werden mit einer neuen leistung, die zudem noch von einer anderen föderalen Ebe-
Geldleistung. Der hier angedeutete Mechanismus ist dem ne finanziert wird. Insofern handelt es sich um eine »attrak-
politischen Geschäft ja nicht fremd, ganz im Gegenteil. tive«, weil kostengünstige Monetarisierung des individuellen
Man nehme beispielsweise die »Rente mit 63« und die Rechtsanspruchs, dessen Einlösung ansonsten ganz ande-
»Mütterrente« als Ergebnisse eines parteipolitischen re Finanzströme mobilisieren würde.
Tauschhandels.
Dritte Ebene: Eine Kompensationsleistung zur
1
In der Debatte werden immer wieder ausschließlich die Bruttokosten aus- Herstellung von »Wahlfreiheit« sowie eine
gewiesen – beispielsweise mit der Aussage, dass ein Krippenplatz um
die 1 000 Euro pro Monat kosten würde. Zielführender wäre eine
Anerkennungsleistung für die Erziehungsleistung
Betrachtung der Nettokosten, also abzüglich der Rückflüsse an die innerhalb der Familie?
öffentliche Hand und weitergehend eine Bilanzierung der fiskalischen
Kosten-Nutzen-Relationen, denn gerade die Kitas – das zeigt sich derzeit
beim Streik in den kommunalen Kitas – induzieren erhebliche Multiplika- Die Apologeten des Betreuungsgeldes begründen die Le-
toreffekte bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen durch ihre gitimation des Betreuungsgeldes, dass mit dieser Leistung
Ermöglichungsfunktion von Erwerbstätigkeit bei den Eltern, vor allem den
Müttern. »Wahlfreiheit« hergestellt wird und gleichzeitig eine staatliche
2
Weiterführend dazu und mit einem konkreten Lösungsvorschlag, wie Anerkennung der Erziehungsleistung innerhalb der Familie
eine zweckgebundene anteilige Mitfinanzierung des Bundes (und der
Sozialversicherungen) an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtun-
erfolgen würde. Wenn man sich diese Argumentation einmal
gen (und der Tagespflege) aussehen könnte: Sell (2014). genauer anschaut, dann ergeben sich doch einige notwen-
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 2015Zur Diskussion gestellt 13
dige kritische Anfragen: Diese beziehen sich nicht nur auf noriert werden soll, auch dadurch fragwürdig, weil zwar kei-
die mehr als diskussionswürdige Höhe der Anerkennungs- ne öffentlich finanzierte Kita oder Tagespflege in Anspruch
leistung (150 Euro pro Monat), die dem einen oder der an- genommen werden darf, daraus aber nicht folgt, dass immer
deren nicht zu Unrecht als ein für den Staat im Vergleich zu und in jedem Fall die betroffenen Eltern, also im Regelfall die
den ansonsten fälligen Ausgaben für die Kinderbetreuungs- Mütter, die Leistung auch tatsächlich übernehmen. Denn
infrastruktur recht billiges »Abspeisen« der Betroffenen vor- das Betreuungsgeld kann selbstverständlich auch in den
kommen mag. Fallkonstellationen bezogen werden, in denen beide Eltern-
teile Vollzeit arbeiten und ein Au-pair-Mädchen aus Osteu-
Suggeriert wird unter dem positiv besetzten Begriff der ropa einstellen, das dann in der Familie die Betreuungsauf-
Wahlfreiheit eine Entscheidungssituation Kita versus zu gaben übernimmt. Die betroffenen Familien werden sich
Hause. Aber eine solche Situation existiert zum einen für über die anteilige Mitfinanzierung dieser Person seitens des
die meisten Familien gar nicht, denn die stundenweise In- Staates sicher freuen.
anspruchnahme einer Kita (und damit der Verzicht auf die
150 Euro) setzt voraus, dass man das auch realisiert be-
kommt. Auch wenn darüber nicht mehr in der Breite be- Fazit
richtet wird – für viele Eltern stellt sich immer noch eher das
Problem, dass das Angebot an Plätzen knapp oder nicht Die neue Geldleistung »Betreuungsgeld« ist in mehrfacher
vorhanden ist. Und auch wenn man Kita-Plätze in Anspruch Hinsicht ein fragwürdiges Unterfangen. Auch (und gerade)
nehmen kann, wird häufig vergessen, dass damit je nach wenn es derzeit »nur« 150 Euro pro Monat sind – denkt man
Bundesland und lokaler Gegebenheit teilweise erhebliche den Ansatz konsequent weiter, dann rutscht man zwangs-
Kosten verbunden sind in Form von Elternbeiträgen und läufig in die Fahrrinne einer Monetarisierung von Familien-
sonstigen Leistungen. Das kann für manche Familien meh- leistungen, an deren Ende eine Art »Elterngehalt« stehen
rere hundert Euro im Monat bedeuten. müsste. Wir müssen derzeit aufgrund der Ausgestaltung als
einkommensunabhängige Leistung (außer es handelt sich
Richtig abstrus wird es, wenn man ein wichtiges Argument um Grundsicherungsempfänger) von erheblichen Mitnah-
der Befürworter des Betreuungsgeldes genauer unter die meeffekten ausgehen. Das Volumen der notwendigen Aus-
Lupe nimmt: Die neue Geldleistung als eine Anerkennung gaben wird nach Erreichen aller potenziell in Frage kommen-
der Betreuungs- und Erziehungsleistungen innerhalb der den »Betreuungsgeldkinder« (das wird im Juli 2015 der Fall
Familien, wenn man keine außerfamilialen, öffentlich geför- sein) im Lichte der derzeit erkennbaren Inanspruchnahme
derten Angebote nutzt. bis auf 2 Mrd. Euro ansteigen. Geld, das man wesentlich
sinnvoller einsetzen könnte.
Wenn man das Argument ernst nimmt, dass die elterliche
Erziehungsleistung innerhalb der Familie mit dieser Geldleis-
tung eine zusätzliche Anerkennung finden soll, dann ist die Literatur
tatsächlich aber vorgenommene Regelung, dass die Eltern,
Sell, St. (2014), Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung vom Kopf auf
die sich im Hartz-IV-Bezug befinden, also im SGB-II-Grund- die Füße stellen. Das Modell eines »KiTa-Fonds« zur Verringerung der
sicherungssystem, von der (eigentlich unbedingten) Zusätz- erheblichen Unter- und Fehlfinanzierung der Kindertagesbetreuung in
Deutschland, Remagener Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe 07-2014,
lichkeit dieser Leistung nichts haben, weil ihnen nämlich das Remagen.
Betreuungsgeld auf die SGB-II-Leistungen angerechnet wird,
logisch nicht wirklich nachvollziehbar. Erbringen etwa die El- Wirth, H. und A. Tölke (2013), »Egalitär arbeiten – familienzentriert leben:
Kein Widerspruch für ostdeutsche Eltern«, Informationsdienst Soziale Indi-
tern, die sich in Grundsicherungsbezug befinden, keine Er- katoren (ISI) (49), 7–11.
ziehungsleistung, die doch zusätzlich honoriert werden soll?
Diese Restriktion ist deshalb auch fragwürdig, weil das Be-
treuungsgeld ja gerade keine einkommensabhängige Leis-
tung ist, somit alle Familien, die die formalen Voraussetzungen
erfüllen, einen Anspruch auf diese Leistung haben, also auch
die Familien, die über ein hohes bzw. sehr hohes Einkommen
verfügen. Aber gerade bei denjenigen, die nun über die nied-
rigsten Einkommen verfügen, wird die Leistung gleichsam
gekappt, indem sie verrechnet wird mit einer anderen staat-
lichen Leistung. Das hat keinen logischen Sinn, sondern er-
scheint eher wie eine Bestrafungsaktion der »Hartz-IV-Eltern«,
die tief blicken lässt hinsichtlich des Familienbildes.
Darüber hinaus ist die Argumentation, dass hier die Erzie-
hungsleistung innerhalb der Familie durch die Eltern ho-
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 201514 Zur Diskussion gestellt
Zielkonflikte
Die theoretischen Anreizwirkungen des Betreuungsgeldes
liegen auf der Hand. Wenn ein staatlicher Transfer unter der
Bedingung gezahlt wird, dass ein Kind privat betreut wird,
erhöhen sich damit indirekt die Fixkosten der Erwerbstätig-
keit mindestens eines, üblicherweise des schlechter verdie-
nenden, Elternteils. Ab einem bestimmten Einkommen spie-
len diese Fixkosten keine Rolle mehr, da die Verdienstmög-
lichkeiten und damit Opportunitätskosten zu hoch sein dürf-
ten, als dass sich ein Verzicht auf Erwerbstätigkeit zuguns-
Miriam Beblo* ten der Betreuung des Kindes zuhause auszahlte (ein
anderes, ohnehin nicht erwerbstätiges Familienmitglied, wie
Großmutter oder Großvater, könnte jedoch hierfür zur Ver-
fügung stehen). Für Gering- oder Nichtverdienende ist das
Betreuungsgeld ebenfalls uninteressant, da es als vorran-
Das Betreuungsgeld: Weder modern gige Leistung ausgezahlt und auf andere Leistungen wie
noch nachhaltig Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinderzuschlag ange-
rechnet wird. Für Einkommensgruppen im unteren Mittelfeld
Hintergrund dagegen oder Nichterwerbstätige ohne Leistungsbezug
(z.B. solche Ehefrauen, denen in der Bedarfsgemeinschaft
Unter dem Stichwort der »Wahlfreiheit« wurde im Jahr 2013 mit ihrem gut verdienenden Ehemann kein Arbeitslosengeld
parallel zum Ausbau der öffentlichen Kindertageseinrich- II zusteht) kann das Betreuungsgeld jedoch eine attraktive
tungen das Betreuungsgeld eingeführt. Seitdem haben El- Nebeneinkunft darstellen und die Wahrscheinlichkeit der
tern von mindestens einjährigen Kindern entweder den Aufgabe einer Erwerbstätigkeit erhöhen bzw. Aufnahme ei-
Anspruch auf eine öffentlich geförderte Tageseinrichtung
ner Erwerbstätigkeit verringern.
bzw. öffentlich finanzierte Tagespflegeperson oder aber auf
ein Betreuungsgeld, wenn sie sich dafür entscheiden, die
Das erklärte Ziel des schon im Jahr 2007 eingeführten El-
formale frühkindliche Förderung nicht in Anspruch zu neh-
terngeldes und der sukzessive ausgebauten Betreuungsin-
men. Mit einem Betrag von 100 Euro pro Monat für jedes
frastruktur (der Rechtsanspruch für dreijährige Kinder be-
privat betreute Kind im zweiten Lebensjahr werden Eltern
steht schon seit 1996) war es ja gerade, insbesondere Müt-
in diesem Fall ab August 2013 direkt finanziell unterstützt.
tern einen Anreiz für den früheren Wiedereinstieg ins Er-
Seit August 2014 beträgt das Betreuungsgeld 150 Euro;
werbsleben zu bieten.
Anspruch haben nun auch Eltern mit Kindern im dritten
Lebensjahr.
Aus familienökonomischer Sicht verbessert sich durch eine
gleichmäßigere Erwerbseinbindung und Einkommenserzie-
Laut Website des BMFSFJ (2013) stellt das Betreuungs-
lung beider Elternteile die relative Verhandlungsposition der
geld »eine neue Anerkennung und Unterstützung für Eltern
Frauen innerhalb der Partnerschaft. Empirische Studien zei-
mit Kleinkindern dar, die ihre vielfältigen Betreuungs- und
gen, dass familiale Entscheidungen nicht nur vom Einkom-
Erziehungsaufgaben in der Familie oder im privaten Umfeld
men der Familie insgesamt, sondern maßgeblich auch vom
erfüllen.« Es schließt die »Lücke im Angebot staatlicher
persönlichen Einkommen abhängen (vgl. Überblick in Beb-
Förder- und Betreuungsangebote für Kinder bis zum drit-
lo und Boll 2014a). Wenn nun wegen des Betreuungsgeldes
ten Lebensjahr« und bietet Eltern damit eine »echte Wahl-
v.a. Frauen ihre Erwerbstätigkeit über das typischerweise in
und Gestaltungsfreiheit bei der Betreuung ihrer Kinder«.
Wird das Instrument Betreuungsgeld diesen Zielen tat- Anspruch genommene erste Elterngeldjahr hinaus unterbre-
sächlich gerecht? Und wie wirkt sich die Wahl- und Ge- chen, statt wieder in den Beruf einzusteigen, bleibt die Er-
staltungsfreiheit längerfristig auf die Erwerbs- und Ver- werbseinbindung und Einkommenserzielung auf längere
dienstchancen der Mütter und Väter aus – im Sinne einer Sicht ungleich zwischen den Elternteilen verteilt. Das Ins
nachhaltigen Familienpolitik? Dies diskutiere ich im Fol- trument Elterngeld und das noch nicht in Kraft getretene
genden aus theoretischer und empirischer, v.a. intrafami- neue ElterngeldPlus wirken eher auf eine gleichmäßigere
lialer, Perspektive. Beteiligung der Partner am Erwerbsleben sowie Verteilung
von Hausarbeit und Kinderbetreuung innerhalb des Paares
hin. Das ökonomische Verhandlungsgefüge zwischen Vater
* Prof. Dr. Miriam Beblo ist Inhaberin der Professur für Volkswirtschaftsleh- und Mutter wird damit sozusagen neu sortiert. Das Instru-
re, insbesondere Arbeitsmarkt, Migration, Gender, am Fachbereich Sozi-
alökonomie der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der
ment Betreuungsgeld verstärkt dagegen die traditionelle
Universität Hamburg. Asymmetrie.
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 2015Zur Diskussion gestellt 15
Nun wirken die angesprochenen familienpolitischen Leis- Auch die Mikrosimulationsstudie von Beninger et al. (2010)
tungen nicht isoliert voneinander, sondern sie sind einge- bestätigt, dass das Betreuungsgeld wesentlich geringere
bunden in ein ganzes Geflecht von familien-und ehebezo- Auswirkungen auf hochqualifizierte Frauen mit hohem Ein-
genen Leistungen, welche das Verhalten von Familien kommen als auf gering qualifizierte Frauen mit geringem
wechselseitig beeinflussen können (vgl. hierzu die Evalua- Einkommen hätte (sowohl in Bezug auf ihre Inanspruchnah-
tionsergebnisse in Bonin et al. 2014). Und so stehen die me formaler Kinderbetreuung als auch auf ihre Erwerbsbe-
Instrumente nicht nur jeweils für sich gesehen in einem Ziel- teiligung), insbesondere solche im zweiten Einkommens-
konflikt zueinander, sondern sie entfalten insbesondere im quartil. Die Effekte auf Mütter polarisieren somit stark. Die
Zusammenwirken mit anderen ehebezogenen Leistungen Studie bestätigt außerdem die hochgradig geschlechtsspe-
zusätzliche entgegengesetzte Anreizwirkungen. Hier wäre zifische Wirkung des Betreuungsgeldes, da es fast aus-
vor allem das Ehegattensplitting zu nennen, das schon für schließlich von Müttern genutzt würde.
sich genommen die oben angesprochene traditionelle
Asymmetrie innerhalb der Ehe (zwischen Hauptverdiener Die Mikrosimulationsstudie von Müller und Wrohlich (2014),
und Nebenverdienerin) begünstigt. Während dem Paar in welche als einzige die Einführung beider Maßnahmen, Rechts-
dem einen Fall (bei Inanspruchnahme des Elterngeldes anspruch und Betreuungsgeld, gleichzeitig berücksichtigt,
durch beide Elternteile und schnellen Wiedereinstieg in den zeigt schließlich, dass die Kombination zu einem geringfügigen
Beruf) durch die bewirkte Annäherung der Partnereinkom- Anstieg sowohl des Anteils an Kindern (ein bis drei Jahre), die
men Steuervorteile aus dem Ehegattensplitting verloren ge- eine öffentliche Kita besuchen, als auch des Arbeitsangebots
hen, können sie nämlich in dem anderen Fall (bei Inan- der Mütter dieser Kinder führt. Beim Rechtsanspruch allein
spruchnahme des Betreuungsgeldes durch nur ein Eltern- (ohne gleichzeitige Einführung des Betreuungsgeldes) wären
teil) wieder generiert werden. entsprechend der Kitabesuch um fast 2% und die durch-
schnittlichen Arbeitsstunden um fast 6% gestiegen. Die allei-
nige Einführung des Betreuungsgeldes (ohne Anspruch auf
Evidenz Kita-Platz) hätte den Kitabesuch um 1,5% und die Stunden
um fast 3% reduziert. Wegen der Leistungsanrechnung des
Haben sich die theoretisch abgeleiteten Anreizwirkungen des Betreuungsgeldes ist gemäß dieser Studie interessanterweise
Betreuungsgeldes in der Praxis bewahrheitet? Um diese Fra- der positive Effekt des Rechtsanspruchs gerade für Mütter mit
ge zu beantworten, benötigen wir idealerweise eine Evalua- geringer Bildung und niedrigem Einkommen größer.
tionsstudie. Die zeitgleiche Einführung zweier familienpoliti-
scher Maßnahmen für ein und denselben Adressatenkreis Dies sind, wie gesagt, Schätzergebnisse auf Basis von Ver-
– der Rechtsanspruch auf eine formale Kinderbetreuung und haltensparametern, die mit Ex-ante-Daten ermittelt und fort-
das Betreuungsgeld bei Nicht-Inanspruchnahme dieser Kin- geschrieben wurden. Nur so scheint momentan eine Tren-
derbetreuung – erschwert allerdings eine Evaluation ihrer je- nung der Auswirkungen von den beiden sich gegenseitig
weiligen Wirkmacht erheblich. Die einzigen mir bisher be- ausschließenden Leistungen, nämlich Infrastruktur- und
kannten empirischen Zugänge, die eine erste empirische Geldansprüchen, methodisch möglich zu sein. Im Gegensatz
Abschätzung der Verhaltenseffekte erlauben, bieten eine Be- dazu konnte die Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007
fragung unter jungen Eltern zu ihren Wünschen nach einer vergleichsweise problemlos evaluiert werden: Bisherigen
öffentlichen Kinderbetreuung durch das Deutsche Jugendin- Analysen zufolge sind Mütter mit dem Elterngeld im ersten
stitut (DJI 2014) sowie die Mikrosimulationsstudien mit struk- Jahr zwar seltener, dafür aber im zweiten Jahr häufiger er-
turellen Verhaltensmodellen von Beninger et al. (2010) und werbstätig (vgl. Kluve und Tamm 2013, Wrohlich et al. 2012).
Müller und Wrohlich (2014). Alle drei geben jedoch nur ex Das neue ElterngeldPlus wird aller Voraussicht nach die Aus-
ante Hinweise, da sie auf Daten basieren, die vor Einführung zeiten weiter verkürzen und stattdessen Anreize zur Aufnah-
des Betreuungsgeldes erhoben wurden. me einer Teilzeittätigkeit von Beginn der Elternzeit an setzen
(weil es die finanziellen Einbußen für Teilzeitarbeit vermeidet
Mit Hilfe des DJI-Survey »Aufwachsen in Deutschland: All- und Anreize für eine gleichzeitige Teilzeit + Elternzeit beider
tagswelten« (AID:A) und der darauf aufsetzenden jährlich Elternteile gibt) (vgl. Beblo und Boll 2014b). Dadurch werden
wiederholten Elternbefragung im Rahmen der Kinderförde- die Beschäftigungsfähigkeit von Müttern erhöht und unter-
rungsgesetz-(KiFöG-)Evaluation wurden insbesondere die brechungsbedingte Lohneinbußen in der längeren Frist min-
schichtspezifische Unterschiede bei den Betreuungswün- destens verringert.
schen untersucht. Demnach fragen v.a. die oberen Schich-
ten formale Kinderbetreuung für unter Dreijährige nach – Zusammengefasst scheint sich also auch empirisch – bei
insbesondere wenn die Eltern unverheiratet sind und eine aller Vorsicht wegen der schwierigen Datenlage – die theo-
hohe Bildung haben (DJI 2014). Deshalb hätte eine alterna- retische Prognose zu bestätigen, dass den positiven Er-
tive Geldleistung wie das Betreuungsgeld für diese Gruppen werbsanreizen des Elterngeldes und der Kinderbetreuungs-
vermutlich wenig Bedeutung. infrastruktur die negativen Anreizwirkungen des Betreuungs-
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 201516 Zur Diskussion gestellt
geldes entgegenstehen. Im Saldo werden damit die quan- staltungsfreiräume bei der Erwerbs- und Familienarbeit ge-
titativ bedeutsamen positiven Erwerbseffekte für Frauen ben und v.a. auch eine gleichmäßigere Aufteilung zwischen
reduziert und die nachhaltige Verbesserung ihrer ökonomi- den Geschlechtern stimulieren sollen (Beispiele Elterngeld,
schen Verhandlungspositionen verhindert. ElterngeldPlus, Kitaplatz), scheint sie die Erreichung dieser
Ziele auf der anderen Seite, durch das zum Teil zeitgleich
eingeführte Betreuungsgeld und die gemeinsame steuerli-
Relevanz che Veranlagung von Ehegatten, wieder zu konterkarieren.
Allen Erwartungen zum Trotz scheint die Nachfrage nach Angesichts der geringen Inanspruchnahme des Betreuungs-
dem Betreuungsgeld bisher eher gering: Im Jahr der Ein- geldes mag man geneigt sein, die Debatten um dieses Ins-
führung, 2013, habe der Bund dafür nur knapp 16,9 der trument als »viel Lärm um nichts« abzutun. Andererseits
insgesamt 55 Mio. Euro ausgegeben, hieß es vom Bundes- scheint die familienpolitische »Strategie«, ein Nebeneinander
familienministerium.1 Allerdings steigen die Bezüge von Be- diametral entgegengesetzt wirkender Politikinstrumente, zu-
treuungsgeld laut Pressemitteilung des Statistischen Bun- mindest in einer Hinsicht in die gleiche Richtung zu weisen.
desamtes (2014) an. Im zweiten Quartal 2014 beispielswei- Sie erzeugt nämlich gleichgerichtete Verteilungseffekte und
se wurden schon um etwa 50% mehr Leistungsbezüge ge- führt längerfristig – neben einer stärkeren Bildungsungleich-
meldet als im ersten Quartal. Nach der Statistik der Leis- heit unter den Kindern – zu einer stärkeren Einkommensun-
tungsbezüge (vgl. Statistisches Bundesamt 2015) wird das gleichheit unter den Eltern (nämlich zwischen den Eltern-
Betreuungsgeld dabei zu 95% von Müttern bezogen, wobei geld- und Kitanutzern und den Betreuungsgeldbeziehern).
der Anteil an männlichen Beziehern im Ländervergleich bis Auf der einen Seite verstetigen diejenigen Instrumente, die
zu 11% betragen kann. Das Betreuungsgeld ist außerdem Müttererwerbsarbeit fördern (Elterngeld, Kitaplatz) v.a. die
ein eindeutig westdeutsches Instrument: Im früheren Bun- Einkommensgewinne der einkommensstärkeren gehobe-
desgebiet wird nicht nur der Großteil der Anträge gestellt, nen Mittelschichtfrauen. Zu den Gewinnerinnen gehören al-
es wünschen auch 80% und damit doppelt so viele der An- so höher qualifizierte, besser verdienende Frauen. Sie ge-
tragstellerinnen wie in den neuen Ländern den maximal winnen nicht nur absolut an Einkommen, sondern sie ver-
möglichen Bezugszeitraum von 22 Monaten. bessern auch ihre intrafamiliale Position gegenüber ihren
Partnern. Auf der anderen Seite verstärken Instrumente, die
Die Statistik der Leistungsbezüge gibt auch Hinweise auf die Erwerbsarbeit von Müttern hemmen (Betreuungsgeld)
die weiter oben angesprochene Interaktion mit anderen ehe- eine Abkoppelung insbesondere der Einkommensschwä-
und familienpolitischen Leistungen. Demnach sind verhei- cheren vom Arbeitsmarkt. Die Verliererinnen sind demnach
ratete Elternpaare – wie schon theoretisch vermutet – über- die niedriger qualifizierten und geringer verdienenden Frau-
proportional vertreten unter den Beziehern und dies umso en. Diese verlieren langfristig nicht nur an Einkommen, son-
mehr, je länger die voraussichtliche Bezugsdauer des Be- dern auch an Verhandlungsposition und verstetigen somit
treuungsgeldes ist. die Abhängigkeit von ihren (Ehe-)Männern.
Wie die Autorinnen Fogli und Veldkamp (2011) zeigen, wird
Fazit der gesellschaftliche Lernprozess darüber, wie Kinder sich
auch (oder gerade) bei Erwerbstätigkeit ihrer Mütter entwi-
Das Betreuungsgeld soll Eltern im Namen der Wahlfreiheit ckeln, vor allem dadurch befördert, dass Frauen das Verhal-
bei Nichtinanspruchnahme eines Kitaplatzes für die ihnen ten anderer Mütter und Kinder in ihrer unmittelbaren Umge-
entgangenen staatlichen Subventionen kompensieren. bung beobachten. Welche Lerneffekte sollen wir nun ange-
Müssten nach derselben Logik nicht all diejenigen, deren sichts der zu erwartenden Polarisierung der Erwerbseinbin-
Kinder sich nicht für ein Abitur und anschließendes Studium dungen und Verdienstmöglichkeiten von hoch- und gering-
entscheiden, für die entgangene fiskalische Förderung ent- qualifizierten Frauen erwarten?
schädigt werden und stattdessen Geldleistungen erhalten?
Die Anreiz- und Verteilungseffekte wären vermutlich die glei-
chen wie beim Betreuungsgeld – wenn auch weniger ge- Literatur
schlechtsspezifisch ausgeprägt.
Beblo, M. und C. Boll (2014a), »Ökonomische Analysen des Paarverhaltens
aus der Lebensverlaufsperspektive und politische Implikationen«, Familien-
Während die Familienpolitik auf der einen Seite also gesetz-
politische Maßnahmen in Deutschland – Evaluationen und Bewertungen,
liche Rahmenbedingungen schafft, die den Eltern mehr Ge- Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 83(1), 121–144.
1
Demgegenüber steht der Befund, dass die Betreuungsquote (in Tages- Beblo, M. und C. Boll (2014b), »Die neuen Elterngeld-Komponenten: Will
einrichtungen) für Kinder unter drei Jahren von März 2013 bis März 2014 Money Trump Gender?«, Wirtschaftsdienst (8), 564–569.
deutschlandweit durchschnittlich um 3 Prozentpunkte gestiegen ist und
dass die Differenz zwischen geäußertem Betreuungsbedarf und Betreu- Beninger, D., H. Bonin, J. Hortsschräer und G. Mühler (2010), »Wirkungen
ungsquote 9,2 Prozentpunkte beträgt (BMFSFJ 2015). eines Betreuungsgeldes bei bedarfsgerechtem Ausbau frühkindlicher Kin-
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 2015Zur Diskussion gestellt 17
dertagesbetreuung: Eine Mikrosimulationsstudie«, Vierteljahrshefte zur
Wirtschaftsforschung 79(3), 147–168.
BMFSFJ (2013), Website des Ministeriums, Eintrag Betreuungsgeldgesetz,
11. September 2013, verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/fami-
lie,did=200354.html, aufgerufen am 2. Juni 2015.
BMFSFJ (2015), Fünfter Bericht zur Evaluation des Kinderförderungsge-
setzes, Kurzfassung. Berlin.
Bonin, H., C.K. Spieß, H. Stichnoth und K. Wrohlich (Hrsg.) (2014), Famili-
enpolitische Maßnahmen in Deutschland – Evaluationen und Bewertun-
gen, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 83(1).
DJI (2014), Empirische Daten und Analysen zur Wirkung des Betreuungs-
geldes, Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts, Februar.
Fogli, A und L. Veldkamp (2011), »Nature or Nurture? Learning and the Geo-
graphy of Female Labor Force Participation«, Econometrica 79(4), 1103– Notburga Ott*
1138.
Kluve, J. und N. Tamm (2013), »Parental Leave Regulations, Mothers‘ Labor
Force Attachment and Fathers‘ Childcare Involvement: Evidence from a
Natural Experiment«, Journal of Population Economics 26(3), 983–1005.
Zurück in die 1960er: Zankapfel
Betreuungsgeld
Müller, K.-U. und K. Wrohlich (2014), »Two Steps Forward - One Step Back?
Evaluating Contradicting Child Care Policies in Germany«, DIW Discussion
Papers 1396. Mal wieder wird ein Thema heiß diskutiert und ein ideologi-
Statistisches Bundesamt (2014), »Betreuungsgeld für 224 400 Kinder«, scher Gegensatz hochstilisiert, den wir endlich überwunden
Pressemitteilung Nr. 294, 20. August. glaubten und der beim Großteil der Bevölkerung längst
Statistisches Bundesamt (2015), Statistik der Leistungsbezüge (Statistik schon keiner mehr ist: Diejenigen, die Kleinkinder am besten
zum Betreuungsgeld – Leistungsbezüge 4. Vierteljahr 2014), Wiesbaden. ausschließlich bei der Mutter aufgehoben sehen, sind für
Wrohlich, K., E. Berger, J. Geyer, P. Haan, D. Sengül, C. K. Spieß und A.
das Betreuungsgeld, die anderen, die dagegen sind, miss-
Thiemann (2012), Elterngeld Monitor, Endbericht zum Forschungsprojekt trauen der familiären Erziehung und wollen Mütter am Ar-
im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, DIW, Berlin.
beitsmarkt sehen. Dafür wird eine Vielzahl von Argumenten
ins Feld geführt, die überwiegend einer nüchternen Betrach-
tung nicht standhalten.
Das Betreuungsgeld ist im Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz (BEEG, §§4a–4d) verankert. Danach erhalten El-
tern ab dem 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes (bis
zu) 150 Euro monatlich, wenn sie den Rechtsanspruch auf
Förderung in Tageseinrichtungen oder Tagespflege nach §24
SGB VIII nicht in Anspruch nehmen.
Die Argumente der Politik zur Einführung waren die »Aner-
kennung und Unterstützung der Erziehungsleistung von El-
tern mit Kleinkindern«, die Verbesserung der »Wahlfreiheit
von Vätern und Müttern« und die Schließung der »verblie-
bene(n) Lücke im Angebot staatlicher Förder- und Betreu-
ungsangebote für Kinder bis zum dritten Lebensjahr« (BT-
Drs. 17/9917). Die Opposition bemängelt die Verletzung
gleichstellungspolitischer Ziele und die der Chancengleich-
heit von Kindern aus benachteiligten Elternhäusern. Von Sei-
ten der Wirtschaft werden negative Effekte auf das Arbeits-
angebot und die negativen Folgen unterbliebener frühkind-
licher Förderung bestimmter Bevölkerungsgruppen betont.
Die Familienverbände sind sich uneins in ihrer Prioritätenset-
zung für einen weiteren Kita-Ausbau oder Verbesserung der
monetären Anerkennung familialer Leistungen, lehnen aber
* Prof. Dr. Notburga Ott ist Inhaberin des Lehrstuhls für Sozialpolitik und
Institutionenökonomik an der Ruhr-Universität Bochum.
ifo Schnelldienst 11/2015 – 68. Jahrgang – 11. Juni 2015Sie können auch lesen