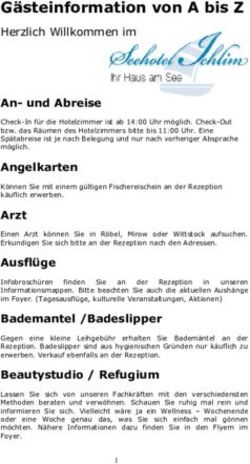Deutsch - Q-Phase Grundkurs Abitur 2019 - Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für das Fach - Webflow
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für das
Fach
Deutsch – Q-Phase Grundkurs
Abitur 2019
Stand: Januar 2018
1Fach Deutsch - Grundkurs
Jahrgangsstufe Q1/Q2, Abiturjahrgang 2018/2019
Stand: Januar 2018
Qualifikationsphase 1
1. Unterrichtsvorhaben
Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel des Theaters – Epochenumbruch 18./19.Jh.
Vorschlag der Fachkonferenz: Emilia Galotti (Gotthold Ephraim Lessing) / Kabale und Liebe (Friedrich Schiller)
Iphigenie auf Tauris (Johann Wolfgang von Goethe)
Projekt (optional): Theaterbesuch
Inhaltliche Schwerpunkte: Übergreifende Kompetenzerwartungen: Die SuS können…
Sprache: Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung REZEPZION:
Texte: strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen Strategien und Techniken des Textverstehens unter Nutzung von
historischen Kontexten, komplexe auch längere Sachtexte Fachwissen in Bezug auf mündliche und schriftliche Texte in
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, verschiedenen medialen Erscheinungsformen reflektiert anwenden,
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen selbständig Texte mithilfe von textimmanenten und textübergreifenden
Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes Verfahren analysieren die Analyseergebnisse überprüfen und in einer
schlüssig, differenzierten Deutung zusammenführen
sprachliche Gestaltungsmittel, Texte, kommunikatives Handeln und
mediale Gestaltung in historisch-gesellschaftliche Entwicklungslinien
einordnen
PRODUKTION
komplexe Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen planen,
gestalten, reflektieren und das Produkt überarbeiten,
formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch angemessen eigene
schriftliche und mündliche Texte dem kommunikativen Ziel
entsprechend formulieren
Empfohlene Lehrmittel/ Materialien/ Methoden: Didaktisch-methodische Anmerkungen und Empfehlungen der
Oberstufenbuch: TTS Cornelsen Fachkonferenz:
Paul D (Schöningh) Aufbau einer Dramenanalyse (Monolog- oder Dialoganalyse)
Analyse von Sekundärtexten (z.B. Kabale und Liebe: Safranski Verfassen von Deutungshypothesen
„Absolutismus der Liebe“) Strukturierung einer Klausur
Auszüge aus weiteren Primärtexten der jeweiligen Autoren (z.B. Schiller Übung mit Klausurtexten (Orientierung an alten Abiturklausuren +
„Über das Erhabene“, Büchner „Hessischer Landbote“) Besprechung der Erwartungshorizonte)
2 Szenisches Lesen Epochenzugehörigkeit
Standbilder bürgerliches Trauerspiel
Um- bzw. Weiterschreiben einer Szene (optional)
Gestaltender Vortrag von Texten (Fokus Gestaltung)
Rezension zu einer Bühneninszenierung
filmische Umsetzungen/Analyse von Filmsequenzen
Inhaltsfeld Konkretisierte Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
Die Schülerinnen und Schüler können…
REZEPTION:
Wirkung sprachlicher Elemente unterscheiden und erläutern
Sprachliche Gestaltungsmittel identifizieren und in ihrer Bedeutung für Aussage und Wirkung beurteilen
Sprache
PRODUKTION:
Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen
Sprechgestaltende Mittel einsetzen
Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formulieren
REZEPTION:
Drama in Bezug auf seine gattungstypischen Gestaltungsformen analysieren und deuten
Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung in Texten beurteilen
literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesellschaftliche Entwicklungen einordnen und die Möglichkeit und
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen.
PODUKTION:
komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag interpretieren,
Texte
Schreibprozesse reflektieren – Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags beschreiben und die besonderen
Herausforderungen identifizieren
Verschiedene Textmuster zielgerichtet anwenden (bei analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten und beim
produktionsorientierten Schreiben)
in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Unter- suchungsverfahren darstellen und in einer
eigenständigen Deutung zusammen- führen
REZEPTION:
Eigene und fremde Unterrichtsbeiträge kriteriengeleitet in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten (Gespräch, Diskussionen,
Feedback zu Präsentationen) beurteilen
Die Darstellung von Gesprächssituationen in literarischen Texten unter Beachtung von kommunikationstheoretischen Aspekten analysieren
Kommunikation
verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation identifizieren und
beurteilen.
PRODUKTION:
sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und zielführend auf andere beziehen,
3Mimik, Gestik, Artikulation in eigenen komplexen Redebeiträgen funktional einsetzen
REZEPTION:
die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer ästhetischen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer
erläutern.
Medien
PRODUKTION:
Feedback zu medialen Aufbereitungen – funktionale Medienverwendung in konstruktivem, kriterienorientierten Feedback beurteilen
mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge präsentieren,
Klausur(empfehlung): Typ IA: Analyse eines literarischen Textes mit weiterführendem Schreibauftrag - Szenenanalyse
2. Unterrichtsvorhaben
Lyrische Texte zu einem Themenbereich im historischen Längsschnitt (Teil 1): Lyrik der Romantik
Vorschlag der Fachkonferenz: Motive Liebe, Reise, Natur
Inhaltliche Schwerpunkte: Übergreifende Kompetenzerwartungen: Die SuS können…
Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel selbständig Texte mithilfe von textimmanenten und textübergreifenden
Texte: lyrische Texte zu einem Themenbereich aus unterschiedlichen Verfahren analysieren die Analyseergebnisse überprüfen und in einer
historischen Kontexten, komplexe auch längere Sachtexte schlüssig, differenzierten Deutung zusammenführen
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in ihrem jeweiligen
Kontext und ihrer Wirkungsabsicht vergleichend beurteilen
PRODUKTION
komplexe Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen planen, gestalten,
reflektieren und das Produkt überarbeiten,
formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch angemessen eigene
schriftliche und mündliche Texte dem kommunikativen Ziel entsprechend
formulieren
Empfohlene Lehrmittel/ Materialien/ Methoden: Didaktisch-methodische Anmerkungen und Empfehlungen der
TTS Fachkonferenz:
Paul D Epochenzugehörigkeit
Lehrbuchunabhängige Arbeitsmaterialien Leitfaden zur Interpretation lyrischer Texte
Kreative Zugänge zur Lyrik ( z.B. Parallelgedichte verfassen, Grundbegriffe zur Lyrik (metrische und strophische Formen)
Verfassen von Gedichten, Verfremdungen etc.) Heine
Auseinandersetzung mit Vertonungen (z.B. von Oliver Steller)/Schulung Textauszüge zum Thema Weltsicht der Romantik (Philosophie, Poetologie)
des Hörvermögens
szenischer/gestaltender Vortrag
Inhaltsfeld Konkretisierte Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
Die Schülerinnen und Schüler können …
Sprache REZEPTION:
grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen,
sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung
4erläutern und diese kriterienorientiert beurteilen.
PRODUKTION:
Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formulieren,
selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien u. a. stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit beurteilen
Texte REZEPTION:
aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese für die Textrezeption nutzen,
lyrische Texte unter besonderer Berücksichtigung der Formen des lyrischen Sprechens analysieren,
literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesellschaftliche Entwicklungen einordnen und die Möglichkeit und
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen,
an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutigkeit von Texten sowie die Zeitbedingtheit von Rezeption und Interpretation reflektieren,
PRODUKTION:
in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Unter- suchungsverfahren darstellen und in einer
eigenständigen Deutung zusammen- führen,
komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag interpretieren,
komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren
Kommunikation REZEPTION
den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert verfolgen,
verschiedene Mittel der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation identifizieren und beurteilen.
PRODUKTION:
Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback
formulieren.
Medien REZEPTION:
PRODUKTION:
die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und eigene Präsentationen entsprechend
überarbeiten.
Klausur(empfehlung): Typ IA: Analyse eines literarischen Textes mit weiterführendem Schreibauftrag - Gedichtanalyse
3. Unterrichtsvorhaben
Traditionen und Traditionsbrüche in Literatur und Gesellschaft am Beispiel ausgewählter Kurzprosa
Heinrich von Kleist: Die Marquise von O.
Judith Hermann: Sommerhaus, später und weitere aktuelle Kurzprosa
Projekt (optional): Filmanalyse
Inhaltliche Schwerpunkte: Übergreifende Kompetenzerwartungen: Die SuS können…
Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel REZEPTION
Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen Strategien und Techniken des Textverstehens unter Nutzung von
5historischen Kontexten, komplexe auch längere Sachtexte Fachwissen in Bezug auf mündliche und schriftliche Texte in
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext verschiedenen medialen Erscheinungsformen reflektiert anwenden,
Medien: ggf. filmisches Erzählen/Analyse von Filmsequenzen unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in ihrem jeweiligen
Kontext und ihrer Wirkungsabsicht vergleichend beurteilen
PRODUKTION
Formen des Sprechens in verschiedenen Kommunikationssituationen
unterscheiden und Beiträge adressatenbezogen und zielgerichtet
gestalten,
selbstständig Rückmeldungen konstruktiv und differenziert formulieren.
Empfohlene Lehrmittel/ Materialien/ Methoden: Didaktisch-methodische Anmerkungen und Empfehlungen der Fachkonferenz:
TTS Hinterfragung der Epochenzugehörigkeit
Paul D Grundbegriffe zur Epik
Auszüge aus Rohmer, „Marquise von O.“ (Verfilmung) Erzähltheorie
Weitere Primärtexte bzw. Textauszüge von Kleist (z.B. Briefe etc.) Leitfaden zur Interpretation von Erzähltexten
Freud: Instanzenmodell Leitfaden zur Interpretation von Sachtexten
Sekundärtexte
Inhaltsfeld Konkretisierte Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
Die Schülerinnen und Schüler können …
Sprache REZEPTION:
grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen,
sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung
erläutern und diese kriterienorientiert beurteilen.
PRODUKTION:
Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formulieren,
selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien u. a. stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit beurteilen
und überarbeiten,
Sprachliche Darstellung beurteilen und überarbeiten
Texte REZEPTION:
aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese für die Textrezeption nutzen,
strukturell unterschiedliche erzählende Texte unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypischen
Gestaltungsform analysieren,
literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesellschaftliche Entwicklungen – von der Aufklärung bis zum 21.
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit und Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen,
die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten anhand von Merkmalen erläutern,
PRODUKTION:
in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Unter- suchungsverfahren darstellen und in einer
eigenständigen Deutung zusammen- führen,
ihr Textverständnis durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen,
6komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren,
Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags beschreiben, besondere fachliche Herausforderungen identifizieren und
Lösungswege reflektieren,
Kommunikation REZEPTION:
sprachliches Handeln in Alltagssituationen und in seiner Darstellung in literarischen Texten unter besonderer Berücksichtigung des
kommunikativen Kontextes analysieren,
PRODUKTION:
sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und zielführend auf andere beziehen,
Medien REZEPTION:
die filmische Umsetzung einer Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer unter
Einbezug medientheoretischer Ansätze erläutern,
PRODUKTION:
Klausur(empfehlung): Typ IA: Analyse eines literarischen Textes mit weiterführendem Schreibauftrag – Szenenanalyse
Typ IIA: Analyse eines Sachtextes mit weiterführendem Schreibauftrag
4. Unterrichtsvorhaben
Das Verhältnis von Sprache, Denken und Wirklichkeit
Spracherwerbsmodelle
Inhaltliche Schwerpunkte: Übergreifende Kompetenzerwartungen: Die SuS können…
Sprache: Spracherwerbsmodelle REZEPTION
Texte: komplexe auch längere Sachtexte Strategien und Techniken des Textverstehens unter Nutzung von
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen
Fachwissen in Bezug auf mündliche und schriftliche Texte in
Medien
verschiedenen medialen Erscheinungsformen reflektiert anwenden,
selbstständig eigene und fremde Beiträge und Standpunkte fachlich
kompetent überprüfen und differenziert beurteilen
PRODUKTION
eigene Positionen zu fachspezifischen Sachverhalten vor dem Hintergrund
ihres Fachwissens formulieren und argumentativ vertreten
Empfohlene Lehrmittel/ Materialien/ Methoden: Didaktisch-methodische Anmerkungen und Empfehlungen der Fachkonferenz:
TTS Leitfaden zur Sachtextanalyse
Paul D Analyse diskontinuierlicher Texte
Sapir/Whorf „Linguistische Relativitätstheorie“ Aufbau/Struktur Erörterung
Dieter E. Zimmer „Wiedersehen mit Whorf“ verschiedene Diskussionsformen (z.B. Talkshow, heißer Stuhl)
Nietzsche „Lügen im außermoralischen Sinn“ Kurzvorträge von Arbeitsergebnissen
7 Mauthner „Missverstehen durch Sprache“
Übersichten: Spracherwerbsmodelle (u.a. behavioristisch, nativistisch,
kognitivistisch, interaktionistisch)
Leßmöllmann, „Raus aus der Sprache“ (Phasen des Spracherwerbs)
Inhaltsfeld Konkretisierte Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
Die Schülerinnen und Schüler können …
Sprache REZEPTION:
Funktionen der Sprache für den Menschen benennen,
grundlegende Modelle zum ontogenetischen Spracherwerb vergleichend erläutern,
PRODUKTION:
Die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese überarbeiten
Texte REZEPTION:
komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Erscheinungsform
analysieren,
die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-historischen Kontextes von Sach- texten ermitteln,
PRODUKTION:
komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag auch unter Nutzung von Visualisierungen darstellen,
komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren,
Kommunikation REZEPTION:
den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für gelingende Kommunikation auf einer
metakommunikativen Ebene analysieren und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren,
PRODUKTION:
verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien identifizieren und zielorientiert einsetzen
Medien REZEPTION:
durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medien Informationen zu fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln,
PRODUKTION
die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und eigene Präsentationen entsprechend
überarbeiten.
Klausur(empfehlung):Typ IIA: Analyse eines Sachtextes mit weiterführendem Schreibauftrag
Typ IIIA: Erörterung von Sachtexten
__________________________________________________________________________________________________________
8Qualifikationsphase 2
1. Unterrichtsvorhaben
Lyrische Texte zu einem Themenbereich im historischen Längsschnitt (Teil 2): Lyrik des Expressionismus
Vorschlag der Fachkonferenz: Motive Liebe, Reise, Natur, Stadt, Krieg, Ich-Verlust
Inhaltliche Schwerpunkte: Übergreifende Kompetenzerwartungen: Die SuS können…
Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel REZEPTION
Texte: lyrische Texte zu einem Themenbereich aus unterschiedlichen selbständig Texte mithilfe von textimmanenten und textübergreifenden
historischen Kontexten, komplexe auch längere Sachtexte Verfahren analysieren die Analyseergebnisse überprüfen und in einer
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext schlüssig, differenzierten Deutung zusammenführen
unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in ihrem jeweiligen
Kontext und ihrer Wirkungsabsicht vergleichend beurteilen
PRODUKTION
komplexe Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen planen, gestalten,
reflektieren und das Produkt überarbeiten,
verschiedene Präsentationstechniken in ihrer Funktionalität beurteilen und
zielgerichtet anwenden,
Empfohlene Lehrmittel/ Materialien/ Methoden: Didaktisch-methodische Anmerkungen und Empfehlungen der
TTS Fachkonferenz:
Paul D Epochenzugehörigkeit/historischer Hintergrund
Sekundärtexte (z.B. Susman, „Expressionismus“) Leitfaden zur Interpretation lyrischer Texte/Gedichtvergleich
Fächerübergreifend: Expressionismus in Kunst/Musik/Literatur Gedichtvergleich (epochenübergreifend)
kreative/produktionsorientierte Zugänge zu Gedichten
Besuch des Käthe-Kollwitz-Museums in Köln (optional)
Inhaltsfeld Konkretisierte Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
Die Schülerinnen und Schüler können…
Sprache REZEPTION:
Wirkung sprachlicher Elemente unterscheiden
Sprachliche Gestaltungsmittel identifizieren und in ihrer Bedeutung für Aussage und Wirkung beurteilen
PRODUKTION:
Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen
Sprachliche Darstellung beurteilen und überarbeiten
Texte REZEPTION:
Lyrik (in themat. Zusammenhang) in Bezug auf ihre Strukturmerkmale analysieren und deuten
Historisch – gesellschaftliche Bezüge der Werke aufzeigen
Den Zusammenhang von Teilaspekten und dem Textganzen zur Sicherung des inhaltlichen Zusammenhangs herausarbeiten
Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung in Texten beurteilen
PRODUKTION:
Textimmanente Ergebnisse und Textexterne Informationen in eigenen Analysetexten unterscheiden
Texte kriterienorientiert überarbeiten
Analyse durch angemessene und formal korrekte Textbelege absichern
Beschreibende, deutende, wertende Aussagen in Analysen unterscheiden
Für die zielgerichtete Überarbeitung von eigenen Texten deren Qualität kriteriengeleitet überarbeiten
9Kommunikation REZEPTION
Unterrichtsbeiträge kriteriengeleitet beurteilen (in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten – Gespräch, Diskussion, Feedback zu
Präsentation)
PRODUKTION:
Mimik, Gestik, Artikulation funktional einsetzen- in eigenen komplexen Redebeiträgen
Medien REZEPTION:
Mediale Gestaltungen zu literarischen Texten entwickeln
PRODUKTION:
Klausur(empfehlung): Typ IB: Vergleichende Analyse literarischer Texte
Typ IIIB: Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text
2. Unterrichtsvorhaben
Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel des Theaters – ein Drama des Epochenumbruchs 18./19.Jh.
Johann Wolfgang von Goethe: Faust
Projekt (optional): Theaterbesuch
Inhaltliche Schwerpunkte: Übergreifende Kompetenzerwartungen: Die SuS können…
Sprache: Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung REZEPTION
Texte: strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen sprachliche Gestaltungsmittel, Texte, kommunikatives Handeln und
historischen Kontexten, komplexe auch längere Sachtexte mediale Gestaltung in historisch-gesellschaftliche Entwicklungslinien
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, einordnen
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen selbstständig eigene und fremde Beiträge und Standpunkte fachlich
Zusammenhängen kompetent überprüfen und differenziert beurteilen.
Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes PRODUKTION
Formen des Sprechens in verschiedenen Kommunikationssituationen
unterscheiden und Beiträge adressatenbezogen und zielgerichtet
gestalten,
Empfohlene Lehrmittel/ Materialien/ Methoden: Didaktisch-methodische Anmerkungen und Empfehlungen der
Oberstufenbuch: TTS Cornelsen Fachkonferenz:
Paul D Übersicht strophische/metrische Formen, rhetorische Figuren
Handlungsübersicht/Struktur des Dramas Dramentheorie
Szenisches Lesen Übung mit Klausurtexten (Orientierung an alten Abiturklausuren +
Handlungs- und produktionsorientierte Methoden (z.B. Standbilder) Besprechung der Erwartungshorizonte)
Sekundärtexte/Rezensionen zur Bühneninszenierung Epochenzugehörigkeit
Verfilmung der Gründgens-Inszenierung (optional)
Ggf. Theaterbesuch
Inhaltsfeld Konkretisierte Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
10Die Schülerinnen und Schüler können …
REZEPTION:
Wirkung sprachlicher Elemente unterscheiden
Sprachliche Gestaltungsmittel identifizieren und in ihrer Bedeutung für Aussage und Wirkung beurteilen
Sprache
Spracherwerbsmodelle
PRODUKTION:
Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen
Sprechgestaltende Mittel einsetzen
REZEPTION:
Drama in Bezug auf seine Strukturmerkmale analysieren und deuten
Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung in Texten beurteilen
Historisch-gesellschaftliche Bezüge der Werke aufzeigen
strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten
PODUKTION:
Texte
Gestaltend vortragen
Schreibprozesse reflektieren – Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags beschreiben und die besonderen Herausforderungen
identifizieren
Verschiedene Textmuster einsetzen (bei analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten und beim produktionsorientierten
Schreiben)
Analyse durch Textbelege absichern
REZEPTION:
Eigene und fremde Unterrichtsbeiträge kriteriengeleitet in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten (Gespräch, Diskussionen, Feedback
zu Präsentationen) beurteilen
Die Darstellung von Gesprächssituationen in literarischen Texten unter Beachtung von kommunikationstheoretischen Aspekten analysieren
Kommunikation
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext
PRODUKTION:
Gesprächsbeiträge/-verhalten kriterienorientiert analysieren
Mimik, Gestik, Artikulation in eigenen komplexen Redebeiträgen funktional einsetzen
REZEPTION:
Filmanalyse eines im Unterricht thematisierten Werkes; Vgl. mit Original, Theaterbe3ushc
Medien PRODUKTION:
Feedback zu medialen Aufbereitungen – funktionale Medienverwendung in konstruktivem, kriterienorientierten Feedback beurteilen
Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien
Klausur(empfehlung): Typ IA: Analyse eines literarischen Textes mit weiterführendem Schreibauftrag – Szenenanalyse
Typ IIA: Analyse eines Sachtextes mit weiterführendem Schreibauftrag
113. Unterrichtsvorhaben
Sprachliche Vielfalt im 21. Jahrhundert
-Mehrsprachigkeit, Sprachvarietäten-
Inhaltliche Schwerpunkte: Übergreifende Kompetenzerwartungen: Die SuS können…
Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel, Sprachvarietäten und ihre REZEPTION
gesellschaftliche Bedeutung unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in ihrem jeweiligen Kontext
Texte: komplexe auch längere Sachtexte und ihrer Wirkungsabsicht vergleichend beurteilen ,
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext selbstständig eigene und fremde Beiträge und Standpunkte fachlich
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen kompetent überprüfen und differenziert beurteilen.
Medien PRODUKTION
eigene Positionen zu fachspezifischen Sachverhalten vor dem Hintergrund
ihres Fachwissens formulieren und argumentativ vertreten,
verschiedene Präsentationstechniken in ihrer Funktionalität beurteilen und
zielgerichtet anwenden,
selbstständig Rückmeldungen konstruktiv und differenziert formulieren.
Empfohlene Lehrmittel/ Materialien/ Methoden: Didaktisch-methodische Anmerkungen und der Fachkonferenz:
TTS Sachtextanalyse (Wiederholung)
Paul D Definitionen/Konzepte: Äußere/Innere Mehrsprachigkeit
Nützel „Erst tausend, dann hundert, dann eine….“ Politische Dimension des Themas: EU/ Vielsprachigkeit
Tarnas „Sprachlabor Deutschland (Auszüge) Sprachwandel (synchron) (z.B. Thematisierung von Anglizismen/ Veränderung
Diskurs zum Thema „Doppelte Halbsprachigkeit“ der Sprache durch den Einfluss moderner Medien, Kanak Sprak)
Gedichte zum Thema Positionen von Wissenschaftlern zum Sprachwandel
Inhaltsfeld Konkretisierte Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
Die Schülerinnen und Schüler können…
Sprache REZEPTION:
Sprachliche Gestaltungsmittel identifizieren und in ihrer Bedeutung für Aussage und Wirkung beurteilen (informierend, argumentierend,
appellierend)
Verschiedene Ebenen von Sprache unterscheiden (phonologisch, morphematisch, syntaktisch, semantisch, pragmatisch)
Sprachvarietäten anhand von Beispielen erläutern und deren Funktion beschreiben (z.B. Jugendsprache, Dialekte)
Aktuelle Entwicklungen in der deutschen Sprache anhand von Beispielen und ihre sozio-kulturelle Bedingtheit erklären (z.B. Denglisch)
Grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen
PRODUKTION:
Die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese überarbeiten
Texte REZEPTION:
Sachtexte analysieren – kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in ihrer Abhängigkeit von Situation, Adressat, Textfunktion
unterscheiden; mit Hilfe textimmanenter und textübergreifender Informationen analysieren
Leseziele ableiten – Aufgabenstellungen für Textrezeption nutzen
12 Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung in Texten beurteilen
PRODUKTION:
Verschiedene Textmuster einsetzen (bei analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten und beim produktionsorientierten
Schreiben)
Kommunikationssituation, Adressat, Funktion bei der Textgestaltung berücksichtigen
Texte kriterienorientiert überarbeiten
Kommunikation REZEPTION:
Verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung in rhetorisch ausgestalteter Kommunikation identifizieren
PRODUKTION:
Gesprächsbeiträge/-verhalten kriterienorientiert analysieren
Medien REZEPTION:
Methoden der Informationsbeschaffung unterscheiden (Internet, Bibliothek usw.)
Besonderheiten digitaler Kommunikation als öffentliche Kommunikation erläutern und beurteilen
PRODUKTION
Textverarbeitungsprogramme – Arbeitsergebnisse mit Textverarbeitungsprogrammen als diskontinuierliche/ kontinuierliche Texte darstellen
Klausur(empfehlung):Typ IIA: Analyse eines Sachtextes mit weiterführendem Schreibauftrag
Typ IIIA: Erörterung von Sachtexten
Typ IIIB: Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text
13Sie können auch lesen