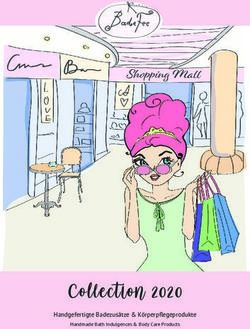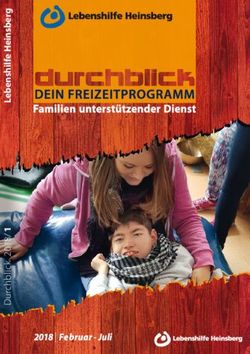Fachkonferenz "Das Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fachkonferenz „Das Radschnellnetz der
Metropolregion Hamburg“
Nutzen-Kosten-Analyse für Radschnellverbindungen
Caroline Rose, M. Sc.
20. November 2019 | Hamburg
Dieser Vortrag basiert auf der Präsentation von Lange und
Schreck-von Below vom 13.09.2019 (in Essen) zum Thema
„Verfahren zur Potenzialanalyse und Nutzen-Kosten-Analyse“
Bundesanstalt für StraßenwesenAgenda
• Überblick Forschungsprojekt
• Potenzialermittlung
– Detailliertes Verfahren
– Überschlägiges Verfahren
• Nutzen-Kosten-Analyse
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 2Agenda
• Überblick Forschungsprojekt
• Potenzialermittlung
– Detailliertes Verfahren
– Überschlägiges Verfahren
• Nutzen-Kosten-Analyse
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 3Forschungsprojekt
FE 82.0680 „Einsatzbereiche und
Entwurfselemente von Radschnellverbindungen“
• Auftragnehmer: PTV Transport Consult GmbH, Planungsbüro
Via, Goudappel Coffeng, J. Thiemann-Linden
• Schwerpunkte des Forschungsprojekts:
– Potenzialanalyse
– Nuten-Kosten-Analyse
– Entwurfselemente
− Sicherheitsbewertung (Strecke, Knotenpunkt)
− Einsatzbereiche typischer Knotenpunktformen
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 4Forschungsprojekt
FE 82.0680 „Einsatzbereiche und
Entwurfselemente von Radschnellverbindungen“
BASt-Bericht Leitfaden zur Potenzialanalyse
V 320 und Nutzen-Kosten-Analyse
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 5Agenda
• Überblick Forschungsprojekt
• Potenzialermittlung
– Detailliertes Verfahren
– Überschlägiges Verfahren
• Nutzen-Kosten-Analyse
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 6Potenzialermittlung
Anwendungsfälle
• Mit welcher Route können die meisten potenziellen Nutzer
angesprochen werden?
• Welches Radverkehrsaufkommen ist zu erwarten?
• Kann der Ausbau zu einer Radschnellverbindung
gerechtfertigt werden?
• In welchem Ausmaß stellen sich Verlagerungen auf das Rad
ein?
• Wie ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis?
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 7Potenzialermittlung
Anforderungen
• Verfahrensentwicklung für eine Potenzialermittlung für
Radschnellverbindungen mit der Zielsetzung
− Belastbar
− Überprüfbar
− Anwendbar
Ergebnisse dienen als Einflussgrößen für die Nutzen-Kosten-
Analyse mit ihren verschiedenen Nutzen-Komponenten
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 8Potenzialermittlung
Rahmenbedingungen
• Radverkehrsplanung erfolgt meist angebotsorientiert
• Bisher gibt es kaum Erfahrungen mit der Nachfrageberechnung und
Routenwahl von Radfahrern
• Städtische und regionale Verkehrsmodelle verfügen i.d.R. nicht über
ein detailliertes Angebots- oder Nachfragemodell für den Radverkehr
• Gleichzeitig sind Verkehrsmodelle das Hilfsmittel, das für die
Berechnung von Verlagerungswirkungen herangezogen sollte
Erste Folgerung: Die Bearbeitung der Fragestellung auf Grundlage
eines Verkehrsmodells ist sinnvoll, es bedarf aber eines alternativen
Verfahrens
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 9Potenzialermittlung
Herangehensweise: 2 Verfahrensansätze
Detailliertes Verfahren Überschlägiges Verfahren
• Einsatz eines bestehenden • Berechnung ohne Verkehrsmodell auf
Verkehrsmodells mit Nachfrage für den Grundlage von Strukturdaten
Pkw-Verkehr • Berechnungsansätze folgen dem Ablauf
• Verfeinerung des Streckennetzes für die von
Anwendung auf den Radverkehr − Verkehrserzeugung
• Berechnung Radverkehrsaufkommen − Zielwahl
mittels Modal-Split-Funktion − Abspaltung des Radverkehrsanteils
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 10Potenzialermittlung
Detailliertes Verfahren Überschlägiges Verfahren
1) Bestimmung der Parameter der Modal-Split-Funktion 1) Untersuchungsgebiet und Bezirkseinteilung
Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
Kennwerte der Mobilität aus SrV, MiD oder Haushaltsbefragungen Zur Abbildung räumlicher Verflechtungen sind gegebenenfalls auch
Verhältnis von Pkw- zu Radverkehrsaufkommen je Streckenlänge umliegende, nicht betroffene Städte zu berücksichtigen
Unterteilung des Untersuchungsgebiets in Teilgebiete
z.B. Städte, Stadt- oder Ortsteile, Siedlungsgebiete
Modal-Split-Funktion: Anpassung der Parameter g1, g2, g3 und a0
Angleichung des Funktionsverlaufs auf die Mobilitätskennwerte Ermittlung von Strukturdaten je Teilgebiet (Relevant sind Einwohner,
Arbeitsplätze oder eine Abschätzung der Verteilung
Schulplätze oder eine Abschätzung der Verteilung
Einkaufsflächen oder eine Abschätzung der Verteilung)
2) Ermittlung des Radaufkommens je Quelle-Ziel-Relation im Bestand
2) Ermittlung des Quellverkehrsaufkommens jedes Teilgebiets
Nachfragematrix Pkw Streckennetz des MIV im Streckennetz des Angepasste Modal-Split-
Bestand Bestand Radverkehrs ohne RSV Funktion aus 1)
Vereinfachend angenommen werden täglich 1,5 Ausgänge/Einwohner
aus der eigenen Wohnung durchgeführt (vgl. SrV (2013)); die Anzahl der
Ermittlung der Ermittlung der Einwohner (>6 Jahre) wird mit 1,5 multipliziert um das
Reisezeitenmatrix Pkw Reisezeitenmatrix Rad Quellaufkommen vom Wohnort zu bestimmen.
Bestand Bestand
3) Reisezeiten und Zielwahl
Ermittlung der Radanteile je Quelle-Ziel-Relation mit Hilfe der Modal-Split-Funktion und
der Eingangsdaten
Die Reisezeiten werden mithilfe der Luftlinienentfernung und einer
Berechnung des Radaufkommens je Quelle-Ziel-Relation mittleren Geschwindigkeit abgeschätzt. Im Bestandsfall wird eine
Ergebnis: Nachfragematrix Rad Bestand mittlere Geschwindigkeit von 10 km/h angenommen.
Das Quellverkehrsaufkommen wird unter Berücksichtigung der
3) Ermittlung des Radaufkommens je Quelle-Ziel-Relation im Mitfall erhobenen Strukturdaten auf die Zielzellen verteilt. Hierzu wird ein
Gravitationsansatz gewählt, der einerseits die Größe der
Streckennetz des Strukturgrößen und andererseits die Distanzen zwischen den
Nachfragematrix Pkw Streckennetz des MIV im Angepasste Modal-Split-
Radverkehrs mit RSV und Teilgebieten berücksichtigt
Bestand Fall mit RSV Funktion aus 1)
flankierender Maßnahmen
Aus den berechneten Quellverkehren werden die Rückfahrten zum
Ermittlung der Ermittlung der Wohnort durch Umkehrung der Matrix abgeleitet. Es wird somit
Reisezeitenmatrix Pkw Reisezeitenmatrix Rad vereinfachend angenommen, dass keine Wegeketten bestehen.
Mitfall Mitfall
4) Radverkehrsmatrix
Ermittlung der Radanteile je Quelle-Ziel-Relation mit Hilfe der Modal-Split-Funktion und
der Eingangsdaten Von der ermittelten Gesamtverkehrsmatrix wird das
Radverkehrsaufkommen über Radverkehrsanteile abgespalten. Diese
Berechnung des Radaufkommens je Quelle-Ziel-Relation
werden zuvor in Abhängigkeit der Reisezeit bestimmt.
Ergebnis: Nachfragematrix Rad Mitfall
5) Ermittlung des Radverkehrsaufkommens im Mitfall
4) Auswertung
Die Abbildung der attraktiven Routenführung erfolgt mithilfe der
mittleren Geschwindigkeit zur Berechnung der Reisezeit. Durch
Anhebung der Luftliniengeschwindigkeit auf 15 km/h auf den
Relationen, die von der Radschnellverbindung profitieren, reduziert
sich die Reisezeit und das Radverkehrsaufkommen erhöht sich
6) Auswertung
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 11Potenzialermittlung
Detailliertes Verfahren: Modal-Split-Funktion
Ableitung des Radverkehrs in Abhängigkeit des Kfz-Aufkommens
• Für die Anwendung wird ein
Standardfunktionsverlauf sowie
Ober- und Untergrenze zur
Anpassung an örtliche
Gegebenheiten angegeben
• Der Funktionsverlauf wird durch
die Parameter g1, g2 und g3
angepasst
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 12Potenzialermittlung
Detailliertes Verfahren: Angebotsnetz
Streckenattribute
Notwendige Attribute
• Streckenlänge
• Geschwindigkeit
• Knotenpunkte und
Verlustzeiten
Sinnvolle Ergänzungen
• Steigung und Gefälle
• „Attraktivität“
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 13Potenzialermittlung
Überschlägiges Verfahren
• Einteilung des Untersuchungsgebietes in Bezirke
• Erhebung von Strukturdaten je Bezirk
– Einwohner
– Arbeitsplätze (räuml. Verteilung)
– Schulplätze (räuml. Verteilung)
– Freizeiteinrichtung (räuml. Verteilung)
– Einzelhandel (räuml. Verteilung)
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 14Potenzialermittlung
Überschlägiges Verfahren Darstellung des Berechnungsansatzes:
Auf der Wohnseite wird der
Händisches Berechnungsverfahren
•
Gesamtverkehr erzeugt
(Einwohner als maßgebende
Strukturgröße)
• Die Zielverkehrspotenziale von
Verkehrserzeugung:
Freizeit, Einkauf, Arbeit und
1,5 Ausgänge /(P*d)
Ausbildung wirken mit
unterschiedlichen Anteilen auf die
Zielwahl auf Grundlage Zielwahl ein
verschiedener Wegezwecke • Innerhalb eines Tages führen alle
Wege wieder zum Wohnort; pro
Tag entstehen somit 3
28% 28% 26% 18% Wege/Einwohner
Freizeit Einkauf Arbeit Ausbildung
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 15Agenda
• Überblick Forschungsprojekt
• Potenzialermittlung
– Detailliertes Verfahren
– Überschlägiges Verfahren
• Nutzen-Kosten-Analyse
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 16Nutzen-Kosten-Analyse
Komponenten
Nutzen-Komponenten Kosten-Komponenten Deskriptive Komp.
Betriebskosten der Planungskosten Senkung des
Infrastruktur (25 Jahre Nutzungsdauer) Flächenverbrauchs
Fahrzeugbetriebskosten Grunderwerb Verbesserung der Lebens- u.
(unbegrenzte Nutzungsdauer) Aufenthaltsqualität der Stadt
Einsparungen im Fahrweg Verbesserung d. Teilhabe nicht-
Gesundheitswesen (25 Jahre Nutzungsdauer) motorisierter Personen am
städtischen Leben
Reduzierung der Ingenieurbauwerke Nutzen im Bereich Dritter
Sterblichkeitsrate aktiver Pers. (50 Jahre Nutzungsdauer)
Reisezeitveränderung Betriebstechnik Verbesserungen für den
(25 Jahre Nutzungsdauer) Fußgängerverkehr
Umweltkosten
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 17Nutzen-Kosten-Analyse Reisezeit Einfluss unterschiedlicher Nutzergruppen: • Bestandsradfahrer ziehen Nutzen aus reduzierter Reisezeit wegen besserer Infrastruktur • Wechsler bspw. vom MIV erleben nach dem Wechsel veränderte Reisezeit; diese wirkt sich auf die NKA aus • Monetarisierung der Zeit auf Grundlage der BVWP-Methodik Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 18
Nutzen-Kosten-Analyse Einsparung im Gesundheitswesen Einfluss unterschiedlicher Nutzergruppen • WHO: Mit regelmäßiger Aktivität kann eine gesundheitsfördernde Wirkung erreicht werden (Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck) • Gesundheitskosten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes 2015: 55,3 Mrd € (DESTATIS) Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 19
Nutzen-Kosten-Analyse
Nutzen-Kosten-Analyse:
• Übersicht der NKA mit Nutzen und
Kosten pro Jahr sowie Nutzen-
Kosten-Verhältnis
• Übersicht aller Nutzenkomponenten
mit jeweiligen Nutzen pro Jahr in €
• Übersicht aller Kostenkomponenten
mit jeweiligen Kosten pro Jahr in €
• Übersicht der deskriptiven
Komponenten mit farblicher
Hervorhebung
Caroline Rose 20.11.2019 Folie Nr. 20Sie können auch lesen