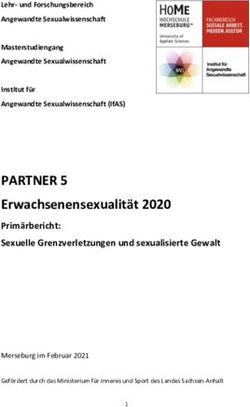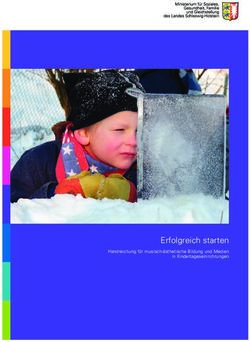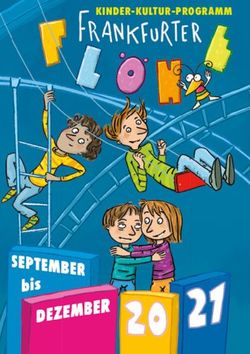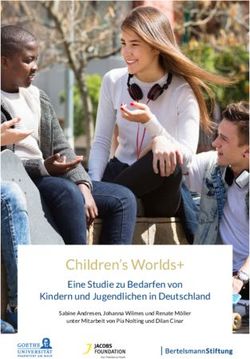Gewalt gegen Kinder Thüringer Leitfaden für Ärzte
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Thüringer Leitfaden
für Ärzte
Gewalt
gegen
Kinder Landesärztekammer Thüringen
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit
Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Thüringen
Weiterentwickelt und adaptiert durch die Arbeitsgruppe
„Gewalt gegen Kinder“
bei der Landesärztekammer Thüringen
2. Auflage, 20072 Impressum: Herausgeber - Landesärztekammer Thüringen - Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit - Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Thüringen Unterstützt durch - Kassenärztliche Vereinigung Thüringen - Berufsverband der Ärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Landesverband Thüringen Projektentwicklung Weiterentwickelt und adaptiert durch die Arbeitsgruppe “Gewalt gegen Kinder” bei der Landesärztekammer Thüringen: - Dr. Sibylle Banaschak, Köln, Fachärztin für Rechtsmedizin - Dr. Christiane Becker, Ärztliche Geschäftsführerin der Landesärztekammer Thüringen - Dr. Bernhard Blochmann, Nordhausen, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie - Dr. Roland Eulitz, Dingelstädt, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie - Dr. Bernd Lutter, Landesfachkrankenhaus Stadtroda, Kinderneuropsychiatrische Abteilung, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie - Ina Schairer, Arztpraxis Stadtroda, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie - Dr. Ingrid Schlonski, Arztpraxis Gera, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin - Dr. Carsten Wurst, Zentralklinikum Suhl gGmbH, Sozialpädiatrisches Zentrum, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Ein herzlicher Dank für die Mitwirkung gilt: - Steffi Lippold für die umfangreiche Sachbearbeitung Wir danken der Freien und Hansestadt Hamburg für die Gestattung des teilweisen Nach- drucks einzelner Textpassagen sowie allen Projektbeteiligten für die Zusammenarbeit und Unterstützung. „Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte
3
Inhalt
Teil I
Seite
Vorworte 4
Allgemeine Hinweise 7
Grundlagen für das ärztliche Vorgehen bei Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche 8
1. Gewalt in der Familie - ein gesellschaftliches Problem 10
2. Was ist Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 12
3. Epidemiologische Aspekte 17
4. Risikofaktoren der Kindesmisshandlung 18
5. Diagnostische Kriterien 20
6. Ärztliches Vorgehen bei Misshandlungs- und Gewaltverdacht 27
7. Probleme der multiprofessionellen Kooperation 34
8. Probleme von Ärzten im Umgang mit Kindesmisshandlung 37
9. Defizite und Forderungen 40
10. Literatur 41
11. Autoren 47
Auszüge aus der Berufsordnung der Landesärztekammer Thüringen, dem
Strafgesetzbuch (StGB), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sowie dem
Sozialgesetzbuch VIII (SGB) 48
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte4
Vorwort
Seit der Publikation des letzten Leitfadens „Gewalt gegen Kinder“ 1998 ist viel passiert:
Nachrichten von getöteten, misshandelten und vernachlässigten Babys und Kleinkindern
sind in erschreckendem Ausmaß fast schon alltäglich geworden, gleichzeitig werden so in-
tensiv wie schon lange nicht mehr die Probleme, insbesondere natürlich die Prävention, aber
auch das Erkennen der Gewaltanwendungen, diskutiert und Maßnahmen ergriffen. Erinnert
sei hier beispielsweise an die Thüringer Ambulanz für Kinderschutz am Universitätsklinikum
Jena.
Häufig sind Misshandlungen, Vernachlässigungen sowie Missbrauch Wiederholungstaten.
Ein frühes Erkennen kann deshalb die Zahl schwerer, bleibender Schäden oder auch von
Todesfällen verringern helfen. Mit dem Leitfaden „Gewalt gegen Kinder“ wollen wir Ärztinnen
und Ärzten ein Instrument zur rechtzeitigen Diagnose und zum rechtzeitigen Handeln in die
Hand geben. Mit ihm soll die Wachsamkeit von Ärztinnen und Ärzten geschärft und unsere
Berufsgruppe ermutigt werden, couragiert in den nötigen Fällen einzugreifen.
Den Kolleginnen und Kollegen vom Ausschuss „Gewalt gegen Kinder“ der Landesärzte-
kammer danke ich herzlich für Ihr Engagement bei der Neuherausgabe des Leitfadens.
Dr. med. Mathias Wesser
Präsident der Landesärztekammer Thüringen
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte5
Vorwort
Gewalt gegen Kinder hat vielfältige Formen. Körperliche und seelische Misshandlung, sexu-
eller Missbrauch, aber auch psychische und emotionale Vernachlässigung haben weit rei-
chende Konsequenzen für die Entwicklung von Kindern. Körperliche und seelische Verlet-
zungen, Angst, mangelndes Selbstwertgefühl, Aggressivität und Suchtmittelmissbrauch kön-
nen Auswirkungen von Gewalt sein.
Alle am Entwicklungsprozess von Kindern Beteiligten brauchen Verantwortungsgefühl, Sen-
sibilität und Fachkompetenz, um Anzeichen von Gewalt frühzeitig zu erkennen und adäquate
Schritte dagegen einleiten zu können.
Die Hilfen, die ein misshandeltes oder missbrauchtes Kind und im Einzelfall auch dessen
Familie benötigen, sind sehr differenziert und zeitintensiv. Sie können meist nicht allein von
einer Person oder Einrichtung erbracht werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Partnern
und Hilfeeinrichtungen ist somit sehr oft erforderlich.
Die Thüringer Landesregierung hat daher bereits Ende 2006 einen umfassenden Maßnah-
mekatalog verabschiedet, der frühzeitige Hilfen für Familien und einen wirksamen Kinder-
schutz vorsieht. Gleichzeitig begrüßen wir alle Initiativen gegen Gewalt an Kindern. Auch
dieser Leitfaden leistet einen effektiven Beitrag zur Aufdeckung, Verarbeitung und Abwen-
dung weiterer Gefährdungen durch Gewalt gegen Kinder.
Das Thema "Gewalt gegen Kinder" hat leider nicht an Aktualität verloren. Wir müssen daher
auch weiterhin gemeinsam alles dafür tun, um Gewalt gegen Kinder zu verhindern. Es gilt
also: bei Anzeichen von Gewalt - unabhängig ob physisch oder psychisch ausgerichtet -
frühzeitig und sachgerecht zu intervenieren, um Kinder bzw. Betroffene besser zu schützen.
Das sind wir unseren Kindern und ihrer Zukunft schuldig.
Ich möchte Sie daher ermuntern, dieses Material griffbereit stehen zu haben und mit diesem
Material zu arbeiten. Ausdrücklich möchte ich Sie auf das Verzeichnis der Beratungs- und
Hilfsangebote in Ihrer Nähe im Serviceteil aufmerksam machen. Nutzen Sie bitte die Kompe-
tenz anderer Beratungs- und Hilfsangebote, von Jugendämtern über Jugendschutzdienste
bis hin zum Frauenhaus in ihrer Region.
Der Landesärztekammer, den Autoren und der Techniker Krankenkasse möchte ich stellver-
tretend für alle Mitwirkenden danken, dass diese wichtige Publikation hat entstehen können.
Dr. Klaus Zeh
Thüringer Minister für
Soziales, Familie und Gesundheit
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte6
Vorwort
Immer wieder lösen Medienberichte über vernachlässigte, verwahrloste, misshandelte oder
gar getötete Kinder Betroffenheit und Entsetzen aus. Wie hoch darüber hinaus die Dunkelzif-
fer im Bereich der Kindesmisshandlung ist, können selbst Experten nur schwer einschätzen.
Körperliche und seelische Misshandlung von Kindern, sexueller Missbrauch und Vernachläs-
sigung haben vielfältige Ursachen. Diese zu beseitigen oder wenigstens einzudämmen, zählt
zu den wichtigen Aufgaben der im Gesundheitswesen Tätigen.
Erhöhte Aufmerksamkeit, ein zuverlässiges Frühwarnsystem und Rechtssicherheit für die
Handelnden sind dabei wichtige Bausteine, um gefährdete Kinder und Jugendliche rechtzei-
tig zu erkennen und ihnen und ihren Familien Hilfe und Unterstützung zu geben. Das Projekt
"Gewalt gegen Kinder" will mithelfen, die auch bei Fachleuten bestehenden Informationsdefi-
zite abzubauen, wenn es darum geht, gegen Kinder verübte Gewalt zu erkennen und sach-
gerecht darauf zu reagieren.
Bereits seit 1999 steht ein Leitfaden "Gewalt gegen Kinder" in vielen Thüringer Arztpraxen, in
Kinderkliniken und Kinderschutzdiensten, gemeinsam herausgegeben von Gesundheitsmi-
nisterium, Landesärztekammer und Techniker Krankenkasse in Thüringen. Er war und ist
eine wichtige Hilfe, um Symptome von Misshandlungen und Gewalt rechtzeitig zu erkennen
und bei entsprechendem Verdacht die richtigen Partner für eine weiteres Vorgehen einzube-
ziehen. Die positive Resonanz auf unseren ersten Handlungsleitfaden für Früherkennung,
Handlungsmöglichkeiten und Kooperation hat uns darin bestärkt, das Projekt "Gewalt gegen
Kinder" weiter auszubauen und den vorliegenden Leitfaden in einer aktualisierten Version
neu aufzulegen.
Es ist uns als Krankenkasse ein besonderes Anliegen, verschiedenen Akteure des Gesund-
heitswesens bei einem gemeinsamen Ziel zu unterstützen: dem Schutz unserer Kinder.
Guido Dressel
Leiter der TK-Landesvertretung Thüringen
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte7 Allgemeine Hinweise Dieser Leitfaden richtet sich an Ärzte aller Fachrichtungen, die mit dieser Problematik be- fasst sind, soll aber auch die Arbeit anderer Institutionen und Professionen unterstützen. Der Leitfaden soll außerdem dazu anregen, sich selbst ein persönliches Netzwerk aufzubauen, um bei einer entsprechenden Problemlage rasch in der Lage zu sein, Kontakt mit weiterhel- fenden Institutionen oder Personen aufnehmen zu können. In einem Textbeitrag werden die wichtigsten Aspekte von Gewalt gegen Kinder beschrieben. Zusätzlich informiert der Leitfaden in einem Serviceteil über Hilfseinrichtungen für Opfer und Angehörige und über Beratungsmöglichkeiten in Thüringen. Diese Institutionen sind in zwei Adressverzeichnissen zusammengestellt. Das erste Verzeichnis führt medizinische Einrich- tungen bzw. landesweite Verbände und Institutionen auf, während der zweite Teil sonstige Beratungs- und Hilfsangebote enthält. Beide Verzeichnisse wurden aufgrund einer zielge- richteten schriftlichen Befragung erstellt. Ärzte finden in dem Leitfaden Vorlagen zur praxisinternen Falldokumentation. Eine Vorlage sollte für Kopien zurückgehalten werden. Wir bitten die Anwender des Leitfadens um Mitteilung geänderter Anschriften und Telefon- nummern. Dankbar sind wir für inhaltliche und konzeptionelle Änderungs- und Ergänzungs- wünsche. Zu diesem Zweck liegt ein Rückmeldebogen bei. Diesen Bogen bitten wir an fol- gende Anschrift zu übersenden: Arbeitsgruppe „Gewalt gegen Kinder“ Landesärztekammer Thüringen Frau Dr. med. Chr. Becker Im Semmicht 33 07751 Jena „Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte
Inhaltsverzeichnis 8
Grundlagen für das ärztliche Vorgehen bei
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Gewalt in der Familie - ein gesellschaftliches Problem 10
2. Was ist Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 12
2.1. Körperliche Gewalt 12
2.2. Seelische Gewalt 13
2.3. Vernachlässigung 14
2.4. Sexuelle Gewalt 14
2.5. Genitale Verstümmelung 15
2.6. Häusliche Gewalt 15
3. Epidemiologische Aspekte 17
4. Risikofaktoren der Kindesmisshandlung 18
4.1. Anamnestische Merkmale des Kindes 18
4.2. Anamnestische Merkmale der Eltern bzw. des Misshandlers 18
4.3. Anamnestische Merkmale der Familie als Ganzes 19
5. Diagnostische Kriterien 20
5.1. Körperliche Misshandlungszeichen 20
5.1.1. Äußere Verletzungen 20
5.1.2. Innere Verletzungen 22
5.1.3. Frakturen 22
5.1.4. Verborgene Verletzungen 23
5.1.5. Weitere Verletzungen 23
5.2. Zeichen der Vernachlässigung 23
5.3. Sozial-emotionale Störungen 24
5.4. Diagnostische Hinweise auf sexuelle Gewalt 25
5.5. Kennzeichnendes Verhalten misshandelnder Personen 26
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteInhaltsverzeichnis 9
6. Ärztliches Vorgehen bei Misshandlungs- und Gewaltverdacht 27
6.1. Untersuchung 27
6.2. Dokumentation 27
6.3. Diagnosesicherung 28
6.4. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Professionen 28
6.5. Umgang mit den Eltern 31
6.6. Stufenplan zur Sicherstellung des Schutzes des betroffenen Kindes 33
7. Problem der multiprofessionellen Kooperation 34
7.1. Problem der ärztlichen Schweigepflicht 34
7.2. Probleme zwischen Kinderschutz, Therapie und Ermittlung
bzw. Strafverfolgung 35
7.3. Konflikte und Stellvertreterkonflikte zwischen Professionellen 35
8. Probleme von Ärzten im Umgang mit Kindesmisshandlung 37
8.1. Aggressionen 37
8.2. Identifikation mit dem Opfer 37
8.3. Hilflosigkeit 37
8.4. Problem der Verdrängung 37
8.5. Diagnoseschwierigkeiten 38
8.6. Die Notwendigkeit, mit nicht-ärztlichen Stellen zusammenarbeiten zu müssen 39
8.7. Mangel an Rechtskenntnissen 39
9. Defizite und Forderungen 40
10. Literatur 41
11. Autoren 47
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteGewalt in der Familie – ein gesellschaftliches Problem 10
1. Gewalt in der Familie - ein gesellschaftliches Problem
Körperliche Gewalt, Vernachlässigung, emotionale Misshandlung und Kindesmisshandlung -
sexuelle Gewalt von Minderjährigen sind in unserer Gesellschaft Prob- ein ungelöstes Prob-
lem der Gesellschaft
leme ersten Ranges. Nach Einschätzung der "Unabhängigen Regie-
rungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt" (Ge-
waltkommission) ist Gewalt in der Familie die bei weitem verbreitetste
Form von Gewalt überhaupt (Schwind).
Gewalterlebnisse, die Minderjährige innerhalb des Familienlebens er-
leiden mussten, bestimmen dabei wesentlich die späteren Möglichkeiten
der Betroffenen, als Erwachsene mit Konflikten umgehen zu können
("Kreislauf der Gewalt").
Gewaltsame Interaktionen im Elternhaus stehen in enger Beziehung zu
psychosozialen Störungen, zum Auftreten von sozialabweichendem
Verhalten und Kriminalität im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter.
Misshandlungserlebnisse wirken sich negativ auf die somatische und
psychische Entwicklung und Wertvorstellung beim Kind sowie letztlich
desozialisierend aus.
Gewalt in der Familie wird somit als „Schlüssel zur Gewalt in der Gesell-
schaft" angesehen. Sie ist deshalb nicht nur wegen ihrer erheblichen
individuellen Bedeutung für die Betroffenen, sondern auch wegen ihrer
gewichtigen sozialen Folgen als bedeutsames gesundheits-, sozial- und
rechtspolitisches Problem anzusehen. Dabei ist jede Form von Gewalt in
der Familie Produkt und Bestandteil von Interaktionsprozessen innerhalb
der Familie, ihren Lebensbedingungen und Verflechtungen mit dem so-
zialen Umfeld, ebenso wie von Normen, Einstellungen und Wertvorstel-
lungen der Gesellschaft.
Nach langer politischer Diskussion trat am 2. November 2000 eine Än-
derung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in Kraft, die in diesem
Zusammenhang eine vielleicht auf den ersten Blick unbedeutende Ände-
rung bewirkte. Nach §1631 BGB haben Kinder seither ein Recht auf eine
gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzun-
gen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Dies führt
dazu, dass das (schon lange umstrittene) elterliche Züchtigungsrecht
nun auch in Deutschland vom Gesetzgeber verneint wird.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteInhaltsverzeichnis 11 Bereits 1991 forderte der 94. Deutsche Ärztetag die Öffentlichkeit auf, Verstärkte Integration sich dem Problem der Vernachlässigung und Misshandlung von Minder- des Problems in die jährigen intensiver als bisher in Erziehung und öffentlicher Diskussion zu ärztliche Tätigkeit widmen. Darüber hinaus beauftragte er, zur verstärkten Integration die- ser Problematik in die ärztliche Tätigkeit, die Landesärztekammern, “Ar- beitsgruppen zu den ärztlichen Problemen der Misshandlung Minderjäh- riger” einzurichten. Im Mai 1995 konstituierte sich bei der Landesärztekammer Thüringen die interdisziplinäre Arbeitsgruppe “Gewalt gegen Kinder”, zu der sich bisher Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, für Psychotherapeutische Medizin, Kinderärzte, Rechtsmediziner und Psychologen zusammengefunden haben. Seine Aufgaben sieht der Arbeitskreis im Fortsetzen der begonnenen Fortbildungen für Ärzte zu Fragen von Kindesmisshandlungen, sexuel- lem Gewalt und Kindesvernachlässigung. Gleichzeitig versteht er sich als ansprechbereiter und kooperativer Partner für Ärzte, Jugendämter und Kinderschutzdienste, um unmittelbare Verbindungen zur Praxis in Thüringen zu entwickeln und zu vermitteln. Kontakte zu Arbeitskreisen anderer Bundesländer werden gepflegt, um bereits vorhandene Erfah- rungen zugunsten der Kinder zu nutzen. Das Bemühen um Aufklärung und Wissensvermittlung soll einen wir- kungsvollen Beitrag zur Prävention von Gewalt gegen Kinder darstellen. Der Arbeitskreis „Gewalt gegen Kinder“ vertritt durch Teilnahme an Fo- ren, Gesprächsrunden und Fortbildungen auch anderer Fachleute und gesellschaftlicher Gruppen die Landesärztekammer Thüringen. Damit möchte der Arbeitskreis seinen Beitrag zur Sensibilisierung der Öffent- lichkeit für Belange des Kindeswohls leisten. Der vorliegende Leitfaden stützt sich auf die Inhalte von bereits vorlie- genden Texten aus der Broschüre der BÄK sowie Leitfäden anderer Bundesländer in Deutschland zur Problematik „Gewalt gegen Kinder“ und dem Abschlußbericht des Projektes „Wege aus der häuslichen Ge- walt“ beim Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit. „Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte
Diagnostische Kriterien 12
2. Was ist Gewalt gegen Kinder und Jugendliche?
“Kindesmisshandlung ist eine nicht zufällige (bewusste oder unbewuss-
Definition
te) gewaltsame körperliche und/oder seelische Schädigung, die in Fami-
lien oder Institutionen (z. B. Kindergärten, Schulen, Heimen) geschieht,
und die zu Verletzungen, Entwicklungsverzögerungen, schwere Entwick-
lungsstörungen oder sogar zum Tode führt, und die somit das Wohl und
die Rechte eines Kindes beeinträchtigt oder bedroht”. (nach BAST,
1978)
In dieser Definition wird deutlich, dass Gewalt gegen Kinder folgende
Formen annehmen kann: körperliche Gewalt, seelische Gewalt, Ver-
nachlässigung und sexuelle Gewalt. Zu unterscheiden ist jeweils die
Misshandlung als aktive und die Vernachlässigung als passive Form.
Mehrere Formen können bei einem Kind auch gleichzeitig vorkommen.
Es muss von dem Umstand ausgegangen werden, dass Kindesmiss-
handlung gegen den Willen des Kindes stattfindet, bzw. die Willenlosig-
keit des Kindes, seine Hilflosigkeit und Abhängigkeit ausgenutzt werden.
Bei der Kindesmisshandlung geschieht die Schädigung des Kindes nicht
zufällig. Meist wird eine verantwortliche erwachsene Person wiederholt Gewalt wird meist in
gegen ein Kind gewalttätig. Gewalt wird fast immer in der Familie oder in der Familie ausgeübt
anderen Zusammenlebenssystemen ausgeübt. Häufig ist die Gewalt-
anwendung der Erwachsenen ein Ausdruck eigener Hilflosigkeit und
Überforderung, d. h. Folge einer eigenen gestörten Entwicklung.
Den verantwortlichen Erwachsenen sollen frühzeitig Hilfen zur Selbsthil-
fe angeboten werden. Dabei müssen verschiedene Institutionen unter- Hilfe für Opfer und
stützend zusammenarbeiten, um dem komplexen Problem gerecht zu Täter ist notwendig
werden. In diesem Leitfaden sollen Hilfen für das Kind im Vordergrund
stehen, aber es darf nicht übersehen werden, dass auch die Täter Hilfe
(Therapie) benötigen. Möglichkeiten für ein gemeinsames Vorgehen mit
anderen Einrichtungen werden aufgezeigt.
2.1. Körperliche Gewalt
Erwachsene üben körperliche Gewalt an Kindern in vielen verschiede-
nen Formen aus. Verbreitet sind Schläge mit oder ohne Gegenständen,
Kneifen, Treten und Schütteln des Kindes. Daneben werden Stichverlet- Formen der Gewalt
zungen, Vergiftungen, Würgen und Ersticken, sowie thermische Schä- sind vielfältig
den (Verbrennen, Verbrühen, Unterkühlen) bei Kindern beobachtet. Das
Kind kann durch diese Verletzungen bleibende körperliche, geistige und
seelische Schäden davontragen und in Extremfällen daran sterben.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 13
Viele Erwachsene halten Schläge nach wie vor für ein legitimes Schläge – ein legitimes
Erziehungsmittel. Die meisten geben dabei an, dass ihnen „ein Klaps zur Erziehungsmittel?
rechten Zeit auch nicht geschadet habe“ und dass sie dieses Prinzip
genauso für ihre Kinder angemessen finden. Körperliche Gewalt ist aus
den o. g. Gründen kein Bagatelldelikt und muss deshalb gesellschaftlich
auch so bewertet werden. Der Schutz von Kindern vor jeder Form von
Gewalt innerhalb und außerhalb ihrer Familien muss im Erziehungsalltag
oberstes Gebot darstellen. Ziel ist die Befähigung der Eltern, andere
Konfliktlösungsmöglichkeiten im Zusammenleben mit ihren Kindern zu
entwickeln. Ächtung der Gewalt als Erziehungsmittel muss
gesellschaftliches Anliegen sein.
2.2. Seelische Gewalt
Seelische oder psychische Gewalt sind „Haltungen, Gefühle und Aktio-
Beziehungskrise
nen, die zu einer schweren Beeinträchtigung einer vertrauensvollen Be- zwischen Eltern und
ziehung zwischen Bezugsperson und Kind führen und dessen geistig- Kindern
seelische Entwicklung zu einer autonomen und lebensbejahenden Per-
sönlichkeit behindern.“ (EGGERS, 1994). Die Schäden für die Kinder
sind oft folgenschwer, d. h. sie haben Krankheitswert und sind daher mit
denen der körperlichen Misshandlung vergleichbar.
Bei seelischer Gewalt wird dem Kind ein Gefühl der Ablehnung vermit-
telt. Das Kind wird gedemütigt und herabgesetzt, durch unangemessene
schulische, sportliche oder künstlerische Leistungen überfordert, oder
durch Liebesentzug, Zurücksetzung, Gleichgültigkeit und Ignorieren be-
straft.
Schwerwiegend sind ebenfalls Handlungen, die dem Kind Angst machen:
Einsperren in einen dunklen Raum, Alleinlassen, Isolation des Kindes,
Drohungen, Anbinden. Vielfach beschimpfen Eltern ihre Kinder in einem
extrem überzogenen Maß oder brechen in Wutanfälle aus, die für das
Kind nicht nachvollziehbar sind, weil es oft nur Auslöser, aber nicht
Verursacher der Wut ist.
Kinder werden auch für die Bedürfnisse der Eltern missbraucht, indem sie Kinder werden in Part-
gezwungen werden, sich elterliche Streitereien anzuhören, oder sie nerschaftskonflikten
werden in Beziehungskonflikten zur Parteinahme aufgefordert und damit missbraucht
zu Entscheidungen gezwungen, die sie überfordern. Auch
überbehütendes und überfürsorgliches Verhalten kann zur seelischen
Gewalt werden, wenn es Ohnmacht, Wertlosigkeit und Abhängigkeit
vermittelt.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 14
2.3 Vernachlässigung
Die Vernachlässigung stellt eine Besonderheit sowohl der körperlichen
als auch der seelischen Kindesmisshandlung dar. Eltern können Kinder Mangel an Fürsorge
und Pflege
vernachlässigen, indem sie ihnen Zuwendung, Liebe und Akzeptanz,
Betreuung, Schutz und Förderung verweigern, oder indem die Kinder
physischen Mangel erleiden müssen. Dazu gehören mangelnde Ernäh-
rung, unzureichende Pflege und gesundheitliche Fürsorge bis hin zur
völligen Verwahrlosung. Diese Merkmale sind Ausdruck einer stark be-
einträchtigten Beziehung zwischen Eltern und Kind.
2.4. Sexuelle Gewalt
"Diese Gewaltform umfasst jede sexuelle Handlung, die an oder vor ei- Definition
nem Kind entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird
oder der das Kind auf Grund seiner körperlichen, emotionalen, geistigen
oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann bzw.
bei der es deswegen auch nicht in der Lage ist, sich hinreichend wehren
und verweigern zu können. Die MissbraucherInnen nutzen ihre Macht-
und Autoritätsposition sowie die Liebe und Abhängigkeit der Kinder aus,
um ihre eigene (sexuellen, emotionalen und sozialen) Bedürfnisse auf
Kosten der Kinder zu befriedigen und diese zur Kooperation und Ge-
heimhaltung zu veranlassen." (SCHECHTER UND ROBERGE, 1976)
Formen sexueller Gewalt sind das Berühren des Kindes an den Ge-
schlechtsteilen, die Aufforderung, den Täter anzufassen, Zungenküsse, Sexuelle Gewalt ist
oraler, vaginaler und analer Geschlechtsverkehr, Penetration mit Fin- nicht nur körperliche
Gewalt
gern oder Gegenständen. Auch Handlungen ohne Körperkontakt wie
Exhibitionismus, Darbieten von Pornographie, sexualisierte Sprache und
Herstellung von Kinderpornographie sind sexuelle Gewaltakte.
Im Unterschied zur körperlichen Misshandlung misshandelt der Täter bei Sexuelle Gewalt
sexueller Gewalt meist in überlegter Absicht. Sexuelle Übergriffe sind meist nicht spontan
eher geplant als körperliche Gewalttaten.
Einige spezifische Merkmale sind charakteristisch für die sexuelle Ge-
walt, wenn er in der Familie oder durch Bezugspersonen stattfindet. Der
Täter nutzt in besonderem Maße das Macht- und Abhängigkeitsverhält-
nis aus, das zwischen ihm und dem betroffenen Kind besteht. Dieses
Machtgefälle und das Vertrauen des Kindes ermöglichen ihm, das Kind
zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Dabei wendet er meist keine kör-
perliche Gewalt an. Das Kind wird mit Drohungen zur Geheimhaltung
verpflichtet. Übergriffe können auch mit Zuwendungen verbunden sein.
Auf diese Weise wird das Kind zunächst scheinbar aufgewertet.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 15 Die Widersprüche im Verhalten des Täters sind für das Kind nicht zu durchschauen. Das Kind sucht daher die Schuld für die sexuellen Über- griffe bei sich und schämt sich dafür. Scham und Schuldgefühle, von einer meist geliebten und geachteten Scham und Angst- Person sexuelle Gewalt erfahren zu haben, machen es dem Kind nahe- gefühle verhindern ein zu unmöglich, sich einer dritten Person anzuvertrauen. Vor allem Jun- Sich-Anvertrauen gen sind häufig noch weniger in der Lage, sich mitzuteilen. Für sie kann die sexuelle Gewalt zusätzlich mit dem Stigma der Homosexualität be- haftet sein. Außerdem wird von Jungen erwartet, keine Schwächen zu zeigen und sich zu wehren. Die meisten Kinder schützen den Täter, um den Familienzusammenhalt nicht zu gefährden. Ein weiterer Grund für Kinder, die Erlebnisse für sich zu behalten, ist die Androhung durch den Täter, im Fall der Offenbarung in ein Heim zu müssen. Häufig wird Kindern vom Täter eingeredet, niemand werde ih- nen glauben. 2.5. Genitale Verstümmelung Bei der so genannten Genitalverstümmelung handelt es sich um eine rituelle Form der „Beschneidung“ bei Mädchen, die von der Entfernung der Klitoris bis zur Entfernung der Klitoris und der großen und kleinen Schamlippen reichen kann. Die Durchführung des Eingriffes in Deutsch- land ist verboten, eine Einwilligung nicht möglich, da der Eingriff an sich sittenwidrig ist. Wenn eine Gefährdung eines Mädchens absehbar ist, sollten Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. 2.6. Häusliche Gewalt – (siehe auch Literaturverzeichnis) Definition: Häusliche Gewalt bezeichnet Gewaltstraftaten physischer und Definition psychischer Art zwischen Personen - einer partnerschaftlichen Beziehung, die derzeit besteht, sich in Auf- lösung befindet oder aufgelöst ist (unabhängig vom Tatort, auch oh- ne gemeinsamen Wohnsitz) - oder die in einem Angehörigenverhältnis zueinander stehen, soweit es sich nicht um Straftaten ausschließlich zum Nachteil von Kindern handelt Kinder und Jugendliche, die in solchen Gemeinschaften le- ben, gelten hierbei als Opfer, da sie solche Gewaltgeschehen miter- leben. „Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte
Diagnostische Kriterien 16
Kinder und Jugendliche, die wiederholt ernste physische und psychische Folgen häuslicher
Gewalthandlungen gegen ihre Mutter, die von deren Beziehungspartner Gewalt
ausgingen, erlebt haben, sind in indirekter Weise ebenfalls betroffen von
dieser Gewalt. Zusätzlich besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass
bei Vorliegen häuslicher Gewalt auch die Kinder direkt misshandelt wer-
den.
Kinder, die häusliche Gewalt erleben, sind darauf angewiesen von au-
ßen Schutz und Unterstützung zu erhalten. Die Verantwortung für den
Schutz der Kinder kann nicht allein von dem misshandelten Elternteil
getragen werden, da dieses selbst Opfer von Gewalt ist und den eige-
nen Schutz nicht sicherstellen kann.
Das Erleben von Gewalt und Bedrohung bedeutet für jeden Menschen
Auswirkungen
eine massive Erschütterung der Lebensgefühle und der inneren Sicher-
häuslicher Gewalt
heit, mit oft schwerwiegenden Folgen für die körperliche und seelische
Gesundheit. Die Auswirkung und die Folgen für die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen sind umso gravierender, wenn nahe stehende
Menschen an dem Gewaltgeschehen beteiligt sind. Dies im besonderen
Maße für Kinder, da sie für ihre emotionale Entwicklung von Normen,
Werten und Verhaltensweisen auf Sicherheit und Geborgenheit ange-
wiesen sind und nachahmenswerte Vorbilder benötigen. (Ostbomk –
Fischer 2004)
50 bis 70 Prozent der Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, Posttraumatische
leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Sie werden ver- Belastungs-
mutlich achtmal häufiger selber misshandelt als Kinder in Familien ohne störungen
Partnerschaftsgewalt, sie haben ein höheres Risiko im Laufe ihres Le-
bens selber Täter oder Opfer zu werden (Kindler 2003, Heynen 2003).
Häusliche Gewalt kann Auslöser oder Hintergrund für diverse psychi-
sche und physische (psychosomatische) Beschwerden sowie Verhal-
tensstörungen sein. Frauenhäuser und -schutzwohnungen nehmen ne-
ben misshandelten Frauen auch deren Kinder auf (siehe Serviceteil).
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 17
3. Epidemiologische Aspekte
Es ist unmöglich, einen zuverlässigen Überblick über die Häufigkeit von
Gewaltanwendung gegenüber Minderjährigen in Deutschland zu gewin-
nen. Die "Epidemiologie" ist in beeindruckender Weise unbekannt. Alle
Experten sind sich darüber einig, dass neben den bekannt gewordenen
Fällen von einer erheblichen Dunkelziffer insbesondere bei sexueller
Gewalt - auszugehen ist.
Völlig ungeklärt ist die Häufigkeit seelischer Misshandlungen. In der Lite-
Die Epidemiologie ist in
ratur werden eklatante Fälle (Freiheitsbeschränkung, Diffamierung, De- beeindruckender Weise
mütigung der Kinder von z. T. sadistischem Ausmaß) beschrieben (z. B. unbekannt
Strunk, Stutte, Garbarino). Insbesondere kinderpsychiatrische Erfahrun-
gen sprechen dafür, dass die Problematik der seelischen Misshandlung
von erheblicher Relevanz ist.
Im westlichen Ausland (z. B. USA, Großbritannien, Niederlande) ist das
Thema Misshandlung Minderjähriger in Wissenschaft, Öffentlichkeit und
Politik schon viel früher aus dem Schattendasein eines gesellschaftli-
chen Tabuthemas herausgetreten. In den USA wird Kindesmisshand-
lung heute als sozialpolitisches Problem erster Linie („National Emer-
gency“) eingeschätzt (Krugmann).
Anders als in den USA (Meldepflicht) gibt es in den Niederlanden seit Ausland reagierte
1972 ein freiwilliges Meldesystem (Koers, Pieterse). Seitdem hat die schon früher
Zahl der gemeldeten Fälle von Kindesmisshandlung und sexueller Ge-
walt ständig zugenommen. Die Erfahrungen aus den Niederlanden (so-
wie inzwischen auch aus den Kinderschutzeinrichtungen in der Bundes-
republik) zeigen, dass die Meldefrequenz stark durch die öffentliche Dis-
kussion sowie Zusichern von Vertraulichkeit im Einzelfall beeinflusst
wird.
In zahlreichen Studien aus dem In- und Ausland wurde festgestellt, dass
insbesondere bezüglich der Häufigkeit der schweren körperlichen Kin-
desmisshandlung Familien aus den unteren sozioökonomischen Schich-
ten in den jeweils betrachteten Untersuchungskollektiven überrepräsen-
tiert waren (Gil, Mätz, Schwind). In der Dunkelfeldforschung (Straus
1980) werden ähnliche Beziehungen zwischen Berufsstand, Arbeitslo-
sigkeit, Wohnverhältnissen, Kriminalität und Gewalt in der Familie deut-
lich.
Es muss dem Vorurteil entgegengetreten werden, Misshandlungen sei-
Alle Bevölkerungs-
en nur ein typisches Unterschichtenproblem. Insbesondere seelische
schichten sind be-
Misshandlung und sexuelle Gewalt kommen in allen Schichten in erheb-
troffen
lichen Umfang vor und auch „geordnete Familienverhältnisse“ und ein
„ordentlicher Haushalt“ schließen schwere körperliche, seelische und
sexuelle Misshandlung nicht aus.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 18
4. Risikofaktoren der Kindesmisshandlung Risikofaktoren der Kindes
4.1. Anamnestische Merkmale des betroffenen Kindes
Der Gefährdung eines Kindes, misshandelt zu werden, können sowohl Anamnestische Merk-
objektive Faktoren zugrunde liegen, als auch die subjektive Einstellung male des Kindes
der Eltern oder Betreuer. Die im Folgenden aufgelisteten Faktoren sind
nicht individuelle Ursachen, die obligatorisch zu Vernachlässigung und
Kindesmisshandlung führen. Sie sind aber häufig charakteristische
Merkmale, die in den betroffenen Familien zu beobachten sind und ge-
zielt erfragt werden sollen:
- unerwünschte Schwangerschaft ohne postnatale Veränderung
der negativen Einstellung zum Kind,
- geplanter Schwangerschaftsabbruch, der verworfen oder verwei-
gert wurde,
- kurz aufeinander folgende Schwangerschaften,
- Risikoschwangerschaften,
- Tod eines nahe stehenden Menschen in der Schwangerschaft,
- Krisen während der Schwangerschaft, die im Erleben der Eltern
(der Mutter) mit der Geburt des Kindes verbunden werden,
- ungeklärte Vaterschaft bzw. Zweifel über die Vaterschaft,
- Früh- oder Mangelgeburtlichkeit des Kindes,
- neonatale Erkrankungen von Mutter und Kind,
- tief greifende Enttäuschung über das Geschlecht oder angebore-
ne Missbildungen bzw. Behinderungen des Kindes,
- ungewöhnliches Verhalten des Neugeborenen wie Unruhezu-
stände, außergewöhnliches Schreien, extrem unregelmäßiger
Tages- und Nachtrhythmus, Apathie und Kontaktverweigerung,
- Trennung von Mutter und Kind in den ersten drei Monaten nach
der Geburt.
4.2. Anamnestische Merkmale der Eltern bzw. des Misshandlers
Bei Gewaltphänomenen innerhalb der Familie werden sehr häufig Fakto-
Anamnestische
ren sichtbar, die eine adäquate Eltern-Kind-Beziehung nicht entstehen Merkmale des Miss-
lassen: handlers
- intrafamiliäre Gewalterfahrung in der Kindheit der Eltern,
- die Erfahrung unangemessener oder unbeständiger elterlicher
Sorge in der Kindheit der Eltern,
- längere Perioden von Klinikaufenthalten und Heimunterbringung,
- belastete Schulkarrieren ohne erreichten Schul- bzw. Ausbildungs-
abschluss,
- Fehlen fester sozialer Beziehungen in der Adoleszenz,
- zu frühes Verlassen des Elternhauses,
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 19
- Häufung von Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder häufiger Wech-
sel der Arbeitsverhältnisse,
- fehlende Freundschaftsbeziehungen bis hin zur sozialen Isolation,
- ständig wechselnde Partnerschaftsbeziehungen,
- stress- und/oder krankheitsbedingte Dekompensation mit krisenhaf-
ten Zuständen, die zu Angst, Verzweiflung und aggressiven Hand-
lungen führen,
- physische und psychische Leistungsbeschränkung, noch ohne
Krankheitswert,
- Persönlichkeitsstörungen oder geistige Behinderung eines oder
beider Elternteile,
- Alkohol- oder Drogenmissbrauch,
- Bejahung des elterlichen Züchtigungsrechtes.
4.3. Anamnestische Merkmale der Familie als Ganzes
Familiensituationen sind u. a. abhängig von den Lebensbedingungen,
Anamnestische
dem sozialen Umfeld und gesellschaftlichen Bedingungen. Familien, in
Merkmale der Familie
denen Kinder vernachlässigt oder misshandelt werden, weisen oft eine
Reihe von Merkmalen auf:
- instabile partnerschaftliche oder eheliche Verhältnisse mit häufigen
Streitigkeiten und/oder gewalttätigen Auseinandersetzungen,
- soziale Benachteiligung (z. B. niedriges Einkommen, beengte,
schlecht ausgestattete Wohnverhältnisse mit ungünstigem Wohn-
umfeld, häufige und langzeitige Arbeitslosigkeit),
- drei und mehr Kinder,
- soziale Isolation,
- intrafamiliäre Ghettoisierung.
Trotz dieser Aufzählung muss vor der Annahme gewarnt werden, dass
körperliche und seelische Misshandlung, Vernachlässigung und sexuelle
Gewalt abhängig vom sozialen Status der Familie seien.
Viele schwer einzuordnende Verhaltensauffälligkeiten und Krankheits-
bilder - auch ohne äußere Verletzungszeichen - können Folgen von Ge-
waltanwendung im körperlichen und seelischen Bereich von Kindern
sein. Da aber Gewalt gegen Kinder nach wie vor zu den bestgehütetsten
Geheimnissen gehört, gelingt es den Eltern aus Mittel- und höheren
Schichten aufgrund ihrer günstigeren Bildungs- und Lebenssituation
besser, die Folgen der innerfamiliären Gewaltanwendung zu vertuschen.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 20
5. Diagnostische Kriterien
5.1. Körperliche Misshandlungszeichen
Entscheidend für die Diagnosestellung ist, dass der Arzt bei kindlichen Man muss an
Verletzungen stets auch an die Möglichkeit einer Misshandlung denkt. Misshandlung denken!
Das Verletzungsmuster, einschließlich so genannter „Bagatellverletzun- Aussage zur
gen", ist unter funktionellen Gesichtspunkten sowie unter Berücksichti- Verletzungsentstehung
gung der motorischen Entwicklung des Kindes zu analysieren. Angaben kritisch überprüfen
der Eltern zu Verletzungsmechanismen (z.B. Sturz vom Wickeltisch,
Auseinandersetzung mit anderen Kindern) sollten nicht kritiklos über-
nommen werden. Diskrepanzen lenken den Verdacht auf eine mögliche
Misshandlung. Zu bedenken ist, dass selbst ältere Kinder nicht selten
eine unkorrekte Schilderung über die Verletzungsursachen geben, weil
sie eingeschüchtert sind oder Angst vor weiteren Misshandlungen oder
Folgen der Aufdeckung haben.
5.1.1. Äußere Verletzungen
Die häufigste Verletzungsart bei Kindesmisshandlungen ist die Einwir-
Einwirkung stumpfer
kung stumpfer Gewalt (Schlagen mit der Hand, Faust oder einem Ge-
Gewalt am häufigsten
genstand, Zerren und Verdrehen von Körperteilen, Quetschmechanis-
men wie Kneifen und Beißen, Treten). Es entstehen Abschürfungen,
intrakutane und subkutane Hämatome sowie Riss-, Quetsch- und Platz-
wunden. Thermische Einwirkungen sind nicht selten (Verbrennungen,
Verbrühungen, brennende Zigaretten). Auch Einwirkungen scharfer Ge-
walt (Stich- und Schnittverletzungen) werden beobachtet. Besonders
folgende Kriterien sind zu beachten: Lokalisation, Formung, Gruppie-
rung, Mehrzeitigkeit (Brinkmann).
Lokalisation
Misshandlungsbedingte Hämatome und Hautabschürfungen sind häufig
an folgenden Körperteilen: Rücken, Hinterseite der Beine, Innenseiten Lokalisation an ge-
schützten Körperteilen
der Arme, Gesäß, Anal- und Genitalregion, Bauch, Hals, Mund, Augen
und Ohren.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 21
Prädilektionsstellen für Misshandlungen durch stumpfe Gewalteinwir-
kung sind der Kopf und das Gesäß. Zur differentialdiagnostischen Be-
wertung der Gesichts- und Kopfverletzungen sind zwei Lokalisationsty-
pen zu unterscheiden:
- sturztypische Lokalisation an prominenten Gesichtsteilen (Nase,
Lokalisationstypen
Stirn, Kinn), sowie bei älteren Kindern Verletzungen unterhalb der
am Kopf
so genannten Hutkrempenlinie. Jüngere Kinder können als Sturz-
verletzungen durchaus auch höher liegende Wunden und Hämato-
me in der Scheitelgegend aufweisen, wobei allerdings doppelseitige
und mehrfache Verletzungen meist gegen die Entstehung durch
Sturz sprechen;
- misshandlungstypische Lokalisation an geschützt liegenden und
seitlichen Gesichtspartien wie Augen und Wangen. Insbesondere ist
die Entstehung durch Sturz unwahrscheinlich, wenn beide Seiten
der "Halbkugel" des Gesichts verletzt sind.
Besonders zu beachten sind Abwehrverletzungen an den Streckseiten
der Unterarme sowie symmetrische Griffmarken an den Armen, am
Brustkorb und der Umgebung des Mundes (insbesondere bei Kleinkin-
dern). Sturz- bzw. Anstoßverletzungen liegen demgegenüber bevorzugt
über Handflächen, Ellenbogen, Knie und Schienbeinen.
Formung
Je nach Beschaffenheit des verwendeten Schlagwerkzeuges kann die
Differentialdiagnose
Formung von Verletzungen mannigfaltig aber z. T. spezifisch sein: dia- Abwehrverletzungen,
gnostisch von herausragender Bedeutung sind doppelstriemenförmige Griffmarken, Sturz-
Hautunterblutungen bei stockähnlichen schmalen Werkzeugen, Gürteln, und Anstoßverletzun-
gelegentlich auch bei Einwirkung der Finger. Je kantiger, kleinflächiger, gen
geformter das Werkzeug ist und je stärker und schneller die Einwirkung,
desto eher entstehen geformte Hämatome oder auch Platzwunden, die
die Geometrie des Schlagwerkzeuges wiedergeben (Kochlöffel, Gürtel-
schnallen, Schuhsohlen und ähnliches). Menschliche Bisse können ova-
le oder halbmondförmige, individuelle Zahnabdrücke hinterlassen.
Ungewöhnlich geformte Narben (z. B. Rundnarben nach Zigaretten- Hinweise auf Gegen-
verbrennungen) oder große Narben, die offensichtlich nicht medizinisch stände
versorgt wurden, sind grundsätzlich verdächtig.
Gruppierung
Bei einer Einzelverletzung kann der objektive Nachweis einer Misshand-
lung Schwierigkeiten bereiten. Gruppierte Verletzungen sind typischer.
Sie sind gekennzeichnet durch die Zusammenordnung von mehreren,
unter Umständen einer Vielzahl von unterschiedlich geformten und gro-
ßen Einzelverletzungen.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 22
Mehrzeitigkeit
Die Kindesmisshandlung ist ein typisches Wiederholungsdelikt (Stich- Wiederholungs-
wort: "chronische Krankheit"). Deshalb ist das Nebeneinander frischer, delikt
älterer und ganz alter Verletzungen (Narben) ein wichtiges diagnosti-
sches Kriterium. Manchmal ergibt sich der Hinweis auf eine mehrzeitige
Misshandlung erst durch wiederholte Untersuchungen eines einmal
misshandelten Kindes und bei sorgfältiger Erhebung der Anamnese.
5.1.2. Innere Verletzungen
Ohne äußerlich erkennbare Verletzungen bleibt das so genannte Schüt- Schütteltrauma und
teltrauma der Säuglinge: infolge von Brückenvenen-Abrissen kann es subdurales Hämatom
hier zu subduralen Hämatomen mit Hirnschädigung bzw. sogar mit leta-
lem Ausgang kommen. Bei Verdacht auf ein Schütteltrauma sollten bild-
gebende Schädeluntersuchungen (Sonographie, CT, MRT) sowie eine
Fundoskopie durchgeführt werden. Ebenfalls ohne äußerlich erkennbare
Verletzungen kann das stumpfe Bauchtrauma bleiben. Im Widerspruch
dazu können jedoch massive Rupturen innerer Organe bis hin zu Todes- Stumpfes Bauchtrauma
fällen resultieren. Wegen der hohen Elastizität der kindlichen Thorax-
wand gilt dieses auch für die Brustorgane.
Bedingt durch Unzulänglichkeiten im System der Leichenschau und der Dunkelziffer tödlicher
Todesursachenfeststellung ist mit einer Dunkelziffer bei tödlichen Miss- Misshandlungen
handlungen zu rechnen. Es sollte deshalb bei unklaren Todesursachen
die Obduktion angestrebt werden.
5.1.3. Frakturen
Bei Verdacht auf Misshandlung sollte stets ein Röntgenstatus des ge-
samten Skelettsystems erwogen werden. Kennzeichnend sind: multiple, Röntgenstatus
verschieden alte Frakturen an sonst unauffälligen Knochen, differente
Stadien der Periostreaktion mit Manschettenbildungen an den langen
Röhrenknochen, metaphysäre Infraktionen und Kantenabbrüche,
Epiphysenlösungen und deren Folgen, eventuell mehrere Bruchzentren
bei Schädelfrakturen. Schläge, Stöße, Verdrehungen kindlicher Glied-
Cave: Frakturen im
maßen müssen nicht immer zu Knochenbrüchen führen. Statt dessen
1. Lebensjahr
kommt es zu Blutungen unter der Knochenhaut und späteren subperi-
ostalen Verkalkungen. Typisch ist dabei das komplikationslose Aushei-
len von Knochenläsionen in der geschützten Krankenhaussituation.
Frakturen bei Kindern unter einem Jahr sind ausnahmslos als hoch ver-
dächtig anzusehen.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 23
5.1.4. Verborgene Verletzungen
Hierzu gehören z. B. Narben nach Kopfplatzwunden im Behaarungsbe-
reich, zirkumskripte Alopezien, Trommelfellblutungen, Retinablutungen, Inspektion des behaar-
ten Kopfes und der
retroaurikuläre Hämatome und Hautrisse (z. B. nach Zerren an den Oh-
Schleimhäute!
ren), Verletzungen in der Mundschleimhaut sowie (besonders wichtig!)
punktförmige Blutungen an den Augenlidern und in den Augenbindehäu-
ten (nach Würge- und Strangulationsmechanismen). Strangulationsmar-
ken bzw. Würgemale dagegen können bei Kindern auch fehlen (große
Hand am kleinen Kinderhals, Wehrlosigkeit des Opfers).
5.1.5. Weitere Verletzungen
Auch bei Verbrennungs- und Verbrühungszeichen muss der Verdacht Verbrennungen und
einer Misshandlung in der Differentialdiagnose berücksichtigt werden; Verbrühungen
die Häufigkeitsangaben schwanken zwischen 3 Prozent und 25 Prozent
bei körperlicher Misshandlung. Bei der körperlichen Untersuchung sollte
z. B. daran gedacht werden, dass sich ein Kind kaum durch Unfall das
Gesäß verbrühen kann, ohne dass die Füße beteiligt sind. Rundliche,
pfennigstückgroße Verletzungen können Abdrücke brennender Zigaret-
ten sein. Symmetrische, ufoscharf begrenzte Verbrühungen sind grund-
sätzlich verdächtig.
Seltenere Verletzungsarten sind lokale Erfrierungen oder generelle Un-
seltene
terkühlung mit Frostflecken, Stromverletzungen mit Strommarken, Ver-
Verletzungsarten
giftungen mit eventuellen Veränderungen der Haut und Schleimhäute,
Schnitt-, Stich- und Schussverletzungen sowie Säure- und Laugenverät-
zungen. Grundsätzlich muss jede Verbrennung oder Verätzung mit kla-
ren Begrenzungen und mit gleichmäßiger Tiefe über ein großes Körper-
gebiet als verdächtig angesehen werden.
Unter "Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom" versteht man kindliche “Münchhausen-
Krankheitssymptome, welche von den Eltern vorgetäuscht (z. B. Blut- Stellvertreter-Syndrom”
beimischung zu einer Urinprobe) oder induziert werden (z. B. durch Diu-
retika induzierte Enuresis). Die betroffenen Kinder werden oftmals lang-
wierigen Krankenhausaufenthalten mit zum Teil schwerwiegenden Un-
tersuchungen und Behandlungen unterzogen.
5.2. Zeichen der Vernachlässigung
Symptome der Vernachlässigung sind z. T. weniger eindeutig. Die Diag-
nose "nicht organische Gedeihstörung" kann nur nach Ausschluss so-
matischer Ursachen gestellt werden.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 24
Der Verdacht auf Misshandlung infolge von Vernachlässigung muss bei Hinweise auf Vernach-
Vorliegen folgender Symptome aufkommen: lässigung
- verwahrlostes Äußeres, Parasitenbefall;
- Hautaffektionen: Eiterungen, „Wundsein", unbehandelte Dermatitis
im Ano-Genitalbereich;
- psychosozialer Minderwuchs;
- Zeichen der Unterernährung, der Fehlernährung und des Flüssig-
keitsmangels: Abmagerung, Anämie, Vitamin-
Mangelerscheinungen, Wachstumsverzögerungen und allgemeine
körperliche und geistige Entwicklungsverzögerung, unersättlicher
Appetit;
- charakteristische Verhaltensweisen wie allgemeine Apathie, Katato-
nie, sprachliche Entwicklungsstörung, soziale Inkompetenz (verzö-
gerte Sozialisation), emotionale Verwahrlosung (Distanzlosigkeit,
Unruhe, Konzentrationsstörungen, Angst vor Beziehungsangeboten,
"everyone's friend").
5.3. Sozial-emotionale Störungen
Misshandelte Kleinkinder sind Fremden gegenüber weit über das nor-
Ängstlichkeit, Über-
male Maß hinaus und vor allem auch den Misshandlern (meist einem höflichkeit, mangelnde
Elternteil) gegenüber ängstlich und ablehnend. Sie lassen sich nicht Emotion
"drücken" (schmiegen sich z. B. auf dem Arm nicht an, sondern machen
sich absichtlich steif). Ältere Kinder sind überhöflich bemüht, die Erwar-
tungen von Ärzten und Eltern zu erfüllen, reagieren jedoch emotionslos,
wenn sie von den Eltern getrennt werden.
Typische Verhaltensauffälligkeiten Betroffener sind: Passivität, Schüch- Typische Verhaltens-
ternheit, Freudlosigkeit, Misstrauen, Aggressivität gegenüber Gleichaltri- auffälligkeiten
gen und Fremden, Kontaktarmut, fast berechnend wirkende Zuvorkom-
menheit und Anpassungsbereitschaft (durch Angst diktiert), Unruhe,
Erregbarkeit, Hyperaktivität, Enuresis, Ticks, Neigung zu Wutanfällen,
Eigensinn, Ungehorsam, Überempfindlichkeit, Gehemmtheit, Apathie,
Neigung zur Selbstbeschuldigung (Engfer), Pseudoreife (unkindliches
Verhalten). In Einzelfällen sind misshandelte Kinder bei der Hospitalisie-
rung extrem ängstlich, gehemmt und passiv. Sie lassen medizinische
Maßnahmen widerstandslos über sich ergehen, weinen kaum, verharren
z. T. bewegungslos (katatonisch), mustern ihre Umgebung mit erhöhter
Wachsamkeit (Kempe).
Bei dem Verdacht auf eine Misshandlung sollte man daher das Verhal-
ten des misshandelten Kindes sehr genau beobachten und dokumentie-
ren.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteDiagnostische Kriterien 25 5.4. Diagnostische Hinweise auf sexuelle Gewalt Sexuelle Gewalt ist häufiger als früher angenommen wurde. Jeder Hin- Sexuelle Gewalt sog. weis oder Verdacht, dass ein Kind sexuelle Gewalt erfahren hat, muss „sanfte Gewalt“ unbedingt ernst genommen werden. Im Unterschied zu anderer körperlicher Gewaltanwendung führt die se- xuelle Gewalt häufig nicht zu offensichtlichen körperlichen Hinweisen. Folgende körperliche Symptome können als verdächtig angesehen wer- Körperlicher Befund den: nicht lokalisierbare Schmerzen im Unterleib, Schmerzen beim Sit- bei sexueller Gewalt zen, Gehen oder Wasserlassen, Schwellungen, Rötungen, Juckreiz, Wundsein, ungeklärte Blutungen, Entzündungen oder Ausfluss im Geni- tal- und/oder Analbereich, wiederholte Harnweginfektionen, Fremdkör- per in Urethra, Vagina oder Rektum, frühkindliche Defloration, Genital- und Analverletzungen, Bissverletzungen. Weitere Anhaltspunkte können sein: Wiederauftreten von Bettnässen Psychosomatische und Einkoten, Kopf- und Bauchschmerzen sowie andere psychosomati- Symptome sche Symptome. Bei folgenden Verhaltensstörungen ist sexuelle Gewalt in die Differenti- aldiagnose einzubeziehen: Verhaltensstörungen Schlafstörungen, Essstörungen, Angst, sich auszuziehen und an sportli- chen Schulaktivitäten teilzunehmen, unangemessene genital-sexuelle Aktivität in der frühen Kindheit, sexual-provozierendes Verhalten; alters- unangemessenes Sexualwissen; sozialer Rückzug und unerklärte Schulschwierigkeiten in der Vorpubertät, Promiskuität, Prostitution, Dro- genkonsum, Depression, Selbstmutilation, Suizidversuch, Konversions- symptome und pseudoepileptische (sogenannte "hysterische") Anfälle im Adoleszentenalter (Olbing). „Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für Ärzte
Diagnostische Kriterien 26
5.5. Kennzeichnendes Verhalten misshandelnder Personen
Normalerweise werden Kinder nach einer schweren Verletzung sofort
Verspätete medizini-
einem Arzt vorgestellt. Bei körperlich misshandelten Kindern erfolgt die sche Vorstellung
Vorstellung häufig erst verzögert, nach Stunden oder sogar Tagen - oft
erst, wenn sich die gesundheitliche Situation verschlechtert hat oder als
Notfall.
Typischerweise werden dabei Erklärungen für das Zustandekommen der
Unglaubhafte
Verletzungen angegeben, die mit den Verletzungsspuren nicht überein-
Unfallschilderungen
stimmen. Derartige stereotype Angaben sind z. B.: Sturz von der Trep-
pe, vom Arm oder Wickeltisch, Verletzungen durch andere Kinder,
Selbstverletzungen von Säuglingen durch lebhafte Bewegung im Bett-
chen. Bei wiederholten Verletzungen wird häufig ein anderer Arzt aufge-
sucht, der die vorherige Krankengeschichte nicht kennt.
Bei der stationären Einlieferung körperlich misshandelter Kinder verlas-
sen die einliefernden Eltern charakteristischerweise auffällig rasch das Beziehung zum Kind
Krankenhaus, z. B. noch bevor eine vom aufnehmenden Arzt verordnete beobachten
Röntgenuntersuchung durchgeführt wurde. Unter Umständen verhindern
die Eltern aber auch, dass das Kind allein mit den Betreuern bleibt. Be-
suche während eines stationären Aufenthaltes sind in der Regel relativ
selten und kurz. Bei den Besuchen weichen die Eltern Gesprächen mit
den Ärzten bzw. dem Pflegepersonal oft aus.
Bei der Vorstellung eines frisch verletzten Kindes durch offenbar betrun-
kene oder unter Drogeneinfluss stehende Eltern muss besonders an die
Möglichkeit der Misshandlung gedacht werden.
„Gewalt gegen Kinder“ – Thüringer Leitfaden für ÄrzteSie können auch lesen